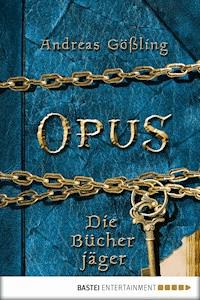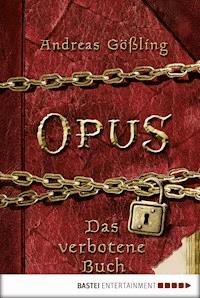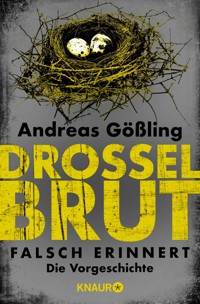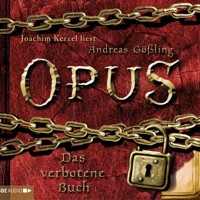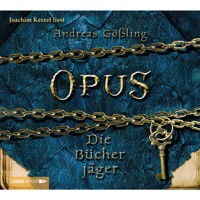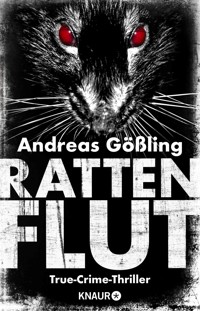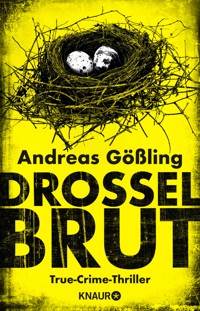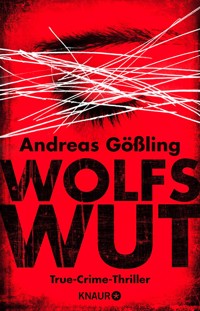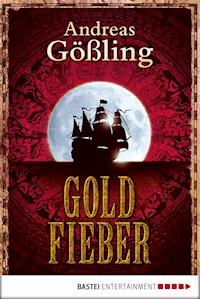
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Baumhaus
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
1519: Der 16-jährige Orteguilla de Sandoval nimmt als Page an der Eroberung Mexikos teil. An der Spitze von kaum dreihundert Spaniern verfolgt Hérnan Cortéz den wahnwitzigen Plan, Kaiser Montezuma II. inmitten der Hauptstadt seines Riesenreichs gefangen zu nehmen. Die Spanier gieren nach dem Gold, das die Azteken in ihren Schatzkammern horten. Orteguilla gerät als Gefangener im Königspalast in größte Gefahr. Doch die Liebe zur 15-jährigen Priestertochter Carlita zeigt ihm eine sanfte Seite dieser fremden Welt. Carlita kennt den Palast des Königs wie keine zweite. Wird sie Orteguilla und den Spaniern helfen, bevor sie mitten in Montezumas Reich schmachvoll untergehen? Ein spannendes Abenteuer rund um die Eroberung Mexikos durch die Spanier.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 631
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Erstes Kapitel Ergründe die Herzen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zweites Kapitel Bringt mir sieben Körbe voll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Drittes Kapitel Kostbarer als Gold
1
2
3
4
5
6
7
Viertes Kapitel Ein Gewand aus roten Vogelfedern
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fünftes Kapitel Die goldene Göttin
1
2
3
4
5
6
7
Sechstes Kapitel Immer sollt ihr treu mir folgen
1
2
3
4
5
6
7
Siebtes Kapitel Der Tag, an dem wir uns vergaßen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Achtes Kapitel Wie in einem Spinnennetz gefangen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Neuntes Kapitel Seid mein Gast in eurem Reich
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zehntes Kapitel Eine Nacht so schwarz vor Schmerz
1
2
3
4
5
6
7
Nachwort
Über den Autor
Andreas Gößling, geboren 1958, lebt und arbeitet als freier Autor in Coburg. Der promovierte Literatur- und Kommunikationswissenschaftler beschäftigt sich seit vielen Jahren mit mythen- und kulturgeschichtlichen Themen, insbesondere der alten Maya-Kultur, mit Drachenmythen sowie mittelalterlicher Magie und Alchemie. Neben Romanen für erwachsene und junge Leser hat er auch zahlreiche Sachbücher publiziert.
Andreas Gößling
GOLDFIEBER
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2011 by Boje Verlag in der Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Frank Griesheimer, Starnberg
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel, punchdesign, München
unter Verwendung von Motiven von Shutterstock
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-1192-8
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
ERSTES KAPITEL
Ergründe die Herzen
- 1 -
Am späten Vormittag erreichen wir die Bucht, die ihr Entdecker Grijalva auf den Namen Puerto Deseado getauft hat: »Ersehnter Hafen«. Ich stehe auf dem Vorderdeck der Santa Maria, eingezwängt zwischen meinem Kameraden Diego und all den anderen, und mein Herz schlägt wild und hart.
Wir schreiben den 15. März im 1519. Jahr des Herrn. Jetzt erst – jetzt endlich! – fängt unser Abenteuer an.
Ich bin Orteguilla, der dritte Sohn des Hidalgo Gonzalo de Villafuerte, eines kleinadeligen Grundbesitzers aus der Estremadura. Mein ältester Bruder wird den Hof unseres Vaters erben, mein zweiter Bruder besucht die Universität in Sevilla und soll einmal Rechtsanwalt werden. Für mich bleibt nur die Hoffnung, hier drüben mein Glück zu machen – also Gold zu finden, genug Gold, dass ich mir eines Tages vielleicht eine Hazienda davon kaufen kann.
Zuerst und vor allem aber will ich Abenteuer erleben. Ich träume davon, das Reich der Amazonen zu entdecken. Schon die berühmten Reisenden des Altertums erzählen von ihnen und gewiss werden wir über kurz oder lang auf Ansiedlungen dieser kriegerischen Frauen und Mädchen stoßen.
Letzten Herbst bin ich aus Spanien nach Kuba gekommen, um Gott und dem König hier in der Neuen Welt zu dienen. In Santiago habe ich als Hilfsschreiber bei einem Goldminenbesitzer gearbeitet, bis Cortés auf mich aufmerksam wurde und mich als Page in seine Dienste nahm. In jener Zeit habe ich gelernt, wie entsetzlich das Gold Menschen verändern kann. Wie sein gelber Glanz das Fieber der Begierde, ja des Wahnsinns in den Herzen stolzer Männer anzündet, die bis dahin besonnen und kaltblütig waren.
Die Bucht ist wie ein Halbmond geformt. Glitzernd weißer Strand, gesäumt von dichten Wäldern. Dahinter ragen wohl hundert Fuß hohe Felswände auf. Das Wasser ist türkisblau und durchsichtig bis zum Grund. Gewaltig große Fischschwärme fliehen vor unserer viermastigen Karavelle, die mit leichter Takelage in die Bucht hineinsegelt. Über uns kreisen Fischadler und Möwen und erfüllen die Luft mit ihrem Geschrei.
»Puerto Deseado«, sage ich zu Diego. »Der Name zeigt ja schon, wie verängstigt Juan de Grijalva gewesen sein muss.«
Er schaut mich verständnislos an. »Verängstigt, Orteguilla?«, fragt er. »Wieso das denn?«
»Durch feindselige Indianer natürlich – und ihre teuflischen Gebräuche«, antworte ich.
Diego ist erst vierzehn, zwei Jahre jünger als ich. Aber Hernán Cortés, der Anführer unserer Expedition, schätzt Kühnheit mehr als fast jede andere Eigenschaft. Also hat er Diego de Coria als zweiten Pagen neben mir in seine Dienste genommen – dabei hat Diego noch nicht einmal gelernt, das Schwert richtig zu führen. Doch er versteht es, in jeder Lage unerschütterlich Haltung zu bewahren. Außerdem besitzt er eine klare, fast rechteckige Handschrift, und wenn Cortés einen Schreiber für seine Berichte oder Briefe braucht, ruft er öfter nach Diego als nach mir.
Was mich betrifft, ich habe andere Stärken. So zumindest hat es mir unser Herr erst vor ein paar Tagen wieder erklärt: Die Menschen öffnen mir ihr Herz – dabei weiß ich selbst nicht recht, wie ich es anstelle, ihr Vertrauen zu gewinnen.
Diego zuckt mit den Schultern und schenkt mir ein spöttisches Grinsen. »Keine Ahnung, wovon du redest, Orte.«
Und doch kennt er die schauerlichen Geschichten genauso gut wie ich. Einige Männer, die schon letztes Jahr mit Grijalva bis hierher gekommen waren, schlossen sich, kaum nach Kuba zurückgekehrt, gleich wieder unserer Expedition an. Während der Tage auf dem Meer haben sie uns von den Teufelsaltären mit Überresten von Menschenopfern und vom unaufhörlichen Trommeln bei Nacht erzählt. Außerdem von gewissen »Spukerscheinungen«, die selbst hartgesottene Konquistadoren erzittern ließen – wandelnde Tote, die ihre Köpfe unter dem Arm trugen, und andere Schrecknisse mehr.
Natürlich ist auch Diego erschauert, als er diese Geschichten gehört hat. Aber er würde niemals zugeben, dass er Gefühle wie Angst und Verzagtheit aus eigener Erfahrung kennt. So wenig wie unser Vorbild, dem wir beide glühend nacheifern – Hernán Cortés. Selbst wenn uns die Sonne auf den Kopf fallen würde, unser verehrter Herr würde uns sogleich davon überzeugen, dass dieser Zwischenfall nichts an unseren Plänen ändert. Ja, er würde sogar die Sonne selbst dazu überreden, an ihren angestammten Platz zurückzukehren.
Hernán Cortés steht über uns auf der Kapitänsbrücke, gekleidet in die prächtigen Gewänder, die er sich gleich nach seiner Ernennung zum Caudillo zugelegt hat – zum obersten Kommandanten unserer Expedition. Er trägt den Hut mit Federbusch und seinen schwarzen Samtumhang mit den goldenen Quasten und Schleifen. Golddurchwirkt sind auch seine Strümpfe, die unter dem Saum des Umhangs hervorblitzen, und die Troddeln an seinen Stiefeln, die ich ihm vorhin eigens für diesen Anlass blank putzen musste. Sein Gesicht ist blass und starr wie meistens, doch seine Brust ist gewölbt und seine Augen funkeln.
»Das Vertrauen der Menschen kann kostbarer als alle irdischen Schätze sein«, hat Cortés vor einigen Wochen zu mir gesagt. »Ihre Herzen sind wie unsichtbare Goldminen, Orteguilla – und du bist dazu berufen, dieses Gold zu schürfen.«
Segel werden gerafft, Anker fahren rasselnd in die Tiefe. Oben auf der Brücke hebt Cortés seine Hand – auf allen elf Schiffen heben die Hornbläser ihre Instrumente an die Lippen und spielen eine überschwängliche Fanfare.
Wer auch immer in den Wäldern da drüben lauern mag, so lautet unsere Botschaft – wir werden uns nicht verstecken! Geschweige denn, uns zermürben und verjagen lassen wie der zaghafte Grijalva letztes Jahr.
Viel weiter als bis hierher ist er nicht vorgedrungen. Nur ein paar Dutzend Seemeilen nördlich befahl er seinen Kapitänen, Hals über Kopf nach Kuba zurückzukehren. Dabei hatten sie unten in Yucatan schon beträchtliche Goldschätze erbeutet – Goldfiguren und -masken und vergoldete Holzscheiben so groß wie Wagenräder. Doch wo immer sie anlegten, wurden sie mit einem Hagel von Speeren und Pfeilen empfangen. Gut zwei Dutzend Männer hatten ihr Leben bereits verloren – die meisten von ihnen auf Opferaltären –, als Grijalva den Befehl zur Rückkehr nach Kuba gab. Dort aber beschimpfte ihn Gouverneur Velazquez als feige Milchamme und beauftragte Cortés, so schnell wie möglich eine neue Expedition auszurüsten und dort weiterzumachen, wo Grijalva den Mut verloren hatte.
Die Matrosen haben unterdessen die Beiboote zu Wasser gelassen. Gleich werde ich zum ersten Mal die wilde, unerforschte Welt betreten, von der ich seit so vielen Jahren träume. Mein neues Leben hat begonnen! Was wird es mir bringen – welche unerhörten Abenteuer und Entdeckungen?
Während ich an der Strickleiter ins Boot hinunterklettere, schicke ich ein Stoßgebet zum Himmel empor: Heilige Muttergottes, bitte mach, dass wir kein Gold finden – jedenfalls hier noch nicht, Amen!
- 2 -
Mit zweihundertfünfzig Mann in zwei Dutzend Booten gehen wir an Land. Der größere Teil unserer Streitmacht bleibt vorerst auf den Schiffen. Wir sind die gewaltigste Expedition, die jemals in diesen Breitengraden gekreuzt ist – fünfhundertfünfzig Konquistadoren; nicht mitgerechnet Pagen wie mich und Diego, Kapitäne und Seeleute, Zimmerer und Schmiede, Priester, Ärzte und Notare; und ganz zu schweigen von den fast zweihundert Sklaven aus Kuba und Afrika, die Cortés für alle groben Arbeiten mitgenommen hat, heimlich und gegen Gouverneur Velazquez’ Befehl.
Ich springe aus dem Boot ins flache Wasser und verliere fast das Gleichgewicht. Nach sechs Tagen auf See muss ich mich erst wieder daran gewöhnen, dass der Boden unter meinen Füßen nicht unaufhörlich schlingert und stößt. Außerdem ist die Luft hier so feuchtheiß, dass sie über dem blendend weißen Sand flimmert. Der Schweiß tropft mir nur so aus den Haaren und Diego geht es nicht besser. Schwankend wie Betrunkene stapfen wir durch den knöcheltiefen Sand, der zum Wald hin sanft ansteigt.
Hernán Cortés ist uns ein Dutzend Schritte voraus, doch als seine Pagen sind wir verpflichtet, in Sicht- oder wenigstens Rufweite zu bleiben. Wie üblich wird er von seinen drei engsten Vertrauten begleitet – dem »Dröhnenden«, dem »Durchtriebenen« und dem »Tollkühnen«, wie ich diese ungleiche Dreiheit für mich nenne.
»Verdammt noch mal, hier ist doch keine Sau!«, schreit gerade eben Alonso de Portocarrero und schaut sich nach allen Seiten um.
Er ist Ende zwanzig und stämmig wie ein Weinfass. Sein rundes Gesicht mit dem dünnen schwarzen Bart ist wie meistens ziegelrot. Cortés hat ihn aus irgendeinem Grund in sein Herz geschlossen, vielleicht nur deshalb, weil sie beide in Medellín aufgewachsen sind. Portocarrero ist sogar mit dem Grafen von Medellín verwandt, doch er flucht von früh bis spät wie ein Henker.
»Bist du sicher, dass du damals nicht stinkbesoffen warst, Pedro«, fährt er mit seiner dröhnenden Bassstimme fort, »als du hier einen Haufen verdreckter Eingeborener gesehen hast?«
Pedro de Alvarado wirft ihm einen abschätzigen Blick zu. »Wahrscheinlich haben sie dich schreien gehört, Alonso«, sagt er, »und sind in den Wald abgehauen.«
Sein schmales Gesicht ist zu einem verschlagenen Lächeln verzogen. Während er spricht, sieht er sein Gegenüber nie länger als für einen Atemzug an. Seine bernsteinbraunen Augen, wie stets zu Schlitzen zusammengekniffen, flitzen unablässig hin und her.
»Dann fangen wir sie eben ein!«, steuert Gonzalo de Sandoval bei.
Sandoval ist erst einundzwanzig Jahre alt, und doch gehört er schon zu den Männern, denen Cortés am meisten vertraut. Er ist hochgewachsen, breitschultrig und der vortrefflichste Schwertkämpfer, den ich jemals gesehen habe. Außerdem der geschickteste Reiter und beste Armbrustschütze weit und breit. Er hat vor nichts und niemandem Angst und Diego und ich bewundern ihn hemmungslos. So wie dieser tollkühne Hüne mit den hellbraunen Locken, den blauen Augen, dem offenen Lachen möchten auch wir einmal werden.
»Langsam, Gonzalo«, wendet Alvarado ein. »Gerade hier sind uns die Indianer zuerst ganz friedlich begegnet. Wir hatten ja nur den schielenden Melchorejo als Dolmetscher dabei und der Kerl versteht bloß ein paar Brocken Spanisch. Aber mit seiner Hilfe hat Grijalva den Indianern irgendwie klargemacht, dass wir in friedlicher Absicht gekommen sind und von ihnen nichts weiter als Nahrungsmittel und Wasser wollen.«
Er wirft Cortés einen Blick zu, seine Augen funkeln. »Und Gold«, fügt er hinzu. »So viel Gold, wie sie auftreiben könnten – im Tausch gegen Glasperlen und sonstigen Klimperkram.«
Alvarado war bei Grijalvas Expedition letztes Jahr dabei. Als er erfuhr, dass Cortés eine neue Expedition organisierte, war er sofort zur Stelle und bot von sich aus an, eines der Schiffe auf eigene Kosten auszurüsten. In Kuba hat Cortés ihn tagelang auf seiner Hazienda bewirtet, und dort habe ich selbst mit angehört, wie er von den goldenen Statuen, Masken und Rädern erzählte. Seine Augen glänzten, und da erkannte ich, dass auch er vom Goldfieber befallen ist. Aber er versteht es, sich vollkommen zu verstellen, und ich glaube, dass Cortés ihn vor allem wegen dieser Gabe schätzt: Pedro de Alvarado lässt sich niemals anmerken, was er im Schilde führt.
»Und da sind sie zornig geworden?«, fragt Sandoval und tastet unwillkürlich nach seinem Schwert. »Als ihr von ihnen Gold verlangt habt?«
Alvarado schüttelt den Kopf. »Da noch nicht«, antwortet er. »Das kam erst, als Grijalva befohlen hat, ihre Götzenbilder zu zerstören.«
Hernán Cortés bleibt unvermittelt stehen und seine Begleiter tun es ihm gleich. Während Diego und ich zu ihnen aufschließen, schaut sich unser Herr die wellenförmigen Linienmuster im Sand an.
»Pedro hat recht«, sagt er und wie immer klingt seine Stimme vollkommen beherrscht. »Vor Kurzem muss es hier noch vor Indianern gewimmelt haben. Dann aber haben sie wohl unsere Schiffe da draußen gesehen und daraufhin alle Spuren mit Palmwedeln verwischt. Seht ihr?« Er deutet auf die Muster im Sand.
Unser Herr ist einen halben Kopf kleiner als Alvarado und Portocarrero und der junge Hüne Sandoval überragt ihn sogar um mehr als Haupteslänge. Trotzdem wäre jedem, der diese vier Männer zufällig beobachten würde, auf der Stelle klar, wer von ihnen das Sagen hat. Und das liegt keineswegs nur an den kostbaren Gewändern, die Cortés trägt.
Der »Dröhnende«, der »Durchtriebene« und der »Tollkühne« pflichten ihm nickend bei. Auch ich schaue mir die Linienmuster genauer an. Auf den ersten Blick sehen sie aus, als ob die Meeresflut sie in den Sand gezeichnet hätte. Dafür sind sie allerdings nicht gleichmäßig genug – doch das wäre mir von selbst bestimmt nicht aufgefallen.
»Weit können sie noch nicht sein«, fügt Cortés hinzu.
Er wirft einen Blick zum Wald hinauf, der in einer Entfernung von vielleicht fünfzig Schritten beginnt. Eine Wand aus Stämmen, Astwerk und fleischig aussehenden Blättern, dunkelgrün, fast schwarz. Zumindest aus dieser Entfernung ist kein Weg durch das Dickicht auszumachen. Doch je länger ich zum Waldrand hinaufstarre, desto mehr kommt es mir vor, als ob dort hinter Laub und Zweigen Augenpaare lauern.
»Alonso, Pedro«, sagt Cortés, »stellt zweimal hundert Mann zusammen – mit voller Rüstung, Schild und Schwert. Auch eine Fahne brauchen wir, den Dolmetscher und natürlich den Notar. Aber keine Geschütze, überhaupt keine Feuerwaffen – verstanden?«
Portocarrero und Alvarado nicken erneut.
»Abmarsch in einer halben Stunde«, sagt Cortés. »Grijalva hat richtig gehandelt, als er die Götzenbilder zerstören ließ. Die Indianer sind Teufelsanbeter – das hat der Heilige Vater höchstpersönlich erklärt. Also ist es auch unsere Christenpflicht, sie zum Glauben an Gott den Herrn zu bekehren.«
Er hält inne und sieht seine drei Vertrauten nacheinander eindringlich an.
»Deshalb sind wir hier, vergesst das niemals«, fährt er fort. »Um die Macht Gottes auf Erden zu mehren!«
»Und unsere Erträge«, murmeln Portocarrero, Alvarado und Sandoval im Chor.
In ihren Augen bemerke ich wieder diesen fiebrigen, fast irrsinnigen Glanz. Auch in den dunkelbraunen Augen von Hernán Cortés.
- 3 -
Kaum sind wir drei Schritte tief im Dickicht, da umfängt uns Dämmernis. Nur in dünnen Fäden, zitternd wie Spinnweb, flirren Sonnenstrahlen durch die Wipfel hoch über uns.
Pedro de Alvarado stapft auf dem Trampelpfad voran, gefolgt von einem Fahnenträger, der die Tanto Monta, die spanische Flagge, an einem Messingstab trägt. Dahinter marschieren Cortés und Sandoval, dann Diego und ich, gefolgt von Alvarados Einheit. In geringem Abstand folgt Portocarrero mit dem Notar Pedro Gutierrez, dem schielenden Dolmetscher Melchorejo und weiteren Hundert Konquistadoren.
Papageien krächzen, Affen schreien. Mit einem Palmwedel fächele ich mir stickig heiße Luft zu. Bleischwer hängt das Kurzschwert an meinem Gürtel und will mich mit sich zu Boden ziehen. Am liebsten würde ich mir Wams und Hemd vom Leib reißen, doch das käme den Mücken, die uns in hellen Schwärmen umschwirren, gerade recht. Vor allem aber würden mich die Konquistadoren verfluchen, die in voller Rüstung durch diese dampfende Hölle marschieren. Der Boden erbebt unter ihren Tritten. Die Scharniere an ihren Arm- und Beingelenken rasseln. Portocarreros Flüche dröhnen durch den Wald.
Damit wir die Indianer in ihrem Versteck überraschen könnten, müssten sie schon allesamt stocktaub sein. Aber Anschleichen gehört ohnehin nicht zu Cortés’ bevorzugten Plänen. Unterwegs auf der Santa Maria hat er Sandoval und den beiden anderen Männern einmal seine Kampfstrategie erklärt. »Wir müssen die Indianer in Angst und Schrecken versetzen – durch unser Auftreten und Aussehen, durch Schnelligkeit und Entschlossenheit. Auch durch Grausamkeit, wenn es nicht anders geht – aber wirklich nur dann.«
Nach einigen Hundert Schritten wird der Pfad zum Weg, breit genug, dass Diego bequem neben mir gehen kann. Wie mit dem Lineal gezogen, führt er auf einen rechteckigen Platz zu, in dessen Mitte sich ein wuchtiges Bauwerk erhebt. Eine steinerne Plattform, mit Moosflechten überzogen, zu der fünf Stufen emporführen. Darauf ein würfelförmiger Tempel mit einem gewaltigen Säulenportal.
»Bis hier war ich auch mit Grijalva«, sagt Alvarado, der mittlerweile zur Linken von Cortés geht. »Aber dann keinen Schritt mehr weiter. Die Indianer hatten sich im Wald versteckt, wir hörten nur ihre Trommeln, Triller und Schreie – aber die scheinbar von überall. Grijalva ließ uns die Götzenbilder zertrümmern und die Überreste unserer geopferten Gefährten begraben – danach hasteten wir zu den Schiffen zurück.«
Wir gehen auf den Tempel zu, und mein Herz beginnt wieder, hart und schnell zu schlagen. Das Bauwerk macht einen düsteren, ja unheilvollen Eindruck. Die oberste Treppenstufe ist fingerdick mit Blut verkrustet. Aber es ist altes Blut, geronnen und so schwarz wie das Tempelinnere hinter dem Türloch.
Sandoval geht furchtlos hinein und kehrt im nächsten Moment zurück: »Da drinnen ist niemand – auch keine Dämonen.«
Zersplitterte Balken und Bretter, leuchtend grün und rot bemalt, liegen um den Tempel verstreut. Auf der Plattform, auf den Treppenstufen, im knöchelhoch wuchernden Gras. Anscheinend sind es Überreste der Götzenbilder, die Grijalvas Männer hier in Trümmer gehauen haben.
Unsere Männer hocken sich auf Felsbrocken und Baumstämme vor dem Tempel oder einfach ins Gras. Viele von ihnen haben ihre Helme abgenommen und trocknen sich den Schweiß auf Stirn und Wangen. Auf einmal kommt es mir geradezu unwirklich still vor. Nur das Sirren der Mücken ist zu hören und das leise Scheppern von Eisen. Keine Affenschreie mehr, keine Vögel. So als ob der ganze Urwald urplötzlich den Atem anhalten würde.
»Und, Orteguilla«, flüstert mir Diego zu, »bist du jetzt auch ›verängstigt‹ – wie damals Grijalva?«
Ich grinse ihn nur an. Eigentlich kann ich Diego ziemlich gut leiden – wie einen jüngeren Bruder. Aber die können einem manchmal auch auf die Nerven gehen.
Erst vor ein paar Tagen habe ich ja versucht, ihm zu erklären, was es meiner Ansicht nach mit der Angst auf sich hat. Dass wir uns niemals wacher, nie lebendiger fühlen als in Momenten großer Gefahr – das verdanken wir doch einzig unserer Angst! Sie ist es, die alle unsere Sinne wie Kampfdolche schärft. Nur durch sie scheint die Sonne strahlender, das Himmelsblau leuchtender, jeder Laut um uns herum tausendfach intensiver als im gewöhnlichen Alltag – durch unsere Angst! Sie ist die Feder in unserem Innersten, die uns bis zum Zerreißen spannt. Ohne unsere Angst würden wir nicht einmal richtig bemerken, welches Abenteuer wir gerade erleben!
So habe ich auf Diego eingeredet, aber er hat mich nur mit großen Augen angeschaut. »Bei mir ist das anders«, hat er gesagt. Doch als ich von ihm wissen wollte, wie anders, da zuckte er wieder nur mit den Schultern.
Während mir diese Gedanken durch den Kopf gehen, berät sich Cortés mit dem »Tollkühnen« und dem »Durchtriebenen«. »Den Tempel hier haben sie aufgegeben«, erklärt er ihnen. »Also müssen wir ihnen dorthin folgen, wo sie jetzt ihre Teufelsmessen abhalten. Dort werden wir wiederum alle Götzenbilder zerstören. Aber dabei lassen wir es nicht bewenden.«
Ohne diesen dunklen Zusatz zu erläutern, befiehlt er uns, weiter vorzurücken. Die Männer rappeln sich auf und wir setzen uns aufs Neue in Bewegung. Schnurgerade zieht sich der Weg tiefer in den Wald hinein. Nach einigen weiteren Hundert Schritten geht er in eine befestigte Dammstraße über.
Verwundert schauen wir uns um. Als Straßenbelag verwenden die Indianer keine einzelnen Steine, wie es in unserer Heimat üblich ist, sondern eine Art gehärteten Stuck, der den Weg mit einer fugenlos glatten Schicht überzieht.
»Ihre Kultur ist offenbar höher entwickelt als die der Eingeborenen auf Kuba«, erklärt Cortés. »Und doch sind auch sie Götzenanbeter, denen ihr Teufelsglaube ausgetrieben werden muss.«
Sandoval und Alvarado bekunden murmelnd ihre Zustimmung.
»Alles, was sie können und besitzen«, fährt unser Anführer fort, »verdanken sie allein dem Teufel. Deshalb genügt es nicht, dass wir nur ihre Götzenbilder zerstören. Wir müssen auch alle heidnischen Blendwerke, die sie aus Gold gefertigt haben, an uns bringen und einschmelzen – nur so können wir sie aus dieser Hölle befreien.«
»So ist es«, murmeln die beiden Männer wie aus einem Mund.
Im nächsten Moment bricht um uns herum wahrhaftig die Hölle los.
Trommeln dröhnen, Pfiffe, spitz wie Vogelkrallen, fahren uns in die Ohren. Dazu ertönen Schreie, Jaulen und Geheule wie aus Tausend Kehlen – ein markerschütterndes Getöse, sodass wir alle wie gelähmt stehen bleiben und mit schreckgeweiteten Augen um uns schauen. Die Straße hinauf und hinunter und ins Dickicht links und rechts, aber nirgendwo sind Indianer zu sehen. Sie schreien und trommeln und trillern, und an der Art, wie Alvarado bedeutungsvoll in Cortés’ Richtung nickt, kann ich mir leicht zusammenreimen, was er sagen will: Genauso haben sie es auch gemacht, als er mit Grijalva hier war. Und natürlich glauben sie, dass wir genauso erschrocken zur Küste zurückrennen werden wie damals Grijalva und seine Leute.
Aber Cortés ist nicht der Mann, der sich durch Trommeln und Geheule in die Flucht schlagen lässt. Mit einem Satz springt er auf einen Felsbrocken am Wegrand und hebt beide Hände. Sein Gesicht ist so blass, seine Miene so gefasst, ja starr wie nahezu immer.
»Die Schilde hoch, die Reihen dicht!«, schreit er gegen das höllische Lärmen an. »Wir marschieren weiter!«
Diego und ich wechseln einen Blick. Er ruft mir etwas zu, aber ich sehe nur seinen Mund, der auf- und zugeht – zu verstehen ist überhaupt nichts.
Stumm stolpern wir hinter Cortés und Alvarado her. Der hat mittlerweile ein Dutzend Konquistadoren herbeigewunken, um unseren Tross nach vorne abzusichern. Gegen ihre Rüstungen und Schilde können die Indianer mit Pfeilen und Speeren wenig ausrichten. Wohl deshalb versuchen sie gar nicht erst, uns den Weg abzuschneiden – dabei müssen sie zu Hunderten sein. Der Wald hallt von ihren Trommeln und Schreien.
Oder wollen sie uns nur tiefer ins Dickicht locken – an einen Ort, an dem sie uns niedermachen können? Mithilfe von Skorpionen und Giftschlangen, die sie laut Grijalva herbeizurufen vermögen, oder mit Steinlawinen, die wie von selbst auf Berghängen niederdonnern, wenn der Teufel ihre Zauberpriester erhört?
Aber Cortés fürchtet weder den Teufel noch die Götzen, in deren Gestalt sich der Satan von den Indianern anbeten lässt – so jedenfalls haben es uns die Priester auf Kuba und noch an Bord der Santa Maria wieder und wieder erklärt. Unser Herr fürchtet niemanden als Gott und den König, und selbst diese beiden vielleicht nicht jederzeit. Im Marschieren macht er dem Flaggenträger ein Zeichen, und der nimmt das Horn, das ihm am Lederriemen über der Schulter hängt, und bläst einen aufsteigenden Dreiton.
Im nächsten Moment rennen wir los.
- 4 -
Für die Dauer eines halben Herzschlags hört das Getöse im Dickicht auf, und wieder ist es, als ob der ganze Urwald zu atmen vergäße. Dann beginnen die Indianer aufs Neue, zu trommeln und zu heulen, und überall im Gestrüpp kann ich nun ihre erschrockenen Gesichter sehen. Stirn und Wangen leuchtend grün und blau und gelb bemalt, dazwischen die weit aufgerissenen Augen. Bunter Federschmuck wippt auf ihren Köpfen, und so bizarr ihr Anblick ist, so unbegreiflich furchterregend muss unsere Heerschar in ihren Augen erscheinen: Hunderte bärtiger Männer in eiserner Kleidung, mit Schilden und Schwertern, die klirrend und scheppernd auf ihrer Prunkstraße entlangrennen, so wie die Indianer es ja eigentlich vorgesehen hatten.
Nur dass wir in die falsche Richtung stapfen – nicht in panischer Flucht zu den Schiffen zurück, sondern tiefer in den Wald! Auf ihren Teufelstempel zu, denn gewiss führt diese Straße geradewegs zu dem Heiligtum, in dem sie ihre abscheulichen Messen zelebrieren, seit Grijalva befohlen hat, ihre Götzen in dem anderen Tempel zu zertrümmern. Damit hat er ganz richtig gehandelt, wie Cortés uns erklärt hat – nur hielt Grijalvas Mut seinen eigenen Befehlen leider nicht stand.
Das Wummern der Trommeln wird leiser, ebenso die Pfiffe und Schreie. Bald schon sind sie gänzlich verstummt und nun ist nur noch das Stampfen unserer Schritte und das Rasseln von Eisen zu hören.
»Warum im Sturmschritt«, keucht neben mir Diego, »verstehst du das, Orte?«
Ich habe schon angefangen, meinen Kopf zu schütteln, da fällt mir die Antwort ein. »Menschenopfer!«
Für mehr reicht mein Atem nicht, aber an Diegos Gesicht sehe ich, dass er auch so schon verstanden hat. Dass ihm genauso wie mir wieder eingefallen ist, was die Männer, die mit Alvarado letztes Jahr hier waren, auf der Santa Maria erzählt haben. Die Götzen sind die vielerlei Fratzen und Gestalten des Satans. Wenn die Indianer sie auf genau vorgeschriebene Weise anbeten, werden sie dafür mit verschiedenerlei Zauber belohnt. Mit Regengüssen, die ihre Felder bewässern – oder eben mit Giftmückenplagen, Schlammlawinen oder sonstigen Verheerungen, die ihre Feinde schwächen. Doch als Gegenleistung verlangen die Teufelsgötzen jedes Mal ein Menschenopfer, das auf ihren Altären geschlachtet wird.
Und deshalb rennen wir! Im Sturmschritt auf das Heiligtum der Indianer zu – um ihnen zuvorzukommen, um ihre Priester zu überwältigen, die ausersehenen Opfer unter dem Schlachtbeil fortzureißen! Um Jesu Christi willen, aber genauso zu unserem eigenen Wohl. Bevor die Götzenpriester das Opfer dargebracht haben, bevor der Teufel sie dafür mit einem Schadenszauber belohnen kann, müssen wir zur Stelle sein!
Bei allen Heiligen im Himmel, denke ich, warum laufen wir nicht schneller! Von teuflischen Tempeln ist weit und breit nichts zu sehen – nur Dickicht links und rechts und vor uns das graue Band der Straße, das sich scheinbar endlos dahinzieht. Übergangslos bricht nun auch noch ein Sturzregen auf uns herein – mit Tropfen so groß wie Gewehrkugeln, die auf Blätter und Äste, auf die Helme und Schilde der Konquistadoren prasseln, dass es wahrhaftig wie Gewehrschüsse knallt. Nur ein paar Atemzüge später sind wir von Nebel umgeben – so dicht und dampfend, dass ich kaum mehr meinen Vordermann sehen kann.
Ist das schon ein Unwetter, das der Teufel geschickt hat, um uns zu schaden? Aber diese Straße hier, sage ich mir dann, kann unmöglich Teufelswerk sein – dafür ist sie zu klug erdacht und zu solide erbaut. Weiterhin stürzen die Wassermassen vom Himmel und abseits des Weges hat sich der Boden längst in Schlamm verwandelt. Doch die Straße ist zur Mitte hin gewölbt und so laufen die Fluten gurgelnd nach beiden Seiten ab. Daher kommen wir weiter rasch voran, auch wenn im Nebel kaum mehr zu sehen ist, wohin der stürmische Marsch uns führt.
Irgendwo vor uns im Wald sind nun auch wieder Trommeln zu hören, dazu schrilles Pfeifen wie von Muschel- oder Knochenflöten. Ein Mann ruft irgendetwas in beschwörendem Tonfall und eine Vielzahl dumpfer Stimmen antwortet ihm im Chor.
Der Teufelstempel!, denke ich. Er muss irgendwo da vor uns im Nebel sein! Ich werfe Diego einen Blick zu und er schaut mich aus blitzenden Augen an. Bei allen Heiligen der Christenheit, durchfährt es mich – Diego hat mich nicht angelogen! Sein Mund ist halb geöffnet, als hätte er Mühe, das Jauchzen zurückzuhalten, das ihm in der Kehle sitzt. Was immer uns da vorne erwarten mag – er hat keine Angst davor, ja er kann es kaum erwarten, sich ins Getümmel zu stürzen!
Wir rennen und keuchen, Wasser platscht auf uns nieder, und im nächsten Moment hört das Unwetter urplötzlich auf. So maßlos, wie eben noch der Regen geströmt ist, flutet Sonnenlicht herab. Geblendet schaue ich um mich. Die Straße hat sich zu einem gigantischen Platz geweitet, auf dem unzählige kolossale Bauten stehen. Die meisten von ihnen scheinen Ruinen zu sein – gewaltige Flachbauten mit eingestürzter Säulendecke oder Pyramiden, deren Treppen und Firste von Bäumen und Buschwerk überwuchert und teilweise zersprengt sind.
Unser Fahnenträger hebt erneut sein Horn an die Lippen und lässt die Fanfare erklingen. Beim Anblick des gewaltigen Tempelplatzes waren wir langsamer geworden, doch nun setzen wir erneut zum Sturmlauf an. Vielleicht zwanzig Schritte vor uns, am Ende einer Allee aus baumartigen Steinskulpturen, erhebt sich ganz genau so eine Plattform wie weiter vorne im Wald. Mit einem würfelförmigen Tempel darauf, zu dem wuchtige Stufen hochführen, und einem Säulenportal – doch im Unterschied zu dem Heiligtum, das Grijalvas Männer verwüstet haben, ist der Tempel da vorne offenbar noch in Gebrauch.
Im Rennen erkenne ich eine Gestalt, die mit weit ausgebreiteten Armen vor dem Tempelportal steht – anscheinend ist es der Zauberpriester, der jene rituellen Beschwörungen hervorbringt. Auf den Stufen kauern wenigstens zwei Dutzend weitere Gestalten – einige von ihnen blasen in Knochenflöten, andere schlagen auf Trommeln und antworten in dumpfem Chor auf die Anrufungen des Priesters.
Auf einem lang gestreckten Stein zu seinen Füßen aber liegt eine weitere Figur. Ungewiss, ob lebendig oder tot, ob Steinskulptur oder ein Mensch aus Fleisch und Blut. Die Figur liegt auf dem Rücken, vollkommen reglos, und nun reißt der Priester seine Rechte mit einem langen, gezackten Messer in die Höhe und stößt es auf den Liegenden hinab!
Im grellen Licht der Mittagssonne kann ich einen Moment lang die zahnartigen Zacken an der Klinge ganz genau sehen. Wie mit der Tuschfeder gezeichnet, so überdeutlich, wie man nur in solchen Augenblicken alles wahrnimmt – in den Augenblicken äußerster Gefahr. Wenn alles in dir schreit vor Angst, aber du gleichzeitig weißt, dass dein Wille stärker ist. Dass du deiner Angst keinesfalls nachgeben wirst, dass du weiter voranstürmen wirst, was auch passieren mag – und dadurch, nur dadurch wird das angstvolle Schreien in dir zu brausendem Jubel.
Ja, denke ich, ganz genau so ist das bei mir, wenn ich mich in ein Wagnis stürze! Ich muss es mir merken, damit ich es nachher Diego erklären kann – und nicht nur wegen Diego, sondern mehr noch, weil mich Cortés beauftragt hat, die Regungen des Herzens zu ergründen.
Wir stürmen auf den Teufelstempel zu, zwischen den steinernen Alleebäumen, die mit schreiend bunten Fratzen und Bildzeichen bedeckt sind.
»Angriff!«, ruft Cortés. »Ich will sie lebend – alle!«
- 5 -
Die Kompanien von Alvarado und Portocarrero teilen sich auf und umstellen blitzschnell die Plattform mit dem Tempel. Auf ein Zeichen von Cortés stürmen fünfzig Konquistadoren die Stufen hoch – in voller Rüstung, mit gezücktem Schwert.
Diego will sich unter sie mischen, sein Kurzschwert in der Hand, doch Gonzalo de Sandoval hält ihn lachend zurück. »Du Milchbart!«, schreit er. »Kannst es wohl nicht erwarten?«
Währenddessen ist Portocarrero schon oben auf der Plattform. Er stürzt sich auf den Priester, gerade als der sein gezacktes Messer erneut auf die liegende Gestalt hinabstößt. Der »Dröhnende« reißt ihn zurück – und schreit vor Abscheu auf. Der Priester ist von Kopf bis Fuß mit Blut verschmiert. Seine Haare starren vor Blut, sein Umhang, seine Arme.
»Du stinkendes Stück Teufelsdreck!«, schreit Portocarrero. »Diese verfluchten Höllenpriester baden in Blut!«
Die Konquistadoren werfen die Indianer zu Boden, drücken ihnen die Schwertspitze gegen Brust oder Kehle. Das Messer fällt klirrend hin und zerspringt – seine schwarze, gezackte Klinge ist anscheinend aus Stein. Auch die Trommeln und Knochenflöten werden von den Stiefeln der Konquistadoren zertreten. Stockstarr liegen die Indianer da und schauen aus großen Augen zu ihren Bezwingern hoch.
Der Kampf ist zu Ende, bevor er überhaupt begonnen hat. Doch für die Gestalt auf dem Opferstein kommt unser Sieg offenbar zu spät. Es ist ein muskulöser Mann, stämmig gebaut und nur mit einem Hüfttuch bekleidet, und er liegt so reglos da, wie das nur Tote fertigbringen. Seine Augen sind geschlossen, seine linke Brustseite ist blutüberströmt. Soweit ich das sehen kann, ist sein ganzer Körper mit Tätowierungen bedeckt – ein gelbbraunes, gleichförmiges Muster wie auf Schildkrötenhaut. Seine Haare sind kurz geschoren, sein Gesicht ist hager und seltsam ausdruckslos.
Cortés erklimmt die Stufen und tritt neben den Opferstein. Suchend schaut er sich um und winkt dann Alvarado und Portocarrero zu sich.
»Pedro, Alonso«, sagt er, »nehmt jeder fünfzig Mann und sucht das Gelände ab! Allerdings glaube ich nicht, dass ihr hier noch irgendwen finden werdet. Diesmal waren wir zu schnell für sie – die restliche Teufelsbande wird die Flucht ergriffen haben, als ihnen klar wurde, dass ihre Priester das hier nicht zu Ende bringen würden.«
Alvarado beugt sich über den Opferstein. Mit Daumen und Zeigefinger zieht er dem anscheinend toten Mann die Augenlider auseinander und richtet sich wieder auf.
»Wenn du mich fragst, in dem Burschen ist kein Funken Leben mehr«, sagt er zu Cortés. »Aber du hast recht – wir haben sie gestört, bevor sie ihn auf jene Weise hinschlachten konnten, die der Satan von ihnen fordert.«
Diego und ich wechseln einen Blick. »Auf jene Weise« – wir beide wissen, was Alvarado damit meint. Während der Überfahrt von Kuba haben einige der Männer, die schon mit Grijalva hier waren, mehr als einmal von den Opferriten erzählt. Rasch schüttele ich den Kopf, bevor Diego irgendwelche grässlichen Einzelheiten erwähnen kann, wie er das nur allzu gerne macht. Schon um mir zu beweisen, dass er weder Angst noch Abscheu kennt.
Alvarado und Portocarrero stellen Suchtrupps zusammen und durchforsten das Tempelgelände. Währenddessen schaut sich Cortés aufs Neue suchend um. Diesmal winkt er den Notar Gutierrez und den Fahnenträger herbei.
»Dich brauche ich auch, Orteguilla«, fügt er in meine Richtung gewandt hinzu. »Und bring Melchorejo mit.«
Die Stufen hinauf zur Plattform sind mit schwarz-roter Schmiere überzogen. Blut, vermischt mit Regenwasser und Schlamm. Melchorejo taumelt neben mir die Treppe empor. Seine Augen schielen so sehr, dass er alles verschwommen und zugleich zweifach sieht. Melchorejo ist eigentlich Fischer, ein kaffeebrauner Indianer von vielleicht fünfundzwanzig Jahren. Letztes Jahr hat ihn Grijalva an der Küste von Yucatan gefangen und als Dolmetscher mitgenommen. Bei den Indianern werden die Schielenden angeblich als »Seher« verehrt, die in die Götter- und Geisterwelt hinüberspähen können. Jedenfalls hat Melchorejo mir das an Bord der Santa Maria erzählt – oder zumindest habe ich ihn so verstanden. Sein Spanisch ist allerdings so miserabel, dass eigentlich kaum etwas zu verstehen ist. Umgekehrt scheint er auch von dem, was man auf Spanisch zu ihm sagt, so gut wie nichts aufzufassen. Aber einen anderen Dolmetscher haben wir leider nicht, und deshalb hat mich Cortés beauftragt, jeden Tag wenigstens eine halbe Stunde mit Melchorejo Spanisch zu reden.
»Nur Mut«, sage ich zu ihm und deute mit dem Kopf zu Pedro Gutierrez, der vor uns die Treppe hinaufstakst.
Der Notar Gutierrez ist mehr als sechs Fuß groß und hager wie ein Skelett. Er bewegt sich so vorsichtig, als ob seine überlangen Gliedmaßen aus morschem Holz wären und jederzeit zerbrechen könnten. Er trägt einen knöchellangen schwarzen Umhang und unter dem Arm ein großes Buch mit dem königlichen Wappen darauf.
Melchorejo schielt eingeschüchtert zu Gutierrez empor und gleichzeitig zu mir herüber. Wir beide wissen, dass er von den feierlichen Sätzen, die Gutierrez gleich vorlesen wird, höchstens einen Bruchteil versteht. Aber natürlich wird er alles so gut, wie er es hinbekommt, in die Sprache der Indianer übersetzen.
Die Sprache heißt Chontal, falls ich Melchorejo richtig verstanden habe. Und die Indianer dieser Gegend nennen sich Maya – die Eingeborenen unten in Yucatan genauso wie die Bewohner dieser Insel, die Grijalva auf den Namen Don Juan getauft hat. Laut Melchorejo ist es allerdings keine Insel, sondern der Ausläufer einer großen, geschlossenen Landmasse, die sich bis weit nach Norden und Westen erstreckt. Aber das kann eigentlich nicht sein. Auf den Landkarten, die Cortés eigens für unsere Reise hat zeichnen lassen, gibt es in dieser Weltgegend nur den Ozean mit einer unbestimmten Anzahl von Inseln darin. Das indische Festland muss ein gutes Stück weiter westlich liegen. Doch Melchorejos Spanisch ist wirklich ungeheuer schlecht und bestimmt habe ich ihn wieder einmal falsch verstanden. Noch immer kann er nur ein paar Dutzend Brocken Spanisch, und manchmal befürchte ich, dass es auch mit seinen Kenntnissen des Chontal nicht viel weiter her ist.
Unterdessen hat unser Fahnenträger das flache Tempeldach erklommen und unsere heimatliche Flagge gehisst. Zusammengedrängt kauern die gefangenen Indianer auf der Plattform, von zwei Dutzend Konquistadoren mit gezogenen Schwertern bewacht. Auch Diego hat sich irgendwie zu ihnen durchgeschlagen und hält einen der Opferpriester, die vorhin auf Flöten gepfiffen oder im Chor gesungen haben, mit seinem Kurzschwert in Schach.
»Gonzalo, du eilst mit dreißig Mann zurück zur Küste«, sagt Cortés zu Sandoval, gerade als der Notar, Melchorejo und ich oben auf der Plattform angekommen sind. »Bringt einen Zimmerer her und genügend Balken und Bretter für einen Altar.«
Sandoval schaut Cortés verständnislos an. Sein Mund öffnet sich, aber was immer er einwenden wollte, bleibt ungesagt. So tollkühn, Cortés offen zu widersprechen, ist nicht einmal er.
»Und bringt Weihrauch, eine Glocke und eine Madonnenfigur mit«, fügt Cortés hinzu.
Sandoval nickt, wendet sich ab und ruft einige Männer zu sich. Nur ein paar Augenblicke später eilt er mit einer Schar Konquistadoren auf der Straße zurück in Richtung Meer.
Aber dann brauchen wir auch einen Pater!, denke ich und schaue Cortés eindringlich an. Wenn er hier einen Altar errichten will, dann benötigt er einen christlichen Priester, der diesen Tempel von allem Teuflischen reinigt und feierlich der Muttergottes weiht!
Cortés scheint meinen Blick bemerkt zu haben – ganz kurz wendet er sich zu mir um und nickt mir mit kaum merklichem Lächeln zu. Im nächsten Moment dreht er sich wieder zu Gutierrez. »Das Requerimiento«, sagt er, »die königliche Erklärung.«
Notar Gutierrez sieht sich unbehaglich um. Offenbar ist ihm klar geworden, dass er sich an diesem Ort nirgendwo niederlassen kann, ohne seine Robe mit frischem oder geronnenem Blut zu beflecken. Also bleibt ihm nichts anderes übrig, als das Requerimientoim Stehen zu verlesen. Er macht einen halben Schritt rückwärts, aber auch das hilft ihm wenig: Der Tempelbau ist zu flach, um seiner hoch aufgeschossenen Gestalt ausreichend Schatten zu bieten.
Fast senkrecht brennt die Sonne auf die Plattform herab und der Gestank nach Blut ist kaum zu ertragen. Unmittelbar vor Melchorejos und meinen Knien liegt der Geopferte auf dem Stein. Obwohl seine Augen geschlossen sind, habe ich den beklemmenden Eindruck, dass er mich durch seine Lider hindurch anstarrt. Doch das kann eigentlich nicht sein – schon weil auch seine Lider mit diesem eigenartigen Schildkrötenmuster tätowiert sind.
»Im Namen Gottes, Unseres himmlischen Herrn, und Seines Stellvertreters auf Erden, des Heiligen Vaters Papst Leo X., erklären Wir, König Karl I. von Spanien, hiermit, dass ihr, die natürlichen Einwohner der Insel San Juan, nach himmlischem Ratschluss allesamt Unsere Vasallen seid und Uns für alle Zeiten Tribut und Gehorsam schuldet.«
Der Notar unterbricht sich und sieht Melchorejo auffordernd an. Der Dolmetscher schielt zu Tode erschrocken in alle erdenklichen Richtungen und dann mit seinem linken Auge flehend zu mir.
»Du schaffst das«, murmele ich und nicke ihm ermutigend zu.
Melchorejo ist einen halben Kopf kleiner als ich und seine Schultern sind schmaler als Diegos. Neben den Konquistadoren in ihren Eisenrüstungen sehen die meisten Indianer aus wie halbwüchsige Knaben.
Melchorejo stottert irgendetwas und verstummt gleich wieder. Was immer er gesagt hat, es war viel zu kurz, um den feierlichen Wortschwall von Gutierrez auch nur einigermaßen vollständig wiederzugeben.
»Weiter, Melchorejo«, murmele ich.
Er schielt erneut in alle Richtungen und stottert dann das Gleiche noch einmal hervor. Jedenfalls hat es sich für meine Ohren genauso angehört. Die gefangenen Indianer starren ihn fassungslos an.
Währenddessen hat der Notar begonnen, den nächsten Absatz des Requerimiento vorzutragen. Cortés und die Konquistadoren hören mit andächtigen Gesichtern zu, während Gutierrez den Indianern erklärt, was vor mehr als eintausendfünfhundert Jahren in einem Stall zu Bethlehem geschehen ist. In feierlichen Sätzen trägt er die gesamte Geschichte der Christenheit vor, von der Geburt Jesu bis zum heutigen Tag. Nach jedem Absatz legt er eine Pause ein und schaut Melchorejo erwartungsvoll an.
Melchorejo gibt sich jedes Mal redlich Mühe, doch die Gesichter der gefangenen Indianer drücken vollkommene Ratlosigkeit aus.
»Und aus allen diesen und einigen weiteren Gründen«, erklärt Notar Gutierrez schließlich, »hat der Heilige Vater Uns, dem spanischen König, diese Inseln auf immer und ewig zu eigen gegeben. Als Gegenleistung haben Wir Uns verpflichtet, euch, die natürlichen Einwohner der Inseln Yucatan und Don Juan, zum Christentum zu bekehren. Und so soll es geschehen, im Namen des Erlösers, Amen!«
Der erschöpfte Melchorejo krächzt einige abschließende Laute hervor. Der Notar klappt das in Leder gebundene Requerimiento zu und wischt sich mit dem Ärmel über die Stirn. Und genau in diesem Moment flüstert es irgendwo vor meinen Knien mit kraftloser Stimme, doch in fehlerfreiem Spanisch:
»Im Namen des … Erlösers … Amen!«
- 6 -
Unser Zimmerer heißt Jesus Mendoza und hat ungeheuer geschickte Hände. Mit Säge und Hobel hantiert er so kunstvoll, dass es fast wie Zauberei aussieht. Ich schaue ihm dabei zu und behalte gleichzeitig den geretteten Mann vom Opferstein im Blick. Er liegt abseits des Tempels im Schatten eines Maniokbaums, und ich kauere neben ihm, wie es mir Cortés befohlen hat – sobald der Gerettete neuerlich erwacht, soll ich ihn aushorchen. Doch der Mann liegt reglos im Gras und schläft wie ein Toter.
Gleich nachdem er vorhin jene wenigen Worte gemurmelt hatte, sank er aufs Neue in Ohnmachtsschlaf. Unser Wundarzt Carlos Jeminez, genannt »der Schlitzohrige«, versorgte seine Wunden und netzte seine Lippen mit Wasser – mehr war fürs Erste nicht zu tun. Der schwarze Steindolch scheint nicht allzu tief in seine Brust eingedrungen zu sein – Jeminez ist sich sicher, dass keine lebenswichtigen Organe verletzt worden sind. Und wenn irgendwer das beurteilen kann, dann unser Wundarzt: Seine Ohren wurden ihm Anno Domini 1507 in Sevilla zur Strafe zerschnitten, weil er heimlich Leichen sezierte. Fünf Jahre saß er deshalb in Kerkerhaft und nach seiner Freilassung heuerte er auf der nächsten Karavelle an und fuhr in die Neue Welt.
Jeminez hat ausgiebig die Pupillen unseres Geretteten betrachtet und schließlich verkündet, dass dem Mann ein betäubendes Mittel eingeflößt worden sei. Er nimmt an, dass die Götzenpriester üblicherweise so verfahren – nicht aus Erbarmen, sondern damit die Opfer nicht schreiend um sich schlagen, wenn man sie bei lebendigem Leib abschlachtet.
Ich starre den Geretteten an, und mich überläuft ein Frösteln – dabei ist es sogar hier im Schatten furchtbar schwül. Ich brenne darauf, sein Geheimnis zu erfahren, doch mehr noch giere ich danach, mich vor Cortés auszuzeichnen. Ich will ihm und mir selbst beweisen, dass ich wirklich jene Gabe besitze – die Fähigkeit, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen, das unsichtbare Gold aus ihren Herzen hervorzuschürfen. Der Gerettete muss mir sein Geheimnis verraten!
Ich beuge mich über ihn und am liebsten würde ich ihn an den Schultern packen und rütteln. Aber Jeminez hat mich streng ermahnt, ihn nicht aus seinem Heilschlaf aufzustören. Er hat viel Blut verloren – wenn auch sehr viel weniger, als er nach den Plänen der Teufelspriester verlieren sollte.
Alvarado und Portocarrero streifen noch immer mit ihren Einheiten durch die Ruinenstadt. Sie scheint von gewaltiger Ausdehnung zu sein – selbst von Portocarreros Flüchen ist nur noch ein fernes Dröhnen zu hören, wie Donner bei einem Gewitter, das sich langsam verzieht.
Währenddessen schafft der narbenreiche Guerrero mit etlichen weiteren Konquistadoren Unmengen an Götzenbildern aus dem finsteren Tempel ins Freie. Einige Bildsäulen sind so gewaltig groß, dass die Männer sie zu zweit aus dem Tempel schleppen müssen. Abscheulichere und zugleich kunstvoller geschnitzte Statuen habe ich niemals vorher gesehen. Einer der Götzen gleicht einer sich windenden Schlange, die mit bunten Vogelfedern geschmückt ist. Ein weiterer hat eine Nase wie eine sich aufbäumende Viper, und jede einzelne dieser Fratzen stiert so düster und bedrohlich, dass es mich bei ihrem Anblick kalt überläuft.
Unsere Männer werfen die bunten Schnitzereien die Stufen hinab und die gefangenen Indianer sehen ihnen mit ausdruckslosen Gesichtern zu. Sie protestieren nicht einmal, als Gonzalo de Guerrero die zertrümmerten Bildnisse zu einem Haufen aufschichten lässt und mit einer Fackel in Brand setzt.
Sehr viel mehr als die Zerstörung ihrer alten Götzenbilder interessiert sie offenbar, welches neue Heiligtum unter Jesus Mendozas geschickten Händen entsteht. Oben auf der Plattform, zwischen dem Tempel und den gefangenen Indianern, steht der Zimmerer über den Altar gebeugt und prüft die Glätte der Platte, indem er mit einer Hand darüber reibt. Sein Kopf ist zur Seite geneigt, so als lauschte er dem seidigen Klang, den das Reiben auf den Brettern hervorruft.
Cortés steht ein paar Schritte neben ihm, an seiner Seite Melchorejo. Er befragt die gefangenen Götzenpriester, und obwohl seine Stimme vollkommen beherrscht klingt, spüre ich, dass er seine Ungeduld nur mühsam bezähmt. Der arme Melchorejo stottert irgendetwas, einmal auf Chontal, dann wieder auf Spanisch – und bestimmt ist weder das eine noch das andere auch nur halbwegs zu verstehen. Wonach Cortés die Priester auch fragen mag – nach ihrem Glauben, ihren Gebräuchen und gewiss auch nach Gold –, er wird aus den Antworten so wenig schlau werden wie die Indianer aus Melchorejos Fragen.
So ruhen also alle Hoffnungen auf dem Geretteten, der wundersamerweise fließend Spanisch spricht, obwohl er wie ein Maya aussieht. Aber er liegt weiterhin reglos neben mir, und nur das fast unmerkliche Heben und Senken seines Brustkorbs verrät mir, dass er noch atmet.
Wer bist du?, befrage ich ihn im Stillen, doch der Gerettete antwortet mir nicht. Meine Gedanken schweifen aufs Neue ab, und bald bin ich bei der Frage, zu der mich über kurz oder lang fast alles führt: Wer bin eigentlich ich? Bin ich wirklich derjenige, den Cortés in mir sieht? Warum sollte irgendjemand gerade mir sein Herz ausschütten – obwohl schon mein eigenes Herz mir oft so unergründlich scheint? Wieso liege ich so häufig halbe Nächte wach und beklage mein Schicksal, das mich gezwungen hat, meine geliebte Heimat zu verlassen? Dasselbe Schicksal hat mich doch zu Hernán Cortés geführt und auf diese abenteuerliche Lebensbahn gebracht, von der ich schon als Knabe träumte!
Ich starre den Geretteten an, doch ich nehme ihn nicht mehr wahr. In Momenten wie diesen sehe ich nur noch mich selbst.
Schon richtig, sage ich mir, von diesem abenteuerlichen Leben hast du immer geträumt! Aber warum hast du davon geträumt? Weil du wusstest, schon als kleiner Knabe wusstest, dass zu Hause, auf dem Hof deines Vaters, für dich kein Platz vorgesehen war! Und deshalb ist es ebenso wahr, dass ich zuweilen, in dunklen Stunden, meinen Bruder Leonel verfluche. Ich hasse mich dafür, ich verachte mich, ich bereue und gelobe Besserung – aber es hilft alles nichts! Beim nächsten Mal, wenn mich jenes dunkle Rasen wieder überkommt, ergeht es mir genauso.
Dabei sind Sitte und Gesetz ganz und gar auf seiner Seite. Leonel ist der Zweitgeborene und ich bin nur der Dritte. Aber zugleich ist er mein Zwilling – und gerade einmal zehn Minuten älter als ich! Wäre ich als Erster von uns beiden zur Welt gekommen, so würde jetzt ich in Sevilla auf der Universität studieren – und Leonel säße in irgendeinem gottverlassenen Winkel und würde mit den Zähnen knirschen!
Mir wird bewusst, dass ich tatsächlich mit den Zähnen knirsche, und beschämt fahre ich mir mit der Hand über das Gesicht. Erneut richte ich meine Aufmerksamkeit auf den Geretteten und versuche, sein Geheimnis zu ergründen.
Er spricht Spanisch wie ein Mann, der in Sevilla oder Medellín aufgewachsen ist, sage ich mir – doch seinem Äußeren nach ist er ein Indianer! Sogar seine Schneidezähne sind spitz zugefeilt und die Zwischenräume mit Splittern von Türkisstein ausgefüllt, wie es bei den Maya hierzulande Brauch ist. Ob seine Haut von Natur aus hell oder kaffeebraun ist, kann ich unmöglich entscheiden – aber ein Spanier käme niemals auf den Gedanken, sich von Kopf bis Fuß mit so einem Schildkrötenmuster zu tätowieren!
Nein, er muss ein Indianer sein – aber wieso spricht er dann Spanisch? Vor Grijalvas Expedition ist niemals ein spanisches Schiff in diesen Gewässern gekreuzt – und der mutlose Grijalva hat zwar Dutzende Männer zurückgelassen, aber keiner von ihnen war mehr am Leben. Einige fielen im Kampf, die weitaus meisten starben auf den Opfersteinen der Götzenpriester – und ganz bestimmt hätte keiner von Grijalvas Männern sich die Zähne spitz gefeilt und seine Haut mit Schildkrötenmuster tätowiert!
Ich schüttele den Kopf über mich selbst – dieses ewige Grübeln bringt mich keinen Schritt weiter. Wie gut es Diego doch hat, sage ich mir, der Junge kennt weder Selbstzweifel noch Angst! Zumindest versteht er es, vor sich selbst und vor aller Welt diesen Anschein zu erwecken. Wie enttäuscht er vorhin war, als Sandoval ihn nicht mit auf die Plattform stürmen ließ! Diego kann es wirklich kaum erwarten, mit dem Schwert in den Kampf zu ziehen.
Ich drehe meinen Kopf hin und her, aber ich kann ihn nirgendwo entdecken. Verstohlen beobachte ich Cortés, der es offenbar aufgegeben hat, die gefangenen Indianer zu verhören. Mit seinem prachtvollen Samtumhang, den breitkrempigen Federhut auf dem Kopf, schreitet er auf der Plattform auf und ab.
Aus irgendeinem Grund fällt mir die Geschichte wieder ein, wie Cortés vor rund zehn Jahren in der Neuen Welt ankam. Damals waren seine Taschen praktisch leer, und so wie die Geschichte meistens erzählt wird, handelt sie von einem mittellosen Einwanderer Anfang zwanzig, der in kurzer Zeit zum reichen Haziendero aufsteigt. Aber Cortés selbst hat mir gleich bei unserem ersten Zusammentreffen eine ganz andere Version erzählt. »Nichts daran kam unerwartet, Orteguilla«, sagte er damals zu mir. »Ich bin in die Neue Welt gekommen, um reich und mächtig zu werden. Schon unterwegs auf dem Schiff, ja bereits drüben in Sevilla fühlte ich, dass alles ganz genauso kommen würde, wie ich es mir vorgenommen hatte.«
Auf der Insel Hispaniola ließ sich Cortés eine Encomienda zuweisen – ein Landstück sowie einige Dutzend Eingeborene für die Arbeit, wie sie jedem neuen Siedler aus Spanien zustehen. Er befahl ihnen, im Fluss nach Gold zu suchen. Er selbst stand von früh bis spät bis zu den Knien im Wasser und wusch Sand und Kiesel im Sieb. Nach Monaten harter Arbeit wurde er fündig: Er entdeckte Goldkrumen in seinem Sieb, folgte der Spur zu ihrem Ursprung und stieß auf ein funkelndes Flöz im Fels.
Die Mine enthielt Gold für rund zehntausend Pesos. Cortés kaufte sich eine Hazienda und scharte zahlreiche Gefolgsleute und Bedienstete um sich, darunter auch Jesus Mendoza. Dem Zimmerer ging der Ruf voraus, dass niemand prächtigere Altäre schreinern könne als er. Als Cortés’ Tochter zur Welt kam, gezeugt mit einer getauften Indianerin namens Lenita, war die Kapelle auf seiner Hazienda gerade fertig geworden. Das Taufbecken stand neben dem Altar, den Jesus Mendoza gezimmert und mit kunstvollen Schnitzereien versehen hatte. Fray Bartolomé, Cortés’ geistlicher Vertrauter, der uns auch auf dieser Expedition begleitet, taufte die kleine Mestizin auf den Namen Leonor.
Das alles geschah, Jahre bevor ich in die Neue Welt kam und Cortés auch mich in seine Dienste nahm. Doch noch auf seiner neuen Hazienda, die er inzwischen in Kuba erworben hatte, wurde von dem verschwenderischen Tauffest erzählt. Gouverneur Velazquez war der Pate der kleinen Leonor und nicht nur er soll über die ungeheuer prunkvolle Feier erstaunt gewesen sein. »Es war, als ob eine Prinzessin getauft würde«, so äußerte sich manch einer mit Bewunderung und Befremden, »und nicht bloß ein Halbblut, gezeugt von einem drittklassigen Hidalgo und einem Indianerweib aus einem dreckigen Lehmhüttendorf.«
Doch so hat Cortés sich selbst niemals gesehen. »Ich wusste schon als kleiner Knabe«, sagte er damals zu mir, »dass ich dazu berufen bin, eines Tages zum König gekrönt zu werden.« Dabei sah er mich mit seinen dunklen Augen so durchdringend an, wie nur er das vermag.
Während ich über seine Worte nachdenke, fällt mein Blick auf den Geretteten – und gerade in diesem Moment schlägt er seine Schildkrötenlider auf.
- 7 -
Der Gerettete dreht seinen Kopf im Liegen hin und her. Sein Blick flackert zum Tempel und zu dem Haufen brennender Götzenbilder davor. Er murmelt irgendetwas, doch ich verstehe kein Wort. Es klingt überhaupt nicht spanisch. Da durchzuckt mich der Gedanke: Vielleicht hat er vorhin nur im Rausch oder Fiebertraum die letzten Worte aus dem Requerimiento nachgelallt!
Also kann er gar kein Spanisch? Aber das darf nicht sein! Wie soll ich jemals sein Herz ergründen, wenn wir unterschiedliche Sprachen sprechen?
Ich beuge mich über ihn und berühre ihn an der Schulter. »Wie heißt du?«, frage ich.
Seine Augen fallen wieder zu. Ein Lächeln fliegt über sein Gesicht und enthüllt ganz kurz seine raubkatzenhaft zugefeilten Zähne. Offenbar bereitet es ihm Mühe, halbwegs wach zu bleiben.
»So war es also kein Traum?«, murmelt er mit schlafverquollener Stimme, doch in fehlerlosem Spanisch.
»Nein, kein Traum«, sage ich und rüttele ihn ein wenig fester. »Schlaf nicht wieder ein«, bitte ich ihn. »Sage mir deinen Namen! Wie kommt es, dass du so gut Spanisch sprichst?«
»Du meinst …« Seine Stimme erstirbt zu einem Flüstern. »So gut Chontal …?«
»Oder auch so herum«, antworte ich erstaunt. »Aber wie kannst du Spanier sein – und siehst doch wie ein Indianer aus? Deine Haut …«
Sein Lächeln wird zum listigen Grinsen. »Es sieht echt aus, oder?«, murmelt er. »So viele Nadeln …« Er unterbricht sich und stöhnt auf. Seine Hand tastet nach dem Verband auf seiner linken Brustseite.
»Sie nehmen die Nadeln von Kakteen«, flüstert er. »Tauchen sie in Pflanzenfarben und stechen sie dir in die Haut. Überall, eine nach der anderen, stundenlang. Tagelang – bis du es nicht mehr zu ertragen glaubst! Aber natürlich lässt du dir nichts anmerken … du zuckst nicht einmal mit der Wimper … das ist hier ganz wie zu Hause in …«
»In?«, wiederhole ich und schüttele ihn hin und her. »Weiter!«, stoße ich hervor. »Wo kommst du her, wie heißt du? Wie hat es dich hierher verschlagen?«
Doch der Gerettete schenkt mir keine Beachtung. Meine Fragen scheint er überhaupt nicht mitbekommen zu haben. »Weißt du noch?«, flüstert er. »Als wir beide Knaben waren …«
Seine Augen gehen wieder auf und diesmal scheint er mich zu sehen. »Carlito?«, murmelt er, und ein verzücktes Lächeln lässt sein Gesicht erstrahlen, soweit das trotz Schildkrötenmuster möglich ist. »Du bist es doch – mein kleiner Bruder, Carlos de Aguilar?«
Ich schüttele den Kopf – Leonels kleiner Bruder zu sein reicht mir völlig aus. »Mein Name ist …«, beginne ich und beiße mir auf die Unterlippe. Gerade noch rechtzeitig ist mir klar geworden, dass der Gerettete drauf und dran ist, mir sein Herz zu öffnen.
»Na klar, Bruder«, murmele ich und nicke ihm eifrig zu, »ich bin’s – Carlito, wer denn sonst?«
Er starrt mich an und seine Augen füllen sich mit Tränen. Mir wird heiß und kalt, weil ich ihn angelogen habe, aber gleichzeitig spüre ich, dass ich so und nicht anders handeln musste.
Der Gerettete hebt seine Arme empor und umfasst meinen Kopf mit seinen Händen. »Carlito, mein lieber Carlito«, flüstert er unter Tränen, »wie oft habe ich davon geträumt, dich und unsere Eltern eines Tages wiederzusehen!« Er unterbricht sich und schaut mich erschrocken an. »Aber sag doch«, fragt er dann, »wie geht es ihnen? Dem Vater, der Mutter – sie sind doch am Leben?«
Ich nicke so gut, wie das geht, wenn jemand deinen Kopf mit beiden Händen festhält. Aber dem Geretteten scheint es zu genügen.
»Gott sei es gedankt«, murmelt er. »Sie leben! Du lebst! Und ich bin frei!« Wieder fallen seine Augen zu, aber gleichzeitig bricht ein Redestrom aus seinen Lippen hervor – wie ein Wasserfall, der dort über viele Jahre, in Tausenden Stunden schwärzester Verzweiflung, angestaut worden war.
Sein Name ist Geronimo de Aguilar, so viel kann ich seinem rasenden Gestammel entnehmen. Er stammt aus Ronda und ist ein Minoritenmönch, der im Jahr 1511 auf einer Brigg nach Jamaika unterwegs war. Doch sie erlitten Schiffbruch und Geronimo wurde zusammen mit einem Dutzend Leidensgefährten an die Küste von Yucatan gespült. Damals war er dreiundzwanzig Jahre alt. Tagelang waren sie im Meer getrieben, an einige Planken geklammert. So konnten die Indianer sie leicht überwältigen und in eine Siedlung im Landesinneren verschleppen. Sie wurden in Käfige gesperrt und bekamen reichlich zu essen und zu trinken. Die Indianer behandelten sie zuvorkommend, als ob sie hochgestellte Persönlichkeiten oder sogar Götter wären. Doch eine Woche, nachdem sie in die Käfige gesteckt worden waren, legten die Indianer in jener Siedlung ihren prächtigsten Federschmuck an. Sie schlugen auf ihre Trommeln, pfiffen auf ihren Knochenflöten, und unter diesen Klängen wurden die Schiffbrüchigen aus den Käfigen gezerrt und zu einer Pyramide in der Mitte des Hüttendorfs geführt.
An dieser Stelle unterbricht sich Geronimo. Er schwitzt, sein Mund zuckt. »Carlito«, flüstert er, »du bist noch so jung! Wirst du ertragen, was ich dir jetzt erzählen muss?«
Ich schlucke krampfhaft und zwinge mich zu nicken. Ich bin keineswegs sicher, ob ich es ertragen werde. Aber ich muss wissen, was dort passiert ist, bei der Pyramide, unter dem Wummern der Trommeln – ich muss alles in Erfahrung bringen, damit ich Cortés davon berichten kann. Und vielleicht mehr noch, um ihm und mir selbst zu beweisen, dass ich die Geheimnisse eines ganz und gar fremden Mannes zu ergründen vermag.
»Sprich weiter, Bruder!«, sage ich.
Glücklicherweise hat er mittlerweile meinen Kopf losgelassen und hält stattdessen meine Hände umfasst. Seine Hände sind schwielig und sein Griff ist eisenhart.
Die Indianer, fährt er fort, zerrten alle Gefangenen zum Dach ihrer Pyramide hinauf. Dort mussten sie sich nebeneinander aufstellen, und ein Orakelpriester warf Kakaobohnen und Bambusstangen auf ein aufgeschlagenes Buch, dessen Blätter mit bunten Bildern und Schriftzeichen bedeckt waren. Durch das Orakel sprach anscheinend einer der Teufelsgötzen zu den Indianern, und er befahl, dass acht der zwölf Gefangenen geopfert werden sollten. Geronimo verstand kein Wort von dem, was die Indianer miteinander besprachen. Aber er sah, wie der Orakelpriester die rechte Hand spreizte und von der linken nur drei Finger: acht.
Er erlitt tausend Qualen der Todesangst, während die Priester endlos beratschlagten, wie der Orakelspruch zu erfüllen sei. Auf dem Pyramidendach stehend musste er schließlich mitansehen, wie seine Leidensgefährten einer nach dem anderen auf den Opferstein gestreckt wurden. Der Teufelspriester stach sie mit einer Pfeilspitze, die mit einem betäubenden Gift bestrichen war. Daraufhin ließen sie alles mit sich geschehen und gaben höchstens noch ein dumpfes Stöhnen von sich. Mit dem schwarzen, gezackten Steindolch schnitt der Priester ihnen das Herz aus der Brust. Das Blut quoll hervor und er salbte sich damit an Händen und Armen. Die anderen Gefangenen aber, die noch nicht an der Reihe waren, bekamen kein Gift und mussten folglich bei vollem Bewusstsein alles mitansehen.
Das Herz wurde in eine steinerne Schale gelegt und mit brennendem Harz übergossen, der wie Weihrauch roch. Mit Hacke und Säge hieben und schnitten währenddessen weitere Priester den Kopf und die Gliedmaßen vom Rumpf herunter. Arme und Beine wurden in ein Kohlebecken gelegt und wie Wildbret gebraten. Der Gestank nach verkohltem Menschenfleisch war entsetzlich, aber die Gesichter und Gebärden der Indianer verrieten, dass sie sich auf das grausige Mahl freuten.
Die kannibalische Zeremonie zog sich stundenlang hin, erzählt mir Geronimo. Die Priester schrien Beschwörungen und andere Priester antworteten mit dumpfen Chorgesängen. Zwischendurch wurde auch die Menge mit einbezogen, die sich auf dem Platz unter der Pyramide versammelt hatte: Sie tanzten und sangen dort unten, lachten oder heulten, je nachdem, was die Priester oben auf dem Heiligtum gerade verkündeten.
Währenddessen wummerten unablässig die Trommeln, die Knochenflöten schrillten und stöhnten, und längst wünschte sich Geronimo nur noch, dass es endlich zu Ende wäre. Dass die Teufelsschergen auch ihn packen und auf den Opferstein niederdrücken würden. Dass sie ihm die vergiftete Pfeilspitze in die Armbeuge oder in die Zunge stechen würden – Hauptsache, es war endlich vorbei!
Doch als dann wirklich einer der Götzenpriester kam und ihn am Arm ergriff, da schrie er auf und riss sich los. Es war ein Irrtum! Er wollte überhaupt nicht, dass es zu Ende ging! Lieber in Todesangst noch Stunde um Stunde auf dieser Höllenpyramide stehen, durchfuhr es ihn, oder wenigstens noch ein paar Minuten – alles lieber als jetzt schon, in diesem Augenblick, sterben müssen!
Der Teufelspriester lachte ihm ins Gesicht mit seinem Mund voller Raubkatzenzähne. Er fauchte irgendetwas, und Geronimo verstand kein Wort, denn damals konnte er noch kein Chontal. Aber schließlich begriff er, dass der Indianer irgendwohin deutete, und als er in die gewiesene Richtung schaute, gaben seine Beine urplötzlich unter ihm nach.
»Vor Entsetzen, vor Erleichterung, Carlito. Vor Ekel, vor Reue, vor Dankbarkeit!«, stammelt Geronimo. »Kannst du das verstehen?«
Ich nicke, obwohl ich es nicht verstanden habe, jedenfalls noch nicht ganz. »Du wurdest nicht geopfert«, sage ich, denn das zumindest steht ja fest.
Er schüttelt den Kopf. Seine Augen sind weit geöffnet, doch sein Blick geht durch mich hindurch.
Der Priester deutete auf eine Pyramide aus Köpfen, die sie auf der Steinpyramide aufgeschichtet hatten. Ohne richtig zu bemerken, was er da machte, hatte Geronimo sofort zu zählen begonnen – sechs, sieben, acht! Es waren acht Köpfe, die sie abgehackt und sorgsam übereinandergestapelt hatten – vier, dann drei, obendrauf einen einzelnen Kopf, der Geronimo in starrem Entsetzen ansah.