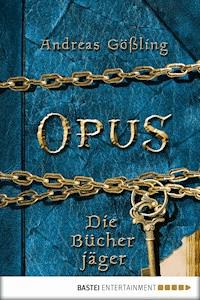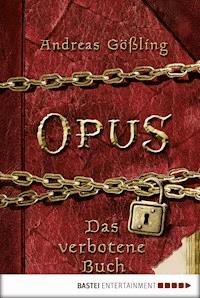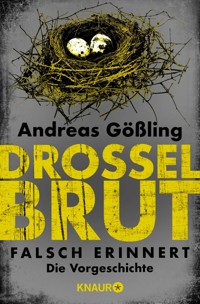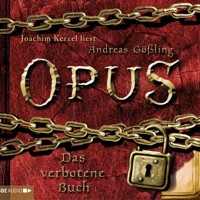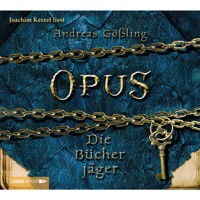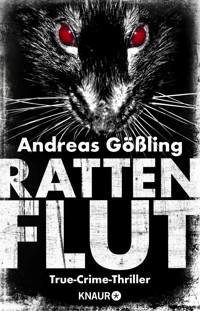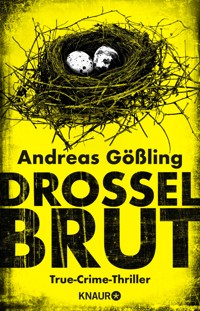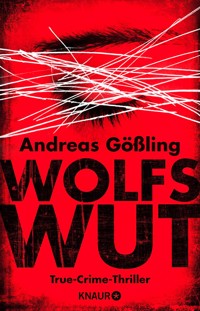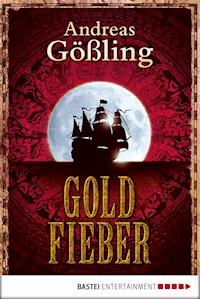7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Super Natural - Secret Agency
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
James Bond meets Fantasy
Er ist halb Mensch, halb Geist. Er ist ein magischer Geheimagent. Und seine Mission ist lebensgefährlich. Denn nur er kann vermitteln – zwischen unserer Welt und legendären fantastischen Reichen.
Irland: Der 15-jährige Arvid kann es nicht fassen, als ihm auf einer Klassenreise nach Irland mitgeteilt wird, dass er in Wahrheit ein Halbgeist ist. Und nicht nur das: Er ist dazu auserkoren, als Geheimagent für die »Supernatural Secret Agency« zu arbeiten! Sein Auftrag: den Zorn uralter Reiche zu beschwichtigen, die sich von den Menschen zu Unrecht vergessen fühlen. Erster Einsatzort: das Elfenreich. Arvid ist schockiert und fasziniert zugleich. Denn schon bald überbringt ihm eine äußerst verführerische Elfe die wahnwitzigen Forderungen ihres Volks.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 508
Ähnliche
Der Autor
Autorenfoto: © privat
Andreas Gößling, geboren 1958, lebt und arbeitet als freier Autor in Coburg. Der promovierte Literatur- und Kommunikationswissenschaftler beschäftigt sich seit vielen Jahren mit fantastischen, mythen- und kulturgeschichtlichen Themen, insbesondere mit der alten Maya-Kultur, mit Drachenmythen und Schöpfungslegenden. Neben Romanen für jugendliche und erwachsene Leser hat er auch zahlreiche Sachbücher veröffentlicht.
Von Andreas Gößling ist bei cbt bereits erschienen:
Die Dämonenpforte (30491)
SuperNatural Secret Agency –
Die Rache der Vampirgeister (30699)
SuperNatural Secret Agency –
Die Zwergenverschwörung (30781)
Andreas Gößling
SUPERNATURAL SECRETAGENCY
Geheimagent auf Elfenjagd
cbtist der Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House
1. Auflage
Originalausgabe März 2012
Gesetzt nach den Regeln der Rechtschreibreform
© 2012 cbt/cbj Verlag, München
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Frank Griesheimer
Umschlaggestaltung: init.büro für gestaltung, Bielefeld
SK · Herstellung: AnG
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-05760-2
www.cbt-jugendbuch.de
Kapitel I
Brianna
eins
»Pass auf, Felisa«, sage ich, »da ist es gefährlich.«
Ich will nach ihrer Hand greifen, um sie von dem wacklig aussehenden Mauersims wegzuziehen. Aber Felisa macht blitzschnell einen Schritt zur Seite.
»Gefährlich ist höchstens dein Blick, Alien«, sagt sie und starrt mich an.
»Gruselig, wie seine Augen glühen«, pflichtet ihr Jessica bei. »Als ob er nicht ganz richtig verdrahtet wäre.«
»Arvid«, mischt sich auch noch Lena ein, »was ist das überhaupt für ein Name?«
»Na, eben ein Alien-Name«, sagt Felisa und pustet sich eine schwarze Haarsträhne vom linken Auge weg.
»Oder ganz einfach mein Name?«, schlage ich vor.
Jetzt starren mich alle drei an. Abweisend, aber gleichzeitig eine Spur ängstlich, so als hätte ich sie irgendwie bedroht.
»Ist ja schon gut«, sage ich. »Ich dachte nur…«
Ich beiße mir auf die Unterlippe. Schließlich kann ich Felisa nicht gut erzählen, was ich gerade erst vor ein paar Augenblicken vor mir gesehen habe: wie sie rückwärts über diese Mauerüberreste stolpert. Wie sie den steilen Hang runterkollert und ein ganzes Stück weiter unten in einer Art Felsrinne liegen bleibt. Sie würde mich sonst nur für noch abgedrehter halten als sowieso schon. Und natürlich würde sie mir nicht glauben, dass mir so etwas schon mehr als einmal passiert ist: Wie in einem alten Schwarz-Weiß-Film sehe ich schattenhaft irgendeine Szene vor mir, die sich kurz darauf in Wirklichkeit mehr oder weniger genau so abspielt.
Gerade in diesem Moment macht Felisa einen halben Schritt nach hinten, stolpert und verliert das Gleichgewicht. Ihre Augen werden groß, sie fuchtelt mit den Armen und fällt rückwärts über den Mauersims.
Mit einem Sprung bin ich bei den Überresten des uralten Gemäuers, das mir gerade so bis zu den Knien reicht. Da unten liegt Felisa, ganz genau wie ich es eben vorausgesehen habe.
Der Wind pfeift um Felszacken und Mauerbrocken hier oben auf dem Mount Brandon. Frau Krofinger, unsere Lehrerin, ist mit dem Rest der Klasse längst in der Ruine des altirischen Sonnengotttempels verschwunden. Von links her, tief unter uns, schickt der Atlantik eine schaumgekrönte Riesenwelle nach der anderen gegen das Steilufer an der Westküste Irlands. Noch aus dieser Höhe ist das Donnern der Wellen zu hören, wenn sie gegen die Felswand krachen und zu Milliarden Tropfen zerplatzen. Möwen kreischen und schießen im Sturzflug auf das Meer hinab.
»Bleibt hier«, sage ich zu Jessica und Lena, »ich klettere runter und helfe ihr.«
Sie schauen sich um, wechseln dann hilflose Blicke. Anscheinend ist Jessica so wenig wie Lena versessen darauf, den rutschigen Hang hinunterzukraxeln, um ihrer besten Freundin wieder auf die Füße zu helfen.
Schließlich zuckt Jessica mit den Schultern. »Aber schnell«, sagt sie zu mir in einem Tonfall, als ob ich einer der Gärtner bei ihr zu Hause wäre. Oder sogar eines der quiekenden Rassehündchen, die ihre Mutter manchmal mitbringt, wenn sie Jessica von der Schule abholt. In einem Riesen-SUV, der bestimmt dreimal so viel gekostet hat, wie meine Mutter das ganze Jahr über verdient.
Irgendwie haben sie schon recht, denke ich. Für Felisa und ihre Freundinnen bin ich ein Alien. Nicht nur weil um mich herum manchmal spukhafte Dinge passieren. Und nicht nur, weil ich so dünn und blass bin, mit Haaren wie Flachs und grünen Augen, die wirklich ein bisschen wie Kontrolllampen bei einem Roboter aussehen. Sondern vielleicht auch deshalb, weil ich mit meiner Mutter in einer ziemlich armseligen Mietwohnung lebe– statt in einer Villa mit Park oder zumindest in einem gediegenen Einfamilienhaus wie fast alle anderen in unserer Klasse. Der 9c am Wohlthat-Gymnasium in Berlin Steglitz. In unserem Stadtteil gibt es viele »gute« und ein paar »weniger gute Ecken«, und der Teil der Pfalzgrafenstraße, in dem ich wohne, gehört eindeutig zu den weniger guten. Jedenfalls in den Augen von Jessica & Co.
Während mir diese Gedanken durch den Kopf gehen, klettere ich schon die staubige Böschung hinunter. Im nächsten Moment kauere ich neben Felisa. Sie sieht mich mit einem benommenen Lächeln an, als versuchte sie, sich zu erinnern, woher sie mich kennt.
»Ich bin’s– Arvid«, sage ich.
Sie hört schlagartig auf zu lächeln.
»Der Alien aus der 9c«, füge ich hinzu und mustere besorgt ihren linken Fuß. Er sieht irgendwie verdreht aus, und als ich mit zwei Fingern ganz sachte ihren Knöchel berühre, stöhnt Felisa auf.
»Lass das, Idiot«, presst sie hervor. »Du tust mir weh, verdammt noch mal!«
Ich hole tief Luft. Ich bin in dich verliebt, Felisa, denke ich, aber heißt das, dass du mich für den Rest meines Lebens beschimpfen darfst?
Einen Augenblick lang grüble ich an dieser Frage herum, dann lasse ich es wieder sein. Schließlich weiß ich nicht einmal, wie ich Felisa auf ihre Füße hieven soll, ohne dass sie gleich aufs Neue loszetert.
Suchend sehe ich mich um– weit und breit kein Ast, kein Stock, auf den sie sich beim Aufstehen stützen könnte. Ich verdrehe mir halb den Nacken und schaue zu Jessica und Lena hinauf, die in erstarrter Haltung über die Mauer gebeugt sind. Auf diesem seltsamen Berg wächst kein Baum, nicht mal ein einigermaßen solider Busch. Nur staubgraues Gras, das einen zähen Eindruck macht, und halb tote Farnwedel.
Bei allen altirischen Zauberpriestern– wie soll ich Felisa nur den Hang wieder hinaufbugsieren? Wahrscheinlich würde sie lieber für den Rest des Tages auf dem unbequemen Steinboden liegen bleiben, als freiwillig einen Arm um meine Schultern zu legen.
Wieder schaue ich mich nach links und rechts um– und gerade da taucht der Miniatur-Ziegenbock auf. Mit all dem peinlichen Drum und Dran, wie jedes Mal, wenn er plötzlich vor mir aus dem Boden wächst. Mit gedämpftem Donner und winzigen Blitzen wie beim Tischfeuerwerk. Und mit dem grässlichen Gestank, der jedes Mal noch Stunden später in der Luft schwebt, wenn der verdammte Bonsai-Bock bei mir zu Hause wieder mal aufgekreuzt war.
Dwinte, so heißt er– keine Ahnung, woher ich das weiß. Keine Ahnung, was es mit dem Mistvieh überhaupt auf sich hat– warum es seit mehr als drei Jahren hinter mir her ist. Warum ich nicht einfach ein Junge wie alle anderen sein kann. Timm und Julian kriegen ja schließlich auch keine verwackelten Schwarz-Weiß-Visionen. Im Gegensatz zu mir können sie auch nicht ab und zu die Gedanken von anderen Leuten lesen. Um sie herum fangen niemals irgendwelche Sachen an, plötzlich in der Luft herumzuschweben– ein MP3-Player zum Beispiel oder ein tibetisches Zweihandschwert. Und schon gar nicht werden Julian oder Timm oder all die anderen Jungen aus meiner Klasse seit ihrem zwölften Geburtstag von einem stinkenden Ziegenbock in Zwergpudelgröße heimgesucht.
Felisa hat sich im Liegen halb aufgerichtet und starrt mit verschleierten Augen zu der Stelle weiter unten in der Felsrinne, an der Dwinte aus dem Boden gewachsen ist. Der Donner ist verhallt, die Blitze sind verblasst. Nur der strenge Geruch hängt noch in der Luft.
»Was… was ist…?«, murmelt sie im Tonfall einer Schlafwandlerin.
Rasch werfe ich wieder einen Blick zu Jessica und Lena. Sie schauen immer noch wie erstarrt zu Felisa und mir hinunter, als dürften sie uns keinen Moment aus den Augen lassen. Dabei kann ihnen das Spektakel, mit dem Dwinte erschienen ist, eigentlich nicht entgangen sein. So wenig wie ihrer Freundin Felisa, die mich plötzlich beim Arm packt und sich aufzurappeln versucht.
»Ja, hilf mir doch mal, herrje!«, stößt sie hervor.
Sie stützt sich auf mich, lehnt sich gegen mich, während wir beide uns gleichzeitig aufrichten. Eng an mich gedrückt, bleibt sie einen Moment lang stehen. Sie ist außer Atem, ich dagegen vergesse vor Überraschung beinahe, Luft zu holen. Habe ich mir das nicht immer gewünscht? Erträumt und ausgemalt? Felisa in meinen Armen, so nah bei mir, dass ich ihren Atem an meinem Hals spüre, ihr Haar mich an der Wange kitzelt.
Verstohlen atme ich ihren Duft ein. Mein Herz schlägt dreimal so schnell wie gewöhnlich, mindestens. Bis ich merke, dass sie nur Augen für Dwinte hat. Auf meinen rechten Arm gestützt, hinkt sie die Felsrinne entlang, zieht mich mit sich, auf den Miniatur-Ziegenbock zu.
»Keine Ahnung…«, fange ich an und breche gleich wieder ab.
Felisa achtet nicht auf mich. Mir ist nicht klar, ob sie Dwinte wirklich sieht, ob er überhaupt für irgendwen außer mir sichtbar ist. Einerseits hoffe ich natürlich, dass weder Felisa noch ihre beiden Freundinnen oben auf der Bergkuppe den kleinen, schmutzig weißen Ziegenbock mit seinem lächerlichen Bärtchen und den kunstvoll in sich verdrehten Hörnern wahrnehmen können. Aber andererseits: Falls wirklich nur ich Dwinte sehen kann– heißt das nicht letzten Endes, dass ich verrückt bin? Dass ich zumindest ab und zu mal Wahnvorstellungen habe?
Felisa jedenfalls humpelt geradewegs auf Dwinte zu. Der steht regungslos da, schaut schläfrig in unsere Richtung und scheint sich nicht besonders für uns zu interessieren. Manchmal scharrt er mit seinem linken Vorderfuß irgendwelche seltsamen Zeichen in den Boden, bevor er wieder verschwindet. Manchmal schmeißt er auch ein paar Blumentöpfe oder sonst etwas um, und dann wieder schaut er mich nur so wie heute an– oder eigentlich eher an mir vorbei– und verschwindet kurz darauf wieder.
So macht er es auch diesmal: Noch bevor die eifrig hinkende Felisa mit mir als lebendigem Krückstock bei ihm angekommen ist, beginnt Dwinte wieder zu verblassen. Ein paar Herzschläge lang schwebt sein Bild noch über dem kahlen Steinboden, löst sich langsam auf und ist weg. Nur der herbe Bocksgestank hängt noch in der Luft. Wo Dwinte gestanden hat, ist jetzt überhaupt nichts Auffälliges mehr zu sehen.
Außer einem kreisrunden Loch im Felsboden, gerade so groß, dass man einen Fuß hineinsetzen kann.
zwei
Felisa ist stehen geblieben und schaut benommen um sich, so als würde sie sich fragen, wie sie eigentlich an diesen Ort geraten ist. Aber ich ziehe sie behutsam weiter– bevor sie richtig zu sich gekommen ist, muss die Operation über die Bühne gegangen sein.
Die Operation Wundersame Fußheilung– auf einmal ist mir ganz und gar klar, was ich jetzt machen muss. Warum Dwinte gerade jetzt und hier aufgetaucht ist. Er hat mir eine Botschaft gebracht, eine Lösung für ein Problem, das ich allein nicht hätte lösen können. Oder jedenfalls nicht so leicht. Also bugsiere ich Felisa weiter den Weg entlang. Dabei achte ich darauf, dass sie mit ihrem verletzten linken Fuß genau in der kreisrunden Mulde landen muss, in der eben noch Dwinte gestanden hat. Felisa stützt sich jetzt schwer auf meinen Arm. Sie atmet gepresst, und sie seufzt jedes Mal leise auf, wenn sie mit ihrem verstauchten Fuß auf dem Boden aufkommt. Schon fängt sie an, sich gegen mich zu sträuben. Gleich wird sie stehen bleiben, denke ich, einen Schritt vor der Mulde– aber irgendwie schaffe ich es, sie noch ein wenig weiterzuziehen.
Ihr linker Fuß hebt sich vom Boden, senkt sich aufs Neue und kommt genau in dem Loch zu stehen, aus dem Dwinte mit Blitz und Donner aufgetaucht war. Blasse Lichtzungen zucken auch um ihren Fuß herum auf, aber außer mir scheint das wieder mal niemand zu bemerken.
Abrupt bleibt Felisa stehen und schaut um sich– mit großen Augen, als ob sie gerade aus dem Tiefschlaf gerissen worden wäre. »Was soll… was willst du…?«, murmelt sie und starrt mich einen Moment lang verständnislos an. Sie lässt meinen Arm los und schaut an sich herab. Sie schüttelt den Kopf, und gerade da ruft Jessica zu ihr herunter:
»Feli… alles okay mit dir?«
Felisa schaut ruckartig nach oben zu dem Mauersims mit ihren beiden Freundinnen dahinter. »Na klar, was soll denn sein?«, antwortet sie in munterem Tonfall und fängt an, den Hang wieder hochzuklettern.
Für mich hat sie keinen Blick mehr. Geschweige denn ein Lächeln oder ein Dankeschön. Das ist nicht mal böse Absicht, das spüre ich genau.
Sie hat ganz einfach vergessen, dass ich ihr geholfen habe. Dass es mich, Arvid Warner, überhaupt gibt. Den Jungen mit dem Alien-Aussehen, den zweifelhaften Talenten und dem stinkenden Donnerbock.
Es tut weh, so behandelt zu werden von dem Mädchen, das man liebt. Noch vor ein paar Monaten hatte ich geglaubt, dass Felisa mich ganz okay findet– bis diese blöde Sache mit dem MP3-Player passiert ist. Warum musste ich ihr auch unbedingt vorführen, dass ich manchmal Sachen zum Schweben bringen kann? Na ja, um sie zu beeindrucken, natürlich– aber Felisa war damals überhaupt nicht beeindruckt. Sie hat behauptet, ich hätte ihr irgendwelches Zeug in ihren Softdrink gemischt, damit sie Halluzinationen bekommt. Sie ist schreiend weggerannt und hat mich danach nur noch Alien genannt. Wenn sie überhaupt noch mit mir geredet hat.
Ich schaue ihr hinterher, wie sie schlank und flink an der steilen Felswand hochklettert. Wie ihr langes schwarzes Haar im Wind hinter ihr herweht. Wie Jessica und Lena sie oben mit Fragen und Kichern begrüßen und Felisa irgendetwas antwortet.
Da höre ich aber schon kaum mehr hin. Mein Blick ist noch einmal auf das runde Loch im Boden gefallen. Es hat die Form eines Trichters und reicht anscheinend tief in den Fels hinein. Ich knie mich neben das Loch und beuge mich tief hinab, um in den Steintrichter hineinzuspähen. Kann es sein, dass sich Dwinte durch diesen winzig schmalen Tunnel irgendwie an die Oberfläche gezwängt hat und auf dem gleichen Weg wieder verschwunden ist?
Vollkommen unmöglich, sage ich mir. Jedenfalls dann, wenn es sich um einen wirklichen Ziegenbock handelt und nicht bloß um eine Spukerscheinung. Und die wiederum braucht keine Löcher im Stein, um sich zu materialisieren und wieder aufzulösen.
Ich nehme mir vor, bei der nächsten Gelegenheit Dwinte anzufassen– ihm ins Fell oder an die Hörner zu greifen. Dann werden wir ja sehen, ob er ein wirkliches Mistvieh oder bloß ein Spukbock ist! Mit diesem Gedanken richte ich mich wieder auf.
Irgendwo hinter mir höre ich ein leises, sehr helles Sirren. Ich drehe mich um, halb darauf gefasst, dass Dwinte zurückgekehrt ist. Aber anstelle des Ziegenbocks erblicke ich gleich drei Gestalten, die mindestens genauso sonderbar aussehen.
Wenn auch– im Gegensatz zu Dwinte– atemberaubend schön.
Es sind drei Mädchen oder vielleicht auch junge Frauen. Die mittlere zumindest ist bestimmt nicht viel älter als ich. Ein grünliches Leuchten geht von ihnen aus und ihre langen silberhellen Haare glimmen und funkeln wie Sternenlicht. Auf dem schmalen Felspfad stehen sie nebeneinander und schauen alle drei zu mir her. Oder nein, sie stehen nicht– sie schweben über dem Boden, jetzt sehe ich es ganz genau. Obwohl sie mindestens dreißig Meter von mir entfernt sind.
Entfernungen scheinen plötzlich keine Rolle mehr zu spielen, weder im Raum noch in der Zeit. Dieser Gedanke zuckt mir durch den Kopf, und er kommt mir ganz selbstverständlich vor, obwohl ich ihn gar nicht wirklich begreife.
Wer sind diese drei? Spukerscheinungen? Geister? Aus welcher Welt? Und warum fühle ich auf einmal eine solche Sehnsucht, dass es mich innerlich fast zerreißt? Zwischen Menschenwelt und Geisterwelt. Zwischen Felisa und dem Mädchen da drüben, mit den langen hellen Haaren, aus denen Sternenfunken sprühen.
Die beiden jungen Frauen neben ihr schauen so zornig, als ob ich ihnen irgendetwas ganz Übles angetan hätte. Das Mädchen aber lächelt und macht mir Zeichen, dass ich zu ihnen kommen soll. Dabei macht sie ihren Mund auf und zu und da erklingt wieder jenes helle Sirren.
Sie spricht mit mir, denke ich– sie ruft mich!
Ohne es richtig mitgekriegt zu haben, bin ich schon auf dem Weg zu ihr.
Ich laufe die Felsrinne wieder hoch, an der Stelle vorbei, an der ich Felisa auf die Füße gehievt habe– Felisa, die mir auf einmal ganz fremd vorkommt. Fremd und fern.
Da fällt mir ein, was Frau Krofinger gesagt hat: Der Mount Brandon ist angeblich ein Fairy Hill…
drei
Den halben Vormittag sind wir auf kahlen, staubigen Pfaden bis zum Gipfel hochgeklettert, um die Überreste des uralten Sonnengotttempels anzuschauen. Aber von dem habe ich bisher nicht viel mehr zu sehen bekommen als ein paar wacklig aussehende Mauern.
»Bleib stehen!«, fährt mich eine der beiden jungen Frauen an. »Wage es nicht, auch nur einen Schritt weiterzugehen!«
Folgsam bleibe ich stehen, so nah vor dem Mädchen, dass wir einander mit ausgestreckten Händen gerade so berühren könnten. Ich will das Mädchen anschauen, aber die Frau zu ihrer Linken zwingt mich irgendwie, einzig sie anzusehen. Ihre Augen sind wie Gucklöcher in eine andere Welt. Darin sehe ich Bäume, die in Flammen stehen, lodernde Büsche und Farne. Vögel, die brennend vom Himmel fallen, Hasen und Rehe, die sich auf dem Boden wälzen, während Flammen aus ihrem Fell schlagen.
Ich will das alles nicht sehen. Es flößt mir Grauen ein, eine beklemmende Angst, sodass ich kaum mehr Luft holen kann. Aber die Frau hat meinen Blick gebannt und so muss ich unverwandt in ihre Augen sehen.
Sie dreht ihren Kopf ein wenig nach links, zum Sonnengotttempel hinauf, und da wird mir plötzlich klar, was sich in ihren Augen spiegelt. Es ist genau dieselbe Stelle am Hang des Mount Brandon, an der wir auch jetzt stehen. Nur muss das, was ich in ihren Augen erblicke, in Wirklichkeit vor langer Zeit passiert sein. Auf dem Berggipfel, wo jetzt nur noch die Tempelruine steht, befand sich damals ein gewaltiger Rundbau mit bunt bemalten Reliefs. Dichter Wald bedeckte den Berghang, der heute fast nur noch aus kahlem Fels besteht. Dies alles wurde damals ein Raub der Flammen, und ob ich will oder nicht, ich muss die schreckliche Verwüstung weiter mitansehen. Und den Schmerz mitfühlen, das Grauen und den Zorn, die im Innern der Frau wüten wie ein zweiter verheerender Brand.
»Bitte lass ihn, Graínne«, sagt das Mädchen, und da endlich gelingt es mir, meinen Blick von der Frau mit den schrecklichen Augen loszureißen.
Ich schaue das Mädchen an. Sie lächelt immer noch und mit einer bittenden Geste berührt sie den Unterarm der Frau zu ihrer Linken.
»Er gehört zu uns, Graínne«, sagt sie, »das spürst du doch auch.«
Von ihren Augen geht ein grünes Leuchten aus. Schauer aus Sternenlichtfunken stieben aus ihrem Haar. Ihre Stimme klingt, wie wenn Wind über die Saiten einer Harfe streicht– jedenfalls stelle ich mir das so vor. Ich bin vollkommen durcheinander. Ich will dem Mädchen danken, aber während ich noch nach Worten suche, beginnt die zweite junge Frau zu sprechen.
»Nein, Brianna, er muss weg«, sagt sie und schaut dabei nur mich an.
Ihre Stimme ist hart und kalt wie Eis. Auch von ihr geht eine bezwingende Macht aus. Wie ich mich auch dagegen sträube, ich muss meinen Blick von dem Mädchen lösen und diesmal der Frau zu ihrer Rechten in die Augen sehen. Ein Frösteln überläuft mich und eine tödliche Kälte kriecht in mich herein. In ihre Augen zu sehen, ist noch schrecklicher als bei der anderen jungen Frau.
Wieder sehe ich den Wald, der irgendwann vor Jahrtausenden hier den Berg bedeckt haben muss. Erneut erblicke ich auch den Tempel von Sonnengott Lug auf dem Gipfel, doch in den Augen dieser Frau ist das alles schwarz und tot. Die Bäume sind nur noch rußige Gerippe, der Tempel ist halb in sich zusammengesackt. Die bunten Steinreliefs sind so schwarz wie der Felsboden, wie der rußverhangene Himmel– wie alles, was diese Augen sehen. Nichts regt sich dort mehr, kein Lebewesen, nicht mal ein Windhauch. Nicht einmal eine Flamme oder ein Qualmfaden steigt noch aus den Trümmern auf.
»Er muss verschwinden«, sagt die zweite junge Frau mit tödlich kalter Stimme. »Verstehst du nicht, Brianna, er ist gefährlich wie alle von seiner Art– ein lebendiger Mensch!« Sie spuckt diese Worte geradezu aus, wie einen ekelhaften Brocken, der ihr irgendwie zwischen die Zähne geraten ist.
»Lass ihn!«, ruft das Mädchen– Brianna, so hat die Frau mit den Rußaugen sie genannt. »Er ist einer von uns, Niamh!«
»Ein Lebendiger ist er! Weg mit ihm!« Niamh hebt drohend eine Hand. Ihre Augen sind nur noch schwarze Schlitze.
Wie gelähmt stehe ich vor ihnen. Wie kommt Brianna darauf, dass ich zu ihnen gehöre? Wer sind sie überhaupt? Fairies? Elfen? Ja, was denn sonst! Ich bin außerstande, einen klaren Gedanken zu fassen. Irgendetwas zu sagen oder zu tun. Innerlich entzweigerissen wie niemals vorher in meinem Leben. Und gleichzeitig– entzwei wie eigentlich immer schon.
Niamh öffnet ihren Mund und grauer Eisnebel schießt aus ihrem Rachen hervor.
»Schnell– geh weg von hier!«, ruft mir Brianna zu. Ihre Stimme klingt jetzt so schrill wie Saiten, die gleich mit einem grässlichen Knall zerreißen werden.
Ich hebe meinen Arm, will sie zum Abschied zumindest mit meiner Hand berühren. Da spüre ich auf einmal einen Sog– er geht von Niamh aus und er zieht und zerrt an mir wie mit Krallen aus Frost und Eis. Gleichzeitig erklingt eine Melodie, lockend, wehmütig, aber auch unheimlich anzuhören.
Rasch schaue ich noch einmal in Briannas Augen. Das warme grüne Leuchten darin kommt von dem frisch belaubten Wald, der sich in ihren Augen spiegelt. Die Melodie erklingt irgendwo tief in diesem Wald voll lockender Farben und Düfte.
»Rette dich!«, ruft Brianna. »Wir werden uns wiedersehen!«
Mit aller Kraft werfe ich mich nach hinten, reiße mich aus dem eiskalten Sog heraus, der von Niamh ausgeht, der Frau mit den Totenwaldaugen. Vor mir zerstieben die drei Fairies in einem Funkenwirbel und die wunderschöne Melodie verhallt.
Benommen schaue ich mich um. Ich liege rücklings am Boden, in meinem Ellbogen pocht ein leiser Schmerz. Doch tausendmal stärker ist der Schmerz, den ich tief in mir spüre. Und der sich genau wie Heimweh anfühlt.
Brianna… »Er gehört zu uns!«, hat sie gesagt. Aber wie kommt sie darauf? Ich bin doch kein Elf, überlege ich– ich gehöre in die Welt der Menschen, wie es mir ja gerade eben auch diese Niamh voller Abscheu entgegengeschleudert hat. »Ein lebendiger Mensch!« Und trotzdem spüre ich, dass Brianna recht hat. Dass ich irgendwie auch zu ihnen gehöre, in die Welt der Geister– mindestens genauso sehr wie in die Menschenwelt.
Auch wenn das ja überhaupt nicht sein kann. Anscheinend habe ich wirklich ab und zu Wahnvorstellungen und gerade eben war der Irre in mir wieder mal am Steuerpult.
Noch während ich mich aufrappele, höre ich Schritte. Sie klingen kein bisschen geisterhaft, aber für den Moment habe ich von stinkenden Spukböcken und gruseligen Fairies auch erst mal genug.
Nur ein paar Meter hinter der Stelle, wo eben noch Graínne, Brianna und Niamh vor mir gestanden haben, macht der schmale Felsweg eine Biegung um den Berggipfel herum. Und während ich mir den Staub von Jeans und Shirt klopfe, kommen aus dieser Kurve ein Mann und eine Frau hervormarschiert.
Die Frau ist ungefähr im Alter meiner Mutter, schätze ich, Mitte dreißig. Der Mann hat schon ein paar Jahre mehr hinter sich– vielleicht ist er etwa so alt, wie mein Vater heute wäre.
Mein Vater, der vor fünfzehneinhalb Jahren bei einem Autounfall gestorben ist, sechs Wochen vor meiner Geburt. Gerwin Warner, dem ich meinen seltsamen Vornamen und mein Alien-Aussehen verdanke. Auf dem einzigen Foto, das meine Mutter von ihm aufbewahrt hat, sieht er haargenau so aus wie ich. So schlaksig und lang, mit mondbleichem Gesicht, flachsfarbenem Haar und Augen, die so rund und leuchtend grün sind wie die Kontrolllampen bei einem Roboter.
vier
»Wir haben genau gesehen, was du da eben gemacht hast«, sagt der Mann, als die beiden vor mir stehen.
Er sieht mich streng an, aber irgendwie so, als ob er diese Strenge gleichzeitig nur schauspielern würde. Auch seine Kleidung kommt mir nicht ganz echt vor. Er trägt einen grauen Anzug, der ihm viel zu weit ist, darunter ein grellweißes Hemd mit grauer Krawatte. Seine Haare sind kurz geschnitten und wie mit dem Lineal gescheitelt, wodurch er noch altmodischer aussieht. Aber sein Gesichtsausdruck ist wachsam und seine Bewegungen wirken kraftvoll und vollkommen kontrolliert.
Während ich noch überlege, was ich antworten soll, mischt sich die Frau ein.
»Woher hast du das mit dem Felsloch gewusst?«, fragt sie und verzieht ihr Gesicht zu einem anerkennenden Lächeln.
Die Frau trägt ein kariertes Kleid und einen genauso gemusterten Schal, der auf komplizierte Weise mit ihrer Frisur verknotet ist. Beide sprechen akzentfreies Deutsch, sind also bestimmt keine Iren. Aber was haben sie auf diesem staubigen Berg an der irischen Küste zu suchen? Es sind weder Touristen noch Lehrer, die mit ihrer Schulklasse den Tempel besichtigen, das habe ich sofort erkannt. Eher schon sehen sie aus, als wären sie eben aus einer Zeitmaschine gestiegen, die sie aus muffigsten Nachkriegszeiten hierher katapultiert hat. Ära Elvis Presley, mindestens. Was allerdings erst recht keinen Sinn ergibt.
Ich zucke mit den Schultern. Immer noch fühle ich mich ziemlich durcheinander.
»Keine Ahnung, wovon Sie reden«, sage ich. »Aber ich muss jetzt sowieso gehen– die anderen suchen mich bestimmt schon.«
Ich deute mit dem Kopf zum Berggipfel hoch. Dort sind allerdings nur der berüchtigte Mauersims und dahinter ein paar Trümmerbrocken von der Tempelruine zu sehen.
Vielleicht sind Frau Krofinger und die gesamte 9c längst wieder den Berg hinabgewandert, unten im Dorf in den Bus gestiegen und auf der Rückfahrt nach Dublin. Heute ist der letzte Tag unserer Klassenfahrt– irgendwann am Nachmittag startet unser Flieger nach Berlin.
Wer aus meiner Klasse würde mich vermissen? Wem würde überhaupt auffallen, dass Alien Warner nicht mit an Bord ist? Felisa bestimmt nicht, sage ich mir und kämpfe eine Anwandlung von Trübsinn nieder. Aber vielleicht Timm und Julian– die einzigen Jungen in der Klasse, die mich nicht einfach nur für durchgeknallt halten.
Ich nicke den beiden Zeitreisenden zu und wende mich nach rechts, um den Hang wieder hochzuklettern.
»Nicht so schnell, Freundchen!« Der Mann hebt eine Hand, wie um mich festzuhalten.
Die Frau wirft ihm einen raschen Blick zu. »Du glaubst gar nicht, wie froh wir sind, dass wir dich hier getroffen haben«, sagt sie zu mir.
Weiter kommt sie erst einmal nicht– erneut reißt ihr Begleiter das Wort an sich.
»Wir lauern schon lange auf eine Gelegenheit, in Ruhe mit dir zu reden«, erklärt er und zieht seine struppigen Augenbrauen hoch.
»Mit mir?«, gebe ich zurück. »Aber ich kenne Sie doch gar nicht!«
Ich schließe meine Augen zu schmalen Schlitzen und versuche, die Gedanken des bulligen Mannes zu lesen. Manchmal gelingt es mir überraschend leicht, in das Bewusstsein anderer Leute einzudringen, aber diesmal habe ich keine Chance. Es fühlt sich an, als ob ich mit der Stirn gegen eine Stahltür gerannt wäre. Ich japse leise auf und öffne wieder die Augen. Gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie der Mann missbilligend die Stirn runzelt.
Lass das gefälligst, sagt er klar und deutlich in meinem Kopf.
Er setzt ein schmallippiges Grinsen auf.
»Dafür kennen wir dich umso besser, Arvid Warner«, fährt er auf gewöhnliche Weise fort. »Wir haben seit Langem ein Auge auf dich. Nach unseren Vorschriften mussten wir warten, bis du alt genug und bereit sein würdest. Aber jetzt endlich ist es so weit.«
Ich mache den Mund auf und wieder zu. In meinem Kopf wirbelt alles durcheinander. Wer sind diese beiden? Woher kennen sie meinen Namen? Und was wollen sie von mir? Ich bin doch einfach nur ein x-beliebiger fünfzehnjähriger Junge, wenn auch mit ein paar zweifelhaften Talenten ausgestattet, die ich sowieso nur ganz unzulänglich beherrsche. Im Gegensatz zu dem Mann, der es offenbar gelernt hat, sein Bewusstsein abzuschirmen und in Gedankensprache zu reden.
»Was für Vorschriften?«, gelingt es mir schließlich zu fragen. »Und wofür soll ich jetzt angeblich bereit sein?«
Der bullige Mann mit der altmodischen Frisur sieht sich nach allen Seiten um. Es wirkt vollkommen übertrieben, aber trotzdem habe ich überhaupt nicht den Eindruck, dass er sich über mich lustig machen würde. Er kommt mir im Gegenteil ganz und gar humorlos vor.
»Wir sind Geheimagenten«, sagt er mit gedämpfter Stimme. »SuperNat– das ist die Abkürzung für Supernatural Secret Agency.«
»SuperNat?«, wiederhole ich. »Nie gehört.«
Mit Agenten und Geheimdiensten kenne ich mich sogar einigermaßen aus. Aber von einem Spezialdienst, der sich mit übernatürlichem Geheimwissen beschäftigt, habe ich wirklich noch nie gehört. Doch gleichzeitig spüre ich, dass der Mann zumindest in diesem Punkt die Wahrheit sagt.
Mit einem Mal werde ich ganz aufgeregt. Geheimagenten! Wie oft habe ich mir schon vorgestellt, dass ich selbst einmal als Agent waghalsige Spezialeinsätze durchführen werde. Ich versuche, mir meine Aufregung nicht anmerken zu lassen. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass mir das besonders gut gelingt.
»Du kannst uns übrigens Alberta und Otto nennen«, sagt die Frau, »oder einfach A&O. Und natürlich hast du noch nie in deinem Leben von der SuperNat gehört. Überleg doch mal, Arvid, was das in den Zeitungen und im Fernsehen für ein Geschrei gäbe– wenn plötzlich bekannt würde, dass die Regierung einen Geheimdienst zur Aufklärung und Abwehr von Geisteraktivitäten unterhält! Offiziell gibt es schließlich gar keine Geister– und folglich kann es auch uns von der SuperNat nicht geben.«
»Oder vom GAAD«, ergänzt Otto, »dem Geisterabwehr- und -aufklärungsdienst, falls du die deutsche Bezeichnung vorziehst. In Wirklichkeit existiert nämlich fast in jedem Land eine Abteilung wie unsere. Außer den jeweiligen Regierungschefs, Ministern und militärischen Oberbefehlshabern weiß natürlich niemand, dass es uns gibt.«
Über dem Meer zu meiner Linken kreischt eine Möwe und ein halbes Dutzend von ihrer Sorte antwortet mit noch viel lauterem Geschrei. Es klingt, als ob sich die Vögel vor Begeisterung kaum mehr einkriegen könnten. Dann stürzen sie sich alle gleichzeitig ins Meer hinunter, mit den plumpen Schnäbeln voran.
Auf einmal muss ich grinsen. »Alberta und Otto, ja?«
Natürlich glaube ich keine Sekunde lang, dass das ihre wahren Namen sind.
Doch die beiden Agenten bleiben ernst.
»Das hier ist kein Spaß, Arvid«, sagt Otto. »Was glaubst du, wie die Lebendigen reagieren würden, wenn sie plötzlich erkennen müssten, dass sie nur eine winzige Minderheit auf diesem Planeten sind? Angewiesen auf die Gnade und Friedfertigkeit einer Heerschar von Ahnengeistern, Seelen, Untoten– oder wie immer du sie nennen willst? Sie alle wachen eifersüchtig darüber, dass ihnen die Nachwelt ein einigermaßen gerechtes und ehrenvolles Andenken bewahrt. Und wenn sie den Eindruck gewinnen, dass man sie schlecht oder auch nur achtlos behandelt, dann können sie zu schrecklichen Mitteln greifen– ihre Macht ist praktisch grenzenlos.«
Wieder schaut sich Otto verstohlen nach allen Seiten um. Als er weiterredet, dringt nur noch ein kaum hörbares Flüstern aus seinem Mund.
»Wenn die Geister in Zorn geraten, können sie furchtbare Zerstörungen anrichten– Flugzeuge vom Himmel stürzen lassen, Erdbeben und Überschwemmungen auslösen. Im Fernsehen ist dann glücklicherweise immer von technischem Versagen oder unvorhersehbaren Naturkatastrophen die Rede. Aber das ist nur der übliche Unsinn, der verbreitet wird, damit keine Massenpanik ausbricht.«
Alberta wirft ihm einen warnenden Blick zu und Otto verstummt.
»Wir wollen die Dinge nicht schlimmer darstellen, als sie sind«, sagt die Agentin und der Wind zerrt an ihrem Würfelschal. »Im Allgemeinen sind die Geister uns Lebenden wohlgesonnen. Sie wollen keine Rache nehmen, sondern verlangen lediglich, dass wir ihnen in unserer Erinnerung einen angemessenen Platz bewahren.«
Otto sieht sie von der Seite her mit hochgezogenen Augenbrauen an. Er scheint Albertas Sicht der Dinge nicht so ganz zu teilen. Aber er widerspricht ihr mit keinem Wort.
»Wir haben dir zugesehen, Arvid«, fährt Alberta fort. »Als du deine Klassenkameradin dazu gebracht hast, ihren Fuß in die Geisterzone dahinten zu stellen.«
Sie deutet auf einen imaginären Punkt hinter meinem Rücken. Ich wende mich kurz um, obwohl mir natürlich klar ist, wovon sie redet. Ihr Zeigefinger deutet haargenau auf die Mulde im Felsboden, in der vorhin Dwinte aufgetaucht war. Als ich mich wieder zu Alberta herumdrehe, sehe ich gerade noch, dass sie Otto einen fragenden Blick zuwirft. Der zieht ein grüblerisches Gesicht, dann holt er tief Luft und nickt ihr zu.
Alberta setzt wieder ihr anerkennendes Lächeln auf. »Du kannst sie sehen, das stimmt doch?«
»Wen sehen?«, gebe ich zurück.
»Na, wen schon!«, ruft Otto aus. »Die Ahnengeister«, fährt er sehr viel leiser fort, »die Vampire und Kobolde, die Fairies und was da sonst noch so herumflattert, -hüpft und -schwebt.« Er wedelt kurz mit seinen Armen. »Du kannst sie sehen, oder?«
Die beiden fangen an, mir auf die Nerven zu gehen– besonders Otto mit seinen pantomimischen Einlagen.
»Sie etwa nicht?«, gebe ich zurück. »Na klar kann ich sie sehen. Manchmal sehe ich überhaupt nichts anderes als Unmengen von Geistern– dafür brauche ich nicht mal vor die Tür zu gehen. Und gerade eben habe ich mit drei Elfen geredet– ziemlich genau hier, wo wir jetzt stehen.«
Otto und Alberta wechseln bedeutungsvolle Blicke.
»Natürlich können wir das auch«, behauptet Otto. »Aber aus gewissen Gründen wäre es trotzdem hilfreich, wenn du ab und zu mit uns zusammenarbeiten würdest. Sozusagen als Vermittler zwischen uns und der Geisterwelt.«
Sprachlos starre ich ihn an. Vielleicht sind diese angeblichen Agenten ja einfach entlaufene Irrenhäusler? Aber ich spüre, dass das nicht stimmt. Es sind Special Agents, Abteilung Geisterabwehr. Und obwohl ich wirklich noch nie von dieser SuperNat oder von einem GAAD gehört habe, bezweifle ich nicht im Geringsten, dass es ihren Geheimdienst gibt.
»Und warum gerade ich?«, frage ich.
fünf
Der Wind weht salzige Tropfen vom Atlantik zu uns herauf, vermischt mit dem Staub von den Felshängen des Mount Brandon. Wo früher einmal Bäume standen und angenehme Kühle spendeten, wächst heute fast nur noch dieses zähe graue Gras.
»Warum wir ausgerechnet dich anheuern wollen?« Otto schaut plötzlich ganz feierlich.
Alberta setzt ein mütterliches Lächeln auf. »Weil du der Sohn von Gerwin Warner bist– und alt genug, das Erbe deines Vaters anzutreten.«
»Und das Erbe deiner Mutter«, ergänzt Otto, »noch dazu.«
Wieder sieht er sich verstohlen um.
»Eine unschlagbare Kombination!«, ruft er gedämpft.
Da kommt mir doch wieder der Verdacht, dass die beiden sich über mich lustig machen. Oder dass bei ihnen mehr als nur eine Schraube locker ist.
»Was hat denn meine Mutter damit zu tun?«, frage ich.
Meinen Vater habe ich mir eigentlich immer schon als mysteriösen Abenteurer vorgestellt. Laut meiner Mutter hat er als »Kurier für eilige Spezialaufträge« gearbeitet– und dahinter kann sich ja so einiges verbergen. Schon als kleiner Junge habe ich mir oft ausgemalt, dass mein Vater ein Schatzsucher war, ein Detektiv oder sogar ein Geheimagent. Und dass er nicht durch einen banalen Unfall umgekommen, sondern von irgendwelchen finsteren Feinden in eine Falle gelockt worden ist.
Aber meine Mutter Karen? Die sitzt doch von früh bis spät zu Hause in ihrem Arbeitszimmer und übersetzt Romane und was weiß ich noch alles vom Englischen ins Deutsche.
»Karen«, sagt Alberta in meine wirbelnden Gedanken hinein, »hat früher für die SuperNat gearbeitet. Sie war meine Vor-Vorgängerin genauer gesagt– bis sie vor gut sechzehn Jahren mit dir schwanger wurde.«
Die Kinnlade fällt mir herunter. Meine Augen gehen von selbst immer weiter auf.
»Ich glaube Ihnen kein Wort«, sage ich.
Alberta schaut mich voller Mitgefühl an. Meine Kehle wird mit einem Mal eng.
»Karen hat dir nichts erzählt, oder?«, fragt sie. »Niemals die kleinste Andeutung gemacht?«
Ich kann nur stumm den Kopf schütteln. Mein Mund und mein Hals fühlen sich an, als hätte ich löffelweise Sand geschluckt.
»Deine Mutter«, ergreift wieder Otto das Wort, »hatte damals den Auftrag, mit dem Bevollmächtigten der Ahnengeister eines bestimmten Volkes zu verhandeln. Dieses Volk ist vor langer Zeit ausgerottet worden, und die Ahnengeister hatten mit übernatürlichen Attentaten gedroht, falls die Lebendigen ihren Forderungen nicht endlich nachkämen. Und dieser Bevollmächtigte, mit dem Karen sich mehrfach getroffen hat, um einen Vertrag auszuhandeln… na ja, wie soll ich dir das sagen…«
Er gerät ins Stottern und schaut Alberta Hilfe suchend an. Aber anstatt ihrem Kollegen aus der Patsche zu helfen, nickt sie ihm nur energisch zu.
Offenbar kommt jetzt der unangenehmste Teil ihrer Erklärungen, denke ich. Meine Beine fühlen sich zittrig an. Das Herz schlägt mir wie eine Trommel in der Brust. Die Möwen kämpfen kreischend um einen Fisch, den sie in blutige Fetzen zerreißen– zumindest hört es sich für mich so an.
»Dieser Bevollmächtigte der Ahnengeister also«, bringt Otto seinen Satz schließlich doch noch zu Ende, »das war eben dein Vater– Gerwin Warner.«
Ich verstehe kein Wort. Oder nein, ganz im Gegenteil: Ich verstehe nur allzu gut. Vor meinen Augen beginnt sich alles ganz langsam im Kreis zu drehen: Ottos Scheitel und sein grellweißes Hemd. Albertas Karokleid und der mit ihrer Frisur verknotete Schal. Ottos erstarrte Miene und Albertas mitleidiges Lächeln, das genauso eingefroren wirkt.
»Karen sollte nur einen Vertrag mit ihm aushandeln«, sagt Alberta, »aber stattdessen hat sich deine Mutter in den Bevollmächtigten Gerwin Warner verliebt. In einen magisch wiederverkörperten Ahnengeist! So was kommt leider immer wieder mal vor, auch wenn es nach unseren Vorschriften natürlich streng verboten ist. Gerwin Warner hat sich wohl auch seinerseits in die junge SuperNat-Agentin verliebt, und stell dir nur vor, Arvid: Die beiden haben sogar heimlich geheiratet. Schließlich besaß Gerwin Warner erstklassig gefälschte Papiere, und obwohl sie beide wissen mussten, dass diese Geschichte nicht gut ausgehen konnte, gaben sie sich das Ja-Wort. Da war Karen schon schwanger von Gerwin– du warst unterwegs, Junge!«
Ich war unterwegs… Der Satz hallt in mir nach. Und je länger ich seinem Echo lausche, desto besser fühle ich mich. Sollte ich nicht eigentlich niedergeschmettert oder zumindest irgendwie mitgenommen sein? Immerhin ist mir gerade erklärt worden, dass mein Vater ein magisch wiederverkörperter Ahnengeist ist! Was ja wohl bedeutet, dass ich selbst nur zur Hälfte ein Mensch bin– und zur anderen gleichfalls ein Geist.
Alberta schaut mich immer noch so mitleidig an, als ob ich im nächsten Moment in Tränen ausbrechen müsste. Dabei habe ich mich niemals in meinem Leben so leicht gefühlt, so klar, so frei. Jetzt weiß ich endlich, warum ich mich immer schon zur Geisterwelt hingezogen gefühlt habe– weil ich zur Hälfte selbst ein Geist bin! Und so erklären sich auch meine seltsamen Talente– die Visionen, die Neigung mancher Dinge, in meiner Nähe die Schwerkraft abzuschütteln, und irgendwie hat bestimmt auch Dwinte mit alledem zu tun. Vielleicht ist der Bonsai-Bock sogar ein Bote, den mein Vater mir ein ums andere Mal aus der Geisterwelt herüberschickt– nur dass ich die Botschaft bisher nicht verstanden habe?
Denn wenn Gerwin Warner kein gewöhnlicher Mensch war, denke ich weiter, sondern ein Ahnengeist– dann kann er ja auch nicht wirklich ums Leben gekommen sein?
Plötzlich überkommt mich erneut eine gewaltige Aufregung. Alberta und Otto haben mich die ganze Zeit über nur stumm angesehen– Alberta mit einem Gesichtsausdruck, als ob sie mich gleich in den Arm nehmen wollte (was sie hoffentlich niemals versuchen wird!). Otto dagegen sieht aus, als würde er sich weit von hier wegwünschen. Als wäre es eigentlich unter seiner Würde, einen fünfzehnjährigen Jungen um Hilfe zu bitten. Aber weil sie ihren Agentenjob allein nicht erledigt bekommen, bleibt ihm nichts anderes übrig, als dieses Kindertheater auf dem Mount Brandon mit durchzuziehen.
»Wo ist mein Vater jetzt?«, frage ich Alberta. »Die Story mit dem Autounfall kann ja wohl nicht stimmen, oder?«
Die Agentin zuckt mit den Schultern.
»Bedaure, Junge, da muss ich passen. Ein paar Wochen, bevor du geboren wurdest, ist er verschwunden. Wahrscheinlich haben seine Ahnengeister ihn gezwungen, in ihre Welt zurückzukehren. Wenig später wurde auf der Ostsee ein Kajütboot gefunden– mit Gerwin Warners Papieren und persönlichen Sachen unter Deck. Die Polizei nahm damals an, dass er– freiwillig oder nicht– über Bord gegangen wäre. Aber sie wussten natürlich nicht, um wen es sich bei dem Vermissten in Wirklichkeit handelte. Die SuperNat hat sich, wie immer in solchen Fällen, aus den Ermittlungen vollständig herausgehalten. Mehr kann ich dir leider nicht sagen.«
Ich nicke gedankenverloren.
»Und Sie wollen also, dass ich Ihnen helfe, mit den Geistern zu verhandeln?«
»Ganz genau.« Ottos bullige Gestalt strafft sich. »Du wirst nach unseren Anweisungen Verträge mit ihnen aushandeln. Um sicherzustellen, dass die Ahnengeister mit den Lebenden dauerhaft Frieden schließen, kann es auch mal nötig sein, dass du in die eine oder andere Geisterwelt hinüberreist.«
Ich muss mich mit aller Kraft zusammenreißen, damit ich nicht anfange, vor Begeisterung herumzuschreien und mich auf dem Boden zu wälzen vor Glück. Ich bin ein Special Agent, denke ich wieder und wieder, mein Leben wird ein einziges atemberaubendes Abenteuer sein!
»Und warum sollte ich das machen?«, frage ich so lässig wie möglich.
Irgendwie reizt es mich, diese beiden großartigen Agenten– und vor allem den so überlegen tuenden Otto– noch ein bisschen betteln zu sehen. Aber nicht deshalb habe ich diese Frage gestellt.
»Damit du deinen inneren Frieden findest«, antwortet Alberta geheimnisvoll.
»Weil wir dir eine einzigartige Chance bieten«, trumpft Otto auf. »Du wirst Fähigkeiten entwickeln und Abenteuer bestehen, die kein Mensch vor dir jemals besessen und erlebt hat!«
Eigentlich bin ich ja längst Feuer und Flamme für ihren Vorschlag. Aber ich zucke nur mit den Schultern und sehe die beiden weiter abwartend an.
»Du wirst Klarheit über deine Herkunft bekommen«, sagt Alberta schließlich. »Davon bin ich jedenfalls fest überzeugt.«
Und vielleicht werde ich sogar meinen Vater finden, denke ich, irgendwo da drüben in der Geisterwelt.
Beinahe hätte ich doch noch das Heulen angefangen.
sechs
»Dann sind wir uns also einig?«, fragt Otto. Dazu macht er eine sägende Handbewegung, als wollte er sagen: Genug mit diesen Rührseligkeiten!
Ich bringe nur ein Kopfnicken zustande, aber das scheint den beiden zu genügen.
»Wie du dir wahrscheinlich denken kannst«, fährt Otto in mürrischem Tonfall fort, »haben wir diese Reise nicht nur deshalb unternommen, weil wir mit dir reden wollten. Das hätten wir schließlich auch in Berlin machen können. Aber die Fairies von Mount Brandon halten unsere Kollegen von der irischen SuperNat seit Monaten in Atem– sie verlangen, dass der Tempel da oben auf dem Gipfel unverzüglich nach ihren Anweisungen wiederaufgebaut wird. Und das ist noch lange nicht alles– sie sind äußerst zornig und stellen Forderungen, die die irische Regierung beim besten Willen nicht erfüllen kann. Du kannst hier also gleich schon mal deinen ersten Einsatz absolvieren.«
Nichts lieber als das, denke ich. So werde ich Brianna wirklich wiedersehen– und zwar schneller, als vielleicht sogar sie selbst es vorausgesehen hat. Aber dann fallen mir Graínne und Niamh ein– die beiden Fairies mit den schrecklichen Augen.
»Na ja, warum nicht«, sage ich mit einem mulmigen Magengefühl. »Was soll ich diesen irischen Elfen denn ausrichten?«
Verstohlen schaue ich mich um. Brianna und die anderen lassen sich nicht sehen– dabei spüre ich doch, dass sie irgendwo hier in der Nähe sind.
Gerade in diesem Moment fängt oben auf dem Berggipfel die gesamte 9c an, nach mir zu rufen.
»He, Arvid!«
»Hallo, Alien, bitte melden!«
Schritte kommen näher, Steinbrocken werden durch die Gegend gekickt.
»Wo bist du, Arvid? Hat dich etwa eine Fee geküsst?«
»He, Warner– das ist die letzte Warnung! Zeig dich oder wir schalten deine Kontrolllampen auf Rot!«
Na ja, die ganze Palette an nicht besonders witzigen Sprüchen, mit denen sie mich bei jeder Gelegenheit aufziehen.
»Sie sind schon in Ordnung«, versichere ich Alberta und Otto. »Jedenfalls die meisten von ihnen.«
Die beiden Agenten werfen unruhige Blicke über die Schultern und zur Tempelruine hinauf.
»Wir verschwinden jetzt besser«, sagt Otto und klappt seinen Jackettkragen hoch.
»Du hörst von uns, Arvid«, sagt Alberta und schenkt mir ein mütterliches Lächeln.
»Sogar früher, als du dir höchstwahrscheinlich vorstellen kannst«, ergänzt Otto, packt Alberta am Arm und stapft mit ihr davon.
»Mensch, Arvid, was treibst du denn da unten so ganz allein!« Oben hinter dem Mauerfirst ist Frau Krofinger, unsere Klassenlehrerin, aufgetaucht. »Ich denke, du interessierst dich so sehr für alte Kulturen«, fährt sie fort und klingt dabei weniger verärgert als erstaunt. »Aber während wir diesen eindrucksvollen Tempel besichtigen, spielst du da unten Verstecken mit dir selbst– was sollen diese Kindereien?«
Rasch klettere ich zu ihr auf die Bergkuppe hoch. Ich schwinge mich über die bröckligen Mauerüberreste und die ganze Bande schaut mir schon erwartungsvoll entgegen. Sichtlich gespannt auf die »verdrehte« und »alien-mäßige« Geschichte, mit der ich ihrer Meinung nach wieder mal versuchen werde, mich herauszureden.
Die Tempelruine sieht zumindest von außen bloß noch wie ein Trümmerhaufen aus. Kein Wunder, denke ich, dass die Elfen wollen, dass ihr altes Heiligtum wiederaufgebaut wird. Wenn schon der ganze Wald, der hier früher einmal gestanden hat, vom Feuer vernichtet worden ist. Einem Feuer, das bestimmt nicht einfach durch ein Unglück ausgebrochen ist– das spüre ich ganz deutlich. Sonst wären Graínne und Niamh ja auch nicht so zornig, so sehr von Grauen und Trauer erfüllt.
Zwischen all den anderen aus meiner Klasse entdecke ich Felisa im Kreis ihrer Freundinnen. Sie schaut mich genauso spöttisch an wie Jessica oder Lena– anscheinend erinnert sie sich überhaupt nicht mehr an das, was vorhin zwischen uns beiden passiert ist.
Oder zwischen ihr und Dwinte.
»Sie haben recht«, sage ich zu Frau Krofinger, »dieser Tempel zu Ehren von Sonnengott Lug war wirklich mal ziemlich eindrucksvoll. Damals war seine Fassade mit kunstvollen bunten Reliefs geschmückt, und die stellten– kleinen Moment mal…«
Ich senke meine Lider und rufe mir in Erinnerung, was genau ich vorhin in den Augen von Graínne gesehen habe.
»Die Reliefs stellten tanzende Stiere dar«, fahre ich fort, während Frau Krofinger und die gesamte 9c mich mit offenen Mündern anstarren. »Ich nehme an, der Stier war das Symbol von Sonnengott Lug oder seine Verkörperung, oder wie die Priester das damals genannt haben. Jedenfalls war der ganze Mount Brandon damals mit dichtem Wald bedeckt– bis zu dem schrecklichen Tag, an dem hier oben alles abgebrannt ist.«
Felisa und ihre Freundinnen, meine Kumpel Timm und Julian und die ganze restliche Bande starren mich alle so andächtig an, als ob ich der wiedergeborene Oberpriester von Sonnengott Lug wäre.
Frau Krofinger fasst sich als Erste.
»Du bist doch immer wieder für eine Überraschung gut, Arvid«, sagt sie und schüttelt den Kopf, dass ihr grau gesträhnter Pferdeschwanz hin und her fliegt. »Aber die kunstvollen Reliefs hat es außerhalb deiner Fantasie ganz bestimmt niemals gegeben. Nach allem, was die Wissenschaftler herausgefunden haben, hat sich das alte Volk, das diesen Tempel erbaut hat, nicht gerade durch architektonische Glanztaten hervorgetan. Von kunstvollen Reliefs ganz zu schweigen…«
Einmal in Schwung gekommen, zieht Frau Krofinger auch noch über die primitive Schrift, den Aberglauben und die barbarischen Bräuche des alten Volkes her, das vor Jahrtausenden hier auf der Insel gelebt hat.
Ich höre ihr höchstens mit einem halben Ohr zu. In Gedanken bin ich bei A&O und bei den unglaublichen Dingen, die sie mir eben gesagt haben. Und bei Brianna.
Es gibt sie also wirklich, die Geister– das habe ich doch immer schon ganz klar gespürt! Und mich gleichzeitig mit der Angst herumgequält, dass ich nicht ganz richtig im Kopf wäre– weil ich Dinge sehe und Sachen kann, von denen gewöhnliche Menschen nicht einmal träumen können. Aber das kommt eben daher, dass ich kein gewöhnlicher Mensch bin! Sondern zur Hälfte ein Geist, aber eben nur zur Hälfte– weshalb ich Dinge, die Geister perfekt beherrschen, leider auch nur so halb und halb kann.
Aber was spielt das jetzt für eine Rolle, sage ich mir dann– ich werde als Geheimagent in Geisterwelten reisen! Und dort werde ich meinen Vater finden und von ihm alles über das Geheimnis meiner Herkunft erfahren!
Während ich mir meine künftigen Abenteuer ausmale und Frau Krofinger unermüdlich über die abergläubischen Heiden herzieht, spüre ich auf einmal von links her einen tödlich kalten Hauch.
Vor Schreck vergesse ich zu atmen. Niamh!
Im nächsten Moment spüre ich von rechts her sengende Hitze und dazu höre ich das Fauchen von Flammen, das Prasseln von brennendem Holz. Graínne!
Was wollt ihr von mir?, frage ich die beiden schrecklichen Elfen. Ich habe euch nichts getan!
Beweise, dass du zu uns gehörst, verlangt die Elfe mit den Rußaugen.
Aber wie soll ich das machen, Niamh?, frage ich.
Bringe dieses widerliche Menschenweib zum Schweigen, fordert Graínne und ihr Flammenblick versengt mir die rechte Schläfe. Untersage ihr, unser Volk auch nur einen Atemzug länger zu beleidigen.
Das kann ich nicht, wende ich ein, sie ist eine erwachsene Frau und meine Lehrerin– und ich bin nur ein Junge und muss im Gegenteil den Mund halten, wenn sie es will.
Bring sie zum Schweigen!, befiehlt Niamh, und die tödliche Kälte, die von ihr ausgeht, macht meine linke Seite mehr und mehr taub.
Bevor ich irgendetwas antworten kann, mischt sich eine weitere Gedankenstimme ein. Du kannst es, ich weiß es, Arvid.
Sie klingt wie Harfensaiten, über die ein milder Frühlingswind streift. In meinem Nacken spüre ich eine angenehme Wärme, und ohne mich umzuwenden, nehme ich das grüne Leuchten aus ihren Augen wahr.
Brianna…
Du kannst es, Arvid– du gehörst zu uns!
Ich schließe meine Augen zu schmalen Schlitzen und konzentriere mich auf Frau Krofinger. Keine Ahnung, woher ich auf einmal weiß, was ich machen muss, um den Fairies zu beweisen, dass ich auf ihrer Seite bin. Aber ich weiß es eben– der Geist in mir weiß es, der Geist »eines gewissen Volkes, das vor langer Zeit ausgerottet worden ist«, wie Otto sich ausgedrückt hat.
Ich stelle mir den Sonnengotttempel vor, wie ich ihn vorhin in Graínnes Augen gesehen habe. Die glatte Fassade des makellosen Rundbaus, das kunstvolle Relief, das die tanzenden Stiere darstellt, mit glänzend schwarzem Fell und rot unterlaufenen Augen.
Hinter meiner Stirn beginnt es zu sausen und mir wird wieder ein wenig schwindlig. Aber ich spüre, dass Brianna hinter mir steht und mich mit ihren Geisterarmen festhält. Mit ihrem Lächeln, ihrer Wärme, ihrem leuchtenden Blick.
Frau Krofinger hält mit einem Mal inne. Sie schaut um sich und sieht verlegen aus. Sie wird sogar ein wenig rot und macht sich an der Spange zu schaffen, die ihren Pferdeschwanz zusammenhält.
»Arvid hat recht«, sagt sie mit einer Stimme, die fremd und brüchig klingt. »In alter Zeit war dieser Tempel mit ungemein kunstvollen Reliefs geschmückt. Vergesst alles, was ich eben gesagt habe– ich war nicht ganz bei der Sache.«
Sie wirft mir einen fragenden Blick zu und ich zucke mit den Schultern und grinse sie an. Keine Ahnung, Frau Krofinger, was mit Ihnen plötzlich los ist!
Unsere Lehrerin fährt sich mit der flachen Hand über das Gesicht. Sie ist eigentlich ganz nett und behandelt uns im Großen und Ganzen fair. Aber von Magie und Geisterglaube, von alten Göttern und ihren Zauberpriestern hält sie überhaupt nichts.
»Sind alle da?«, fragt Frau Krofinger, um einen munteren Tonfall bemüht. »Dann also Abmarsch, Leute. Unser Bus wartet bestimmt schon unten im Dorf. Ich habe Lunchpakete für alle geordert– wir fahren nonstop nach Dublin zurück. Um 16 Uhr 15 steigen wir in den Flieger– um 19 Uhr 20 Ortszeit sind wir wieder in Berlin.«
Sie wirkt ausgesprochen erleichtert, weil sie all das hier hinter sich lassen kann. Ich dagegen, der es die ganze Woche über kaum erwarten konnte, dass diese öde Klassenfahrt endlich zu Ende geht– ich würde jetzt alles dafür geben, wenn ich nur noch ein paar Tage länger bleiben könnte. Oder wenigstens ein paar Stunden.
Während ich hinter den anderen den Berg hinuntertrotte, schwebt Brianna neben mir her.
Ich wusste, dass du es schaffen würdest, Arvid, sagt sie zu mir. Du gehörst zu uns– das habe ich sofort gespürt.
Ihre Augen leuchten. Ich lächle sie von der Seite an.
Gerade in diesem Moment muss sich natürlich Timm zu mir herumdrehen.
»Was grinst du denn so komisch?«, fragt er.
Ohne weitere Erklärung winke ich ab. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit für dich, Timm.
Werden wir uns wiedersehen, Brianna?, frage ich.
Sie umhüllt mich mit ihrem warmen Lächeln und ihrem leuchtenden Blick.
Sehr bald schon, Arvid, antwortet sie.
sieben
Im stickig heißen Bus auf kurvigen Straßen quer über die Insel zurück nach Dublin. Ich habe wieder mal eine Bank ziemlich weit hinten für mich allein. Vor mir sitzen Timm und Julian und ab und zu dreht sich einer von ihnen zu mir herum und grinst mir zu.
»Wer hat eigentlich behauptet, dass es in Irland immer kalt wäre und ununterbrochen regnen würde?«, fragt mich Julian irgendwann.
Ich zucke mit den Schultern. Stimmt schon, denke ich, die ganze Woche über hat die Sonne vom blauen Himmel gebrannt. Und das Anfang Mai. Aber will Julian jetzt wirklich mit mir über das Wetter reden?
Anscheinend ja. Er kniet falsch herum auf der Bank vor mir und schaut mich über die Rückenlehne hinweg forschend an.
»Da steckst doch bestimmt wieder mal du dahinter, Arvid? Ich meine– wo du dich doch mit diesem Sonnengott Lug und seinen Zauberpriestern so gut auskennst?«
Was soll das denn jetzt?, denke ich. Julian schaut mich durch seine schwarzen Locken, die ihm bis über die Augen hängen, irgendwie herausfordernd an.
»Fängst du jetzt auch noch an, auf mir herumzuhacken?«, frage ich.
Erst als ich das Erstaunen in seinem Gesicht sehe, wird mir klar, dass er mich nicht ärgern will. Seine Frage ist wirklich ernst gemeint.
»Also sag schon«, beharrt er. »Was hast du vorhin da oben gemacht, während wir mit der Krofinger in der Tempelruine waren?«
»Bestimmt keinen Wetterzauber«, gebe ich zurück.
Anscheinend habe ich eine Spur zu laut gesprochen. Jedenfalls drehen schon wieder alle ihre Köpfe zu uns her.
»He, was wollt ihr denn?«, rufe ich ihnen zu.
Etwas ist anders als sonst immer, wenn sie sich über mich lustig machen. Niemand grinst. Niemand nennt mich Alien. Stattdessen starren mich alle irgendwie ehrfürchtig an. Bestimmt spielen sie mir nur etwas vor, denke ich– und im nächsten Moment fallen sie alle mit höllischem Hohngelächter über mich her!
Aber ich spüre ja, dass sie es diesmal ernst meinen. Dass sie wirklich so etwas wie Respekt vor mir empfinden– zum ersten Mal, seit ich am Wohlthat-Gymnasium bin.
Zum ersten Mal überhaupt in meinem Leben.
»Was ist denn los?«, frage ich Julian. »Was habt ihr denn auf einmal alle?«
Er verzieht das Gesicht, hebt halbherzig die Schultern, geht hinter seinen Locken in Deckung. Auch Timm hat sich mittlerweile zu mir herumgedreht. Er wirft einen Blick über seine Schulter– Frau Krofinger sitzt ganz vorn neben dem Fahrer, Kopfhörer auf den Ohren. Der graue Pferdeschwanz wippt im Rhythmus– ich schätze mal– der Rolling Stones.
»Wie du sie vorhin angeschaut hast, Arvid.« Timm deutet mit der Schläfe in Richtung Frau Krofinger. »Ich meine– erst hat sie über dieses Heidenvolk und seine Bräuche hergezogen, dann hast du sie so komisch angeschaut– und dann…«
Er redet nicht weiter, sondern sieht nur aus großen Augen auf mich herunter. Timm hat hellblonde struppige Haare und fast farblose Augen, die er ungeheuer weit aufreißen kann.
»Wie denn angeschaut?«, will ich von ihm wissen. »So vielleicht?«
Ich kneife meine Augen zu schmalen Schlitzen zusammen und starre ihn an. Timm macht ein erschrockenes Gesicht. Einen Moment lang bin ich versucht, auch ihm die Bilder zu schicken, die ich vorhin in Graínnes Augen gesehen habe– den prachtvollen Tempelbau mit den bunten Reliefs, die eine ganze Herde tanzender Stiere darstellen.
Aber ich lasse es sein. Obwohl ich spüre, dass ich jetzt mühelos noch einmal hinbekommen würde, was ich vorhin bei Frau Krofinger geschafft habe. Aber Timm ist mein Freund, und es wäre nicht fair, ihn vor aller Augen wie ein dressiertes Kaninchen vorzuführen.
»War nur ein Witz«, sage ich zu Timm und allen, die uns zuhören.
Dann drehe ich demonstrativ meinen Kopf zur Seite und mache die Augen zu. Ich will an Brianna denken, mich an ihre Harfenstimme, ihr Lächeln erinnern, ihre leuchtend grünen Augen. An die Lichtfunken, die aus ihren Haaren gesprüht sind…
Eine Hand legt sich auf meine Schulter. Anscheinend ist jemand neben mir auf die Sitzbank geglitten. Ich schrecke auf, kann mich aber nicht gleich überwinden, meine Augen zu öffnen.
Im Traum war ich bei Brianna, in ihrem grünen Wald voller Farben und Düfte. In mir verklingt die wunderschöne Melodie und Brianna verblasst ganz langsam vor meinen Augen. Das war kein gewöhnlicher Traum, denke ich. Widerwillig hebe ich meine Lider.
Neben mir sitzt Felisa.
»Ich wollte mich bei dir bedanken, Arvid«, sagt sie leise und schiebt ihr Gesicht extrem nah vor meins. »Weil du zu mir runtergeklettert bist und mir aufstehen geholfen hast.« Sie lächelt ganz lieb. »Zum Glück war ja nichts weiter mit meinem Fuß.«
Sie haucht mir einen Kuss auf die Wange, knapp neben meinen Mund. Erwartungsvoll sieht sie mich an, ihr Mund schwebt vor meinem. Aber ich sitze einfach da wie ein Crashtest-Dummy und schaue an ihr vorbei.
Noch vor Kurzem hätte ich praktisch alles für eine Gelegenheit wie diese hier gegeben. So lieb hat Felisa mich noch niemals angelächelt. So nah sind wir uns eigentlich niemals vorher gekommen, auch nicht vor diesem unheilvollen MP3-Player-Zwischenfall. Hundertmal habe ich mir seit damals vorgestellt, wie es wäre, Felisa in den Arm zu nehmen. Sie zu küssen, sie Feli zu nennen und aus ihrem Mund zu hören, wie sie mich Arvid nennt. Und nicht Alien.
Aber das ist vorbei.
Felisa lässt sich in den Sitz zu meiner Rechten zurückfallen. »Was ist los mit dir?«, fragt sie fast tonlos.
»Was soll schon sein? Ich bin müde«, sage ich lahm. »Letzte Nacht wenig geschlafen.«
Ich mache die Augen wieder zu. Wie erstarrt sitze ich da und kann erst wieder richtig atmen, als ich spüre, dass Felisa aufsteht und im Bus wieder nach vorn geht, zu Jessica und Lena.
Tut mir wirklich leid, Felisa, denke ich. Du glaubst jetzt bestimmt, dass ich dir etwas heimzahlen wollte. Aber das stimmt nicht.
Weißt du noch, setze ich meine stumme Abschiedsrede fort– damals im letzten Winter, Feli, als wir beide im Café Muck neben unserer Schule in der kleinen Nische gesessen haben, in der man von den anderen Tischen aus nicht gesehen werden kann? Da hast du mir die ganze Zeit nur von deinem dämlichen neuen MP3-Player vorgeschwärmt und ich hätte aber viel lieber von uns beiden geredet. Oder, noch lieber, gar nichts geredet, sondern dich nur angeschaut und geküsst. Aber du hast einfach nicht aufhören können, mir immer noch mehr blödsinnige Features zu erklären, und da bin ich irgendwie wütend geworden.
»Also, ich habe ja bloß so ein Billigteil«, habe ich zu dir gesagt, »und das kann nur zwei Sachen: Musik abspielen und fliegen.«
Da endlich hast du wieder mitbekommen, dass ich auch noch da war. Du hast mich fragend angeschaut und da konnte ich natürlich nicht mehr zurück. Sonst hätte ich deine Aufmerksamkeit gleich wieder verloren, das spürte ich genau. Also konzentrierte ich mich auf meinen schäbigen Player und ließ ihn aus meinem Rucksack hervorschweben, der neben mir am Tischbein lehnte.
Es ist wirklich ein unansehnliches Teil aus grauem Hartplastik, made in China oder vielleicht sogar North Korea. Kein Vergleich mit deinem edlen Designerstück, überhaupt nicht.
Aber mein Trash-Ding konnte eben schweben! Es trudelte gemächlich neben dem Tisch zu uns hoch, drehte eine wacklige Schleife über unseren Gläsern und Tellern und krachte dann ziemlich ruppig vor dir herunter.
»Verdammt noch mal«, hast du auf einmal losgeschrien, »was hast du mir in meinen Drink gemischt?«
Ich konnte nur überrumpelt den Kopf schütteln. Kein einziges Wort brachte ich heraus, um mich zu rechtfertigen– und so ganz unschuldig fühlte ich mich ja auch nicht.
Warum musste ich ihr nur diesen blöden Schwebetrick vorführen!, beschimpfte ich mich selbst im Stillen. Fehlte nur noch, dass als Nächstes Dwinte mit Gestank und Donner aus dem Boden wächst!
Das passierte zwar glücklicherweise nicht auch noch. Aber das Desaster war auch so schon perfekt.
»Wir sind fertig miteinander!«, zischtest du mir noch ins Gesicht. »Du beknackter Alien!« Damit ließest du mich sitzen und hast mich nie mehr auch nur angesehen. Jedenfalls nicht, ohne hämisch zu grinsen und mich als Alien zu beschimpfen– bis gerade eben.
Aber jetzt ist es zu spät, Felisa, denke ich– tut mir wirklich leid. Es ist einfach so, dass ich eine andere kennengelernt habe. Eine Fairy. Und außerdem weiß ich mittlerweile, dass ich ein Halbgeist bin. Das verändert alles, das musst du zugeben.
Ganz abgesehen davon, dass ich vorhin als Special Agent angeheuert worden bin.
Etwas Unförmiges klatscht neben mir auf den Sitz. Ich öffne ein Auge– das Lunchpaket.
Der Geist in mir rümpft die Nase. Aber ich bin schließlich zur Hälfte auch ein lebendiger Mensch– sorry, Graínne. Und aus der Lunchtüte steigen unwiderstehliche Gerüche auf.
Während ich meine Schinken- und Käse-Sandwiches esse, schaue ich aus dem Fenster. Draußen ziehen endlose hügelige Wiesen voller Schafe vorbei. Hütehunde rennen bellend hin und her. Zwischen die Hügel geduckt, stehen niedrige Cottages mit knallbunten Türen und Fensterläden. Alles sieht aus wie die ganze Woche über schon. Und doch vollkommen anders. Seit ich weiß, dass mein Vater ein magisch wiederverkörperter Ahnengeist ist.