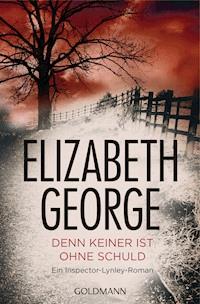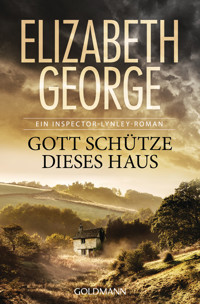
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Inspector-Lynley-Roman
- Sprache: Deutsch
"Elizabeth George ist die Meisterin des englischen Spannungsromans." New York Times
Jahrhunderte lag ein Dorf im englischen Yorkshire im Dornröschenschlaf – bis ein brutaler Mord die Idylle stört: Der Dorfpfarrer entdeckt die enthauptete Leiche seines treuen Schäfchens William Teys in einer Scheune. Und neben dem Toten kauert Roberta, seine leicht debile Tochter, und behauptet: „Ich war’s.“ Danach verstummt sie …
Der zweite Fall für Inspector Lynley.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Buch
Jahrhunderte lag ein kleines Dorf im englischen Yorkshire im Dornröschenschlaf – bis ein brutaler Mord die Spinnweben zerreißt. Der Dorfpfarrer Pater Hart macht eine grauenhafte Entdeckung: William Teys, eines seiner treusten Schäfchen und hoch angesehenes Gemeindemitglied, liegt enthauptet in einer Scheune. Neben ihm kauert Roberta, seine leicht debile neunzehnjährige Tochter. Sie spricht nur zwei Worte: „Ich war’s.“ Dann verstummt sie.
Ein Fall für Scotland Yard, das das ungleiche Team aus dem weltmännischen, galanten Thomas Lynley und seiner eher unscheinbaren Mitarbeiterin Barbara Havers losschickt. In nervenaufreibender Kleinarbeit müssen die beiden nun ein dunkles Netz entwirren und in die Abgründe hinter der biederen Fassade von Wohlanständigkeit schauen, bis sie eine grausige Wahrheit entlarven können, die mehr als ein Leben zerstört hat ...
Inhaltsverzeichnis
FOR NATHALIE
in celebration of the growth of the spiritand the triumph of the soul
1
Es war ein Fauxpas schlimmster Art. Er nieste der Frau mitten ins Gesicht, laut, naß, absolut unverzeihlich. Eine Dreiviertelstunde hatte er das Niesen zurückgehalten, dagegen gekämpft, als handle es sich um Henry Tudors Streitmacht bei der Schlacht von Bosworth. Bis er schließlich kapitulierte. Und nach vollbrachter Tat fing er zu allem Überfluß auch noch zu schniefen an.
Die Frau fixierte ihn. Sie war genau der Typ, in dessen Anwesenheit er unweigerlich zum stammelnden Idioten wurde, mindestens einen Meter achtzig groß, mit jener modischen Unbekümmertheit gekleidet, die für die britische upper class bezeichnend ist, alterslos und zeitlos. Sie fixierte ihn mit stahlblauem Blick, unter dem sich vor vierzig Jahren gewiß manches Zimmermädchen in Tränen aufgelöst hatte. Sie mußte weit über sechzig, vielleicht schon fast achtzig sein, aber es war schwer zu sagen. Sie saß kerzengerade, die Hände im Schoß gefaltet, mit der vorschriftsmäßigen Haltung der höheren Tochter, die sich nicht die kleinste der Bequemlichkeit förderliche Regung gestattet.
Und sie fixierte ihn. Erst seinen Priesterkragen, dann seine tropfende Nase.
Verzeihen Sie, Verehrteste. Ich bitte tausendmal um Verzeihung. Ein kleiner Fauxpas wie ein Niesen darf doch eine Freundschaft wie die unsere nicht zerstören. Er war immer so witzig, wenn er seine geistigen Dialoge führte. Nur wenn er laut sprach, kam er fürchterlich ins Schleudern.
Er schniefte wieder. Sie starrte ihn immer noch an. Wieso reiste sie überhaupt zweiter Klasse? Sie war in Doncaster ins Abteil gerauscht wie eine überalterte Salome, freilich zugeknöpfter gekleidet, und hatte dann die ganze Fahrt nichts anderes getan, als entweder von dem widerlich riechenden lauwarmen Kaffee der Britischen Eisenbahn zu nippen oder ihn in einer Art und Weise anzuschauen, welche die Mißbilligung der gesamten englischen Staatskirche zum Ausdruck brachte.
Und dann kam das Niesen. Tadellos korrektes Verhalten von Doncaster bis London hätte seine Zugehörigkeit zur römischkatholischen Kirche vielleicht entschuldigen können. Das Niesen jedoch trug ihm ewige Verdammnis ein.
»Ich – äh – das heißt – Sie müssen verzeihen...«
Es hatte keinen Sinn. Sein Taschentuch war tief in seiner Tasche vergraben. Um es herauszuziehen, hätte er den abgewetzten Aktenkoffer auf seinem Schoß loslassen müssen, und das war undenkbar. Es geht hier nicht um eine Verletzung der Etikette, Madam. Hier geht es um Mord! Bei diesem Gedanken schniefte er mit selbstgerechtem Nachdruck.
Die Frau nahm noch korrektere Haltung an; ihre Mißbilligung war nun nicht mehr zu übersehen. Ihr Blick sagte alles. Er spiegelte jeden ihrer Gedanken, und er konnte sie alle lesen: Ein jämmerlicher kleiner Mann. Erbärmlich. Zweifellos keinen Tag jünger als funfundsiebzig und sieht entsprechend aus. Aber was kann man von solchen Leuten schon erwarten? Drei Schnitte im Gesicht von der schlechten Rasur und im Mundwinkel noch ein Krümel vom Frühstückstoast; abgetragener schwarzer Anzug, an Ellbogen und Manschetten ausgebessert; und der Schlapphut voller Staub. Und dieser gräßliche Koffer auf seinem Schoß! Er hielt ihn die ganze Zeit fest, so als wäre sie nur mit der Absicht in den Zug gestiegen, ihn ihm zu entreißen. Guter Gott!
Die Frau seufzte und wandte sich ab, als suche sie Erlösung. Aber die blieb ihr versagt. Seine Nase tropfte weiter, bis das Langsamerwerden des Zuges endlich das nahe Ende ihrer gemeinsamen Fahrt ankündigte.
Im Aufstehen strafte sie ihn mit einem letzten Blick. »Endlich begreife ich, was die Katholiken meinen, wenn sie vom Fegefeuer sprechen«, zischte sie und rauschte hinaus.
»Ach du meine Güte«, murmelte Pater Hart. »Ach du meine Güte, ich habe anscheinend tatsächlich...«
Aber sie war schon weg. Der Zug hatte unter dem gewölbten Dach des Londoner Bahnhofs angehalten. Nun war es an der Zeit, den Auftrag zu erledigen, der ihn in die Stadt geführt hatte.
Er hielt noch einmal Umschau, um sich zu vergewissern, daß er alle seine Sachen beisammen hatte; völlig überflüssige Gewissenhaftigkeit, da er aus Yorkshire nichts mitgenommen hatte als den Aktenkoffer, den er bisher nicht aus der Hand gegeben hatte. Mit zusammengekniffenen Augen schaute er durch das Fenster in die riesige Halle des King’s-Cross-Bahnhofs hinaus.
Er hatte eher etwas wie den Victoria-Bahnhof erwartet mit seinen gemütlichen alten Backsteinmauern, seinen Verkaufskiosken und Straßenmusikanten, die der Polizei immer eine Nasenlänge voraus waren. Aber King’s Cross war ganz anders: große Flächen gefliesten Bodens, marktschreierische Reklametafeln, die von der Decke herabhingen, Bücherstände, Kioske mit Süßigkeiten, Hamburgerbuden. Und die vielen Leute! Viel mehr, als er erwartet hatte. In langen Schlangen standen sie vor den Schalterfenstern, rannten, rasch noch einen Imbiß hinunterschlingend, zu ihren Zügen, redeten, lachten, umarmten sich abschiednehmend. Menschen jeder Rasse und Hautfarbe. Wie ungewohnt! Der Lärm und das Durcheinander verwirrten ihn.
»Wollen Sie aussteigen, Pater, oder haben Sie vor, hier zu nächtigen?«
Verdutzt blickte Pater Hart in das rotwangige Gesicht des Schaffners, der ihm am Morgen bei der Abfahrt des Zuges aus York bei der Suche nach seinem Platz geholfen hatte. Es war ein freundliches nordenglisches Bauerngesicht, vom Wind der Hochmoore mit einem Netzwerk feiner geplatzter Äderchen gezeichnet.
»Wie? Ich – O ja... Ich muß raus.« Pater Hart machte entschlossene Anstrengungen, sich von seinem Platz zu erheben. »Ich war seit Jahren nicht mehr in London«, fügte er hinzu, als könne diese Bemerkung sein Widerstreben, den Zug zu verlassen, erklären.
Der Schaffner nahm sie als Aufforderung zum Gespräch.
»Kommen Sie, ich helfe Ihnen«, sagte er. »Haben Sie Ihren Koffer?«
»Ich – ja, ja, ich hab’ ihn.«
Pater Hart ignorierte die hilfreich dargebotene Hand des Mannes. Schon spürte er den Schweiß an den Händen und unter den Achseln, in den Lenden und in den Kniekehlen und fragte sich, wie er diesen Tag überstehen sollte.
»Gut, dann raus auf den Bahnsteig.«
Pater Hart spürte den neugierigen Blick des Schaffners, der von seinem Gesicht zum Aktenkoffer glitt. Er hielt den Griff des Köfferchens fester. In der Hoffnung, dadurch entschlossener zu wirken, spannte er seinen Körper an, bekam aber nur einen äußerst schmerzhaften Krampf im linken Fuß. Er stöhnte vor Schmerz.
Der Schaffner war besorgt. »Sie sollten vielleicht besser nicht allein reisen. Brauchen Sie wirklich keine Hilfe?«
Doch, natürlich brauchte er Hilfe. Aber es konnte ihm keiner helfen. Er konnte sich nicht einmal selbst helfen.
»Nein, nein. Ich bin gleich draußen. Sie waren sehr freundlich. Heute morgen mit meinem Sitzplatz, meine ich. In der ersten Verwirrung.«
Der Schaffner winkte ab.
»Machen Sie sich da nichts draus. Viele Leute wissen nicht, daß mit den Karten auch Plätze reserviert sind. Ist ja alles glattgegangen, nicht?«
»Ja. Ich denke doch...«
Pater Hart holte in aller Eile tief Luft. Den Gang entlang, zur Tür hinaus, zur Untergrundbahn, befahl er sich. Das mußte doch zu schaffen sein. Er schlurfte zur Wagentür. Der Koffer, den er mit beiden Händen in Bauchhöhe hielt, schlug ihm bei jedem Schritt gegen die Schenkel.
»Moment, Pater«, sagte der Schaffner hinter ihm. »Die Tür geht ein bißchen schwer. Lassen Sie mich das machen.«
Er ließ den Mann in dem engen Gang an sich vorbei. Schon drängten zur hinteren Tür zwei mißmutige Männer vom Reinigungspersonal herein, mit Müllsäcken über den Schultern, um den Zug für die Rückfahrt nach York in Schuß zu bringen. Es waren zwei Pakistanis, und obwohl sie englisch sprachen, konnte Pater Hart infolge ihres exotischen Akzents kein Wort verstehen.
Er erschrak, als ihm das bewußt wurde. Was tat er hier in der Hauptstadt, wo die Einwohner Ausländer waren, die ihn mit dunklen, feindseligen Augen und fremdartigen Gesichtern ansahen? Was hoffte, er denn zu erreichen? Was war das für eine Torheit? Wer würde glauben –
»Brauchen Sie Hilfe, Pater?«
Endlich fand Pater Hart eine entschlossene Antwort.
»Nein. Es geht gut. Sehr gut.«
Er schaffte es die Stufen hinunter, spürte den Beton des Bahnsteigs unter seinen Füßen, hörte das Gurren der Tauben hoch oben unter dem gewölbten Dach der Bahnhofshalle. Zerstreut machte er sich auf den Weg den Bahnsteig entlang zum Ausgang Euston Road.
Hinter sich hörte er wieder den Schaffner.
»Werden Sie abgeholt? Wissen Sie, wohin Sie müssen? Wohin wollen Sie denn jetzt?«
Pater Hart straffte die Schultern.
»Zu Scotland Yard«, antwortete er mit fester Stimme.
Der St.-Pancras-Bahnhof gleich auf der anderen Straßenseite bildete einen so eklatanten Gegensatz zum King’s-Cross-Bahnhof, daß Pater Hart einfach stehenbleiben mußte, um den Bau in seiner ganzen neugotischen Großartigkeit zu bestaunen. Straßenlärm und Abgasgestank waren mit einem Mal bedeutungslos. Architektur interessierte ihn, und hier hatte sie die tollsten Blüten getrieben.
»Herr im Himmel, ist das eine Pracht«, murmelte er, den Kopf nach rückwärts geneigt, um die Gipfel und Schluchten des Bahnhofsgebäudes besser betrachten zu können. »Wenn man das Ding ein bißchen säubern würde, wäre es der reinste Palast.« Er schaute sich abwesend um, so als wollte er den nächsten Passanten anhalten, um ihm einen Vortrag über die üblen Auswirkungen jahrzehntelanger Kohleheizung auf das alte Gebäude zu halten. »Es würde mich wirklich interessieren, wer –«
Ein Polizeifahrzeug raste plötzlich mit heulender Sirene die Caledonian Road hinunter und bog mit quietschenden Reifen in die Euston Road ein. Mit einem Schlag befand sich Pater Hart wieder in der Wirklichkeit. Er schüttelte sich innerlich, zum Teil aus Irritation, zum größeren Teil jedoch aus Furcht. Seine Gedanken gingen jetzt immer häufiger auf Wanderschaft. Und das signalisierte doch das Ende, nicht wahr? Er schluckte einen quälenden Kloß der Angst hinunter und bemühte sich wieder um Entschlossenheit. Sein Blick fiel auf den schwarzen Balken der Schlagzeile der Morgenzeitung. Neugierig trat er näher. »Neuer Mord am Vauxhall-Bahnhof!«
Mord! Er schreckte vor dem Wort zurück, sah sich um und gönnte sich einen Blick auf den Bericht, überflog ihn hastig, aus Sorge, genauere Lektüre könnte ein Interesse am Makabren verraten, das einem Geistlichen schlecht anstand. Wörter, nicht Sätze fing sein Blick ein. »... aufgeschlitzt ... teilweise entkleidete Leichen ... Arterien ... durchtrennt ... männliche Opfer ...«
Er schauderte, faßte sich an den Hals, seiner eigenen Verletzlichkeit bewußt. Selbst ein Priesterkragen war kein sicherer Schutz vor dem Messer eines Mörders. Es würde suchen. Es würde zustechen.
Diese Vorstellung wirkte vernichtend auf ihn. Er wich leicht taumelnd vor dem Zeitungsstand zurück und erblickte zum Glück keine zehn Meter entfernt das U-Bahn-Schild. Es half seinem Gedächtnis wieder auf die Beine.
Er kramte einen Plan der öffentlichen Verkehrsverbindungen aus seiner Tasche und studierte mit peinlicher Genauigkeit das zerknitterte Blatt Papier. Die Circle Line bis St. James’s Park, sagte er sich vor. Dann noch einmal mit Nachdruck: »Die Circle Line bis St. James’s Park. Die Circle Line bis St. James’s Park.«
Wie einen gregorianischen Gesang leierte er diesen Satz vor sich hin, während er die Treppe hinunterstieg. Er hielt Metrum und Rhythmus bis zum Schalter und stellte seinen Singsang erst ein, als er im Zug Platz genommen hatte. Dort musterte er die anderen Fahrgäste, stellte fest, daß zwei alte Damen ihn mit unverhohlener Neugier beobachteten, und neigte verzeihungheischend den Kopf.
»Verwirrend«, erklärte er und versuchte es mit einem zaghaft freundschaftlichen Lächeln. »Man kommt so durcheinander.«
»Wirklich die unmöglichsten Typen, sag’ ich dir, Pammy«, bemerkte die jüngere der beiden Frauen zu ihrer Begleiterin. Sie warf dem Geistlichen einen routinierten Blick eisiger Verachtung zu. »Und jede Maske ist ihnen recht, hab’ ich gehört.« Die wäßrigen Augen unverwandt auf den verwirrten Pater Hart gerichtet, zog sie ihre Freundin vom Sitz hoch, hielt sich an dem Pfosten bei der Tür fest und drängte sie an der nächsten Haltestelle laut zum Aussteigen.
Pater Hart sah ihnen resigniert nach. Man kann es ihnen nicht verübeln, dachte er. Man durfte nicht blind vertrauen. Niemals. Und das zu sagen, war er nach London gekommen: daß es nicht die Wahrheit war. Es sah nur wie die Wahrheit aus. Ein Toter, ein junges Mädchen und ein blutiges Beil. Aber es war nicht die Wahrheit. Er mußte sie überzeugen und ... Ach Gott, er hatte so wenig Talent für so etwas. Aber Gott war auf seiner Seite. An diesen Gedanken klammerte er sich. Was ich tue, ist recht, was ich tue, ist recht, was ich tue, ist recht. Dieser neue Singsang führte ihn direkt vor die Tore von New Scotland Yard.
»Es sollte mich wundern, wenn uns da nicht wieder eine Konfrontation zwischen Kerridge und Nies blühte«, schloß Superintendent Malcolm Webberly und zündete sich eine dicke Zigarre an, von der augenblicklich unangenehme Qualmwolken in die Luft stiegen.
»Mensch, Malcolm, mach wenigstens das Fenster auf, wenn du das Ding schon rauchen mußt«, sagte Chief Superintendent Sir David Hillier. Er war Webberlys Vorgesetzter, aber er ließ seinen Leuten in der Führung ihrer jeweiligen Abteilungen weitgehend freie Hand. Ihm selbst wäre es nicht im Traum eingefallen, kurz vor einem dienstlichen Gespräch einen derartigen Angriff auf Geruchs- und Atmungsorgane zu starten, aber Malcolm hatte seine eigenen Methoden, und die hatten sich bisher noch nie als untauglich erwiesen. Er rückte seinen Sessel herum, um dem schlimmsten Qualm zu entgehen, und ließ sein Auge über das Durcheinander im Büro schweifen.
Hillier fragte sich oft, wie Malcolm es mit seiner Neigung zum Chaos schaffte, seine Abteilung so effizient zu führen. Akten und Fotografien, Berichte und Bücher stapelten sich auf sämtlichen verfügbaren glatten Flächen. Leere Kaffeetassen standen neben überquellenden Aschenbechern, und ganz oben auf dem Regal lag sogar ein Paar uralter Laufschuhe. Das Zimmer verbreitete, genau wie es Malcolms Absicht war, die Atmosphäre einer Studentenbude: vollgestopft, locker und im Geruch ein wenig muffig. Nur das ungemachte Bett fehlte. Es war eine Atmosphäre, die ungezwungenes Beisammensein und offenen Gedankenaustausch förderte, Kameradschaft unter Männern gedeihen ließ, die im Team zusammenarbeiten mußten. Ein Menschenkenner, unser Malcolm, dachte Hillier. Weit klüger, als man vermutete, wenn man diesen ganz durchschnittlich wirkenden, fülligen Mann mit den runden Schultern sah.
Webberly hievte sich aus dem Schreibtischsessel und hantierte kurz mit dem Fensterriegel, ehe es ihm gelang, ihn zu öffnen.
»Tut mir leid, David. Das vergess’ ich jedesmal.« Er setzte sich wieder, betrachtete düster den Wust von Papieren vor sich und sagte: »Das hat mir jetzt gerade noch gefehlt.« Er fuhr sich mit einer Hand durch das schüttere Haar, das, früher rotblond, jetzt fast ganz ergraut war.
»Schwierigkeiten zu Hause?« fragte Hillier vorsichtig und hielt den Blick angelegentlich auf seinen goldenen Siegelring geheftet.
Die Frage war für beide problematisch; er und Webberly waren mit zwei Schwestern verheiratet, doch im Yard wußte das kaum jemand, und die beiden Männer bezogen sich in Gesprächen selten darauf.
Ihre Beziehung beruhte auf einer jener Launen des Schicksals, durch die zwei Menschen sich manchmal auf eine Weise miteinander verstrickt sehen, die im allgemeinen besser unbesprochen bleibt. Hilliers berufliche Laufbahn war ein Spiegel seiner Ehe. Seine Karriere war erfolgreich, seine Ehe glücklich, beide füllten ihn aus. Seine Frau war ihm die ideale Partnerin: geistige Freundin, liebevolle Mutter, hinreißende Geliebte. Er gab gern zu, daß sie der Mittelpunkt seines Lebens war; seine drei Kinder brachten Freude und Abwechslung in sein Leben, aber wirkliche Bedeutung hatte nur Laura für ihn. Ihr galt morgens sein erster Gedanke und abends sein letzter, zu ihr trug er praktisch alle Bedürfnisse seines Lebens. Und sie erfüllte jedes.
Bei Webberly war es anders: eine Laufbahn so glanzlos und unauffällig wie der Mann selbst, keine Blitzkarriere, sondern ein schleppender Aufstieg, zwar von verschiedenen Erfolgen begleitet, für die Webberly jedoch selten Lorbeeren einheimste. Er war einfach nicht der diplomatische Taktiker, der er hätte sein müssen, um im Yard Erfolg zu haben. Daher winkte auch kein Adelstitel am beruflichen Horizont, und das war die Belastung, unter der die Ehe der Webberlys litt.
Die Eifersucht darüber, daß ihre Schwester Lady Hillier war, fraß Frances Webberly fast auf. Aus der schüchternen, aber zufriedenen kleinen Hausfrau war darüber eine verbissene Streberin nach gesellschaftlichem Aufstieg geworden. Abendessen, Cocktailpartys, langweilige Einladungen und Empfänge, die sie sich kaum leisten konnten, wurden für Leute veranstaltet, die sie persönlich nicht interessierten, die aber nach Frances’ Auffassung den Aufstieg ihres Mannes zur Creme der Gesellschaft dokumentierten. Zu all diesen Veranstaltungen kamen die Hilliers getreulich; Laura aus besorgter Loyalität zu einer Schwester, mit der keine liebende Beziehung mehr möglich war; Hillier, um Webberly, so gut er konnte, vor den grausamen Bemerkungen in Schutz zu nehmen, die Frances in der Öffentlichkeit häufig über die glanzlose Karriere ihres Mannes zu machen pflegte. Lady Macbeth in Reinkultur, dachte Hillier oft schaudernd.
»Nein, das ist es nicht«, antwortete Webberly jetzt. »Ich glaubte nur, ich hätte das mit Nies und Kerridge vor Jahren endgültig geregelt. Mir graut bei dem Gedanken, daß da jetzt wieder ein Zusammenstoß ins Haus steht.«
Wie typisch für Malcolm, dachte Hillier, die Verantwortung für die Fehler anderer zu übernehmen.
»Worum ging es gleich bei ihrer letzten Fehde?« fragte er. »Das war eine Sache in Yorkshire, nicht wahr? Mit Zigeunern, die in einen Mord verwickelt waren?«
Webberly nickte. »Nies leitet die Dienststelle Richmond.« Er seufzte tief und vergaß einen Moment lang, den Rauch seiner Zigarre zum Fenster hin zu blasen. Hillier unterdrückte mit Mühe ein Hüsteln. Webberly lockerte seine Krawatte und fingerte zerstreut an dem abgewetzten Kragen seines weißen Hemdes herum. »Da oben wurde vor drei Jahren eine alte Zigeunerin umgebracht. Nies führt ein strenges Regiment. Seine Leute arbeiten äußerst gewissenhaft und sind genau bis ins kleinste Detail. Sie ermittelten und nahmen schließlich den Schwiegersohn der Alten fest. Allem Anschein nach hatte es Streit über eine Halskette aus Granat gegeben, von der jeder behauptete, daß sie ihm gehöre.«
»Eine Granatkette? War sie gestohlen?«
Webberly schüttelte den Kopf und klopfte die Asche seiner Zigarre am Aschenbecher auf seinem Schreibtisch ab. Aschepartikel früherer Zigarren flogen auf und setzten sich wie Staub auf Akten und Papiere.
»Nein. Die Kette war ihnen von Edmund Hanston-Smith geschenkt worden.«
Hillier beugte sich vor.
»Hanston-Smith?«
»Ja. Du erinnerst dich jetzt, nicht wahr? Aber der Fall kam erst nach dieser ganzen Sache. Der Mann, der wegen des Mordes an der Alten festgenommen wurde – ich glaube, er hieß Romaniv –, hatte eine Ehefrau. Ungefähr fünfundzwanzig Jahre alt und sehr schön – dunkel und exotisch.«
»Für einen Mann wie Hanston-Smith zweifellos sehr verführerisch.«
»Richtig. Sie konnte ihn davon überzeugen, daß Romaniv unschuldig sei. Es dauerte ein paar Wochen – Romaniv war noch nicht vors Schwurgericht gekommen. Sie beredete Hanston-Smith, den Fall neu aufzurollen. Sie schwor, sie würden nur verfolgt, weil sie Sinti seien; Romaniv wäre in der fraglichen Nacht mit ihr zusammengewesen.«
»Und ihr Charme hat es ihm wahrscheinlich leichtgemacht, das zu glauben.«
Webberlys Mund zuckte. Er drückte seine Zigarre im Aschenbecher aus und faltete die sommersprossigen Hände auf dem Bauch, so daß sie den Fleck auf seiner Weste verdeckten.
»Der späteren Aussage von Hanston-Smiths Diener zufolge hatte die gute Mrs. Romaniv keine Mühe, selbst einen Mann von zweiundsechzig eine ganze Nacht lang beschäftigt zu halten. Du wirst dich erinnern, daß Hanston-Smith beträchtlichen politischen Einfluß besaß und nicht gerade ein armer Schlucker war. Es fiel ihm nicht schwer, die Polizei von Yorkshire zu überzeugen, daß sie in diesem Fall eingreifen müsse. Die Folge war, daß Rubin Kerridge – er ist trotz allem, was geschah, immer noch der Chief Constable von Yorkshire – Nies befahl, die Ermittlungen neu aufzunehmen. Und um allem die Krone aufzusetzen, gab er auch noch Anweisung, Romaniv freizulassen.«
»Und wie reagierte Nies?«
»Nun, Kerridge war schließlich sein Vorgesetzter. Was hätte er tun können? Er war zwar außer sich vor Wut, aber er ließ Romaniv frei und wies seine Leute an, die Ermittlungen wiederaufzunehmen.«
»Romanivs Entlassung wird zwar die Ehefrau glücklich gemacht, Hanston-Smiths nächtlichen Freuden aber wohl ein vorzeitiges Ende gesetzt haben«, meinte Hillier.
»Nun, Mrs. Romaniv fühlte sich natürlich verpflichtet, Hanston-Smith auf die Weise zu danken, an die er sich so sehr gewöhnt hatte. Sie schlief ein letztes Mal mit ihm – hielt den armen Kerl bis in die frühen Morgenstunden auf Trab, wenn die Geschichte stimmt, die ich gehört habe –, dann ließ sie Romaniv ins Haus.«
Webberly verstummte und blickte auf, als draußen an die Tür geklopft wurde.
»Das blutige Ende ist aktenkundig. Das feine Paar ermordete Hanston-Smith, klaute alles, was es tragen konnte, floh nach Scarborough und war noch vor Morgengrauen außer Landes.«
»Und Nies’ Reaktion?«
»Er verlangte Kerridges sofortigen Rücktritt.«
Wieder klopfte es. Webberly ignorierte es.
»Den erreichte er allerdings nicht. Aber seitdem lechzt er danach wie ein Verdurstender in der Wüste.«
»Und jetzt bekommen wir es also wieder mit den beiden zu tun.«
Ein drittes Mal klopfte es, nachdrücklicher diesmal. Auf Webberlys »Herein« trat Bertie Edwards ein, Leiter der forensischen Abteilung, geschäftig wie immer, in der Hand seine Agenda, auf der er sich Notizen machte, während er gleichzeitig sprach. Edwards hatte zu seiner Agenda eine so innige Beziehung wie die meisten Männer zu ihren Sekretärinnen.
»Schwere Kontusion an der rechten Schläfe«, verkündete er vergnügt, »gefolgt von einem Riß der Halsschlagader. Keine Papiere, kein Geld, ausgezogen bis auf die Unterwäsche. Das ist eindeutig der Bahnhofskiller.« Mit einer schwungvollen Handbewegung vollendete er seine Aufzeichnungen.
Hillier betrachtete den kleinen Mann mit heftigem Widerwillen. »Herrgott noch mal, diese Gruselnamen, die sich die Presse immer ausdenkt!«
»Ist das der Tote vom Waterloo-Bahnhof?« fragte Webberly.
Edwards sah Hillier an. Man merkte ihm deutlich an, wie er überlegte, ob er sich mit ihm auf eine Diskussion darüber einlassen sollte, daß man unbekannten Mördern einen Schauernamen gab, um so die Öffentlichkeit aufzurütteln. Dann aber wischte er sich, als wollte er diesen Gedanken auslöschen, mit dem Ärmel seines Laborkittels über die Stirn und wandte sich seinem unmittelbaren Vorgesetzten zu.
»Ja, Waterloo.« Er nickte. »Nummer elf. Dabei sind wir noch nicht mal mit Vauxhall ganz fertig. Beide der gleiche Typ wie die bisherigen Opfer des Killers. Penner oder Stadtstreicher. Abgebrochene Nägel. Verdreckt. Ungepflegtes Haar. Verlaust. Nur der Tote vom King’s-Cross-Bahnhof fällt völlig aus dem Rahmen. Da gibt’s immer noch keine Anhaltspunkte. Keine Papiere. Und bis jetzt auch noch keine entsprechende Meldung beim Vermißtendezernat. Mir völlig schleierhaft.« Er kratzte sich mit dem Ende seines Füllers am Kopf. »Wollen Sie die Waterloo-Aufnahme? Ich hab’ sie mitgebracht.«
Webberly deutete zur Wand, wo bereits die Fotografien der zwölf letzten Ermordeten aufgehängt waren, die alle auf die gleiche Weise in oder nahe bei einem Londoner Bahnhof getötet worden waren. Dreizehn Morde jetzt in knapp mehr als fünf Wochen. Die Presse forderte erbittert eine Verhaftung. Als ließe ihn das völlig kalt, kramte Edwards, leise vor sich hin pfeifend, auf Webberlys Schreibtisch nach einer Reißzwecke. Dann trug er das letzte Opfer zur Wand.
»Keine üble Aufnahme.« Er trat zurück, um sein Werk zu bewundern. »Den haben wir ganz gut zusammengeflickt.«
»Hören Sie auf, Mann!« rief Hillier explosiv. »Da kann einem ja das kalte Grausen kommen. Sie könnten wenigstens Ihren schmutzigen Kittel ausziehen, wenn Sie hierherkommen. Haben Sie denn überhaupt kein Feingefühl? Hier oben arbeiten auch Frauen!«
Edwards trug geduldige Aufmerksamkeit zur Schau, doch sein Blick glitt über Hillier hin und blieb einen Moment an dem fleischigen Hals haften, der in Falten über dem Kragen hing, und dann an dem buschigen Haar, das Hillier gern als Löwenmähne bezeichnete. Er zuckte die Achseln und warf Webberly dabei einen verständnisinnigen Blick zu. »Ein echter Gentleman«, bemerkte er, ehe er aus dem Zimmer ging.
»Schmeiß ihn raus!« brüllte Hillier, als sich die Tür hinter dem Pathologen schloß.
Webberly lachte. »Trink einen Sherry, David«, sagte er. »Er steht im Schrank hinter dir. Wir alle sollten eigentlich an einem Samstag wie heute gar nicht hiersein.«
Zwei Sherrys beschwichtigten Hilliers Zorn über Bertie Edwards beträchtlich. Er stand vor Webberlys Schauwand und betrachtete verdrießlich die dreizehn Fotografien.
»Eine verdammte Sauerei ist das«, bemerkte er grimmig. »Victoria, Kring’s Cross, Waterloo, Liverpool, Blackfriars, Paddington. Verdammt noch mal, warum nicht wenigstens dem Alphabet nach?«
»Verrückten fehlt häufig die organisatorische Ader«, meinte Webberly gelassen.
»Fünf der Opfer haben nicht einmal Namen«, klagte Hillier.
»Papiere, Geld und Kleider werden den Opfern jedesmal abgenommen. Wenn keine Vermißtenmeldung vorliegt, versuchen wir’s zunächst mit den Fingerabdrücken. Du weißt, wie lange so was dauert, David. Wir tun unser Bestes.«
Hillier drehte sich um. Ja, das wußte er mit Sicherheit, daß Malcolm immer sein Bestes tat und still im Hintergrund blieb, wenn der Lorbeer verteilt wurde.
»Entschuldige. Ich war wohl unwirsch?«
»Ein bißchen.«
»Wie üblich. Also, um noch mal auf den neuesten Zusammenstoß zwischen Nies und Kerridge zurückzukommen – worum geht’s da eigentlich?«
Webberly sah auf seine Uhr.
»Wieder mal um einen Mord in Yorkshire. Sie schicken uns jemanden mit den Informationen. Einen Priester.«
»Einen Priester? Lieber Gott, was ist das denn für ein Fall?«
Webberly zuckte die Achseln. »Offenbar ist er der einzige, auf den sich Nies und Kerridge als Überbringer der Informationen einigen konnten.«
»Und wie kommt das?«
»Soviel ich weiß, hat er die Leiche gefunden.«
2
Hillier trat ans Bürofenster. Die Nachmittagssonne fiel auf sein Gesicht. Sie brachte Fältchen zum Vorschein, die von zu vielen langen Nächten zeugten, beleuchtete schlaglichtartig rosige Aufgedunsenheit, die von zuviel schwerem Essen und Portwein sprach.
»Das geht denn doch zu weit! Hat Kerridge den Verstand verloren?«
»Das behauptet Nies jedenfalls schon seit Jahren.«
»Uns einen Mann zu schicken, der nicht zur Truppe gehört – nur weil er zufällig zuerst am Tatort war! Was denkt dieser Mensch sich eigentlich?«
»Daß ein Priester der einzige ist, dem sie beide vertrauen können.« Webberly sah wieder auf seine Uhr. »Er müßte eigentlich innerhalb der nächsten Stunde hier aufkreuzen. Deshalb hab’ ich dich hergebeten.«
»Damit ich mir die Geschichte des Priesters anhören kann? Das entspricht aber gar nicht deinem Stil.«
Webberly schüttelte bedächtig den Kopf. Jetzt kam der kitzlige Teil der ganzen Angelegenheit.
»Nicht, damit du dir die Geschichte anhören kannst; damit du dir den Plan anhören kannst.«
»Na, da bin ich aber neugierig.«
Hillier ging zum Schrank und schenkte sich noch einen Sherry ein. Er hielt dem Freund die Flasche hin, aber der schüttelte den Kopf. Er setzte sich wieder in seinen Sessel und schlug die Beine übereinander, sorgsam darauf bedacht, die messerscharfe Bügelfalte in seiner maßgeschneiderten Hose nicht zu verknittern.
»Also, was ist das für ein Plan?« fragte er.
Webberly trommelte mit einem Finger auf einen Stapel Aktendeckel auf seinem Schreibtisch.
»Ich möchte Lynley für den Fall.«
Hillier zog eine Augenbraue hoch.
»Eine zweite Runde zwischen Nies und Lynley? Hatten wir aus dieser Ecke nicht schon genug Verdruß, Malcolm? Außerdem hat Lynley dieses Wochenende keinen Dienst.«
»Das läßt sich regeln.« Webberly wartete. Die Stille wurde drückend. »Du läßt mich zappeln, David«, sagte er schließlich.
Hillier lächelte. »Entschuldige. Ich wollte nur mal sehen, wie du es anstellen würdest, sie zu verlangen.«
»Verdammter Schurke«, schimpfte Webberly gedämpft. »Du kennst mich entschieden zu gut.«
»Sagen wir, ich kenne deine Neigung, die Fairneß weiter zu treiben, als dir selber guttut. Hör auf meinen Rat, Malcolm; laß die Havers dort, wo du sie hingesteckt hast.«
Webberly seufzte und schlug nach einer fiktiven Fliege.
»Es drückt mir aber aufs Gewissen.«
»Du schneidest dich höchstens ins eigene Fleisch. Barbara Havers hat während ihrer gesamten Dienstzeit bei der Kriminalpolizei hinlänglich bewiesen, daß sie nicht imstande ist, auch nur mit einem einzigen unserer Inspectoren zurechtzukommen. In den acht Monaten, seit sie wieder Uniform trägt, hat sie sich wesentlich besser bewährt. Laß sie dort.«
»Ich hab’ noch nicht versucht, sie mit Lynley zusammenzuspannen.«
»Du hast auch noch nicht versucht, sie mit dem Prinzen von Wales zusammenzuspannen! Es ist nicht deine Aufgabe, die Leute herumzuschieben, bis sie ein Plätzchen gefunden haben, wo sie in Glück und Frieden alt werden können. Es ist deine Aufgabe, dafür zu sorgen, daß die Arbeit getan wird. Und wo die Havers die Hände im Spiel hatte, hat es nie geklappt. Das mußt du doch zugeben.«
»Ich glaube, sie hat aus der Erfahrung gelernt.«
»Was denn? Was hat sie gelernt? Daß sie mit Aufsässigkeit und Sturheit bei uns nicht weiterkommt?«
Webberly ließ Hilliers Worte in der Luft verhallen.
»Tja«, sagte er dann, »das war immer schon das Problem, nicht?«
Hillier bemerkte die Resignation in der Stimme des Freundes. Das war in der Tat das Problem: vorwärtszukommen. Gott, wie hatte er nur etwas so Blödes sagen können.
»Verzeih mir, Malcolm.« Er trank eilig seinen Sherry aus, um seinem Schwager nicht ins Gesicht sehen zu müssen. »Du verdienst meinen Posten. Das wissen wir ja beide, nicht wahr?«
»Sei nicht albern.«
Hillier stand auf. »Ich lasse die Havers kommen.«
Sergeant Barbara Havers zog die Tür zum Büro des Superintendent hinter sich zu, ging mit steifen Schritten an seiner Sekretärin vorbei und trat in den Korridor hinaus, weiß vor Zorn.
Gott, diese bodenlose Unverschämtheit! Sie drängte sich ruppig an einem entgegenkommenden jungen Beamten vorbei und blieb nicht einmal stehen, als ihm die Aktendeckel, die er trug, aus der Hand fielen und auf dem Boden landeten. Sie stieg einfach darüber hinweg. Was glaubten diese Leute eigentlich, mit wem sie es zu tun hatten? Bildeten sie sich ein, sie wäre so dumm, das Spiel nicht zu durchschauen? Zum Teufel mit ihnen! Diese verdammten Heuchler.
Sie zwinkerte krampfhaft. Keine Tränen, sagte sie sich. Sie würde nicht weinen, sie würde nicht reagieren. Schon war sie in der Damentoilette. Hier war niemand. Hier war es kühl. War es in Webberlys Büro wirklich so heiß gewesen? Oder war das nur ihre Wut gewesen? Sie zerrte an ihrer Krawatte, lockerte sie und stolperte zum Waschbecken hinüber. Das kalte Wasser spritzte unter ihren nervösen Fingern in starkem Strahl aus dem Hahn, durchnäßte ihren Uniformrock und ihre weiße Bluse. Das hatte noch gefehlt! Sie sah sich im Spiegel an und brach in Tränen aus.
»Du blöde, häßliche Kuh!« beschimpfte sie sich innerlich.
Sie weinte nicht leicht, gerade darum waren ihre Tränen jetzt heiß und bitter, fühlten sich fremd und ungewohnt an, wie sie ihr über das reizlose Gesicht strömten, das rund und platt war wie das eines Mopses.
»Du bist wirklich ein Bild für Götter, Barbara«, höhnte sie. »Du bist ein prächtiger Anblick.«
Schluchzend ging sie vom Becken weg und lehnte ihren Kopf an die kühlen Wandkacheln.
Barbara Havers, dreißig Jahre alt, war eine entschieden unattraktive Frau, die es aber auch geradezu darauf anzulegen schien, so zu wirken. Statt das feine, glänzende Haar, das die Farbe hellen Fichtenholzes hatte, so zu frisieren, daß es ihrem Gesicht schmeichelte, trug sie es stumpf geschnitten bis knapp über die Ohren, als hätte sie sich einfach einen zu kleinen Topf über den Kopf gestülpt und losgeschnipselt. Sie schminkte sich nicht. Die starken Augenbrauen, die sie niemals zupfte, betonten ihre etwas zu kleinen Augen, nicht aber die wache Intelligenz ihres Blicks. Der schmallippige Mund war in ständiger Mißbilligung zusammengekniffen. Insgesamt vermittelte sie den Eindruck einer kleinen, völlig unnahbaren und spröden Person.
Jetzt haben sie dir also den Goldjungen zugeteilt, dachte sie. Wie schön für dich, Barb! Nach acht elenden Monaten Streife holen sie dich zurück, um dir »noch einmal eine Chance zu geben« – und ausgerechnet mit Lynley!
»Ich tu’s nicht«, murmelte sie. »Fällt mir gar nicht ein. Ich arbeite nicht mit diesem affigen Kerl.«
Sie stieß sich von der Wand ab und trat wieder ans Becken. Sie ließ Wasser einlaufen, vorsichtig diesmal, und beugte sich hinunter, um ihr heißes Gesicht zu kühlen und die Tränenspuren wegzuwaschen.
»Ich möchte Ihnen noch einmal eine Chance bei der Kriminalpolizei geben«, hatte Webberly gesagt.
Er hatte mit einem Brieföffner auf seinem Schreibtisch gespielt, aber sie hatte die Fotografien an der Wand gesehen und hatte Hoffnung geschöpft. Der Bahnhofskiller! Da mitzuarbeiten! O ja, lieber Gott, ja! Wann fange ich an? Mit MacPherson zusammen?
»Es handelt sich um einen merkwürdigen Fall mit einem jungen Mädchen oben in Yorkshire.«
Also doch nicht der Bahnhofskiller. Aber ein Fall immerhin. Ein junges Mädchen, sagen Sie? Natürlich, da kann ich helfen. Mit Stewart zusammen wohl? Der ist in Yorkshire wie zu Hause. Wir würden sicher gut zusammenarbeiten. Ganz bestimmt.
»Ich erwarte die Informationen in ungefähr einer Dreiviertelstunde. Da brauche ich Sie hier; vorausgesetzt natürlich, Sie sind interessiert.«
Vorausgesetzt, ich bin interessiert! Eine Dreiviertelstunde. Da kann ich mich noch umziehen, schnell was essen. Wieder herkommen. Dann mit dem Abendzug nach York fahren.
»Vorher müßten Sie allerdings noch nach Chelsea hinüberfahren.«
Das Gespräch kam plötzlich zum Stillstand.
»Nach Chelsea, Sir?«
»Ja«, antwortete Webberly leichthin und ließ den Brieföffner mitten in das Durcheinander auf seinem Schreibtisch fallen. »Sie arbeiten mit Inspector Lynley zusammen, und den müssen wir leider erst von der St.-James-Hochzeit in Chelsea weglotsen.« Er sah auf seine Uhr. »Die Trauung war um elf, da ist die Feier zweifellos inzwischen in vollem Gang. Wir haben versucht, ihn telefonisch zu erreichen, aber das Telefon ist offenbar ausgehängt.« Er blickte auf und sah ihr fassungsloses Gesicht. »Ist etwas nicht in Ordnung, Sergeant?«
»Inspector Lynley?« Sie begriff mit einem Schlag. Warum man sie brauchte, warum niemand anderer in Frage kam.
»Ja, Lynley. Irgendwelche Probleme?«
»Nein, nein, keine.« Und dann verspätet: »Sir.«
Webberly taxierte mit klugem Auge ihre Reaktion.
»Gut. Das freut mich zu hören. Sie können bei der Zusammenarbeit mit Lynley eine Menge lernen.« Noch immer ruhte sein aufmerksamer Blick abschätzend auf ihrem Gesicht. »Versuchen Sie, so bald wie möglich zurückzusein.«
Er wandte sich wieder den Papieren auf seinem Schreibtisch zu. Sie war entlassen.
Barbara schaute erneut in den Spiegel, kramte ihren Kamm aus der Rocktasche. Lynley. Sie zog den Plastikkamm erbarmungslos durch ihr Haar, so fest, daß die Zinken ihre Kopfhaut aufkratzten, und war fast dankbar für den Schmerz. Lynley! Es war nur allzu offensichtlich, warum man sie zurückgeholt hatte. Man wollte Lynley den Fall anvertrauen. Aber man brauchte auch eine Frau. Und jeder in der Victoria Street wußte, daß es in der ganzen Kriminalpolizei keine Beamtin gab, die vor Lynley sicher war. Er hatte sich durch sämtliche Abteilungen durchgeschlafen, unersättlich und unermüdlich, wenn man dem Getuschel glauben durfte. Der reinste Deckhengst. Zornig schob sie den Kamm wieder in ihre Tasche.
Und wie, fragte sie ihr Spiegelbild, fühlt man sich, wenn man die einzige Frau ist, die vor dem nimmersatten Lynley sicher ist? Nein, mit unserer Barb im Auto läuft da gar nichts. Keine intimen Abendessen, um »unsere Ermittlungsergebnisse zu besprechen«. Keine Einladungen nach Cornwall, um »in aller Ruhe über den Fall nachzudenken«. Da hast du nichts zu fürchten, Barb. Du bist vor Lynley sicher. In den fünf Jahren ihrer Zusammenarbeit in derselben Abteilung hatte der Mann es mit Erfolg vermieden, sie auch nur mit ihrem Namen anzusprechen, ganz zu schweigen von einer, wenn auch noch so flüchtigen, Aufnahme persönlichen Kontaktes, der ihm zweifellos zuwider gewesen wäre. Als wären niedrige Herkunft und öffentliche Schulbildung soziale Krankheiten mit höchster Ansteckungsgefahr.
Sie ging aus der Toilette und eilte den Korridor hinunter zum Aufzug. Gab es in ganz New Scotland Yard überhaupt einen Menschen, den sie mehr haßte als Lynley? Er war die Verkörperung all dessen, was sie zutiefst verachtete: Schulbildung in Eton, Geschichtsstudium in Oxford, eine manierierte upper class-Diktion, ein hochherrschaftlicher Stammbaum, der sich bis zur Schlacht bei Hastings zurückverfolgen ließ. Beste Familie. Intelligent. Und so verdammt charmant, daß sie nicht verstehen konnte, wieso nicht jeder Kriminelle in der Stadt vor seinem Charme einfach die Waffen streckte.
Der Grund, den er für seine Tätigkeit beim Yard angab, war der reinste Witz, ein hübsch erfundenes Märchen, das sie nun wirklich nicht schluckte. Er wolle ein nützliches Mitglied der Gesellschaft sein, einen Beitrag leisten. Eine berufliche Karriere in London lag ihm mehr am Herzen als das Leben auf dem Familiengut. Einfach lachhaft.
Die Aufzugtür öffnete sich, und sie stieg ein, um in die Tiefgarage hinunterzufahren. Und wie angenehm glatt und reibungslos war seine Karriere verlaufen, billig erkauft mit dem Familienvermögen. Bis zum Commissioner würde er es mindestens bringen.
Ihr Wagen, ein rostzerfressener Mini, stand in der hintersten Ecke der Garage. Wie angenehm, reich zu sein wie Lynley, zum alten Adel zu gehören, nur aus Jux zu arbeiten, abends in das vornehme Stadthaus in Belgravia heimzukehren und am Wochenende auf das Gut in Cornwall zu fliegen. Um sich von hinten bis vorn bedienen zu lassen von Butler, Dienstmädchen, Köchinnen und Lakaien.
Stell’s dir vor, Barb: du in Gesellschaft von soviel Glanz und Herrlichkeit. Was würdest du tun? Dahinschmelzen oder dich übergeben?
Sie schleuderte ihre Handtasche auf den Rücksitz, knallte die Wagentür zu und ließ den Motor an, der einmal kurz hustete und dann aufheulte. Die Reifen quietschten auf dem Beton, als sie die Rampe hinaufraste. Sie nickte dem diensthabenden Beamten an der Pforte kurz zu und fuhr auf die Straße hinaus.
Dank dem geringen Wochenendverkehr brauchte sie von der Victoria Street zum Embankment nur wenige Minuten. Das milde Lüftchen des Oktobernachmittags kühlte ihren Zorn und beruhigte ihre Nerven, so daß sie ihre Empörung langsam vergaß. Es war wirklich eine hübsche Fahrt zum Haus der St. James.
Barbara mochte Simon Allcourt-St.-James, hatte ihn schon von dem Tag an gemocht, als sie ihm vor zehn Jahren das erste Mal begegnet war. Sie selbst damals eine unsichere Zwanzigjährige, frischgebackene Polizistin, die sich nur allzu bewußt war, daß sie in eine streng gehütete Männerwelt eingebrochen war, wo man die Frauen, die eigentlich Kolleginnen sein sollten, nach ein paar Bier immer noch gönnerhaft Mäuschen nannte. Und das war noch lange nicht der schlimmste Name, den man ihnen gab – das wußte sie. Zum Teufel mit ihnen allen. Für die war jede Frau, die in die Kriminalpolizei wollte, von vornherein eine arme Irre, und man ließ es sie fühlen. St. James jedoch, zwei Jahre älter als sie, hatte sie als Kollegin akzeptiert, ja als Freundin sogar.
St. James war jetzt selbständiger gerichtsmedizinischer Gutachter, aber er hatte seine Laufbahn beim Yard begonnen. Mit vierundzwanzig bereits hatte er dank rascher Auffassungsgabe, klarer Wahrnehmung und Intuition zu den besten Leuten dort gehört. Er hätte jeden Weg einschlagen können: Ermittlung, Pathologie, Verwaltung. Aber dann war vor acht Jahren plötzlich alles ganz anders gekommen. Auf einer wilden Autofahrt mit Lynley über die Dörfer Surreys war all seinen Hoffnungen ein jähes Ende gesetzt worden. Sie waren beide betrunken gewesen – St. James hatte das immer bereitwillig zugegeben. Aber alle wußten, daß Lynley an dem Abend am Steuer gesessen, daß er in einer Kurve die Herrschaft über den Wagen verloren hatte. Und Lynley war ohne eine Schramme davongekommen, während sein Jugendfreund St. James den Unfall nur als Krüppel überstanden hatte. Er hätte seine Laufbahn am Yard fortsetzen können, doch er hatte sich statt dessen in ein Haus in Chelsea verkrochen, das seiner Familie gehörte, und dort vier Jahre lang wie ein Einsiedler gehaust. Alles Lynley zu verdanken, dachte sie grimmig.
Es war für sie völlig unfaßbar, daß St. James die Freundschaft zu diesem Menschen aufrechterhalten hatte. Doch er hatte es getan, und irgend etwas, irgendeine besondere Situation hatte vor fast fünf Jahren die Beziehung zwischen den beiden Männern noch vertieft und St. James wieder ins Berufsleben zurückgeführt. Auch das, dachte sie widerstrebend, war Lynley zu verdanken.
Sie manövrierte den Mini in eine Parklücke in der Lawrence Street und ging zu Fuß über den Lordship Place zur Cheyne Road. Weiße Holz- und Stuckarbeit zierte die tiefbraunen Backsteinhäuser dieser Gegend nahe der Themse, die schmiedeeisernen Gitter an Fenstern und Balkons glänzten frisch gestrichen. Die Straßen Chelseas, ehemals ein Dorf vor den Toren Londons, waren schmal, vom ausladenden Geäst herbstlich leuchtender Platanen und Ulmen überdacht. Das Haus der St. James’ stand an einer Ecke, und als Barbara an der hohen Backsteinmauer vorüberging, die den Garten umgab, hörte sie von drüben Stimmengewirr und Gelächter. Jemand brachte laut einen Toast aus, Bravorufe und Applaus folgten. Die alte Eichentür in der Mauer war geschlossen, aber das machte nichts. In ihrer Uniform wollte sie sowieso nicht mitten in das festliche Treiben hineinplatzen, als sei sie gekommen, jemanden zu verhaften.
Als sie um die Ecke bog, sah sie, daß die Tür des hohen alten Hauses offenstand. Gelächter kam ihr entgegen, der klare Klang von Silber und Porzellan, der Knall eines Champagnerkorkens, Geigen- und Flötenklänge aus dem Garten. Überall waren Blumen. Weiße und rosafarbene Rosen, die einen schweren Duft verströmten, wanden sich um das Treppengeländer vor der Haustür, und vom Balkon fielen in farbiger Pracht Ranken von Trompetenblumen herab.
Barbara holte tief Atem und stieg die Treppe hinauf. Mehrere Gäste bei der Tür warfen ihr neugierige Blicke zu, als sie in ihrer schlecht sitzenden Uniform zögernd stehenblieb, doch sie schlenderten wieder in den Garten hinaus, ohne sie anzusprechen. Es würde ihr nichts anderes übrigbleiben, als sich mitten in die Hochzeitsgesellschaft hineinzuwagen, wenn sie Lynley finden wollte. Bei dem Gedanken wurde ihr beklommen zumute.
Sie wollte gerade zu ihrem Wagen zurücklaufen und einen alten Trenchcoat holen, um ihn über die Uniform zu ziehen, als Schritte und Gelächter auf der Treppe im Vestibül ihre Aufmerksamkeit auf sich zogen. Eine Frau kam herunter, den Kopf nach rückwärts gewandt, um jemandem, der oben geblieben war, etwas zuzurufen.
»Wir gehen allein. Nur wir zwei. Komm doch mit, Sid, das wird bestimmt nett.«
Sie drehte sich um, sah Barbara und blieb, eine Hand auf dem Geländer, stehen. Eine nicht sehr große, aber sehr schlanke Frau in einem teefarbenen Seidenkleid von fließender Eleganz. Langes kastanienbraunes Haar umrahmte ein ebenmäßiges, ovales Gesicht. Barbara erkannte sie sofort; sie hatte Lynley oft genug im Yard abgeholt. Lady Helen Clyde, Lynleys Freundin und St. James’ Laborantin. Sie setzte sich jetzt wieder in Bewegung, kam die Treppe herunter und ging auf Barbara zu. Mit einer beneidenswerten Selbstsicherheit, wie Barbara feststellte.
»Ich habe das schreckliche Gefühl, daß Sie Tommys wegen hier sind«, sagte sie sogleich und bot Barbara die Hand. »Hallo. Ich bin Helen Clyde.«
Barbara nannte ihren Namen. Der kräftige Händedruck der Frau überraschte sie. Ihre Hände waren schmal und kühl.
»Er wird im Yard gebraucht.«
»Der Ärmste. So ein Pech. Das ist wirklich schade.« Helen sprach mehr zu sich selbst und sah Barbara plötzlich mit entschuldigendem Lächeln an. »Aber das ist ja nicht Ihre Schuld, nicht? Kommen Sie. Er ist gleich da drüben.«
Ohne auf eine Antwort zu warten, ging sie durch das Vestibül zur Gartentür. Barbara blieb nichts anderes übrig, als ihr zu folgen. Aber sie trat schon beim ersten Blick auf die weiß gedeckten Tische, an denen lachend und plaudernd die festlich gekleideten Gäste saßen, hastig in den Schatten des Vestibüls zurück. Unwillkürlich griff sie sich an den Hals.
Helen blieb stehen und sah sie aufmerksam an.
»Soll ich Tommy für Sie suchen?« erbot sie sich mit einem Lächeln. »Das ist so ein Durcheinander hier draußen, nicht?«
»Danke«, antwortete Barbara steif und sah ihr nach, wie sie über den Rasen zu einer Gruppe von Leuten ging, in heiterem Gespräch um einen blendend aussehenden Mann geschart.
Helen berührte seinen Arm und sagte etwas. Er wandte sich zum Haus. Sein ebenmäßiges Gesicht wirkte so zeitlos wie eine griechische Skulptur. Er strich sich das blonde Haar aus der Stirn, stellte sein Champagnerglas auf einen Tisch in der Nähe, wechselte noch ein scherzhaftes Wort mit seinen Freunden und kam dann in Begleitung von Helen zum Haus.
Barbara beobachtete ihn. Seine Bewegungen waren anmutig und geschmeidig wie die einer Katze. Er war der schönste Mann, den sie je gesehen hatte. Sie verabscheute ihn.
»Sergeant Havers.« Er nickte ihr zu. »Ich bin dieses Wochenende nicht im Dienst.« Barbara verstand die eigentliche Bedeutung seiner Worte genau. Sie stören, Havers.
»Webberly schickt mich, Sir. Sie können ihn ja anrufen.«
Sie sah ihn nicht an, während sie sprach, richtete den Blick vielmehr auf einen Punkt unmittelbar über seiner linken Schulter.
»Aber er muß doch wissen, daß heute die Hochzeit ist, Tommy«, warf Helen ein.
»Ja, natürlich weiß er das, verdammt noch mal«, erwiderte Lynley gereizt. Er sah in den Garten hinaus, dann mit scharfem Blick auf Barbara. »Geht es um den Bahnhofskiller? Mir wurde gesagt, daß Stewart MacPherson unterstützen soll.«
»Es geht um einen Fall im Norden, soviel ich weiß. Eine Geschichte mit einem jungen Mädchen.«
Diese Information, dachte Barbara, würde er zu schätzen wissen. Eine Prise Pfeffer, wie er sie liebte. Sie wartete, daß er nach den Einzelheiten fragen würde, die ihn zweifellos am meisten interessierten: Alter, Personenstand und Körpermaße der holden Maid, deren Not zu lindern er gewiß nur allzu bereit war.
Er kniff die Augen zusammen. »Im Norden?«
Helen lachte wehmütig. »Da werden wir unsere Pläne für heute abend wohl vergessen können, Tommy. Und ich hatte Sidney gerade überredet, auch mitzukommen.«
»Ja, das ist wahrscheinlich nicht zu ändern«, meinte Lynley. Er trat unvermittelt aus dem Schatten ins Licht, und die Ruckhaftigkeit dieser Bewegung wie auch sein Gesichtsausdruck verrieten Barbara, wie ärgerlich er tatsächlich war.
Helen sah es offenbar auch, denn sie begann gleich wieder in heiterem Ton zu sprechen.
»Sid und ich könnten natürlich auch allein tanzen gehen. Schließlich ist der androgyne Mensch ja heute die große Mode. Da könnte eine von uns leicht als Mann gelten, ganz gleich, wie wir angezogen sind. Im übrigen ist Jeffrey Cusick auch noch da. Wir brauchen ihn nur anzurufen.« Das schien ein Privatscherz zwischen den beiden zu sein, und er verfehlte die gewünschte Wirkung nicht. Lynley lächelte.
»Cusick?« sagte er lachend. »Die Zeiten scheinen wirklich hart zu sein.«
»Lach du nur«, sagte Helen und lachte selbst. »Aber er ist immerhin mit uns nach Ascot zum Rennen gefahren, während du am St.-Pancras-Bahnhof auf Mörderjagd warst. Auch Leute, die nur in Cambridge studiert haben, haben ihre Qualitäten.«
Lynley schmunzelte. »Ja, zum Beispiel, daß sie im Abendanzug alle wie Pinguine aussehen.«
»Ach, du bist ein schrecklicher Mensch!« Helen wandte sich Barbara zu. »Darf ich Ihnen wenigstens etwas von dem köstlichen Krabbencocktail anbieten, ehe Sie Tommy ins Yard schleppen? Ich habe da vor Jahren einmal ein strohtrockenes Schinkenbrot serviert bekommen. Wenn das Essen sich inzwischen nicht gebessert hat, ist das hier vielleicht Ihre letzte Chance, etwas Anständiges zu sich zu nehmen.«
Barbara sah auf ihre Uhr. Lynley hoffte zweifellos, sie würde die Einladung annehmen, so daß ihm noch ein paar Minuten mit seinen Freunden vergönnt sein würden, ehe er dem Ruf der Pflicht folgte. Aber es fiel ihr nicht ein, ihm den Gefallen zu tun.
»Die Besprechung fängt leider schon in zwanzig Minuten an.«
Helen seufzte. »Ja, da bleibt Ihnen natürlich keine Zeit mehr für einen Imbiß. Soll ich auf dich warten, Tommy, oder soll ich Jeffrey anrufen?«
»Tu das lieber nicht«, antwortete Lynley. »Dein Vater würde dir nie verzeihen, daß du deine Zukunft in die Hände von Cambridge legst.«
Sie lachte wieder. »Na schön. Aber dann laß mich schnell noch das Brautpaar holen, ehe du gehst.«
Sein Gesicht veränderte sich schlagartig.
»Nein. Helen, ich – entschuldige mich einfach bei ihnen.«
Ein rascher Blick flog zwischen ihnen hin und her, Austausch unausgesprochener Gedanken.
»Du muß dich selbst von ihnen verabschieden, Tommy«, sagte Helen leise. Sie schwieg einen Moment, suchte offensichtlich nach einem Kompromiß. »Ich sage ihnen, daß du im Arbeitszimmer wartest.«
Sie ging rasch davon, ohne Lynley Gelegenheit zu einer Erwiderung zu lassen.
Er murmelte etwas Unverständliches, während sein Blick Helen folgte, die schon durch den Garten eilte.
»Sind Sie mit dem Wagen da?« fragte er Barbara plötzlich und drehte sich um, den Flur entlangzugehen, weg von der Feier.
Verblüfft folgte sie ihm.
»Ja, mit meinem Mini. Sie werden sich in Ihrem Cut etwas sonderbar darin ausnehmen.«
»Ich passe mich schon an, keine Sorge. Welche Farbe hat er?«
Sie war verwundert über die Frage, dachte sich, er bemühe sich wohl, recht und schlecht Konversation zu machen.
»Hauptsächlich Rost.«
»Meine Lieblingsfarbe.« Er hielt ihr eine Tür auf und ließ ihr den Vortritt in ein dunkles Zimmer.
»Ich erwarte Sie am besten im Auto, Sir. Es steht –«
»Bleiben Sie hier, Sergeant.« Es war ein Befehl.
Widerstrebend trat sie in das Zimmer. Die Vorhänge waren zugezogen, Licht kam nur durch die von ihm geöffnete Tür. Dennoch konnte Barbara die dunkle Wandtäfelung erkennen, die mit Büchern gefüllten Regale, die bequemen, einladenden Sitzmöbel. Es roch nach altem Leder und einem Hauch Scotch.
Lynley wanderte zerstreut zu einer Wand voller gerahmter Fotografien und blieb dort schweigend stehen, den Blick auf ein Bild gerichtet, das im Mittelpunkt der Sammlung hing. Es war in einem Friedhof aufgenommen. Ein Mann stand vornübergebeugt vor einem Grabstein und berührte mit einer Hand die verwitterte Inschrift. Die geschickte Komposition der Aufnahme lenkte den Blick des Betrachters von der starren Beinschiene ab, die den Mann in seiner Haltung behinderte, und zog ihn statt dessen auf das von wachem Interesse bewegte schmale Gesicht. Lynley stand da und starrte auf das Bild und schien Barbaras Anwesenheit völlig vergessen zu haben.
»Sie haben mich zurückgeholt«, bemerkte Barbara, die fand, dieser Moment wäre zur Eröffnung der Neuigkeit so günstig wie jeder andere. »Deshalb bin ich hier, falls Sie das wundern sollte.«
Er drehte sich langsam nach ihr um.
»Wieder bei der Kripo?« fragte er. »Wie schön für Sie, Barbara.«
»Aber nicht für Sie.«
»Wie meinen Sie das?«
»Na ja, einer muß es Ihnen ja sagen, da Webberly es offensichtlich nicht getan hat. Herzlichen Glückwunsch: ab heute haben Sie mich auf der Pelle.« Sie wartete auf eine Äußerung der Überraschung. Als nichts kam, fügte sie hinzu: »Es ist natürlich eine Zumutung für Sie – glauben Sie nicht, daß ich das nicht weiß. Es ist mir schleierhaft, was Webberly bezweckt.«
Sie hörte kaum ihre eigenen Worte, während sie sprach, wußte nicht, ob sie die unvermeidliche Reaktion vorwegnehmen oder provozieren wollte: den explosionsartigen Ausbruch von Zorn und Ärger, den Griff zum Telefon, die Forderung nach einer Erklärung oder, schlimmer noch, die eisige Höflichkeit, die aufrechterhalten werden würde, bis er den Kommissar hinter verschlossener Tür hatte.
»Ich kann mir nur denken, daß niemand anderer verfügbar ist oder daß ich ein verborgenes Talent besitze, von dem nur Webberly weiß. Oder vielleicht ist es auch nur ein kleiner Streich.« Sie lachte ein wenig zu laut.
»Oder vielleicht sind Sie die Beste für die Aufgabe«, vollendete Lynley. »Was wissen Sie über den Fall?«
»Ich – nichts. Nur daß –«
»Tommy?«
Sie drehten sich beide um beim Klang der Stimme. Die Braut stand an der offenen Tür, Blumen im kupferroten Haar, das ihr lose auf Schultern und Rücken herabfiel. Im Gegenlicht des Flurs stehend, wirkte sie in ihrem elfenbeinfarbenen Kleid wie eine zum Leben erwachte Schöpfung Tizians.
»Helen sagte mir, daß du weg mußt?«
Lynley schien es die Sprache verschlagen zu haben. Er griff in seine Tasche, zog ein goldenes Zigarettenetui heraus, öffnete es und klappte es sogleich mit flüchtig aufflammendem Ärger wieder zu. Die Braut sah ihn stumm an, und einen Moment schien es, als zitterten ihre Hände ganz leicht.
»Der Dienst, Deb«, sagte Lynley endlich. »Ich muß ins Yard.«
Sie erwiderte nichts, spielte zerstreut mit dem Anhänger an ihrem Hals. Erst als er ihr in die Augen sah, antwortete sie.
»Das ist aber eine Enttäuschung für uns alle. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes. Simon sagte mir gestern abend, daß du vielleicht wieder an dem Fall mit dem Bahnhofsmörder mitarbeiten mußt.«
»Nein, es ist nur eine Besprechung.«
»Ach so.« Sie schien noch etwas sagen zu wollen, setzte sogar schon zum Sprechen an, wandte sich dann aber plötzlich mit einem freundlichen Lächeln Barbara zu. »Ich bin Deborah St. James.«
Lynley rieb sich die Stirn. »Oh, ich bitte um Entschuldigung.« Mechanisch stellte er Barbara vor. »Wo ist Simon?« fragte er dann.
»Er war direkt hinter mir, aber ich glaube, Vater hat ihn abgefangen. Er würde uns am liebsten nicht allein reisen lassen. Er ist überzeugt, daß ich überhaupt nicht imstande bin, gut genug für Simon zu sorgen.« Sie lachte. »Vielleicht hätte ich mir zweimal überlegen sollen, ob ich es wirklich riskieren will, einen Mann zu heiraten, der der Augapfel meines Vaters ist. ›Vergiß nicht die Elektroden‹, sagt er dauernd. ›Denk daran, jeden Morgen nach seinem Bein zu sehen.‹ Ich glaube, das hat er mir heute schon mindestens zehnmal gesagt.«
»Ja, ich kann mir vorstellen, daß er euch am liebsten auf die Hochzeitsreise begleiten würde.«
»Na ja, sie waren ja auch nie länger als höchstens einen Tag getrennt, seit –« Sie brach in plötzlicher Verlegenheit ab. Ihre Blicke trafen sich. Röte stieg ihr ins Gesicht.
Zwischen ihnen war plötzlich ein peinliches Schweigen. Man spürte die Spannung, die in der Luft lag, bis endlich – Gott sei Dank, dachte Barbara – schleppende, unregelmäßige Schritte im Flur hörbar wurden, die das Nahen von Deborahs Mann ankündigten.
»Ich höre, Sie wollen uns Tommy entführen.« St. James blieb an der Tür stehen, sprach aber in ruhigem Ton weiter, wie das seine Gewohnheit war, um die Aufmerksamkeit von seinem Gebrechen abzulenken und den Menschen in seiner Umgebung die Befangenheit zu nehmen. »Das ist ja eine ganz neue Sitte, Barbara. Früher wurde die Braut entführt, nicht der Trauzeuge.«
Er wirkte, fand Barbara, wie Lynleys dunkler Bruder. Abgesehen von den Augen, blau wie der Himmel über den Highlands, und den Händen, sensitiv wie die eines Künstlers, war Simon Allcourt-St. James ein häßlicher Mann. Das dunkle lockige Haar stand ihm in krauser Mähne vom Kopf ab. Das Gesicht, schmal und kantig, wirkte hart, ja furchteinflößend im Zorn, und konnte doch voll heiterer Gutmütigkeit sein, wenn ein Lächeln es weich machte. Er war schmal und nicht sehr kräftig, ein Mensch, der allzuviel Schmerz und Qual hatte erleiden müssen.
Barbara lächelte, als er kam, ihr erstes echtes Lächeln an diesem ganzen Nachmittag.
»Aber selbst Trauzeugen werden im allgemeinen nicht von Scotland Yard entführt. Wie geht es Ihnen, Simon?«
»Gut. Zumindest sagt mir das mein Schwiegervater immer wieder. Ich sei ein Glückspilz, behauptet er. Anscheinend hat er alles von Anfang an gewußt. Vom Tag ihrer Geburt an. Sie haben sich mit Deborah bekannt gemacht?«
»Ja, im Moment.«
»Und wir können Sie nicht überreden, ein bißchen zu bleiben?«
»Webberly hat eine Besprechung angesetzt«, warf Lynley ein. »Du kennst ihn doch.«
»Nur allzugut. Dann werden wir wohl auf euch verzichten müssen. Wir fahren auch bald. Helen hat die Adresse, falls irgendwas sein sollte.«
»Mach dir keine Gedanken.« Lynley hielt inne, als wüßte er nicht recht, was er als nächstes tun sollte. »Von Herzen alles Gute, Simon«, sagte er schließlich etwas lahm.
»Danke«, antwortete St. James, nickte Barbara zu, berührte flüchtig die Schulter seiner Frau und ging aus dem Zimmer.
Wie merkwürdig, dachte Barbara. Sie haben sich nicht einmal die Hand gegeben.
»Willst du in diesem Aufzug ins Yard fahren?« fragte Deborah Lynley.
Er blickte an sich hinunter. »Ich muß doch meinem Ruf als Playboy gerecht werden.«
Sie lachten beide, warm und herzlich. Aber plötzlich brach das Lachen ab, und wieder schlich sich dieses unbehagliche Schweigen ein.
»Tja«, sagte Lynley.
»Ich wollte eigentlich eine Rede halten«, sagte Deborah hastig und senkte die Augen zum Boden. Wieder schienen ihre Hände zu zittern, und eine Blume fiel aus ihrem Haar zum Teppich hinunter. Sie hob den Kopf. »Weißt du – so, wie Helen so etwas machen würde. Ich wollte von meiner Kindheit erzählen, von Vater und von diesem Haus. Du weißt schon. Geistreich und witzig. Aber für so was fehlt mir einfach das Talent. Da bin ich hoffnungslos unbegabt.«
Wieder blickte sie zu Boden und bemerkte, daß ein kleiner Dackel ins Zimmer gekommen war, ein paillettenbesticktes Täschchen in der Schnauze. Der Hund legte Deborah das Täschchen zu Füßen und wedelte stolz mit dem Schwanz.
»Um Gottes willen, Peach!« Lachend bückte sich Deborah, um das Täschchen aufzuheben, aber als sie sich wiederaufrichtete, glänzten Tränen in ihren Augen. »Danke dir, Tommy. Danke dir für alles. Wirklich. Für alles.«
»Alles Gute, Deb«, sagte er. Dann ging er zu ihr, nahm sie kurz in den Arm und streifte mit den Lippen ihr Haar.
Während Barbara dastand und die beiden beobachtete, war ihr plötzlich klar, daß St. James aus irgendeinem Grund die beiden absichtlich allein gelassen hatte, um Lynley Gelegenheit zu geben, genau das zu tun.
3
Der Leiche fehlte der Kopf. Das war das markanteste an den Fotografien, die zwischen den drei Kriminalbeamten an dem runden Tisch in einem Büro in Scotland Yard herumgereicht wurden.
Pater Hart blickte nervös von einem Gesicht zum anderen, während er den kleinen silbernen Rosenkranz in seiner Tasche durch seine Finger laufen ließ. Pius XII. hatte ihn 1952 gesegnet. Nicht bei einer Einzelaudienz natürlich. Dergleichen hätte man nicht einmal zu hoffen gewagt. Aber diese zitternde, von Gott begnadete Hand, die über zweitausend ehrfürchtigen Pilgern das Zeichen des Kreuzes gemacht hatte, verfügte zweifellos über eine höhere Macht. Mit geschlossenen Augen hatte er den Rosenkranz hoch über seinen Kopf gehalten, als würde ihn dadurch der Segen des Papstes um so machtvoller treffen.
Er war kurz vor dem dritten Gesätz des schmerzensreichen Rosenkranzes, als der hochgewachsene blonde Mann vor sich hin murmelte: »Welch ein Streich ward hier geführt...«
War er von der Polizei? Wieso aber war der Mann so förmlich gekleidet? Doch jetzt, als Pater Hart diese Worte hörte, schaute er ihn hoffnungsvoll an.
»Ah, Shakespeare. Ja. Irgendwie genau das Richtige.«
Der Dicke mit der Zigarre sah ihn verständnislos an. Pater Hart räusperte sich, während sie sich wiederum über die Fotografien beugten.
Er war nun seit fast einer Viertelstunde hier, und in dieser Zeit war kaum ein Wort gefallen. Der ältere Mann hatte sich die Zigarre angezündet, die Frau hatte zweimal etwas hinuntergeschluckt, was sie hatte sagen wollen, sonst war bis auf diese Zeile Shakespeare nichts geschehen.
Die Frau schlug ab und zu nervös mit den Fingern auf den Tisch. Sie war auf jeden Fall von der Polizei. Pater Hart erkannte das an ihrer Uniform. Aber sie wirkte sehr unangenehm mit ihren kleinen Wieselaugen und dem verkniffenen schmalen Mund. Sie war nicht die Richtige. Nicht für ihn. Nicht für Roberta. Was sollte er sagen?
Immer noch machten die grauenhaften Fotografien die Runde. Pater Hart brauchte sie nicht anzusehen. Er wußte nur zu gut, was sie zeigten. Er war als erster am Ort gewesen. Das Bild war unauslöschlich in sein Gedächtnis eingegraben. William Teys – in seiner ganzen Größe von einem Meter neunzig – in fötaler Stellung auf der Seite liegend, den rechten Arm ausgestreckt, als wolle er noch etwas greifen, den linken Arm in den Magen gedrückt, die Knie fast bis zur Brust hochgezogen, und dort, wo der Kopf hätte sein müssen – nichts. Neben ihm Roberta. Und die schrecklichen Worte: »Ich war’s. Es tut mir nicht leid.«
Der Kopf lag in einem Haufen feuchten Heus in einer Ecke des Stalls. Und als er ihn gesehen hatte ... O Gott, die tückischen Augen einer Ratte glitzerten in dem ausgehöhlten Loch – klein natürlich –, aber die graue Schnauze mit den zitternden Barthaaren war blutrot, und die winzigen Krallen scharrten. Vater unser, der du bist im Himmel... Vater unser, der du bist im Himmel ... Das geht doch weiter, es geht weiter, und ich kann mich nicht erinnern!
»Pater Hart.« Der blonde Mann im Cut hatte seine Lesebrille abgenommen und ein goldenes Zigarettenetui herausgezogen. »Rauchen Sie?«
»Ich – ja danke.«
Pater Hart griff rasch nach dem Etui, damit die anderen nicht sehen konnten, wie stark seine Hand zitterte. Der Mann bot das Etui der Frau an, die in heftiger Ablehnung den Kopf schüttelte. Ein silbernes Feuerzeug kam zum Vorschein. Das alles dauerte ein paar Sekunden, die Zeit, die er brauchte, um seine wirren Gedanken zu sammeln.
Der blonde Mann lehnte sich in seinem Sessel zurück und betrachtete eine lange Reihe von Fotografien, die an einer Wand des Büros aufgehängt waren.
»Warum sind Sie an dem Tag auf den Hof gegangen, Pater Hart?« fragte er ruhig, während sein Blick von einem Bild zum nächsten wanderte.
Pater Hart blinzelte kurzsichtig zu der Bilderwand. Waren das Fotos von Verdächtigen? War Scotland Yard der gemeinen Bestie schon auf der Spur? Er konnte es nicht erkennen, war aus dieser Entfernung nicht einmal sicher, daß die Aufnahmen überhaupt Menschen zeigten.