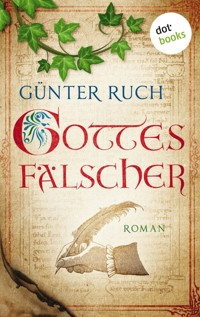
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine historische Persönlichkeit, die zu Unrecht vergessen wurde: Der Mittelalter-Roman »Gottes Fälscher« von Günter Ruch jetzt als eBook bei dotbooks. Fulda in der Mitte des 12. Jahrhunderts. Eberhard ist noch ein Knabe, als er ins Kloster gebracht wird: Der Sohn des Bauernmeisters zeigt eine besondere Begabung für die lateinische Sprache, für das Übersetzen und den Umgang mit Griffel und Federkiel. Im Lauf der Jahre spricht sich herum, was für ein begnadeter Schreiber hinter den Mauern der Abtei herangewachsen ist – aber nur wenige wissen, dass Eberhard sich auch auf die Kunst des Fälschens versteht. Als ein neuer Abt nach Fulda kommt, der seine ganz eigenen Interessen verfolgt, droht Eberhard, wegen seines Talents zwischen die Fronten zu geraten. Und was weit schlimmer ist: Er bringt auch die Frau in Gefahr, die er heimlich liebt. Aber wie soll es ihm gelingen, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen und die schöne Gertrudis zu retten? Perfekt recherchiert, mitreißend erzählt: »Die Männer und Frauen, die vor 850 Jahren lebten, liebten und hassten, kämpften und feierten, waren Menschen aus Fleisch und Blut. Und so weit weg das hohe Mittelalter uns manchmal erscheint, ist darin doch tief unsere eigene Geschichte verwurzelt.« Günter Ruch Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der historische Roman »Gottes Fälscher« von Günter Ruch. Wer liest, hat mehr vom Leben! dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 590
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Fulda in der Mitte des 12. Jahrhunderts. Eberhard ist noch ein Knabe, als er ins Kloster gebracht wird: Der Sohn des Bauernmeisters zeigt eine besondere Begabung für die lateinische Sprache, für das Übersetzen und den Umgang mit Griffel und Federkiel. Im Lauf der Jahre spricht sich herum, was für ein begnadeter Schreiber hinter den Mauern der Abtei herangewachsen ist – aber nur wenige wissen, dass Eberhard sich auch auf die Kunst des Fälschens versteht. Als ein neuer Abt nach Fulda kommt, der seine ganz eigenen Interessen verfolgt, droht Eberhard, wegen seines Talents zwischen die Fronten zu geraten. Und was weit schlimmer ist: Er bringt auch die Frau in Gefahr, die er heimlich liebt. Aber wie soll es ihm gelingen, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen und die schöne Gertrudis zu retten?
Perfekt recherchiert, mitreißend erzählt: »Die Männer und Frauen, die vor 850 Jahren lebten, liebten und hassten, kämpften und feierten, waren Menschen aus Fleisch und Blut. Und so weit weg das hohe Mittelalter uns manchmal erscheint, ist darin doch tief unsere eigene Geschichte verwurzelt.« Günter Ruch
Über den Autor:
Günter Ruch (1956–2010), wurde in Sinzig am Rhein geboren, studierte in Bonn mittelalterliche Geschichte und arbeitete später als Journalist, Grafiker, Fotograf und Autor.
Bei dotbooks erschienen außerdem Günter Ruchs hervorragend recherchierte und mitreißend erzählte historische Romane »Das Geheimnis des Wundarztes« und »Genovefa – Das Herz einer Gräfin«.
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2018
Copyright © der Originalausgabe 2006 by RM Buch und Medien Vertrieb GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2018 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung von Bildmotiven von shutterstock/Artyzan, Ana Gran, lestyan, MaxyM und Naddya
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96148-437-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Gottes Fälscher« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Günter Ruch
Gottes Fälscher
Roman
dotbooks.
Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle.
1 Korinther 13,1
Prolog
Anno Domini 1183, 6. Januaris, Dreikönigstag
Im Hof des Bauernmeisters Wolf von Giesel war es bitterkalt, und der Schnee reichte ihm bis zu den Knien. Doch Wolf ließ sich von der Eiseskälte nicht davon abhalten, neues Pergament aus Rinderhaut herzustellen, genauso wie sein Vater Eberhard es ihm beigebracht hatte, als er noch ein Junge war.
Am Abend, als es dunkel war, spitzte er beim Licht der kleinen Unschlittlampe den Federkiel und bereitete die Tinte nach dem alten Rezept zu, das sein Vater in der berühmten Reichsabtei von Fulda gelernt hatte. Zugleich mit der Geburt seines Sohnes wollte der Bauernmeister das alte Recht ihres Dorfes aufschreiben, so wie der Abt es seinem Großvater Hinkmar einst verliehen hatte.
Plötzlich brach das Messerchen ab, mit dem Wolf den Kiel der Gänsefeder spitzte, um daraus eine anständige Schreibfeder zu machen. Er bewahrte die Schreibutensilien und das Dorfsiegel in der schweren, mit einem großen Schloss versehenen Bauernmeistertruhe auf. Auf seiner Suche nach einer brauchbaren Ersatzklinge räumte Wolf die Truhe aus, bis er unten auf dem Boden angelangt war. Dort fand er nicht nur die gesuchte Klinge, sondern zum ersten Mal seit Jahren fiel ihm auch wieder die eingerollte Urkunde in die Hände, der Vertrag zwischen dem Großvater und Meister Dudo, der einst die Klosterschule von Fulda geleitet hatte.
Wolfs Zeigefinger glitt langsam an den Zeilen entlang, während er die Lateinkenntnisse bemühte, die ihm von dem lange zurückliegenden Unterricht bei seinem Vater im Gedächtnis haften geblieben waren. Das Pergament war rau. Er verstand nicht jedes Wort, aber da ihm die wesentlichen Punkte des Vertrags aus den Erzählungen seines Vaters geläufig waren, fand er sich doch schnell in dem Schriftstück zurecht.
In der guten Stube schrie Hinkmar, sein Erstgeborener, den ihm seine Frau Richildis kurz vor dem vergangenen Weihnachtsfest geschenkt hatte. Als er eine Stunde zuvor in die Bauernmeisterkammer gegangen war, hatte Richildis den Jungen gesäugt, und Wolf erfreute sich an seinem guten Appetit und seiner offensichtlichen Gesundheit. Kopfschüttelnd ging ihm ein Gedanke durch den Kopf: Sein Sohn wäre nicht auf der Welt, wenn sein Vater – so wie es der Vertrag vorsah – damals der Pfarrer von Giesel geworden wäre. Sein Sohn nicht, und er selbst auch nicht.
Er hatte seinen Erstgeborenen über der Grabplatte des Dudo taufen lassen. Die war in den Boden der Dorfkirche St. Laurentius eingelassen, unmittelbar am Altar. Darunter war das kleine, unscheinbare Kästchen mit den einbalsamierten Eingeweiden von Meister Dudo versenkt worden, das auf wunderlichen Wegen seinen Weg zurück aus dem Morgenland in die Heimat gefunden hatte. Die Leute aus der Umgebung verehrten diese Überreste wie die Reliquie eines Heiligen und Märtyrers. Meister Dudo würde es wohl gefallen haben, so wie der Vater ihn beschrieben hatte.
Bauernmeister Wolf hatte seinem Sohn den Namen seines Großvaters gegeben, um so die Erinnerung an ihn wach zu halten. Großvater Hinkmar war der erste Bauernmeister des Dorfes gewesen, als es zu neuem Leben erblühte. Die Leute aus dem Dorf nannten seinen Namen noch immer mit großer Ehrfurcht und tiefem Respekt, sie zündeten am Altar der Dorfkirche für ihn Kerzen an und beteten für seine Seele.
Wolfs Gedanken glitten zurück zu dem ungewöhnlichen Mann, der sein Vater gewesen war und der ihm die Anfangsgründe der schwarzen Kunst des Schreibens beigebracht hatte. Es erfüllte ihn mit Traurigkeit, dass es weder seinem Vater noch der geliebten Mutter vergönnt gewesen war, die Geburt des ersten Enkels mitzuerleben. Seit dem tragischen Tod der beiden waren zwei Jahre vergangen. Sie lagen vereint auf dem kleinen Friedhof hinter der Dorfkirche, und auch ihre Seelen – so hoffte Wolf aus tiefstem Herzen – waren jetzt hoffentlich vereint an einem friedlichen Ort.
Anders als sein Vater, der bis zu seinem Lebensende voller Zweifel und Skepsis gewesen war, glaubte Wolf fest an ein Jenseits und eine Wiederauferstehung der Toten. »Wenn es den Himmel gibt«, sagte Wolf, »dann seid ihr jedenfalls ganz sicher dort.«
Er sprach ein kurzes Gebet für die Seele seiner Eltern und warf dann einen letzten Blick auf die verblassenden Schriftzeichen der alten Urkunde, bevor er sie wieder einrollte und von neuem im finsteren Bauch der Bauernmeistertruhe versenkte. Der Vertrag zwischen dem Bauernmeister Hinkmar von Giesel und Magister Dudo war geschlossen worden, als Wolfs Vater Eberhard zwölf Jahre alt war. Die Urkunde war datiert auf den St.-Matthäus-Tag 1142, den 21. des Monats Octobris, kurz nach dem Kirchweihfest, bei dem die kleine Dorfkirche St. Laurentius vom Würzburger Bischof eingesegnet worden war. Es war das Jahr, in dem das Leben seines Vaters eine ganz neue Richtung nahm, vor mehr als vier Jahrzehnten.
I Kirchweih 1142
10. Augustus, am St.-Laurentius-Tag
Das Dorf lag idyllisch im kühlen Tal eines kleinen, springlebendigen Bachs, der keinen Namen trug. Er floss noch sieben Meilen weiter ostwärts, um knapp oberhalb des ehrwürdigen Reichsklosters in den Fluss zu münden. Wie ein fruchtbarer Kranz umgaben wohl bestellte Felder die Ansiedlung mit ihren gut zwei Dutzend strohgedeckten Häusern und Gehöften. Der Bach teilte die Ansiedlung in ein Ober- und ein Unterdorf.
Es war gut zehn Jahre her, da hatten Bauernmeister Hinkmar und die Seinen auf Befehl des Abtes den verlassenen, uralten Ort Giesel neu besiedelt, von dem nur die dreihundertjährige Gerichtslinde übrig geblieben war. Im Schweiße ihres Angesichts hatten sie die Felder und Wege angelegt, den Wald gerodet, eine übermannshohe Palisade errichtet und eine Schutzhecke gepflanzt. Sie hatten ihre Gehöfte, Häuser, Scheunen, Ställe und Hütten hochgezogen und die Felder bestellt. Und Anno 1137, als die dringendsten Arbeiten erledigt und die Anfangsschwierigkeiten überwunden waren, hatten sie mit dem Bau einer steinernen Kirche begonnen.
Gottes Segen ruhte auf dem Dorf, nun, da die Kirche nach fünf Jahren Bauzeit endlich fertig gestellt war. Drei Tage zuvor war schließlich auch noch die Glocke eingetroffen, die sie in Fulda hatten gießen lassen.
Endlich war der St.-Laurentius-Tag gekommen, der Tag mitten im Hochsommer, an dem die Gieseler Kirche geweiht werden sollte. Das Dorf war festlich gestimmt, es hatte sich geschmückt mit bunten Wimpeln und Blumenkränzen und den Fahnen der Schützenbruderschaft St. Josef. Die goldenen Tragekreuze, wie sie den Prozessionen vorangetragen wurden, staken am Rande des Dorfplatzes im Boden.
Die drei Kinder des Bauernmeisters, dessen stattliches Gehöft gleich neben der Kirche am Dorfplatz lag, freuten sich seit Wochen auf das Fest. Sie waren aufgeregt und konnten es kaum erwarten, hinauszukommen. Doch die Mutter hielt sie zurück. Sie hatte die beiden Jungen und das Mädchen fein herausgeputzt, schließlich waren sie die Kinder der Dorfobrigkeit.
»Junger Mann, pass diesmal gut auf deine neuen Kleider auf!«, sagte Irmhard besorgt und zupfte den Mantel des Ältesten zurecht. »Und ihr beiden anderen auch, hört ihr? Sie haben unseren Vater zwei Dutzend Silberpfennige gekostet, würde ich sagen.«
»Können wir jetzt hinausgehen?«, fragte Bauernmeister Hinkmar mit seiner dunklen, Respekt gebietenden Stimme.
»Ja, endlich!«, riefen die Kinder freudig.
Zusammen trat die fünfköpfige Familie hinaus durch die mit Blumen verzierte Tür des Gehöftes. Die Mägde und Knechte des Bauernmeisters standen am geschmückten Hoftor Spalier. Die Luft schien zu vibrieren, so aufgeregt und voller Vorfreude waren alle. Das Tor führte hinaus zum Dorfplatz, auf dem bereits reges Treiben herrschte. Obwohl der wichtigste Gast noch gar nicht eingetroffen war, war das Kirchweihfest bereits in vollem Gange. Die Musik – Leier, Laute und Trommelschlag – spielte laut, auch wenn sich zahlreiche falsche Töne in die Melodien einschlichen. Die Gaukler rissen ihre Possen und gaben ihre Kunststückchen zum Besten. Ein Großteil der Tische, die Hinkmar hatte aufstellen lassen, war bereits besetzt, und das Bier und der Wein flossen in Strömen. Auch das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite.
Hinkmar schaute angestrengt in Richtung des Dorftores mit seinen massiven Pfosten und dem schweren Querbalken, in den Symbole und Runen eingeritzt waren, die böse Geister und Dämonen vom Dorf fernhalten sollten. »Kinder, wir werden hier bei uns gleich den Würzburger Bischof Embricho und den Abt Alehoff begrüßen«, sagte der Bauernmeister mit von Stolz schwellender Brust.
Dennoch stand ihm und seiner Gemahlin Irmhard die Nervosität ins Gesicht geschrieben. Es war der bisher größte Tag im Leben des Bauernmeisters. Nichts durfte schiefgehen. »Wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch eine Zeit lang zu den anderen Kindern gesellen. Aber seid rechtzeitig zur Weihemesse an der Kirchenpforte. Also los, lauft schon! Ihr habt euch doch so lange darauf gefreut«, sagte der Bauernmeister zu seinen Kindern.
Das brauchte er nicht zweimal zu sagen. Die drei liefen aufgeregt auf den Dorfplatz hinaus und mischten sich unter die Menschen, sowohl Einheimische als auch Gäste aus den umliegenden Dörfern.
Da war der dreizehnjährige Walther, der Erstgeborene, der wie sein Vater ein Krieger des ehrwürdigen Abtes werden sollte. Walther, der sonst eher verschlossen und einsilbig war, platzte jetzt beinahe vor Stolz. Der dunkelhaarige Bursche, der im Herbst seinen Dienst als Knappe beim Grafen Ziegenhayn beginnen würde, war untersetzt und kräftig gebaut und kam auf seine Mutter, deren traurige Augen mit dem bisweilen misstrauischen Blick er geerbt hatte. Walther war der ganze Stolz von Irmhard.
Der zweitgeborene Sohn Eberhard war eher ein Außenseiter unter den Jungen des Dorfes. Mit seinen zwölf Jahren war er wegen seiner Schlauheit, die ihn vorlaut und hochmütig erscheinen ließ, schlecht gelitten im Dorf. Als wollte sein ganzes Wissen aus ihm heraussprudeln, redete er oft zu schnell und abgehackt, sodass es etwas Mühe bereitete, ihm zu folgen. Er hatte das glatte, dunkelblonde Haar und die energischen und zugleich einnehmenden braunen Augen seines Vaters geerbt, war aber schmächtiger und nicht so robust wie der alte Hinkmar. Das bunte Treiben um ihn herum würde ihn wenigstens für ein paar Stunden vergessen lassen, dass er ein Außenseiter unter den Kindern war, und in der eigenen Familie das schwarze Schaf.
Die kleine Theresa war das Nesthäkchen der Bauernmeisterfamilie, sie war die Fröhlichkeit in Person. Locken ihres blonden Haares quollen unter ihrem Kopftuch aus kostbarem Stoff hervor, das die Mutter ihr für das Fest gekauft hatte. Neu ausstaffiert war sie hübsch anzusehen, aber in ihren gewöhnlichen Kleidern fühlte sie sich zehnmal wohler als in den Festtagskleidern. Theresa war ein kleiner Wirbelwind, obwohl sie zierlich und zerbrechlich wirkte. In ihrem jungen Leben war sie schon oft krank gewesen, und sie ermüdete schnell.
Die Sonne stand schon mehr als halbhoch über dem Osten, und es drohte wieder ein so schwüler Tag zu werden wie die Tage zuvor. Seit dem Jakobstag war es jetzt so drückend heiß, und alle paar Tage zogen Gewitter über das Gieseler Tal hinweg, ohne dass sie bisher einen größeren Schaden angerichtet hätten.
Die Bauernmeisterkinder wurden von den anderen Mädchen und Jungen aus dem Dorf in ihrer Mitte begrüßt. Theresa gesellte sich zu ihren Freundinnen, und es gab immer ein paar Jungen, die sich um Walther scharten, weil er der Sohn des Bauernmeisters war. Eberhard stand daneben und reckte den Hals. Er suchte seine Freundin und Spielkameradin Gertrudis, aber sie war nirgendwo zu sehen. Er konnte auch sonst keinen aus ihrer Familie entdecken, weder ihren Vater Rochus noch Gertrudis' Mutter. Dass seit der Gründung des Dorfes zwischen den beiden Familien eine Feindschaft herrschte, änderte nichts an der Tatsache, dass Eberhard und Gertrudis unzertrennlich waren.
Zum Glück war auch Gertrudis' Bruder Ordolf nicht zu sehen, wie Eberhard erleichtert feststellte. In letzter Zeit schnüffelte er ständig hinter ihnen her und bereitete ihnen nichts als Verdruss. Ordolf war ein gewaltbereiter Bursche, der seine Schwester in Angst und Schrecken versetzen konnte. Wenn Ordolf in der Nähe war, dann hatte man keine ruhige Minute, dann lagen Streit, Ärger oder eine Rauferei in der Luft.
Eberhard schüttelte den Kopf. Wo war Gertrudis nur? Wenn sonst im Dorf ein Fest im Gange war, genossen sie die willkommene Gelegenheit, sich unauffällig nahe zu sein. Dann bildeten die Dorfkinder einen großen, unübersichtlichen Haufen – von den Kleinen, die kaum laufen konnten, bis hin zu den großen Jungen, die schon einen Flaumbart hatten, und den beinahe heiratsfähigen Mädchen. Es war etwas ganz anderes als im Wald oder an ihrem Zaubersee. Dorthin gingen Gertrudis und Eberhard in aller Heimlichkeit, denn der Vater von Gertrudis hätte es niemals geduldet, dass seine Tochter sich mit dem Sohn seines Widersachers herumtrieb.
Eberhard konnte es einfach nicht glauben, dass Gertrudis nicht da war. Unruhig trat er von einem Fleck auf den anderen, schaute suchend in die Runde. Ringsumher saßen die Leute schwatzend auf den Bänken oder standen in lachenden Gruppen beieinander, andere verfolgten die Vorstellung der Akrobaten, die schon kurz nach dem Morgengrauen mit ihrem Geschäft begonnen hatten, wieder andere vertrieben sich die Zeit bis zum Beginn der Weihezeremonie, indem sie dem Tanzbären und dem Feuerschlucker zuschauten. Die Mädchen aus dem Dorf bewunderten den kräftig gebauten Hochseilartisten mit seinen schwarzen Haaren und dem südländischen Aussehen, der soeben sein Seil zwischen zwei Pfosten spannte. Es sah unglaublich dünn aus, und die Befestigung, die nur aus ein paar Tauen bestand, wirkte nicht gerade vertrauenerweckend.
»Autsch!«
Plötzlich wurde Eberhard von hinten angerempelt und gestoßen. Er stolperte und fuhr herum. Zwei, drei Jungs lachten. »Wer zum Teufel ... ach, Ordolf!« Er verzog das Gesicht. »Hätt ich mir ja eigentlich denken können.«
»He! Wohl gestolpert, hm?«, fragte der Bruder von Gertrudis hämisch, stemmte die dicken Arme in die Seite und baute sich bedrohlich auf.
Eberhard tat einen Schritt zurück. »Lass das, du Idiot«, sagte er verächtlich.
Im nächsten Moment versuchte Ordolf, nach Eberhard zu treten und sein Bein zu treffen, doch der Sohn des Bauernmeisters konnte eben noch ausweichen.
»Du bist doch verrückt!«, sagte Eberhard keuchend. Er spürte, wie ihm der Zorn in den Kopf stieg, aber das war es ja, was Ordolf wollte. »Dein Vater sollte dich einsperren!«
»Meinst du, er sollte das?« Der Bruder von Gertrudis baute sich vor dem schmächtigen Eberhard auf. »Und bei dir wäre es besser gewesen, deine Mutter hätte dich gleich nach der Geburt ersäuft!«
Ordolf war zwar schwachsinnig, aber viel größer und stärker als Eberhard. Sein hässliches, rundes Gesicht war voller Pickel, und sein dunkler Flaumbart ließ ihn nicht männlicher, sondern noch alberner aussehen. Er war wie ein tollpatschiges Kind in einem viel zu groß geratenen Körper. Sein struppiges, stumpfes Haar war so pechschwarz wie seine Seele. Keiner wusste, von wem er es geerbt hatte, weder seine Mutter noch sein Vater hatten diese Haarfarbe.
Die Kinder musterten Ordolf verstohlen und zugleich ängstlich. Egal wo er auftrat, sorgte er immer für Abwechslung, andererseits wollte ihm auch keiner zu nahe kommen, um nicht vielleicht Opfer seiner gewalttätigen Anwandlungen zu werden.
»Was willst du eigentlich?«, fragte Eberhard angespannt.
»Ich sag es dir nicht noch mal: Behalte deine Finger bei dir!« Er machte eine obszöne Geste.
»Glaubst du im Ernst, du könntest mir irgendetwas verbieten?«
»Ich weiß genau, was ihr treibt!«
»Ha! Du weißt ja gar nichts.«
»Aber eins weiß ich ganz sicher: Ich bringe dich um, wenn du Gertrudis noch ein einziges Mal anfasst.«
Eberhard hasste Ordolf wie keinen anderen Menschen auf der Welt. Tausend Mal hatte er ihn verflucht, tausend Mal hatte er Gott angefleht, dass er Ordolf vom Angesicht der Erde tilgen möge, aber nichts dergleichen geschah. Unbekümmert und unbehelligt durfte der schwachsinnige Kerl sein sündhaftes und gewalttätiges Leben führen. Seit der Bruder von Gertrudis herausgefunden hatte, dass Eberhard heimlich mit seiner Schwester befreundet war, war alles noch viel schlimmer geworden.
»Schluss jetzt!«
Walther hatte die Auseinandersetzung bemerkt und trat hinzu. Ordolf stutzte. Er schaute Walther mit einer Mischung aus Angst, Wut und Hass an.
»Muss das Mönchlein wieder seinen großen Bruder zu Hilfe holen?«, fragte Ordolf hämisch. »Kann es sich nicht selber wehren?«
Mönchlein war Eberhards Spitzname: Die Kinder nannten ihn so, weil er beim alten Meister Guido Lateinstunden hatte und weil er so versessen aufs Lesen war.
»Leg dich lieber mit Gleichaltrigen an«, sagte Walther spöttisch. Er schlug seinen Umhang zur Seite, sodass man sein neues Kurzschwert sehen konnte. Das durfte er tragen, seit er beim Grafen Ziegenhayn zum Knappendienst angenommen worden war. Im Dorf hatte sonst kein Junge ein Schwert. »Hast du nicht genug vom letzten Mal?«
Ordolf kicherte unsicher. Auch die anderen Burschen aus dem Dorf lachten angespannt. Walther hatte sich Ordolf erst vor ein paar Tagen vorgenommen, als der seinen Vater beleidigt hatte. Zwar war es ihm wie immer gelungen, den zwei Jahre älteren Ordolf im Faustkampf zu besiegen, denn er war kräftiger, wendiger und schneller, aber es wurde jedes Mal schwieriger. Ordolf hatte allein aufgrund seines massigen Körpers und seiner bedenkenlosen Brutalität einen Vorteil gegen jeden Herausforderer, mochte der noch so wendig und geschickt sein. Im Frühjahr hatte er einem anderen Jungen aus dem Dorf lächelnd ganz langsam den Arm gebrochen und sich an seinen Schmerzensschreien und am Krachen ergötzt, das deutlich zu vernehmen war, als die Knochen brachen.
»Keine Sorge«, sagte Ordolf zu Eberhard. »Ich krieg dich!« Er atmete schwer und schien zu überlegen. Aber die Angst vor Walthers Schwert gewann die Oberhand. Schwerter und blinkendes Metall flößten ihm eine Heidenangst ein. Da war er höllisch abergläubisch. Er schlug mit der Faust in seine hohle Hand, schaute die Kinder, die um ihn herumstanden, mit einem bedrohlichen Blick an, spuckte aus und verdrückte sich dann zwischen den Festgästen wie ein böser Geist aus dem Reich der Finsternis. Einen Moment lang hinterließ er inmitten des bunten Treibens Betroffenheit.
»Die Katzen im Dorf sollten das Weite suchen«, sagte ein Junge trocken; damit spielte er auf Ordolfs berüchtigten Hang zur Tierquälerei an. Und keiner konnte über seine Bemerkung lachen.
»Sein Hass gegen unsere Familie wird immer größer«, sagte Walther verdrießlich. »Irgendwann passiert ein Unglück.«
Alle schienen machtlos gegenüber dem gewalttätigen Hass des Jungen zu sein, und keiner konnte sich so recht erklären, woher er kam. Hinkmar und Rochus mochten ja Widersacher sein und sich wegen irgendwelcher Kleinigkeiten jahrelang befehdet haben. Aber es war niemals ein blutiger Hass oder offener Zwist zwischen ihnen ausgebrochen. Dafür sorgten schon die beiden Hausherrinnen. Erst Ordolf hatte den blutigen Hass ins Spiel gebracht. Zwar hatte sein Vater anfangs die feindseligen Gefühle des einzigen Sohnes ein wenig geschürt. Als er dann aber bemerkte, wie sehr Ordolf sich in diesen Hass hineinsteigerte, reute ihn sein Verhalten, aber da war es zu spät.
»Ich hab Angst vor ihm«, sagte Theresa. »Er ist ein böser Junge. In seinem Kopf sind ganz viele schwarze Geister.« Plötzlich waren die Kinder ringsum still. »Manchmal ist mir, als ob ich sie sogar sehen kann.«
Im selben Moment ging ein feierliches Raunen durch die Menge. »Schaut, schaut! Der Reisewagen des Bischofs!«, riefen die Leute durcheinander und deuteten in Richtung des Dorftores. »Der Bischof von Würzburg kommt!«
Die Leute reckten neugierig ihre Hälse. Die Kinder vergaßen die Szene mit Ordolf auf der Stelle. Der große, braune Reisewagen mit seinen mächtigen Speichenrädern wurde begleitet von einem Dutzend Ritter, deren prächtiger Anblick die Jungen im Dorf mit Bewunderung erfüllte. Dahinter ritten die geistlichen Herren, die den Bischof begleiteten, gefolgt von einem weiteren Wagen, der in Pracht dem des Bischofs kaum nachstand, und den Schluss des Zuges bildete nochmals eine Gruppe Reiter. Die Menschen liebten es, den Prunk zu bewundern, mit dem die hohen Herren reisten, bot der Anblick doch eine willkommene Abwechslung zu dem tristen Einerlei ihres Alltags.
Die beiden Wagen hielten ächzend in der Mitte des Dorfplatzes. Alles strömte herbei. Die Knechte des Bauernmeisters mussten mit Nachdruck und unter Einsatz der Ellbogen für ihren Herrn und seine Gemahlin eine Gasse durch die drängenden Leute bahnen. Die Bauernmeisterkinder drängten sich wie die anderen Dorfkinder zwischen den Leuten hindurch nach vorn, mochten die Erwachsenen wegen der Drängelei auch noch so schimpfen und fluchen.
Eberhard holte tief Luft. Dann wich er geschickt einer Hand aus, die unversehens nach ihm schlug. Aber es war nicht Ordolf, sondern eine der resoluten Bäuerinnen aus dem Dorf, der er heftig auf die Füße getreten hatte. Walther, der neben ihm stand, lachte. »Also komm!« Die beiden Brüder nahmen ihre Schwester Theresa in die Mitte und hoben sie etwas hoch, damit sie besser sehen konnte.
Der bischöfliche Kutscher sprang in einer Entfernung von vielleicht vier oder fünf Klaftern von seinem Bock und ließ es sich nicht nehmen, seinem Herrn den Schlag zu öffnen und den dreistufigen Tritt an die Wagentüre zu stellen. Dann half er dem alten Bischof, aus dem Wagen zu steigen. Hinkmar und Irmhard beugten ihr Knie. Alle Dorfbewohner rundum taten es ihnen gleich. Als der Bischof von der letzten Stufe des Tritts hinabgestiegen war, trat der Bauernmeister vor und küsste den Ring des hohen Kirchenmannes. Die Leute hielten den Atem an. Bischof Embricho war ein alter, steifer Mann mit einem verkniffenen Gesicht. Aber das Volk interessierte sich nur für die prächtigen, goldenen Gewänder des Kirchenmannes, für die Insignien seiner Macht. Eberhard empfand beim Anblick des Bischofs ebenfalls Ehrfurcht, allerdings weniger wegen dessen prunkvollen Aufzugs, sondern weil dessen Konterfei auf den Würzburger Silberpfennigen abgebildet war, wie sie auch bei ihnen im Dorf im Umlauf waren.
Ein Priester – aufgrund seines Äußeren und der weihevollen Miene wohl einer der wichtigsten Kirchenmänner im Gefolge des Bischofs – reichte seinem Herrn den übermannshohen Bischofsstab. Als Nächstes entnahm er dem Wageninneren die wertvolle Würzburger Mitra, die mit zahlreichen bunten Edelsteinen bestickt war, und setzte sie dem Bischof behutsam auf das fast haarlose Haupt. Den Kindern war es ganz ehrfürchtig zumute, beinahe unheimlich, und sie hatten das Gefühl, Zeuge von etwas ganz Besonderem zu sein, das sie zeit ihres Lebens nicht vergessen würden.
Jetzt hielt auch der zweite Wagen. Über dem Einstieg prangte das vertraute Wappen des Fuldaer Abtes, das schwarze Bonifatiuskreuz auf silbernem Grund. Abt Alehoff und der Hochvogt, Graf Gottfried von Ziegenhayn, stiegen aus und wurden vom Bauernmeister mit der gleichen Ehrerbietigkeit begrüßt wie zuvor der Bischof. Junker Rudolph, der Grafensohn, stieg ebenfalls aus der Kutsche. Er war in etwa so alt wie Walther. Mit seiner rundlichen Figur, dem blonden, gelockten Haar und einem leeren, gleichgültigen Blick wirkte er recht weibisch, wie Eberhard fand. Der arrogante Grafensohn war reichlich verhasst beim Volk. Außerdem entstieg ein hagerer Mönch mit einer großen Nase und verfaulten Zähnen dem Reisewagen.
Mit einem Mal glaubte Eberhard, auf der anderen Seite hinter dem Wagen die kastanienroten Haare von Gertrudis aufblitzen zu sehen. Er reckte den Hals, um besser sehen zu können, aber vergeblich. Wie schön wäre es gewesen, mit seiner Vertrauten und Gefährtin die tausendfältigen Eindrücke dieses Ereignisses teilen zu können! Es beunruhigte ihn, dass er sie noch immer nicht gesehen hatte. Er fragte sich, ob ihre Abwesenheit irgendetwas mit dem dummen Auftritt ihres Bruders Ordolf zu tun hatte.
Vier der Priester, die den Bischof zu Pferde begleitet hatten, holten aus dem großen Kasten des Wagens den prächtigen Reisebaldachin des Bischofs. Der Baldachin strahlte geradezu im Licht der Sonne, die jetzt hoch oben am hochsommerlichen Firmament stand. Drei jüngere Geistliche schwenkten emsig ihre goldenen Weihrauchgefäße. Über der feierlichen Szenerie entfaltete der Himmel sein azurblaues Zelt. Hoch oben in der Luft kreisten große, weiße Vögel wie Sendboten des Heiligen Geistes.
Der Bischof nahm aus den Händen des Priesters seine Reisemonstranz entgegen, in deren Mitte das Zeichen allen Lebens war, eingefasst in ein geschliffenes Glasokular: die heilige Hostie, der Leib des Herrn. Das Licht der Augustsonne brach sich auf dem Glas der Monstranz. Die Prozession setzte sich in Bewegung, vornweg der Bischof, dann die anderen Geistlichen, gefolgt von den Edlen und dem einfachen Volk von Giesel, das vom Bauernmeister und seiner Familie angeführt wurde und geleitet war von den Feldschützen der Bruderschaft St. Josef, die stolz ihre Armbrüste und ihre Bögen geschultert hatten.
Sieben Mal musste das neu zu weihende Gotteshaus umrundet werden, so wollte es das Gesetz der Kirche. Die innigen Gebete des Volkes waren weithin in dem grünen Tal von Giesel zu hören. Der Geruch nach Weihrauchharz lag wie ein Teppich in der Luft. Der Rauch sollte genauso wie die Gebete die bösen Teufel und Dämonen vertreiben, die sich gewiss in großer Zahl eingefunden hatten, um die Weihezeremonie zu stören und zu hintertreiben. Eberhard wünschte sich, dass der Weihrauch auch die finsteren Dämonen aus der Seele Ordolfs vertreiben würde und dass wieder alles so wäre wie früher. Aber er spürte, dass dies ein frommer Wunsch bleiben würde.
Dennoch wollte Eberhard sich den Tag nicht verderben lassen, auf den er sich so lange gefreut hatte. Er schaute sich um, sog die vielfältigen, bunten Eindrücke in sich auf. Unglaublich, dachte er, wie sehr sich das vertraute Dorf an diesem Tag verändert hatte. Plötzlich schien eine Verbindung zu bestehen zu der großen weiten Welt dort draußen, ein Fenster, das sich in die unbekannte, geheimnisvolle, faszinierende Ferne geöffnet hatte. Wieder ertappte er sich bei dem Wunsch, dass er diesen Gedanken am liebsten mit Gertrudis geteilt hätte, wie schon so viele seiner Gedanken zuvor.
Doch würden sie je wieder in ihrer alten Vertrautheit miteinander reden können? Eberhard hatte das unbestimmte Gefühl, dass ihm ein großer Verlust entstanden war. Mechanisch setzte er einen Fuß vor den anderen. Sie kamen am Portal der Kirche vorbei. Fünf. Noch zwei Umrundungen. Vor ihm gingen zwei Feldschützen. Wieder schaute er sich um. Betend folgte hinter ihm die Prozession der Dorfgemeinschaft. Er kannte jedes der Gesichter. Dann sah er Gerlinde, die Mutter von Gertrudis, und Augenblicke später auch den Rest der Familie: den griesgrämigen Rochus mit seinem roten Haarschopf, Gertrudis und die pechschwarzen Haare der verlorenen Seele Ordolf. Der Junge hatte ein ganz harmloses Gesicht aufgesetzt, so als könnte er kein Wässerchen trüben. Gertrudis schien ihren Blick beständig am Boden kleben zu haben, nicht ein einziges Mal schaute sie hoch. Eberhard war nicht im Stande, einen Augenkontakt zu ihr herzustellen. Ordolf grinste selbstgewiss. Eberhard konnte gar nicht in Worte fassen, wie sehr er den Bruder seiner Gefährtin hasste und zum Teufel wünschte.
Vorne am Kopf der Prozession hatten der mit der heiligen Monstranz einherschreitende Bischof, der Abt, die Priester, die Mönche und der Graf ihre siebente Umrundung beendet, und alle schwenkten zum Portal der St.-Laurentius-Kirche ein, die es zu weihen galt.
Eberhard betrat hinter seinem Vater und der Mutter und gemeinsam mit seinen Geschwistern das neue Gotteshaus mit seinen dicken Mauern und dem gedrungenen, viereckigen Glockenturm, der von einem spitzen Dach mit einem eisernen Kreuz gekrönt wurde. Er war, so wie die meisten anderen, erfüllt von einer Mischung aus Stolz, Ehrfurcht und Heimatverbundenheit. Hier also sollten die zukünftigen Generationen des Dorfes den Allmächtigen verehren. Hier in dieser Kirche, die an diesem Tag dem heiligen Laurentius geweiht werden würde, sollten die Leute aus dem Dorf ihren Zufluchtsort und ihren Glauben finden.
Im ersten Augenblick konnte Eberhard in der plötzlichen Dunkelheit im Innern der Kirche nichts erkennen. Die kleinen, schießschartenartigen Fenster ließen kaum Licht ein, und seine Augen mussten sich erst an das düstere Licht gewöhnen, das die Talglichter und Kerzen spendeten. Von draußen drängten immer mehr Leute nach. Vor dem Altar hatten der Bischof und die Priester Aufstellung genommen. In den vordersten Reihen standen die Edelleute, die Ritter des Abtes und des Bischofs, der Graf und sein Gefolge. Dahinter herrschte dichtes Gedränge. Eberhard warf einen Blick über die Schulter zurück in Richtung des Eingangs, und er verfluchte sich insgeheim, dass er einen Kopf kleiner als die meisten Erwachsenen war. Jedenfalls konnte er wenig mehr als das helle Rechteck des Eingangs erkennen und dass sich die Leute auch draußen vor der Kirche drängten. Nirgendwo in dem Kirchlein war noch ein winziges Fleckchen frei.
Die Augustschwüle, der Geruch des Weihrauchs, die Ausdünstungen der Leute – die Luft war zum Schneiden dick, und Eberhard fürchtete, die Sinne zu verlieren.
Plötzlich stand die Grafenfamilie fast zum Greifen nahe vor der Bauernmeisterfamilie, sodass Eberhard Graf Gottfried zum ersten Mal aus nächster Nähe betrachten konnte. Wäre seine prunkvolle Kleidung nicht gewesen, so hätte er sich mit seiner plumpen Figur kaum von einem einfachen Bauern seiner Grafschaft unterschieden. Der Graf, der zugleich Hochvogt des Klosters war, versuchte, sein bäuerisches Äußeres durch besonders aufwändige Kleider nach fränkischer Mode zu überspielen, sodass man ihn im Volk weithin Graf Gottfried Hagestolz nannte. Das also war der Junker, bei dem sein Bruder zum Martinstag in den Knappendienst gehen würde, dachte Eberhard bei sich.
Rudolph, der eitle Sohn des Grafen, stand neben seinem Vater und gähnte. Er machte keinen Hehl daraus, dass ihn die Weihe der neuen Pfarrkirche nicht im Mindesten interessierte. Unter dem pelzbesetzten Hut quollen die hellblonden Locken des Jungen hervor, die – so vermutete Eberhard – mit einem Schüreisen gekräuselt worden waren.
Die Priester des Bischofs malten mit dicken Kreidestücken Buchstaben auf den Boden, die Wände und Pfeiler der neuen Kirche. Eberhard reckte den Hals, aber er konnte kaum etwas von den Schriftzeichen erkennen, und auch die lateinischen Worte, die der Chor sang, blieben ihm unverständlich.
»Was tun sie da?«, fragte Theresa leise.
»Sie segnen und weihen den Altar«, flüsterte Eberhard seiner Schwester ins Ohr. »Siehst du, sie malen mit geweihter Kreide Kreuze und Zeichen darauf, damit die bösen Dämonen und Teufel in unserer Kirche keine Macht haben.«
»Das macht mir Angst«, erwiderte Theresa, doch ihr faszinierter Blick strafte sie Lügen.
Eberhard wandte sich wieder dem Geschehen vorn am Altar zu. Der hagere Mönch mit den verfaulten Zähnen holte aus einem hölzernen Transportkasten ein wertvolles Buch, auf dessen goldenem Einband große, bunte Edelsteine befestigt waren. Eberhard hielt den Atem an. Von seinem halb blinden Lehrmeister Guido wusste er, dass die Mönche des Klosters solche wertvollen Bücher herstellten, aber es war das erste Mal, dass er eines von ihnen zu sehen bekam. Er wagte kaum zu atmen. Es kam ihm vor, als hätte der Himmel selbst das Evangeliar herabgeschickt.
Plötzlich merkte Eberhard, wie sich etwas Hartes in seinen Rücken drückte. »Dreh dich nicht um«, flüsterte es in sein Ohr. Ordolf. Sein heißer, stinkender Atem war ganz nah. Irgendwie hatte sich sein Widersacher nach vorn gedrängt und stand jetzt genau hinter ihm.
»Was willst du?«
»Spürst du das nicht?«, flüsterte Ordolf.
»Was denn?«
»Ich könnte dich jetzt damit durchbohren.«
»Psst!« Der Bauernmeister drehte sich um. »Was soll das Getuschel?« Wütend starrte er Ordolf an. »Was machst du hier?«
»Nichts, es ist nur ... Herr«, stotterte Ordolf, dann setzte er ein harmloses Lächeln auf.
»Verschwinde sofort nach hinten zu deinen Leuten!«, befahl der Bauernmeister Ordolf mit gedämpfter Stimme, ehe er sich schnell wieder nach vorn umdrehte, wo der Bischof Embricho die Weiheformeln über den geschmückten Altar sprach.
»Du bist so gut wie tot«, flüsterte Ordolf Eberhard ins Ohr. »Schau her!«
Eberhard warf einen Blick zurück. Ordolf hatte seinen weißen Ziegenhaarmantel geöffnet und trug in seinem auffälligen, breiten Gürtel einen Totfang, einen dreikantigen Dolch, der bei der Jagd zum schnellen Abstechen des verletzten Wildes eingesetzt wurde. Man sagte, dass Mörder und Totstecher solche Waffen benutzten. Ehe irgendjemand anderes den Dolch sah, hatte Ordolf den Mantel wieder geschlossen und drängte sich unter dem Geschimpfe der Leute durch die Menge zu seinem Platz zurück.
Nach der Dunkelheit in der Kirche herrschte draußen ein gleißendes Licht. Eberhard blinzelte, als er hinaustrat, und atmete tief die unverbrauchte, wenngleich schwüle Luft ein. Er hatte den Schweißgeruch der Menschen und des Weihrauchs noch immer unangenehm in seiner Nase.
Mit Theresa an der Hand schlenderte er zum Kirmesplatz und blieb beim Zahnreißer stehen. Auf dessen Stuhl hatte Rochus der Rote, der Vater von Gertrudis, Platz genommen, um endlich den eitrigen Backenzahn loszuwerden, der ihn schon seit Ostern quälte. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Eberhard und Theresa hatten noch nie zuvor einen Zahnreißer bei der Arbeit gesehen. Sie nahmen sich bei den Händen und schauten ihm fasziniert zu. Der hagere Mann hatte einen bizarren Doktorhut auf und trug einen weiten Umhang. Alle zuckten zusammen, als der Zahnreißer sich an die Arbeit machte und Rochus wie am Spieß losbrüllte. Aber die beiden kräftigen Gehilfen hatten Gertrudis' Vater fest im Griff, sonst hätte er vor Schmerzen um sich geschlagen und den Zahnreißer bei seiner Arbeit behindert. Während das Blut aus dem Mund des Rochus strömte, hielt der Zahnreißer den entzündeten Backenzahn, der dem armen Mann so viel Pein verursacht hatte, triumphierend in die Höhe.
Das Landvolk strömte noch immer auf den Kirmesplatz. Die Vergnügungen, die während des Weiheamtes pausiert hatten, hatten von neuem begonnen. Der dressierte Bär tanzte wieder, begleitet von rhythmischer Musik. Der Feuerschlucker spuckte Flammen. Und der eigens errichtete Tanzboden dröhnte vom Stampfen der Füße.
Eberhard ließ den Blick über die Kirmes gleiten, dann hielt er inne. Dort drüben, nur wenige Schritte entfernt, erblickte er Gertrudis. Endlich! Mit ein paar anderen Mädchen stand sie am Zelt der Akrobaten zusammen und hatte ihn noch nicht bemerkt. Er schaute sich um. Von Ordolf war im Augenblick nichts zu sehen. Möglicherweise war er nach Hause gegangen, um den Totfang zu verstecken, denn wenn ihn der Bauernmeister oder sonst einer der Oberen damit erwischen würde, so würde ihm die Waffe nicht nur augenblicklich weggenommen werden, sondern er müsste auch mit einer empfindlichen Strafe rechnen.
Eberhard drängte sich zu seiner Freundin. »Gertrudis, da bist du ja!«
Sie drehte sich flüchtig nach ihm um. Sie hatte rot geränderte Augen. »Ich ... lass mich besser in Ruhe!«
»Ich muss mit dir reden.«
»Nicht hier und nicht jetzt. Bitte! Du weißt doch, warum du mich in Ruhe lassen musst. Er meint es ernst.«
»Ich lasse mir doch nicht von deinem Bruder mein Leben vorschreiben!«, sagte Eberhard erbost. »Dann hätte er doch genau das erreicht, was er erreichen will.«
»Versteh doch endlich. Er sieht rot, wenn er uns zusammen sieht.«
»Das weiß ich.«
»Ich will nicht, dass dir etwas zustößt.«
»Du hast Angst wegen mir?« Eberhard versuchte ein Lächeln.
Gertrudis fasste Eberhard beim Arm und zog ihn unauffällig ein Stück zur Seite. »Ich habe wirklich Angst um dich. Um dich und um deinen Bruder.« Ihre dunkelgrünen Augen waren voller Furcht. »Ich kenne Ordolf besser als jeder andere Mensch auf dieser Welt. Ich weiß, wozu er fähig ist.«
»Findest du nicht, dass du etwas übertreibst?«
Die Flügel ihrer schmalen Nase bebten. »Wenn du nicht begreifen willst, dann nimmt es ein böses Ende.«
Der südländisch aussehende Hochseilartist, der die Augen aller Frauen auf sich zog, kletterte an der langen Stange zu seinem Balancierseil hoch. Seine Gefährtin folgte wie ein Äffchen. Sie war nicht gerade züchtig bekleidet. Umso großzügiger würden die Almosen sein, die man ihr später in den herumgereichten Holzbecher werfen würde.
»Geh auf die andere Seite«, bat Gertrudis. »Dort drüben, wo auch Walther steht. Nun mach schon! Ordolf kommt jeden Augenblick zurück. Tu es mir zuliebe!«
Eberhard schloss theatralisch die Augen, überlegte einen Moment, dann schaute er Gertrudis voller tiefer jugendlicher Bitternis an und nickte. Zähneknirschend ergab er sich in das scheinbar Unabänderliche. Die Wut, die diese Ohnmacht in seinem Herzen schürte, zerriss ihn fast.
»Also, so kann das nicht weitergehen«, sagte er zu Walther, als er sich auf die andere Seite durch die Menge gekämpft hatte, die gebannt der Akrobatenvorstellung zusah. »Ich kann das nicht vertragen, verstehst du? Dass so jemand wie Ordolf Gewalt über mein Leben hat!«
»Hat sie dich weggeschickt?« Walther deutete mit dem Kinn zu Gertrudis hinüber. Eberhard nickte. »Weißt du was: Sie ist vernünftiger als du. Wir haben schon genug Ärger gehabt. Denk an unsere Eltern! Willst du, dass ihre Söhne sich auf ihrem großen Fest prügeln?«
»Um Himmels willen, natürlich nicht!«, rief Eberhard aus.
Die Hochseilartisten vollführten derweil die verrücktesten Kunststücke, und immer wieder brandete Beifall auf. Plötzlich ging ein ängstliches Raunen durch die Menge, als die junge, katzengleiche Akrobatin auf dem Seil stark ins Schwanken geriet und abzustürzen drohte. Manche Zuschauer hielten sich gebannt die Hand vor den Mund. Doch dann schien sich die Seiltänzerin wieder gefangen zu haben. Ein großes Ahh! ging durch die Menge. Eberhard vermutete, dass es sich um eine gewollte Einlage handelte, um die Spannung zu erhöhen. Abermals ging ein Raunen und ein Flüstern durch die Zuschauer, doch diesmal aus anderem Grund: Die Schlaufe, mit der das hauchdünne Hemd des schönen Gauklermädchens vorn zugehalten wurde, hatte sich gelöst und gab den Blick frei auf ihre kleinen, festen Brüste.
Eberhard spürte den Blick von Gertrudis auf sich ruhen und wurde rot, warum, das wusste er selbst nicht so genau. Er war froh, dass in diesem Augenblick die Vorstellung abrupt ein Ende nahm, als sich der junge Akrobat mitsamt seiner Partnerin spektakulär vom Seil fallen ließ. Die beiden rollten lachend zur Seite, genau vor die Füße der Zuschauer, die in der ersten Reihe standen. Die jungen Zuschauer hatten zunächst erschrocken aufgeschrien, lachten dann aber ebenfalls, als sie sahen, wie die beiden Hochseilartisten sich schnell wieder aufrappelten, um sich dann nach allen Seiten zu verbeugen und den Beifall entgegenzunehmen.
»Also sei ein Mann und geh ihr für heute aus dem Weg«, riet Walther seinem Bruder scherzend. »Wir wollen keinen weiteren Ärger riskieren. Alles andere wird sich finden. Kommt Zeit, kommt Rat.«
Doch Gertrudis ließ es gar nicht erst darauf ankommen. Als Eberhard zu der Stelle hinüberschaute, wo sie eben noch mit ihren Freundinnen gestanden hatte, war sie verschwunden. Er sah zur Brücke hinüber, die das Ober- mit dem Unterdorf verband, und tatsächlich sah er sie, wie sie allein in Richtung ihres Hauses ging, ohne sich auch nur einmal umzuschauen.
ARCHIVUM SECRETUM APOSTOLICUM VATICANUMBericht des Päpstlichen Observators Reichsabtei Fulda, Anno Domini 1142
»... Dito geht in der Abtei Fulda das Gerücht, die gottlosen Männer eines Ritters namens Gerlach von Haselstein hätten eine teuflische Verschwörung angezettelt zur Ermordung des hochwürdigsten Abtes Alehoff. Es wird im Volk und im Kloster fest geglaubt, dass besagte Edelleute auch sonst dem Bösen huldigen und dass sie sich gegen Abt Alehoff zu dessen Mord verschworen haben. Abt Alehoff aber hat sein Schicksal in die Hände des einen allmächtigen Gottes gelegt und will den Baronen trotz seiner schwachen Gesundheit weiterhin trotzen, so lange seine Kraft es zulässt und so lange unsere Heiligkeit Papst Innozenz seine schützende Hand über ihn hält. Aber wegen der Schwäche des Klosters ist der Abt wie einer, der viel Samen auf das Feld sät, aber wenig einsammeln kann, weil die Heuschrecken das Getreide abgefressen haben. Das ist das Klagelied des Reichsklosters, und man muss es singen ...
Dito: Der hochwürdigste Abt aber hat geschworen, den Rittern fürderhin zu trotzen, das Verderben aufzuhalten und das fromme Vorhaben seiner Vorgänger auf dem Abtsstuhl fortzuführen, etliche wüst gefallene Dörfer, Flecken und Gehöfte des Fuldaer Gaues mit klösterlichen Eigenleuten wiederzubesiedeln zur Ehre Gottes, des heiligen Bonifatius und zum Nutzen des Klosters. Der Abt gibt, gleichsam als ein gütiger Vater, den Eigenleuten in den Neusiedlungen ein besonderes, günstiges Dorfrecht mit allen Nutzungsrechten am umliegenden Wald auf eine Stunde, an Weg und Steg, mit Mühl- und Brückenrecht, so dass sie umso freudiger, pünktlicher und geflissentlicher mithelfen können in der Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Gott gebe, dass sich diese Hoffnung erfüllt ...
... Item begann auf die Einflüsterung des Bösen hin der hochmögende Graf Gottfried von Ziegenhayn, Hoch- und Domvogt der Reichsabtei von Fulda, ohne Zustimmung des Abtes Alehoff mit dem widerrechtlichen Bau einer starken Trutzburg innerhalb des Klosterbezirks, um seinem geistlichen Vater, dem Abt, als ein ungehorsamer Sohn zukünftig umso dreister die Stirn bieten zu können ...«
29. Septembris, am Tag des heiligen Erzengels Michael
Der Lehrmeister Dudo war schon am Morgen auf seinem Maulesel das Tal heraufgekommen. Schwere Nebel lagen noch über dem Dorf, und es war empfindlich kalt geworden. Der Sommer ging unaufhaltsam seinem Ende entgegen. Die Natur hatte die lebendige Frische ihrer Farben verloren. Alles roch jetzt nach Vergänglichkeit, nach Herbst. Das Morgengeläut der bronzenen Glocke im Turm der neuen Dorfkirche St. Laurentius verhallte an den bewaldeten Berghängen. Noch war dieser Klang ungewohnt im Gieseler Tal, doch wenn Gott es so wollte, dann hatten der Wald und die Wiese, der Bach und der Berg noch viele Menschenleben lang Zeit, sich an das Läuten zu gewöhnen.
Spärlicher Rauch drang an den Firsten der gedrungenen, strohgedeckten Gehöfte hervor, die Hähne krähten auf den Misthaufen, und die Hunde bellten, als der Mönch die Umfriedung des Dorfes erreichte. Gleichzeitig mit dem Sonnenaufgang war hier das Leben erwacht, doch es war Sonntag, und so ruhte die Arbeit. Alle fragten sich, was der Magister Dudo im Dorf wollte. Er musterte jeden Einzelnen, der ihm begegnete, mit seinem durchdringenden Blick.
Zielstrebig steuerte er das Bauernmeistergehöft am Gieseler Dorfplatz an. Die spielenden Kinder liefen ängstlich davon, als sie den seltsamen, hageren Mönch sahen, der ihnen wegen seiner braunen, verfaulten Zähne und der tief im Schatten der Kapuze liegenden Augen unheimlich wie der leibhaftige Tod erschien.
Er klopfte. Maria, die Magd, öffnete und ließ beim Anblick des Mönchs beinahe die Schüssel mit Brei fallen, die sie gerade rührte. »Herrin. Ich glaube, wir haben hohen Besuch.«
Die Bauernmeisterin erschien hinter der Magd, und Magister Dudo stellte sich als der Herr des Schriftenhauses und als Leiter der Klosterschule von Fulda vor. Er hätte etwas Wichtiges mit dem Bauernmeister zu besprechen, sagte er. Irmhard nickte beflissen und schickte den Oberknecht nach ihrem Gemahl, der wie an jedem Sonntagmorgen nach den Bienenkörben sah, die draußen am Waldesrand aufgestellt waren.
»Ist das Euer Sohn?«, fragte der Mönch und deutete mit seinem dürren Finger auf den untersetzten, aber kräftig gebauten Jungen, der auf der Ofenbank saß und mit Eifer an seinem Übungsschwert aus weichem Lindenholz schnitzte.
»Ja, Herr. Das ist Walther, unser Ältester«, erwiderte die Bauernmeisterin stolz.
»Habt Ihr noch mehr Kinder, Frau? Habt Ihr noch weitere Söhne?«
Obgleich dünn, weißhaarig und ernst wie die meisten Mönche, war der Magister ein Respekt einflößender Mann – ein Mann, der dem Himmel näher schien als den Lebenden.
»Eberhard. Mein zweiter Sohn«, sagte die Mutter beinahe widerwillig und mit wenig Wärme in der Stimme. Es war offenkundig, dass sie ihren Ältesten dem Jüngeren vorzog. Sie wunderte sich, dass sich überhaupt jemand nach Eberhard erkundigte. »Er ist draußen«, sagte Irmhard. »Zusammen mit seiner Schwester. Soll ich Walther schicken, um ihn hereinzuholen?«
Die Frage erledigte sich schnell von selbst, denn im gleichen Augenblick flog die Tür der guten Stube auf. Eberhard und Theresa kamen von draußen hereingestürmt. Eberhard hatte eine blutige Nase und Tränen in den Augen, und seine Kleider waren voller Erde.
»Um Himmels willen!« Die Mutter schlug die Hände theatralisch über dem Kopf zusammen. »Was hast du denn schon wieder angestellt?«
»Eberhard kann nichts dafür!«, rief Theresa. Dann erst bemerkte sie den unheimlichen Gast, den Benediktinermönch in seiner dunklen Kutte, der neben Walther stand. Sie verzog das Gesicht, als sie die schwarzen Zähne des Mönchs sah. Der geistliche Herr musste Tag für Tag höllische Schmerzen leiden, und es schien so, als hätten sich diese seinem ganzen Wesen aufgeprägt.
»Ordolf hat schon wieder unseren Vater beleidigt«, stieß Eberhard mühsam hervor. Sein Gesicht war schmerzverzerrt, und er hielt sich den rechten Arm.
»Ordolf, Ordolf, Ordolf. Was war denn nun schon wieder?« Die Mutter schüttelte den Kopf. »Hat euer Vater euch nicht ein für alle Male befohlen, dass ihr euch von ihm fernhaltet?«
»Ja, das hat er auch! Und wir halten uns ja daran«, sagte Eberhard. Mit dem Handrücken wollte er sich das Blut von der Nase fortwischen, verschmierte es aber nur im Gesicht. »Und der Einzige, der sich nicht darum schert, ist Ordolf.«
»Komm her, Junge.« Maria, die resolute Magd, zog Eberhard in den hinteren Teil der guten Stube und säuberte ihm mit einem feuchten Tuch das Gesicht. »Man muss endlich etwas unternehmen«, murmelte sie.
»Er hat also trotz aller Warnungen schon wieder unseren Vater beleidigt?«, fragte Walther mit einem bedrohlichen Unterton in der Stimme.
»Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr alle euren Disput später fortsetzen würdet«, sagte der zahnkranke Mönch gereizt. »Glaubt ihr etwa, ich bin den langen Weg vom Kloster hierher zu euch ins Dorf gekommen, um mir solche Kindereien anzuhören?«
Plötzlich sprang Walther auf. »Es sind keine Kindereien, wenn man unsere Familie beleidigt, Herr Mönch!«, rief der Junge mit funkelnden Augen. Er meinte es ernst. Die Familienehre war dem erstgeborenen Sohn des Bauernmeisters heilig.
»Seid bitte nicht böse mit meinem Sohn«, sagte die Mutter flehend. »Er ist manchmal ein ziemlicher Heißsporn.« Sie trat zu Walther, legte ihm die Hände auf die Schultern und drückte ihn auf den Schemel zurück.
»Ein Junge in seinem Alter sollte allmählich lernen, sich zu beherrschen«, erwiderte der Mönch mit seiner dumpfen Stimme, die klang, als käme sie aus einer kalten Gruft. Dann suchte sein Blick den jüngeren Sohn des Bauernmeisters. Die Magd ordnete Eberhard gerade die wirren Haare.
»Eberhard heißt du?«, fragte der Mönch. »Du bist der Zweitgeborene?« Er betonte das so, als hätte es eine besondere Bedeutung. »Komm her, junger Mann!«
»Ich?« Eberhard schrak zusammen. Er hatte nicht erwartet, dass der Mönch ihn ansprechen würde. »Ich habe nichts getan!«
Der Mönch lachte ohne Herzlichkeit. »Getan? Das hört sich an, als hättest du ein schlechtes Gewissen! Also, keiner hat behauptet, dass du etwas getan hast. Aber komm jetzt her und setz dich hier auf den Schemel an den Tisch.«
Eberhard widerstrebte es, dem Mönch zu gehorchen, auch wenn er nicht genau wusste, warum. Die Mutter nickte ihm auffordernd zu. Er zuckte mit den Schultern, dann setzte er sich auf den Schemel. Seine verdrießliche Miene wechselte in Neugier, als der Mönch aus seiner Ledertasche ein Wachstäfelchen und einen Griffel zog. Obwohl er sich immer noch keinen Reim darauf machen konnte, was der Mönch von ihm wollte, vollführte sein Herz einen Sprung, als er die Schreibgerätschaften sah. Für ihn waren es magische Werkzeuge, mit denen das Wunder der Buchstaben und der Sprache hervorgebracht und festgehalten wurde. Seine Augen leuchteten für einen Augenblick auf. Geräuschvoll stellte die Magd die gesäuberte Schüssel zu den anderen.
»Darf ich Euch etwas fragen, Magister Dudo?«
»Bauernmeisterin?«
»Was wollt Ihr von meinem Sohn? Natürlich, Herr, Ihr werdet schon wissen, was Ihr tut. Ich verstehe es nur nicht.«
»Ich werde es Eurem Gemahl früh genug sagen, wenn er endlich hier ist«, erwiderte der Mönch von oben herab. »Es ist mir einfach zu wichtig, als dass ich es hier zwischen Küchentisch und Herd in Gegenwart des Gesindes besprechen möchte.«
»Das verstehe ich, Herr«, erwiderte die Mutter kleinlaut.
»Ihr braucht Euch aber keine Gedanken zu machen«, fügte der Mönch mit etwas milderem Tonfall hinzu.
»Gott sei's gedankt.«
»Im Gegenteil.«
»Im Gegenteil? Jetzt macht Ihr mich aber doch neugierig.«
»Geduldet Euch nur, Bauernmeisterin! Und du, Junge: Kannst du mir sagen, was das hier heißt?« Er ritzte ein paar Buchstaben in das Wachstäfelchen und zeigte dann Eberhard das Geschriebene.
»Natürlich, Herr, es heißt Amen.«
»Gut.«
Der Magister ritzte schnell weitere Buchstaben in die Tafel.
»Dominus vobiscum«, sagte Eberhard, ohne zu überlegen.
»Du erstaunst mich. Woher kannst du das?«
Eberhard stockte. Keiner in seiner Familie wusste von seinen heimlichen Lehrstunden bei Guido, dem alten, ausgedienten Hilfspriester am Hohen Dom in Fulda, der hier im Dorf seine letzten Lebensjahre verbrachte – für seinen Lebensunterhalt kam das Kloster auf. Aber irgendwann musste Eberhard es offenbaren, er konnte nicht für alle Zeiten sein Wissen und seine Fähigkeiten verbergen, nur weil er damit bei den Leuten aneckte. Konnte es denn eine bessere Gelegenheit geben, alles zu beichten?
»Meister Guido hat es mir beigebracht.«
»Meister Guido?«, fuhr die Mutter auf. »Hat dein Vater dir nicht ausdrücklich verboten, den alten Mann weiter zu belästigen?«
»Ich habe ihn nicht belästigt, Mutter«, erwiderte Eberhard entschlossen. »Er hat es gern gemacht.«
»Das stimmt«, pflichtete Theresa ihrem Bruder bei. »Meister Guido freut sich immer, wenn wir ihn in seiner Hütte besuchen.«
»Lasst es gut sein, Frau«, sagte der Mönch. »Vielleicht werdet Ihr es Guido eines Tages danken.«
Die Tür zur guten Stube quietschte in ihren Angeln. »Endlich, der Herr kommt heim«, sagte die Bauernmeisterin. Sie atmete auf, und ein Stein fiel ihr vom Herzen.
Hinkmar trat über die Schwelle, gefolgt von Gottschalk, dem Oberknecht. »Verzeiht, wenn Ihr warten musstet, Magister Dudo.« Er beugte das Knie vor dem hochgeborenen Mönch und küsste den Siegelring, den dieser an seiner Rechten über dem dünnen, weißen Handschuh trug. »Welche Ehre Ihr meinem Hause bereitet«, sagte Hinkmar. »Und dazu so unerwartet!«
»Macht kein Aufhebens, Bauernmeister.«
»Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Was verschafft mir die Ehre Eures Besuchs?«
»Bauernmeister, ich will Euch ein Geschäft vorschlagen. Weil ich Euch kenne und weil ich Euch schätze. Ein Geschäft, von dem beide Seiten etwas haben werden.«
»Wollt Ihr ein Stück Fleisch mit uns essen?«, rief die Hausherrin vom Herd her dazwischen.
In einer großen Pfanne brutzelten die Fleischstücke, die später auf den Sonntagstisch kommen sollten. Bei dem Gedanken an festes Essen verzog Magister Dudo das Gesicht.
»Natürlich, Eure Zähne! Wisst Ihr, was ich den meinen gebe, wenn ihnen der Wurm die Zähne zerfrisst?« Die Bauernmeisterin öffnete ihre Gewürztruhe und entnahm ihr ein kleines Fläschchen aus grünem Glas. »Das Öl der Gewürznelke«, sagte Irmhard und hielt das Gefäß in die Höhe. »Ich habe es auf dem Martinsmarkt in Fulda von einem friesischen Händler ...«
»Frau!«, rief Hinkmar, »wir haben hier Männerangelegenheiten zu besprechen.«
»Ich wollte doch nur ...«
»Herrgott, lass es gut sein!«
»Wie du meinst«, sagte Irmhard schmollend, ließ es sich jedoch nicht nehmen, das Fläschchen auf den Tisch zu stellen. »Wenn Ihr nachher vielleicht ...?«
Magister Dudo nickte ihr mit gequältem Gesicht zu. »Also zur Sache«, sagte er. »Hört zu, Meister Hinkmar, weswegen ich Euch aufgesucht habe. Ich will eine Pfarrstelle stiften, hier in Eurem Dorf, für Eure neue Kirche.«
Der Bauernmeister schaute den Mönch zuerst erstaunt, dann freudig an. »Das ist eine gute Nachricht«, sagte er.
»Wenn Gott mich dereinst zu sich ruft«, fuhr Dudo fort und machte ein Kreuzzeichen, »dann will ich hier an Eurem Altar meine letzte Ruhe finden. Das ist mein Wunsch, und der Abt ist einverstanden damit. Ich stifte Euch so viele Höfe aus meinem Besitz, wie ein Priester benötigt, um ein standesgemäßes Leben zu führen. Glaubt mir, ich will nicht, dass ein hungernder oder zerlumpter Armeleutepriester an meinem Grab betet ...«
»Ich kann Euch gar nicht sagen, wie geehrt ich mich fühle ... auch im Namen des ganzen Dorfs!«
»Ich weiß, dass Ihr einer ehrsamen Dorfgemeinschaft vorsteht. Deswegen bin ich zu Euch gekommen. Ich vertraue darauf, dass Ihr eine Pflicht erfüllt, die Ihr einmal übernommen habt.«
»Und von welcher Pflicht redet Ihr?«
»Der Priester und später seine Nachfolger sollen am Gieseler Altar Messen für mein Seelenheil halten. Sooft, wie ich es in meiner Stiftung bestimme. Wir werden darüber eine Urkunde verfassen, sie siegeln lassen und sowohl bei Euch im Dorf als auch im Klosterarchiv hinterlegen, damit es für alle Zeit gilt.«
»Ich verstehe, Herr«, sagte Hinkmar.
»Soweit habe ich mir alles genau überlegt, jetzt ist nur noch eine Frage offen: Wer?«
»Wer?«
»Ja, wer? Wer soll es sein, der an meinem Grab betet? Ich will es wissen, bevor der Herr mich zu sich ruft! Könnt Ihr das verstehen?«
»Natürlich, Herr! Wo unser Seelenheil doch das Wichtigste überhaupt ist.«
»Gestern Abend nach der Komplet ... da habe ich noch lange wach gelegen und darüber nachgedacht. Schließlich habe ich mir vorgenommen, Euch zu fragen, ob Ihr jemand kennt, der für dieses Amt in Frage käme?«
»Nein, Meister Dudo, woher sollte ich ...«
»Es erübrigt sich.«
»Es erübrigt sich? Ich verstehe nicht.«
»Ich habe im Bett gelegen und inniglich zu Gott gebetet, ich habe ihn angefleht, dass er mir ein Zeichen schickt.«
»Aha, ein Zeichen.«
»Ja. Und ich kam hierher und stand in Eurer guten Stube, und was erfahre ich: Hier ist ein Bauernjunge, der Lateinisch kann. Das ist das Zeichen, das ich mir gewünscht habe.«
»Ihr müsst mir auf die Sprünge helfen.«
»Euer zweiter Sohn Eberhard. Ihn meine ich.«
»Ich?«, fuhr Eberhard auf.
»Lateinisch?« Das Gesicht des Bauernmeisters verfärbte sich rot, doch er bemühte sich sichtlich, seine Wut im Zaum zu halten. »Schuster bleib bei deinen Leisten«, sagte er. »Latein ist die Sprache der Herren, nicht deine Sprache. Ein für alle Mal: Du lässt Magister Guido in Ruhe! Ich habe dir verboten, ihn zu belästigen!«
»Und warum? Meister Guido hat doch gar nichts dagegen, wenn ich ihn besuche.«
Der Bauernmeister machte zwei schnelle Schritte auf seinen zweitgeborenen Sohn zu und versetzte ihm eine schallende Ohrfeige. »Das soll dich lehren, mir zu widersprechen!«
Eberhard hielt sich die Backe und schaute den Vater trotzig an.
»Am Martinstag beginnt der Unterricht für unsere Novizen an unserer Klosterschule«, sagte Bruder Dudo. »Gott selbst hat mit dem Finger auf dich gezeigt, Junge! Du wirst einmal der Priester sein, der an meinem Grab betet.«
»Nein, das werde ich nicht.«
»Halt deinen Mund!«, sagte der Bauernmeister barsch.
»Du bist zwölf Jahre alt, oder?«, fragte Dudo unbeeindruckt. Der Junge nickte widerstrebend. »Dann benimm dich nicht trotzig wie ein Kind! Du hast Anlagen, ich spüre es. Gott ist nicht blind. Seine Wahl ist nicht umsonst auf dich gefallen.«
11. Octobris, am Sonntag vor St. Burkhard
Eberhard saß auf der Sitzbank unter der ausladenden Gerichtslinde, wo sein Vater das Dorfgericht abhielt. Der Lindenbaum war das einzige Relikt, das vom alten Giesel übrig geblieben war. Er zog seinen Mantel mit dem Pelzbesatz enger um die Schultern. Den würde er nach Fulda mitnehmen, es sei denn, er würde doch noch davonlaufen.
Gottschalk kam mit einem Fuhrwerk Holz aus dem Wald. »Hoo!« Er ließ den Ochsen anhalten. »Junge, was sitzt du so alleine hier?«, fragte der gutmütige Oberknecht. »Du siehst aus, als wärst du in Gedanken schon ganz woanders.«
»Findest du?«
»Würde ich sagen! Noch einen Monat ...«
»Ja, noch einen Monat. Am Martinstag.«
»Wirst du uns denn vermissen?«
Eberhard starrte auf seine Hände. »Das interessiert doch niemanden«, sagte er bitter.
»Sei nicht undankbar. Natürlich interessiert es uns.«
»Ich glaube nicht, dass mich viele vermissen werden.«
Der Oberknecht schüttelte den Kopf. »Du bist ungerecht, Junge. Du wolltest doch immer deinen eigenen Weg gehen, oder? Du wolltest immer etwas Besonderes sein. Also kannst du jetzt niemandem sonst einen Vorwurf machen. Sei doch froh. Du wirst jetzt einen besonderen Lebensweg einschlagen. Wer kann das schon von sich sagen?«
Eberhard schluckte vor Rührung. Gottschalk war einer von den Menschen, die er sicherlich am meisten vermissen würde. Er ging zu ihm, schlang die Arme um den kräftigen Hals des Knechts und legte den Kopf an seine starke Brust. Eine Geste, die er bei seinem Vater niemals wagen würde. Gottschalk war wie ein Fels in der Brandung seines Lebens. Eberhard schämte sich nicht, dass er Tränen vergoss – zum einen, weil er Gottschalk schrecklich vermissen würde, zum anderen, weil ihm seine bloße Nähe so guttat.
»Junge, ist das nicht ein Wink des Schicksals? Gerade du mit deinen Schrullen! Ein Bauernjunge, der Lateinisch reden, der schreiben und lesen können will ... ich weiß es nicht. Ich hatte Angst um dich, würde ich sagen. Das kann nicht gutgehen, hab ich immer gedacht. Ich hab viel für dich gebetet ... Und jetzt scheint es mit diesem Jungen doch noch ein gutes Ende zu nehmen, hab ich mir gesagt. Dem Himmel sei Dank!«
»Und was ich selbst davon halte, kümmert dich anscheinend so wenig wie alle anderen!«
Gottschalk lachte, und sein sonnengebräuntes Gesicht wirkte dadurch noch freundlicher und jünger, trotz seines grau werdenden Haars. Er krempelte die Ärmel hoch und entblößte seine Muskeln. Er hatte nie geheiratet. Die Knechte sagten, was soll der Oberknecht sich mit einer begnügen, wo er doch alle Mägde haben kann. »Aha. Du findest also, dass sich jemand um deine Grillen und Launen kümmern soll?«
»Das sind keine Launen.«
»Ach. Was ist es denn sonst? Sag mir nicht, dass du Angst hast vor der Welt da draußen. Du hast genauso wenig Angst wie dein Vater und wie dein Bruder.«
»Ich will es aber nicht.«
»Siehst du! Ich will es aber nicht.« Er ahmte die schnoddrige Ausdrucksweise Eberhards nach. »Das nenne ich Grillen und Launen. Der Himmel hat dir ein Geschenk gemacht! Nimm es an!« Er ergriff das Seil, mit dem er den Ochsen führte. »Hopp!«
»Und du? Würdest du denn Priester werden wollen?«
»Ich? Ein Priester?« Er lenkte das Fuhrwerk mit dem Brennholz in Richtung des Südtores von Giesel. »Diese Frage stellt sich zum Glück nicht.«
Eberhard lachte. Er setzte sich wieder auf die runde Bank, die den dicken Stamm der Gerichtslinde umgab, und blickte Gottschalk und dem Fuhrwerk hinterher. Der Oberknecht winkte noch einmal, als er das Tor durchquerte, dann verschwand er hinter den Palisaden.
Eberhard grübelte. War es denn wirklich nur eine Laune und eine Grille, dass er selbst seinen Lebensweg bestimmen wollte? Alle anderen schienen diese Ansicht zu teilen, selbst seine Schwester Theresa, die ihm sonst in fast allem zustimmte.
Durch das jenseitige Tor fuhr ein Planwagen aus dem Dorf hinaus. Er erkannte Ordolf und dessen Vater. Die beiden brachten einmal im Monat eine große Fuhre Krüge, Becher und Töpfe aus glasiertem Ton nach Fulda zu einem Händler. Das Geschirr stellten junge Mägde in einer kleinen, zugigen Werkstatt her, die Rochus an seinem Gehöft angebaut hatte. Der Ton, den sie am Himmelsberg abbauten, war gut, die Ware begehrt. Jedenfalls kehrte Rochus nie mit einem übrig gebliebenen Stück ins Dorf zurück.
Eberhard ließ den Blick schweifen. Die Linde stand auf einer Anhöhe am südlichen Rand der Allmende. Von hier oben konnte er das ganze Dorf überblicken, bis hinüber zum anderen Ende des Tales, das von dem markanten Schattenriss des dunkelgrünen Himmelsbergs überragt wurde. Giesel lag friedlich am Talgrund, umgeben vom fruchtbaren Kranz der buschgesäumten Weiden, der abgeernteten Äcker und Gärten, der bis zum Waldesrain hinaus reichte. Von diesem Platz aus, so hatte er als Bub geglaubt, hätte er die ganze Welt im Blick.
»Ist das nicht wunderschön?«, fragte er sich selbst mit so viel Wehmut und Traurigkeit, wie sie ein Zwölfjähriger empfinden kann. Es lag ein bitterer Geschmack von Abschied in der Luft. Im Tal roch es nach Herbst. Es war kühl, aber die Sonne vergoss an diesem Morgen ihr goldenes Oktoberlicht noch einmal aus voller Kraft. Das Licht brach sich in den Tauperlen, die sich in der kalten Nacht an den Blättern der Linde gebildet hatten.





























