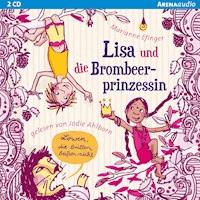1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bookspot Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Wissenschaftsjournalist Manuel Jäger wurde mit Glasknochen geboren und landet zum x-ten Mal in seinem Leben dort, wo er nicht sein will: im Krankenhaus. Dort lernt er die Krankenschwester Dagmar kennen, die ihn eigentümlich fasziniert, weil sie ihn an seine bei einem Unfall getötete große Liebe Lenora erinnert. Doch sein Aufenthalt im Marienhospital steht von Anfang an unter keinem guten Stern. Als er sich eine Erkältung zuzieht, die für ihn lebensgefährlich ist, da er wegen seiner Glasknochen den Schleim nicht abhusten kann, beginnt für Manuel ein Kampf auf Leben und Tod. Ein nachdenklicher, atmosphärisch dichter Roman, der die wirklich wichtigen Fragen unserer Existenz aufwirft: Welche Qualität geben wir unserer Lebenszeit und wie gehen wir mit den zentralen Themen Liebe, Krankheit und Tod um?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Marianne Efinger
Gottes leere Hand
Roman
BOOKSPOT VERLAG
Montag
Sein Herz hämmert, dass es im Hals und im Unterkiefer zu spüren ist. Der Rhythmus ist so schnell, dass die einzelnen Schläge ununterscheidbar werden, sich zusammenballen zu einem Kloß, der in der Kehle sitzt und auf den der Magen prompt mit Übelkeit reagiert. Das Giemen, das er hört, kommt von verzweifelten Versuchen, Luft in die Lungen zu ziehen, doch der Brustkorb hebt sich nicht, senkt sich nicht, er fühlt nur einen enormen Druck darauf lasten. Sein Gesicht ist schweißfeucht und der Schweiß ist kalt und klebrig.
Bis auf einen diffus schimmernden Lichtfleck, den die Ziffern seines Weckers streuen, ist es stockdunkel im Zimmer. Als Manuels Blick auf die Anzeige fällt, springt die letzte der Zahlen gerade um. Es ist fünf Uhr siebenundvierzig.
Er bekommt keine Luft. Die Panik, die ihn aus dem Schlaf gerissen hat, wächst, schwillt unaufhaltsam an, wird Todesangst. Er sieht die Ohnmacht kommen, wartet förmlich darauf, dass der Schalter in seinem Kopf umgelegt wird und auch der schimmernde Lichtfleck verschwindet.
Doch stattdessen löst alle Angst sich auf, zurück bleibt nur ein ungläubiges Staunen: Ich werde sterben.
Er hat noch fünfundvierzig Sekunden.
Fünfundvierzig Sekunden. Der Gedanke löst die erste einer Reihe von Handlungen aus, die ihm längst in Fleisch und Blut übergegangen sind. Er knipst die Nachttischlampe an, kurzfristig blendet ihn das grell aufflammende Licht. Aus dem gleißenden Wirbel fügt sich vor allem anderen das Muster der Bettdecke wieder zusammen. Dann ist auch das Zimmer wieder da und mit dem Zimmer all seine Gegenstände. Während er das fahrbare Sauerstoffgerät zu sich heranzieht und die Plastikhaube entfernt, bleibt sein Blick an dem Lesebändchen des Buches hängen, das auf seinem Nachttisch liegt. Das Lesebändchen ist zerfranst, ein Stück weit aufgespleißt, sodass die einzelnen Fasern auseinanderklaffen.
Manuel stülpt sich die Atemmaske über Mund und Nase, reguliert die Sauerstoffkonzentration und öffnet den Hahn. Beinahe im selben Augenblick registriert er, wie die Lungenflügel sich unter dem einströmenden Gas dehnen. Da ist sie wieder, die wilde Euphorie, die ihn jedes Mal ergreift, wenn er Sauerstoff aus der Flasche atmet. Doch er kann nach wie vor nicht durchatmen. Die Todesfurcht will wiederkehren, er kämpft sie nieder, denn er atmet – oder besser gesagt, das Gerät atmet für ihn. Er wird zu dem Maschinenwesen, das er fürchtet.
Gern hätte er jemanden an seiner Seite gehabt. Einen vertrauten Menschen, der ihm die Hand hält, den Schweiß abwischt oder einfach nur da ist. Aber das Haus ist leer. Die immense Einsamkeit würgt ihn mehr als sein Herz, das in Panik gerät und in seinen Hals springt, wenn die Lungen wieder einmal streiken. Seit Langem schon machen sie Probleme. Es liegt an seinen Glasknochen, an den Rippen, die nach innen gedrückt sind statt sich nach außen zu wölben und die brechen, wenn er kräftig hustet. In den Bronchialverästelungen sammelt sich der Schleim, jede banale Erkältung kann deshalb lebensgefährlich für ihn werden.
Manuel zählt nicht mehr, wie oft er auf Intensivstationen gelegen hat, an Beatmungsgeräte angeschlossen, über Infusionen ernährt, durch Psychopharmaka ruhiggestellt, mit Antibiotika und Sulfonamiden vollgepumpt. Er weiß nur eines, nämlich, dass er nie wieder eine Intensivstation von innen sehen will. All diese Kämpfe um sein Leben sind zu einer einzigen, verstörenden Erinnerung zusammengeschmolzen, aus der seine Albträume sich nähren.
Dieses Mal ist es keine Erkältung. Seine Bronchien kleben, als wären sie mit flüssigem Kunststoff ausgegossen worden. Er erinnert sich nicht, jemals etwas Vergleichbares erlebt zu haben. Plötzlich verschiebt sich etwas, die Muskeln gehorchen wieder, strecken und verkürzen sich, in dieser Bewegung hebt und senkt sich der Brustkorb. Dankbar atmet Manuel ein und langsam wieder aus. Der Kloß in seinem Hals und der Druck auf seiner Brust verschwinden, der Atem beruhigt sich, wird wieder regelmäßig. Er hebt die Maske an und bemerkt im selben Augenblick die Anzeige, die ihn warnt, dass der Sauerstoffgehalt in seinem Blut rapide sinkt. Eben noch bei vierundneunzig Prozent, sackt der Wert schon in der nächsten Sekunde auf neunundachtzig ab. Dann geht das Alarmsignal los, so grell, dass es in den Ohren wehtut.
Manuel starrt fassungslos auf die Anzeige, da drängt sich ihm auf einmal die rote Taste des Babyfons auf, das neben seinem Buch mit dem Lesebändchen steht. So rot ist diese Taste noch nie gewesen. Sie springt auf ihn zu und brennt sich in sein Gehirn ein, während das Gesichtsfeld von beiden Seiten her kleiner wird. Es verengt sich zum Tunnel und die Dunkelheit breitet sich aus.
Mit einem Mal ist er in diesem Tunnel. Es ist eiskalt und ein entsetzlicher Abgrund tut sich auf. Es ist die Finsternis, das Nichts, das Ende von Zeit und Raum. Auf diesen Abgrund schlittert er zu, und da ist niemand, der ihm Halt gibt, und nichts, an dem er sich festhalten kann.
Manuel hört den Schrei, seinen eigenen Schrei, der von den Tunnelwänden zurückgeworfen wird und verhallt.
***
Die Tür des Wohnheims fällt hinter Dagmar ins Schloss. Das tröstliche Licht, das eben noch den Vorplatz erhellt hat, ist mit einem Schlag verschwunden. Regentropfen streifen ihre Wangen und der Regen ist mit Graupeln vermischt. Bei diesem Wetter fällt es ihr besonders schwer, in aller Herrgottsfrühe aus dem Haus zu gehen.
Dagmar fröstelt, schlingt beide Arme um den Körper und marschiert los. Ihr Kopf ist leer und an ihren Beinen hängen Bleigewichte. Halsweh hat sie außerdem. Sie läuft an einem mit Werbetexten bepflasterten Bauzaun entlang, vorbei an einem Plakat des Deutschen Sportbundes, auf dem im Wasser schwimmende Köpfe in einer schief gesetzten Sprechblase Oh, du fröhliche … singen, vorbei an der Information, dass die Aktion Sorgenkind sich in Aktion Mensch umbenannt hat, und vorbei an einem roten Herz, das mit einem blauen Kondom für Safer Sex Reklame macht.
Im Licht der Halogenscheinwerfer sehen die großen, gelben Kräne wie Dinosaurier aus. Der gesamte Westflügel des Krankenhauses ist abgerissen worden und soll durch einen Neubau ersetzt werden. Von einem erstklassigen Strahlenzentrum, Intensiveinheiten für die Stammzelltherapie und komfortablen Patientenzimmern mit eigenen Duschkabinen ist die Rede. Noch sind von dem neuen Klinikanbau nur die Fundamente und eine Menge Stahlträger zu sehen. Im übernächsten Jahr soll der Betrieb aufgenommen werden. Dagmar sieht all diesen Veränderungen mit gemischten Gefühlen entgegen. In einem hypermodernen Glasbau und von noch mehr Hightech umgeben, kann sie sich nur schwer vorstellen.
Der Pförtner am Eingang hat keinen Gruß für sie, sondern blättert demonstrativ eine Seite der Zeitung von gestern um. Der penetrante Geruch aus Krankheit, Schmerz und Desinfektionsmitteln steigt ihr trotz ihres Schnupfens in die Nase, die in der Wärme zu triefen beginnt. Während sie nach ihrem Taschentuch angelt, hört sie das Signal eines Martinshorns, das gedämpft über den Flur heranrollt. Es kommt von der hinteren Einfahrt, wo die Rettungswagen bis an die Rampe heranfahren.
Einmal in der Woche liefern die Rettungswagen sämtliche Notfälle der Stadt im Marienhospital ab.Das ist letzte Nacht wieder der Fall gewesen. Es ist Notaufnahme, heißt es dann. Vor allem im Winter, wenn Inversionswetterlagen auf Herz und Atmung drücken, Grippewellen ihre Opfer fordern oder Glatteis die Zahl der Unfälle sprunghaft ansteigen lässt, werden die einzelnen Stationen mit verletzten, hoch fiebernden, aber auch mit betrunkenen und obdachlosen Menschen überschwemmt. Die Nachtwache ist überfordert, wenn zur normalen Arbeit noch diese schwer einzuschätzenden Notfälle hinzukommen. Nachts ist eine Pflegekraft allein auf Station. Und es gibt im ganzen Krankenhaus keine Nachtschwester, die nicht irgendwann einmal heulend zusammengebrochen ist.
Dagmar kommt vor der Glastür ihrer Station an, sieht dort einen im Flur aufgestellten orangeroten Wandschirm und bleibt wie gelähmt stehen. Hinter dem Wandschirm verbirgt sich ein Bett mit einem Patienten darin, das heißt, dass die Station überfüllt ist. Der Schreck schlägt ihr auf den Magen, der rebelliert und sie daran erinnert, dass sie noch nicht gefrühstückt hat.
An überquellenden Wäschesäcken vorbei eilt sie in Richtung Umkleideraum. Aus einem dieser Säcke hängt ein blutverschmiertes Laken bis auf den Boden herunter. Eine vor eine Tür gestellte Blumenvase ist umgefallen, gelbe Rosen liegen zerstreut herum, jemand ist in die Lache getreten und hat überall auf dem Boden feuchte Fußspuren gesetzt. Mitten im Flur stehen verlassen der Wagen mit den Patientenakten und ein fahrbares Ultraschallgerät, während an drei Patientenzimmern, begleitet von durchdringendem Quäken, die roten Ruflampen blinken. Aus einem dieser Zimmer schiebt der Krankenpflegeschüler umständlich ein Bett heraus. Darin liegt eine Frau, die Dagmar nicht kennt.
»Wo ist die Nachtwache?«, will Dagmar wissen.
Freddy weist mit dem Finger auf eine Tür. »Ulrike und der diensthabende Arzt sind bei einem Notfall. Ein akuter Bauch. Du hättest hören sollen, wie der Mann gebrüllt hat. Der war sogar noch im Treppenhaus zu hören. Ich muss Frau Reich zum EKG bringen. Sie ist auch heute Nacht gekommen.«
»Ist Marion schon da?«, fragt Dagmar weiter, wartet die Antwort aber gar nicht mehr ab, sondern verschwindet im Umkleideraum, wo sie hastig in einen frischen, weißen Hosenanzug schlüpft. Dann atmet sie einmal tief durch und tritt ins nächste Zimmer. Sie entfernt eine Nierenschale mit Erbrochenem und tauscht ein nasses Bettlaken aus, bevor sie zeitgleich mit den beiden Schülerinnen im Stationszimmer eintrifft, wo ihre Kollegin Marion schon dabei ist, sich einen ersten Überblick zu verschaffen. Auch hier fällt Dagmar sofort die überall herrschende Unordnung ins Auge. Auf dem Schreibtisch häufen sich stapelweise Papiere, während leere Plastikverpackungen, benutzte Nierenschalen und zerknüllte Kompressen ein grandioses Durcheinander auf den Ablageflächen bilden. Marion wirft Dagmar einen Blick zu und sagt anstelle einer Begrüßung: »Bist du krank? Du siehst aus, als ob du eigentlich ins Bett gehörst.«
In diesem Augenblick kommt Ulrike ins Stationszimmer und der diensthabende Arzt folgt ihr auf dem Fuß. Ulrikes Hosenanzug ist mit Flecken übersät, ob es sich dabei um Eiter, Blut oder Quittengelee handelt, ist schwer zu sagen. Ihr ansonsten schon schmales Gesicht wirkt durch die Blässe noch spitzer, das ist immer so, wenn sie erschöpft ist. Dr. Fenning sieht fast noch schlimmer aus. Auf seinen Wangen und an seinem Kinn zeichnen sich dunkle Schatten ab, die ihn wie einen Verbrecher aussehen lassen. Auch er ist leichenblass und die Haare kringeln sich, als hätte er sich seit Tagen nicht gekämmt.
»Der Mann muss wahrscheinlich operiert werden«, erklärt Dr. Fenning. »Mit einem akuten Bauch ist nicht zu spaßen. Wo ist die Patientenkurve?«
»Ich hatte noch keine Zeit, die Kurve anzulegen«, entgegnet Ulrike entnervt und erntet dafür einen fragenden Blick.
»Was soll das heißen? Keine Zeit?«, blafft Fenning. »War Ihnen Ihre Kaffeepause wieder einmal wichtiger? Und wo soll ich meine Anordnungen hinschreiben?«
»Mir doch egal, wo Sie Ihre Anordnungen hinschreiben«, schnappt Ulrike patzig zurück. Der Arzt schnaubt verächtlich durch die Nase, nimmt das Spritzentablett und verlässt türknallend das Stationszimmer.
»Was bin ich froh, dass diese Nacht vorüber ist!« Mit einem Seufzer sinkt Ulrike auf den nächstbesten Stuhl. Die beiden Schülerinnen sehen sie ehrfürchtig an. Sonja ist das Stationsküken und hat mit ihrer Ausbildung gerade erst angefangen. Cornelia ist im zweiten Jahr und wird demnächst ihre Zwischenprüfung ablegen. Beide wissen, dass die Nächte in der Inneren Medizin der pure Horror sind.
Marion jedoch ignoriert Ulrikes Jammern. Sie sieht immer noch Dagmar an. »Du hast bestimmt Fieber. Warum bleibst du nicht zu Hause und meldest dich krank?«
»Und wer soll die ganze Arbeit machen?«, verteidigt sich Dagmar. »Seit Katrins Ausscheiden ist Kranksein einfach nicht mehr drin.«
»Du bist nicht für den Stellenplan zuständig«, gibt Marion kühl zurück. »Das ist Sache der heiligen Anneliese. Wenn du krank bist, bist du krank. Niemand kann von dir verlangen, dass du deine Gesundheit für andere ruinierst.«
»Wenn ich zu Hause bleibe, muss ein anderer einspringen. Und wer? Astrid vielleicht, die nach dreizehn Tagen Dienst gerade mal drei Tage frei hat? Astrid wird sich bei dir bedanken.«
»Ich spreche doch nicht von Astrid. Ich spreche davon, dass wir einen anderen Stellenschlüssel brauchen. Unsere Station ist vom Personal her für acht Pflegefälle ausgelegt, wir haben derzeit aber zwölf zu versorgen. Dazu noch die Notaufnahme. Wir müssen der Pflegedienstleitung endlich Druck machen. Warum kämpfen wir nicht ebenso wie die Ärzte für bessere Bedingungen?«
»Wenn du dich so aufregst, machst du uns allen nur das Leben schwer«, erwidert Dagmar.
»Daher verbreitest du lieber deine Grippeviren und Schnupfenbazillen unter Leute, die ohnehin geschwächt sind«, meint Marion giftig. »Ich finde das verantwortungslos.«
»Was für eine Nacht!« Ulrike beginnt, die auf dem Schreibtisch aufgehäuften Befunde, Laborausdrucke, Notarztberichte und Aufkleber zu sortieren. Marion bequemt sich, ihr dabei zu helfen, indem sie die Nierenschalen zusammenstellt, gebrauchte Kanülen entsorgt, abgerissene Etiketten und überflüssige Durchschläge einsammelt und in den Korb für den Schredder legt.
»Sonja, machst du uns einen Kaffee?«, wendet sich Dagmar der dunkelhaarigen Schülerin zu, während sie schon den Infusionsplan studiert und nach den entsprechenden Flaschen im Schrank greift.
»Und Fenning, dieser Arsch, verdächtigt mich, dass ich nur auf der faulen Haut gelegen habe!« Ulrike will sich nicht beruhigen. »Kaffeepause! Ich dachte, ich höre nicht richtig. Pah!«
»Seit er etwas mit Gössners Tochter hat, ist er lange nicht mehr so nett wie vorher«, stimmt Dagmar zu.
»Um dem Chef zu gefallen, muss er seinen Facharzt nun aber in Onkologie machen und die Station wechseln«, kichert Marion. »An seiner Stelle kommt der schicke Junge aus der Onko zu uns herunter. Christian Fischer. Wir werden bei der nächsten Medikamentenbestellung einen Sonderposten Beruhigungsmittel aufschreiben. Für die weiblichen Patienten, die auf unserer Station liegen. Wir werden die Pillen schachtelweise verteilen müssen.«
»Glaubst du wirklich, dass die alten Omis noch Interesse an Männern haben?«, fragt Cornelia erstaunt, während sie die Hocker unter dem Waschbecken hervorzieht und für die Übergabe in einer Reihe nebeneinander aufstellt, denn im Stationszimmer gibt es nur zwei Stühle und alle wollen sitzen, wenn sie mitschreiben, was in der vorangegangenen Schicht passiert ist.
»War doch bloß ein Witz!«, beruhigt Marion.
Eine Weile noch reden sie über den Neuen. Die beiden Schülerinnen haben glänzende Augen, als wären sie gerne bereit, sich in einen gut aussehenden jungen Arzt zu verlieben. Ulrike bedauert, dass sie nicht dabei sein wird, wenn er sich ihnen vorstellt, und Marion ist der Meinung, dass er vielleicht eine Sünde wert sein könnte. Dagmar hingegen denkt nicht an Christian Fischer, sondernan einen Mann, der sie nur mit freundlicher Geringschätzung behandelt, weil er glücklich verheiratet ist und zwei Kinder hat.
Freddy kommt mit seiner Patientin vom EKG zurück. Ulrike beginnt mit der Übergabe. Sie stellt die fünf Neuzugänge der vergangenen Nacht vor und wie die anderen kritzelt Dagmar automatisch mit. Namen und Erkrankungen prasseln auf sie nieder, aber sie kann sie sich nicht merken, weil sie die Personen nicht kennt und deshalb nichts mit all den Einzelheiten verbindet. Erst neulich hat sie im Fernsehen etwas über kosmische Teilchen gehört, die durch die Erde und durch jeden Menschen hindurchgehen, ohne die geringste Spur zu hinterlassen: genauso kommt ihr Ulrikes Bericht vor. Ihre Gedanken schweifen ab zu dem Mann, in den sie heimlich verliebt ist, dadurch verpasst sie einen Teil der Übergabe, hört nur noch etwas von »verwahrlost« und »stinkt gotteslästerlich«. Dagmar lässt eine Lücke, um den Namen und die Erkrankung des Verwahrlosten später nachzutragen. Sie gähnt, trinkt einen Schluck Kaffee und reißt sich energisch zusammen.
***
Der Mann in der roten Jacke richtet sich auf, streicht mit dem Handrücken eine fettige Haarsträhne aus der Stirn und mustert Manuel mit kritischem Blick. Er stößt einen erleichterten Seufzer aus und beginnt, die auf Bett und Boden verstreuten Instrumente einzusammeln und in einen Metallkoffer zu werfen. Manuel fällt auf, dass der Mann dünne Plastikhandschuhe trägt, das findet er seltsam. Ein blaues Licht flackert durchs Fenster herein und lässt sein Schlafzimmer fremd erscheinen.
»Glück gehabt! Zehn Minuten später wäre nichts mehr zu machen gewesen«, meint die Rotjacke.
»Um Himmels willen! Wie können Sie nur so etwas sagen!« Es ist eine Stimme, die Manuel kennt, und erst jetzt sieht er hinter der Rotjacke seinen besten Freund stehen. Dieser ist aschfahl im Gesicht und zudem noch unrasiert. Manuel stellt fest, dass man Lothar seine fünfzig Jahre heute deutlich ansieht. Dann entdeckt er, dass Lothar nur Pantoffeln an den nackten Füßen trägt. Während er sich darüber wundert, wird ihm plötzlich klar, dass sein Freund in Schlafanzug und Morgenmantel bei ihm erschienen ist. Was tut Lothar in diesem Aufzug hier in seinem Haus? Und warum stehen alle Türen sperrangelweit offen?
Da ist der Tunnel, der im Nichts geendet hat. Die Anzeige mit den schnell abfallenden Sauerstoffwerten. Die rote Taste. In scharf gezeichneten Bildern kehrt die Erinnerung zurück. Mit einem Mal versteht Manuel: Das Blaulicht da draußen gilt ihm, und der Fremde in der roten Jacke ist der Notarzt.
»Es ist ja noch einmal gut gegangen«, sagt er heiser. Sein Nacken schmerzt und sein Hals fühlt sich wie wundgescheuert an.
»Willkommen unter den Lebenden«, sagt der Notarzt und grinst ihm zu. »Wie fühlen Sie sich?«
»Wie eine gekochte Kartoffel! Was ist denn eigentlich passiert?«
Der Notarzt deutet auf Lothar. »Ihr Nachbar hat uns gerufen. Wir kamen, sahen Sie kurz vorm Exitus und siegten.« Während er spricht, bückt er sich, fischt eine abgebrochene, leere Glasampulle unter dem Bett hervor und hält sie Manuel unter die Nase. »Das Zeug hier hat Ihnen das Leben gerettet. Suprarenin! Es hat Ihren Kreislauf gerade noch rechtzeitig wieder in Schwung gebracht.«
»Die Lungen haben gestreikt. Ich erinnere mich«, sagt Manuel matt. »Plötzlich ging gar nichts mehr.«
Der Notarzt zuckt mit den Achseln und wirft die Ampulle ebenfalls in den Metallkoffer. »Wahrscheinlich haben Sie sich zu viel Sauerstoff gegeben. Ihr Gerät lief noch, als wir kamen. Wenn das Blut mit Sauerstoff übersättigt ist, kann es passieren, dass das Atemzentrum im Gehirn blockiert.«
»Das kann nicht sein. Ich weiß, wie viel Sauerstoff ich mir geben darf, und die Anzeige mit den Blutgaswerten ging steil nach unten. Der letzte Wert, an den ich mich erinnere, war fünfundachtzig.«
»Das ist typisch!«, bestätigt der Arzt zustimmend. »Das geht ganz schnell. Da hatte Ihr Nervensystem schon reagiert.«
»Ich habe mir den Sauerstoff doch nur gegeben, eben weil die Lungen blockiert haben«, widerspricht Manuel, aber der Notarzt hört ihm nicht mehr zu, sondern dreht sich zu einer Frau um, die eben im Türrahmen aufgetaucht ist. Sie hat einen braunen Schal um den Kopf und ein Umhängetuch um die Schultern geschlungen.
»Hallo, Frau Müller!«, ruft Manuel und hebt grüßend die Hand. Er sieht Frau Müller jeden Tag, denn sie ist es, die ihm den Haushalt führt und die Wäsche bügelt.
»Ich wollte nur fragen, ob ich etwas helfen kann«, sagt Frau Müller atemlos, lässt ihren Blick durchs Zimmer schweifen und richtet ihn schließlich auf den Notarzt. »Die Sirene des Rettungswagens hat uns aus dem Schlaf gerissen, dann haben wir das Blaulicht hier in unserer Straße gesehen. Mein Mann und ich wohnen nebenan … Was ist denn mit Herrn Jäger? Ist er krank?«
»Es ist nur halb so schlimm, wie’s aussieht«, gibt dieser zurück und setzt sich in seinem Bett auf. »Ich bin noch am Leben.«
»Gute Frau, Sie helfen uns am meisten, wenn Sie uns unsere Arbeit machen lassen«, meint der Arzt und schiebt Frau Müller zur Tür hinaus. »Gehen Sie wieder nach Hause und legen Sie sich in Ihr Bett. Hier versperren Sie meinen Leuten nur den Weg.«
Lothar quetscht sich am Arzt vorbei und geht vor Manuels Bett in die Hocke. »Mann, du hast mir vielleicht einen Schrecken eingejagt«, sagt Lothar und klebt das lose Pflaster, das die Kanüle in der Vene hält, sorgfältig an Manuels Arm fest. »Einen Augenblick lang habe ich geglaubt … ich habe tatsächlich geglaubt, du bist … du warst blau im Gesicht … richtig blau … Dem Himmel sei Dank, dass ich vor Kurzem auf die Idee gekommen bin, diesen Notruf bei dir zu installieren. Wozu ein altes Babyfon doch gut sein kann!«
»Damit haben Sie Ihrem Nachbarn zweifellos das Leben gerettet«, sagt der Notarzt und greift in seinem Koffer nach einer durchsichtigen Halbliterflasche aus Plastik. »Ich schließe jetzt noch eine Infusion an die Nadel in Ihrem Arm an«, wendet er sich wieder an Manuel, »dann brauche ich Ihre Personalien, Krankenkasse, Versichertennummer und so weiter. Die Kollegen vom Roten Kreuz bringen Sie ins Krankenhaus, dort wird man Sie gründlich untersuchen.«
Manuel sinkt in sein Kissen zurück, sieht den Arzt an, sieht Lothar an und schüttelt langsam den Kopf. Wie viele Untersuchungen und Behandlungen hat er im Laufe seines Lebens über sich ergehen lassen? Einmal muss es doch genug sein.
»Mir geht es wieder gut«, versichert er deshalb dem Notarzt. »Ich brauche keine Infusion und ich will auch nicht ins Krankenhaus.«
»Wenn Sie glauben, dass nun alles in Ordnung ist, irren Sie sich aber gewaltig«, widerspricht der Arzt.
»Ich will nicht schon wieder ins Krankenhaus.«
»Sie haben vielleicht Nerven!«, gibt der Notarzt gereizt zurück. »Sie waren kurz vorm Aus. Glauben Sie wirklich, da lasse ich Sie einfach in Ihrem Bett liegen und gehe?«
»Hören Sie, das Krankenhaus ist ein gefährlicher Ort für mich«, sagt Manuel und hebt beschwörend beide Hände. »Ich muss jede Infektion vermeiden und im Krankenhaus wimmelt es von Keimen. Die Krise ist vorbei. Mir geht’s wieder gut. Außerdem ist bald Weihnachten. Ich will Weihnachten zu Hause verbringen.«
Der Notarzt achtet nicht auf Manuel, sondern zieht sein Funkgerät aus der Tasche, das sich mit einem aufdringlichen Piepsen bemerkbar gemacht hat. »Ich bin hier gleich fertig«, sagt er ins Gerät und gibt einen kurzen Bericht ab. »In fünf Minuten fahre ich los, okay?«
»Sei nicht kindisch, Manuel«, mischt sich nun Lothar ein. »Irgendetwas stimmt nicht mit dir. Im Krankenhaus werden sie herausfinden, was los ist. Die Atmung setzt doch nicht grundlos aus. Du musst dich untersuchen lassen.«
»Bis Weihnachten sind Sie sicher längst wieder zu Hause«, meint der Notarzt, dreht an einer Klemme und lässt ein paar Tropfen der klaren Flüssigkeit aufs Bett fallen. Zwei Sanitäter stapfen ins Zimmer und bringen einen Schwall eiskalter Luft mit herein. Zwischen sich haben sie eine Rolltrage, die sie mit geübten Griffen auseinanderklappen. Der Notarzt gibt einige Anweisungen, Manuel greift nach Lothars Arm.
»Ich will nicht mehr ins Krankenhaus. Ich will da einfach nicht mehr hin.«
»Bis Weihnachten bist du bestimmt wieder zu Hause.« Lothar wendet seinen Blick ab und hebt ein heruntergefallenes Taschentuch vom Boden auf. »Den Heiligabend verbringst du wie immer bei uns. Die Kinder kommen auch. Linda macht Ente mit Semmelknödeln und ich setze unsere traditionelle Feiertags-Bowle an.«
»Oho! Und was ist, wenn sie mir im Krankenhaus die Geschmacksnerven paralysieren?«, trumpft Manuel mit einem schiefen Lächeln auf. »Jammerschade, wenn ich den köstlichen Geschmack von Lindas Ente bloß von deinem Gesicht ablesen könnte. Wie du weißt, ist das alles schon einmal da gewesen.«
»Tu es mir zuliebe. Glaubst du, ich könnte noch eine einzige Nacht in Ruhe durchschlafen, wenn ich dauernd Angst haben müsste, dass demnächst wieder so etwas passiert?«
Manuel zögert, senkt den Kopf, ringt mit sich. Schließlich gibt er sich einen Ruck und nickt ergeben. »Vielleicht hast du recht. Für deine schlaflosen Nächte will ich nicht verantwortlich sein.«
»Du wirst sehen, die bringen deine Lungenflügel dahin, dass du sogar auf den Mount Everest klettern kannst«, ruft Lothar erleichtert aus.
»Na, dann bin ich aber froh, dass ich kein Einreisevisum für Nepal habe«, gibt Manuel trocken zurück.
Die Sanitäter haben die Decke auf der Trage bereits zurückgeschlagen. »Herr Jäger?«, wendet sich der Jüngere nun fragend an Manuel. »Wenn Sie mir sagen, wo ich die Sachen finde, dann packe ich Ihnen schnell eine Tasche mit dem Notwendigsten zusammen. Zahnbürste, Unterwäsche, Pantoffeln und so weiter.«
Obwohl der Junge freundlich gesprochen hat, sind seine Worte ein Stich in Manuels Herz. Sie meinen es also ernst. Er muss seinen Himmel wieder einmal verlassen. Die Straße, in der er wohnt, heißt tatsächlich so: Im Himmel. Sein Häuschen ist das letzte in der Reihe und hat die Nummer 108. Dahinter ist nur noch Wald. Davor fällt das Gelände steil ab und eröffnet ihm einen malerischen Ausblick auf Dächer und Baumkronen unten im Tal.
Manuels Haus ist klein. Es hat insgesamt vier Zimmer, alle auf ebener Erde gelegen, weil er beinahe zu allem den Rollstuhl braucht. Früher einmal hat das Häuschen seinem Großonkel und zu einer Schrebergartenkolonie gehört. Das ist lange her, die Schrebergärten sind verschwunden. Alle anderen Häuser in der Straße sind neu und vor allem groß. Darin wohnen Leute, die es zu etwas gebracht haben. Lothar ist einer von ihnen.
»Zieh dir nur etwas Warmes über«, sagt dieser gerade fürsorglich und reicht Manuel Hemd und Hose. »Ich komme dich heute Nachmittag besuchen und bringe dir mit, was du brauchst. Wohin geht’s denn eigentlich?«, will er von den Sanitätern wissen.
»Ins Marienhospital auf der Schillerhöhe«, erwidert der Ältere. »Die sind heute mit der Notaufnahme dran. Kennen Sie das Krankenhaus?«
»Ich war zwei- oder dreimal dort«, gibt Manuel zu. »Gehört es nicht irgendeiner katholischen Organisation? Den Barmherzigen Brüdern oder so ähnlich?«
»Der Barmherzigen Gemeinschaft«, berichtigt der Rettungsassistent. »Früher einmal war es ein Mönchsorden, aber heute ist es eine fromme Laiengemeinschaft, der auch Schwestern angehören. Es gibt nur noch eine Handvoll Mönche und alle uralt. Das Haus hat einen guten Ruf. Superfähige Ärzte und die Pflege soll ganz ausgezeichnet sein.«
»Ja«, stimmt Manuel zu, während er in die Jacke schlüpft. »Das habe ich auch schon gehört.«
»Wird auf der Schillerhöhe nicht gebaut?«, will Lothar wissen. »Mir ist, als hätte ich von einem neuen Klinikum gelesen, das dort entstehen soll.«
»Der ganze Park ist aufgerissen«, berichtet der Jüngere, während er noch einmal Manuels Blutdruck misst. »Ein gigantomanisches Projekt, ehrlich. Wir alle wundern uns, wie die Barmherzigen das finanzieren wollen, zumal ansonsten überall geknapst und gespart wird.«
Während er noch spricht, machen die beiden Sanitäter sich daran, Manuel aus dem Bett zu heben, aber dieser wehrt ab. »Lassen Sie das Lothar machen. Er weiß am besten, wie das geht.«
Lothar kniet vor dem Bett nieder und legt beide Arme um Manuels schmächtigen Körper. Dann steht er mit einem Ausfallschritt auf, einen Moment lang liegt Manuel wie ein Kind an seiner Brust.
»Ich danke dir, Lo«, sagt Manuel, als die Decke über ihn gebreitet und festgezurrt wird.
Lothar steht mit hängenden Armen im Licht des Hausflurs, als Manuel in den Rettungswagen geschoben wird. Im Garten haben sich zahlreiche Nachbarn versammelt, die zu ihm herüberblicken. Ihre Gespräche verstummen. Frau Müller hebt zaghaft die Hand, als wolle sie ihm zum Abschied noch einmal zuwinken.
Manuel sieht auf sein Häuschen und mit einem Mal wird ihm ganz weh ums Herz. Die Tür des Rettungswagens schließt sich mit einem blechernen Knall, während der Fahrer schon den Motor startet und die Sirene einschaltet.
***
Nach der Übergabe weist Dagmar den Schülern ihre Aufgaben zu und schickt sie in die entsprechenden Zimmer. Danach sucht sie sich selber Waschschüssel und Handtücher zusammen und geht zu Anna Rosenbach.
Wie immer starrt Anna Rosenbach mit leerem Blick die Wand an. Ihr Gesicht ist weich, die Wangen und das Kinn sind gerundet, nichts darin ist schlaff oder gar eingefallen. Sie sieht im Gegenteil ganz rosig und gesund aus. Frau Rosenbach hat etwas von den Großmüttern, von denen in den Märchen manchmal die Rede ist. Aber Frau Rosenbach spricht nicht und ist eigentlich gar nicht da. Nach einem Herzanfall ist sie wiederbelebt worden, seitdem liegt sie im Wachkoma und niemand weiß, ob und was sie von der Welt noch mitbekommt. Über einen Schlauch, der durch die Bauchhaut in den Magen führt, wird sie künstlich ernährt, und sie hat einen Katheter, durch den der Urin aus ihr heraus und in einen Beutel läuft. Der Beutel wird zweimal täglich geleert, wie viel es jeweils ist, schreiben die Pflegenden in eine Tabelle, die im Wirtschaftsraum an der Wand hängt. Der Sozialarbeiter ist dabei, einen Heimplatz für Frau Rosenbach zu suchen, aber so kurz vor Weihnachten sind alle Pflegeheime überfüllt, deshalb liegt sie immer noch auf der gastroenterologischen Station von Dr. Regina Funke. Das dürfte eigentlich nicht sein.
Bevor Dagmar mit ihrer Arbeit beginnt, legt sie ihre Hand auf Frau Rosenbachs Arm und spricht mit ihr. Anfänglich hat sie sich jedes Mal mit ihrem Namen vorgestellt und der Bewusstlosen erklärt, was sie nun tun wird. Inzwischen spricht sie von anderen Dingen, weil sie glaubt, dass Frau Rosenbach nicht immer dasselbe hören will. Sie erzählt zum Beispiel, wie das Wetter derzeit ist, was sie im Fernsehen gesehen hat oder was es in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt zu kaufen gibt. Manchmal erzählt sie Frau Rosenbach, dass sie am allerliebsten auf dem Land leben würde, wo sie im Sommer den würzigen Duft des Heus und im Herbst die frisch gepflügte Erde riechen kann. In Frau Rosenbachs Gegenwart fallen Dagmar die schönen Dinge des Lebens ein. Von unangenehmen mag sie nicht berichten, denn zum einen will sie Frau Rosenbach nicht traurig stimmen und zum anderen wird diese die Welt auch nicht mehr verändern, wenn sie immerzu nur an die Wand starrt.
Heute erzählt Dagmar Frau Rosenbach, dass ein neuer Arzt auf Station kommen wird, einer, in den sich alle verlieben werden, weil er noch besser als Brad Pitt aussieht. Dabei fällt ihr auf, dass Frau Rosenbach in der Nacht wieder stark geschwitzt hat, und auch jetzt ist die Haut mit einem dünnen Schweißfilm bedeckt. Die Körpertemperatur ist normal. Vielleicht steckt ein ernstes Problem dahinter, Hormonschwankungen könnten es sein oder der Blutzucker.
Frau Rosenbach ist gewaschen, abgetrocknet und eingecremt. Dagmar will ihr ein frisches Flügelhemd überstreifen, doch als sie in den Schrank greift, ist dieser leer. Wo ein Stapel gefalteter Hemden hätte liegen sollen, findet sich nur die aufgerissene Banderole einer Packung Einmalhöschen. Dagmar wirft die Banderole in den Papierkorb, deckt Frau Rosenbach sorgfältig zu und geht aus dem Raum. Sie hasst es, wenn in der Schicht am Nachmittag wieder einmal keine Zeit gewesen ist, die Schränke ordnungsgemäß aufzufüllen. Sie stellt sich vor, dass sie an Frau Rosenbachs Stelle von einer Pflegekraft gewaschen wird, dann möchte sie selber baldmöglichst wieder ein Hemd anhaben.
Aber Frau Rosenbach wird vorerst ohne Hemd bleiben, denn über der gegenüberliegenden Zimmertür blinkt die rote Lampe. Es ist das Zimmer, das Frau Liebich und Frau Kubatzki derzeit gemeinsam bewohnen. Obwohl Dagmar ahnt, dass es nichts Wichtiges ist, muss sie dem Ruf doch Folge leisten.
»Was kann ich für Sie tun?«
»Ich möchte duschen!«, erklärt Frau Kubatzki. In der Übergabe hat Ulrike sich beschwert, dass die Kubatzki in der Nacht wieder endlos geklingelt hat, jede Viertelstunde einmal, sodass sie schließlich für ein paar Stunden den Stecker aus der Dose gezogen hat. Ute Kubatzki leidet seit Jahren an Multipler Sklerose und ist durch einen akuten Schub derzeit ans Bett gefesselt. Wenn kein Schub ist, kann Frau Kubatzki sich zu Hause mithilfe einer Freundin selbst versorgen. Alle auf Station rätseln, wo um alles in der Welt diese Frau eine Freundin hernimmt.
»Wenn Sie mich also bitte ins Bad hinüberfahren wollen, Schwester Dagmar«, so fährt Frau Kubatzki fort, »dann können wir vor dem Frühstück mit allem fertig sein.«
»Heute können Sie leider nicht duschen, Frau Kubatzki«, bedauert Dagmar und will das Zimmer wieder verlassen, aber die Patientin lässt sie nicht so einfach gehen.
»Das hat man mir gestern und vorgestern auch schon gesagt«, kontert Frau Kubatzki und fügt hinzu, dass sie unbedingt duschen muss, weil die Haut juckt, was immer dann geschieht, wenn sie drei Tage lang nicht geduscht oder gebadet hat.
Dagmar versucht zu erklären, dass in der letzten Nacht Notaufnahme gewesen ist, dass nicht nur das Bad, sondern sogar die Besucherecke im Flur mit Notfällen belegt sind, aber damit kommt sie nicht weit.
»Was Sie nicht sagen!«, unterbricht Frau Kubatzki sie und zieht dabei spöttisch die Augenbrauen hoch. »Um Ausreden sind Sie aber nicht verlegen, Schwester Dagmar. Dabei liest man in der Zeitung doch jeden Tag, dass die Krankenhäuser um die Gunst der Patienten buhlen. Ich allerdings habe davon noch überhaupt nichts gemerkt.«
»Es geht aber wirklich nicht«, beteuert Dagmar und verwünscht sich, weil sie dumm genug war, in dieses Zimmer zu kommen. Aber es hilft nichts, sie muss Frau Kubatzki aus dem Bett ans Waschbecken helfen, ihr den Rücken waschen und anschließend auch noch mit Franzbranntwein abklatschen. Dann darf sie endlich gehen und findet draußen im Flur Cornelia in heller Aufregung vor. Diese hat versehentlich einen Infusomaten ausgeschaltet und weiß nicht, wie sie ihn wieder zum Laufen bringen soll. Ein Infusomat ist ein Gerät, das die Tropfgeschwindigkeit einer Infusion penibel regelt und deshalb bei hochwirksamen Medikamenten eingesetzt wird. Cornelia denkt, dass sie einen schrecklichen Fehler gemacht hat. Dagmar muss die Schülerin zuerst beruhigen und danach den Infusomaten wieder einschalten, was nicht so einfach ist, weil er jedes Mal zu piepsen anfängt, sobald sie die grüne Starttaste drückt.
Wieder einmal denkt Dagmar, dass die technischen Geräte im Krankenhaus immer komplizierter werden. Ingenieurin hat sie nie werden wollen. Schließlich kommt sie darauf, dass sich im Infusionsschlauch winzige Luftbläschen bilden, das akzeptiert dieses Gerät nicht. Es ist eines aus der neuen Serie und so empfindlich, dass man es eigentlich gar nicht mehr benutzen kann. Dagmar muss quer durchs ganze Haus in die Gerätekammer laufen und ein anderes holen, bevor sie mit einem Stapel frischer Hemden zu Frau Rosenbach ins Zimmer zurückkehren kann.
Frau Rosenbach liegt ganz zufrieden in ihrem Bett und ahnt nicht, dass man aus ihren Haaren Kerzendochte machen könnte. Dagmar aber sieht die fettglänzenden Strähnen. Und sie ist nicht froh darüber. In den drei Wochen, in denen Frau Rosenbach bei ihnen liegt, sind die Haare kein einziges Mal gewaschen worden. Dagmar zieht ihrer Patientin das Hemd über und verabschiedet sich, indem sie noch einmal die Bettdecke zurechtzupft. Sie träumt davon, Frau Rosenbach in eine Wanne mit viel heißem Wasser und duftendem Schaum zu setzen. Sie möchte Frau Rosenbach von oben bis unten einseifen, ihr die Haare waschen und die Nägel schneiden. Sie möchte das schmuddelige Bett frisch beziehen, eine Duftkerze anzünden und Frau Rosenbach zum Abschluss der Prozedur eine Adventsgeschichte vorlesen. Dafür würde sie zwei bis drei Stunden brauchen, doch diese Zeit hat sie nicht. Aber auch die Ärzte verbieten Dagmar ihren Traum, denn ein Vollbad würde Herz und Kreislauf zu sehr belasten, und die Ärzte haben Frau Rosenbach nicht gerettet, damit sie nun trotzdem stirbt. So bleibt, als Dagmar aus dem Zimmer geht, nur eine leise Trauer und das Gefühl, dass etwas nicht so ist, wie es sein sollte.
***
Manuel ist im Marienhospital angekommen und wird von den Sanitätern durch Flure geschoben, die in ihrer Gleichförmigkeit endlos erscheinen. Er verliert bald jede Orientierung und hofft, dass wenigstens die Rettungsleute sich in diesem Labyrinth zurechtfinden werden. Sie erreichen einen Gang, in dem weitere Sanitäter mit Rolltragen wartend herumstehen. Manuel erkennt, dass es hinter der Notfallambulanz zu einer Intensivstation hinübergeht.
Eine ältere Ärztin schreit etwas von einer lebensgefährlichen Vergiftung und dass der Magen ausgepumpt werden muss. Mit einem Mal ist Manuel inmitten eines Knäuels von Menschen, die kopflos herumrennen, schreien und wild gestikulieren. Die Stimmen klingen gereizt und unfreundlich. Seine beiden Helfer ziehen die Trage zurück, denn Manuel ist mit dem auszupumpenden Magen nicht gemeint. Irgendwo piepsen Geräte, ein Telefon schrillt, noch mehr weiß und blau gekleidete Gestalten laufen über den Flur und verschwinden hinter den Türen. Dort sind plötzlich grässliche Würgegeräusche zu hören, davon wird Manuel selbst ganz mulmig.
Irgendwann wird er von der Trage auf einen Rollstuhl verfrachtet, in ein Zimmer geschoben und die beiden Sanitäter verabschieden sich. Auf rätselhafte Weise erscheinen Leute und verschwinden wieder. Irgendwann wird sein Name aufgerufen, daraufhin schiebt ihn jemand in ein Untersuchungszimmer, wo ihm eine Ärztin ungeduldig entgegensieht. Es ist dieselbe grauhaarige Frau, die meint, dass Mägen von Zeit zu Zeit ausgepumpt werden müssen. Sie mustert Manuel mit durchdringendem Blick, blättert kurz in den Papieren und zieht ihm dann mit einem Ruck das Hemd aus der Hose, während sie schon ihr kaltes Stethoskop auf seine Brust setzt.
»Probleme mit der Atmung, aha!«, sagt sie. »Da werden wir zunächst eine Röntgenaufnahme der Lunge machen.«
Kurz darauf sitzt Manuel vor der Röntgenabteilung und sieht sich dort die geschlossenen Türen an. Sie sind dunkelrot und aus Metall, vielleicht sind sie aus Blei, weil Blei vor Röntgenstrahlen schützt. Er hält ein grünes Formular in den Händen, das ihn an die gelochten Bestellformulare aus jenen Tagen erinnert, als der Computer seinen Siegeszug durch die Welt noch nicht angetreten hatte. Es ist die Anweisung der Ärztin, dass seine Lunge auf drei Ebenen durchleuchtet werden soll.
Vier andere Patienten sind bereits vor ihm da gewesen und in der Stunde, in der er die Türen betrachtet, wird die Schlange länger und länger. Sie hat jetzt bereits das Ende des Flurs erreicht, ob sie auf der anderen Seite noch weitergeht, kann Manuel nicht abschätzen. Die Türen zu den Röntgenräumen bleiben weiterhin geschlossen, nichts weist darauf hin, dass sich daran bald etwas ändern wird.
Manuel sitzt in einem dieser zusammenfaltbaren Rollstühle mit einer Sitzfläche aus Leder und rührt sich nicht. Jedes Mal, wenn er auch nur ein wenig das Gewicht verlagert, bewegt sich das Gefährt und die Räder beginnen, sich von selbst zu drehen. Schließlich findet er heraus, was mit dem Stuhl los ist. Wer immer ihn hierhergebracht hat, hat vergessen, die Bremse festzustellen …
… in welcher Klinik der Unfall damals passiert ist, hat er vergessen. Er weiß auch nicht mehr, wie alt er gewesen ist. Nur an eines erinnert er sich, nämlich daran, dass er am selben Tag hätte entlassen werden sollen. Nun sieht er sich wieder in einem ganz ähnlichen Rollstuhl an einer ganz ähnlichen Stelle sitzen … wie damals, als …
… die Räder plötzlich in Bewegung geraten. Unaufhaltsam wird der Rollstuhl schneller. Manuel hat nicht den Mut, in die Räder zu fassen und den Stuhl anzuhalten, weil er sich dabei die Finger brechen könnte. Er ist seiner eigenen Hilflosigkeit ausgeliefert, sieht mit Schrecken, dass ein silberner Kastenwagen auf ihn zukommt, weiß, was geschehen wird, und kann doch nichts dagegen tun. Bei dem Unfall damals hat er sich das Schlüsselbein und ein paar Handwurzelknochen gebrochen …
Damit dasselbe nicht wieder passiert, sitzt Manuel so bewegungslos wie Buddha in seinem Rollstuhl und ihm kommt der Gedanke, dass er vielleicht selber der Buddha ist. Dieser Gedanke gefällt ihm, deshalb stellt er sich vor, dass eines Tages, in zweieinhalbtausend Jahren vielleicht, in den Büchern der Weisheit von einem Buddha des Stillen Sitzens die Rede sein wird. Es ist ein wunderbarer Buddha und dieser Buddha ist er. Die Menschen, die davon lesen, werden es ihm gleich tun, bewegungslos in Rollstühlen sitzen und dies für einen Zeitraum von weiteren zweieinhalb Jahrtausenden. Mindestens.
Aber dann sieht er die Gesichter der Menschen, die gemeinsam mit ihm warten, und es ist so wenig Freude darin. Manuel sieht ein, dass der wunderbare Buddha sich noch nicht manifestiert haben kann, denn Buddha macht die Menschen glücklich, das ist hier aber nicht der Fall. Ihm fällt der Tunnel wieder ein sowie der entsetzliche Abgrund, in welchem der Tunnel endet. Ihm wird klar, dass er weder an Buddha noch an Gott noch an eine Seele oder sonst etwas in der Art glaubt. Er glaubt, dass es sich bei all diesen frommen Geschichten um tröstliche Bilder handelt, die den Menschen darüber hinwegtäuschen, dass von ihm nichts übrig bleibt, wenn er denn einmal tot ist. Der Tod ist ein Schwarzes Loch, in dem alles Leben verschwindet, ohne nennenswerte Spuren zu hinterlassen.
Vielleicht ist er deshalb Wissenschaftsjournalist geworden. In den Wissenschaften hat er Erklärungen gefunden, die ihm einleuchten. Es sind auf jeden Fall bessere Erklärungen als in den frommen Geschichten. Manuel liebt Tatsachen, denn damit kann er etwas anfangen. Die Welt besteht aus Tatsachen, und der menschliche Geist ist so beschaffen, dass er Tatsachen erkennen und einordnen kann. Daraus konstituiert sich das Wissen. Was ein Leben wertvoll macht, ist der Versuch, eine der vielen Lücken, die es in diesem Wissen immer noch gibt, mit Erkenntnissen zu füllen.
Sein Zahnarzt hat es ihm einmal klar und deutlich gesagt: »Junge, von dir zählt nur der Kopf. Den Rest kann man vergessen.«
Von spekulativen Betrachtungen hält Manuel nichts. Das ist schon so, seit ihm vor vielen Jahren ein Priester erklärt hat, dass Gott in seiner Güte ihm mit den Glasknochen eben eine besondere Prüfung auferlegt habe. Noch weniger hält er von den Lamas und Geshes, die behaupten, dass sich nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung Untaten aus früheren Leben in ihm manifestiert hätten. Was für einen Sinn soll das denn haben, wenn er sich an keine einzige seiner angeblichen Untaten erinnern kann? Gottes besondere Prüfungen ergeben aber auch nicht mehr Sinn, deshalb hält sich Manuel strikt an Tatsachen.
Gott ist nicht mehr als ein Begriff, der sich auflöst, sobald man versucht, seine Bedeutung zu erfassen. Daher ist Gott nicht mehr als ein leeres Wort. Die Karmalehre hingegen ist das Ergebnis der Denkweise, wie sie in den Ländern des Ostens verbreitet ist, und hat mit der Wirklichkeit etwa so viel zu tun wie ein Glühwürmchen mit der Fotosynthese.
Diesem Glauben ist Manuel nicht immer treu geblieben. Es hat in seinem Leben eine Zeit gegeben, da hat er nicht an die Wissenschaften, sondern an Gott geglaubt – wenn auch nicht an einen persönlichen Schöpfergott, wie ihn die Kirche predigt, so doch an eine alles durchströmende Kraft, die das Leben eines jeden Menschen zum Guten hin lenkt. Damals hat er geliebt und ist geliebt worden. Diese Liebe hat ihn aus seiner Mitte und aus seinem streng disziplinierten Tagesablauf herausgerissen. Wie reich und unglaublich schön ist sein Dasein gewesen. Für den Verrat hat er teuer bezahlt. Die Liebe überdauert den Tod nicht. Sie ist nur eine Illusion, ein Gaukelspiel. Sie ist das, was die Lamas und Geshes in ihren Lehren als Maya bezeichnen.
Manuel weiß um den Abgrund. Viele, viele Male schon ist er durch den Tunnel gegangen und hat die Finsternis erfahren, das Nichts, das Ende von Zeit und Raum. Er weiß, dass die Menschen sich die Geschichten von Gott oder einer Liebe, die den Tod überwindet, nur deshalb erzählen, weil sie wie er diese schreckliche Angst vor dem Sterben haben. Er macht das Spiel aber nicht mehr mit, seit dieselben Geschichten ihm einreden wollen, dass seine Existenz ein Unglück sei, das er mit Würde zu tragen habe.
In der Zeit, in der Manuel über Gott und Buddha nachdenkt, herrscht im Flur ein reges Kommen und Gehen. Schließlich fällt es ihm auf und er fragt sich, ob Krankenschwestern denn nichts anderes zu tun haben, als den lieben langen Tag irgendwelche Leute durch die Gänge zu schieben. Besonders interessant findet er die Kurve am Ende des Flurs, denn ein Bett muss richtig gesteuert werden, damit es bei der Drehung nicht gegen die Wand schrammt. Eine Weile zählt er mit, wie viele Betten anstoßen und wie viele nicht, dann wird es ihm wieder langweilig.
In einem Pulk weißgekleideter Gestalten kommt die grauhaarige Ärztin vorbei, die ihn vorhin untersucht hat. Sie redet auf einen jungen Mann ein und Manuel ist versucht, die Hand zu heben und zu winken. Aber die Ärztin hat keinen Blick für die Patienten, die hier sitzen, und seine Hand sinkt wieder herab. Dann ist die Gruppe auch schon in einem zweiten Flur verschwunden.
Manuel sinnt über seine Rolle als Patient nach. Ein Krankenhaus ist so organisiert, dass es am besten funktioniert, wenn keine Patienten darin liegen. Ärzte und Pflegekräfte sind so mit sich selbst beschäftigt, dass jeder Patient sie überfordert, also sollten diese besser zu Hause bleiben. Das wird er seinem Freund Lothar erzählen, wenn dieser ihn das nächste Mal ins Krankenhaus verfrachten will.
Acht Uhr vorbei. Zu dieser Stunde hat er normalerweise das Frühstück und seine Gymnastik hinter sich. Entweder würde er gerade mit Frau Müller ein Schwätzchen halten oder am Computer sitzen und seine E-Mails lesen. Manuel hat im Internet einen Spitznamen. Dort ist er »der Kopf«.
Vielleicht würde er um diese Zeit aber auch bereits über ein physikalisches Phänomen nachdenken, zum Beispiel über die rätselhafte Geschwindigkeitsabweichung der 1972 und 1973 gestarteten Pioneer-Raumsonden, die in etwa dem Produkt aus der Hubble-Konstanten und der Lichtgeschwindigkeit entspricht. Vielleicht kann er beweisen, dass die kosmische Expansion mit dieser Abweichung zusammenhängt. Dann wird er Lothar davon erzählen.
Lothar arbeitet bei der Luft- und Raumfahrtbehörde und hat eine Schwäche für ausgefallene Ideen. Lothar würde die Lösung für das Problem zunächst einmal bei den Sonden selbst suchen, eine Schubanomalie oder schlicht einen Rechenfehler vermuten. Sie würden sich die Köpfe heißreden, und am Ende würde Lothar ihn wieder einmal für verrückt erklären. Als Manuel sich diese Szene vorstellt, wie er sie schon Hunderte von Malen erlebt hat, kann er ein Schmunzeln nicht unterdrücken und seine Stimmung hebt sich.
Auf einmal geschieht, was niemand mehr für möglich gehalten hat. Eine Röntgenassistentin erscheint und ruft mit monotoner Stimme »Der Nächste, bitte!« in den Flur hinein. Sie macht eine erwartungsvolle Pause, aber von den Wartenden kann keiner ohne Hilfe aufstehen. Endlich kommt die Röntgenfrau heraus, greift nach dem ersten Rollstuhl und verschwindet mitsamt dem Patienten hinter der dunkelroten Tür.
Nun vertreibt sich Manuel die Zeit damit, dass er sich fragt, ob die Aufforderung »Der Nächste, bitte!« gerechtfertigt ist oder ob es nicht »Der Erste, bitte!« heißen müsste. Er kommt zu dem Ergebnis, dass der Ausruf durchaus richtig ist, wenn die vorausgegangenen Tage und Wochen mit in Betracht gezogen werden. Schließlich ist die Reihe an ihm und er wird wie die anderen vor ihm in den Raum geschoben.
»Wenn Sie bitte Ihre Kleider ablegen und sich dorthin stellen, Herr …«, sagt die Röntgenassistentin, die geschäftig hin und her läuft. Sie studiert das grüne Formular; da es aber handschriftlich ausgefüllt ist, kann sie Manuels Namen nicht lesen und sieht ihn schließlich direkt an. In ihren Augen flackert es, doch weil sie routiniert ist, weiß sie es geschickt zu überspielen, produziert ein Lächeln und legt das Hemd, das Manuel ausgezogen hat, ordentlich auf die Ablage.
»Kann ich Ihnen helfen?«, fragt sie und will wissen, inwieweit er alleine gehen und stehen kann. Wenn Manuel sich irgendwo festhält, kann er ein paar Schritte auf seinen eigenen Füßen machen. Das führt er der Röntgenfrau nun vor.
»Nicht jedes Krankenhaus ist auf das Röntgen von Kleinwüchsigen eingerichtet«, meint er. »Ich bin deswegen sogar schon in die Kinderklinik gebracht worden.«
»Das geht schon. Das kriegen wir hin«, erwidert die Röntgenassistentin und hantiert, wieder ohne ihn anzusehen, mit dem Gerät, schraubt daran herum, senkt die Röhre, hebt sie erneut an und senkt sie noch weiter. Dann schiebt sie die Platte ein. »So – bitte, Herr …«
»Jäger. Manuel Jäger.«
»Bitte, Herr Jäger. Geht es? Gut so! Alles paletti!«
Manuel steht vor dem Röntgenauge und grinst es an. So also muss sich ein Außerirdischer fühlen, wenn er durchs Hubble-Teleskop beobachtet wird. Die Röntgenfrau legt ihm den Bleigürtel um die Hüfte, dabei geht er in die Knie und fällt beinahe um. Der Rollstuhl wird näher herangeschoben, er darf sich daran festhalten. An den Seitenblicken, mit denen die Frau ihn streift, kann Manuel ablesen, dass sie ihn bedauert.
»Das machen Sie ganz prima!«, sagt sie in einem munteren Ton, der entsetzlich künstlich klingt. »Und jetzt -bitte die Luft anhalten!«, ruft sie ihm zu, während sie in den Schutzraum nebenan verschwindet.
Dann sitzt er wieder im Rollstuhl und wird in den Flur zurückgeschoben. Statt des grünen Formulars hält er nun eine braune Tüte mit Röntgenbildern in seinen Händen und verfolgt, wie der nächste Rollstuhl hinter der Tür verschwindet. Es ist neun Uhr vorbei. Vor seinem inneren Auge erscheinen knusprige Brötchen und dampfend heißer Kaffee mit einem Klecks Sahne darauf. Manuel wünscht sich, der Inhalt der Tüte möge sich entsprechend verwandeln, aber nichts geschieht. Mit knurrendem Magen bleibt er sitzen, wo er ist, denn niemand kommt und holt ihn ab.
***
Was das Frühstück und eine ausgewogene Ernährung betrifft, unterscheiden sich Pflegepersonal und Ärzte wenig voneinander. Beide machen stets Empfehlungen, an die sie sich selbst nicht halten. In der Cafeteria des Krankenhauses sitzen vier Ärzte gemeinsam an einem Tisch, drei davon haben einen großen, mit bitterem Kaffee gefüllten Plastikbecher vor sich stehen. In zwei Bechern ist der Kaffee schwarz, nur einer wird mit Milch und Zucker getrunken. Bei Christian Fischer ist es an diesem Montagmorgen der erste Kaffee, bei Regina Funke der dritte, wie viele Sebastian Fenning getrunken hat, weiß er selber nicht, denn er hat in dieser Nacht Dienst gehabt und sich dafür mit Kaffee gedopt. Ingrid Lauenfels-Bopp trinkt Tee. Das Rauchen haben sich die Ärzte abgewöhnt. Sie haben dafür die wirksame Methode entwickelt, so lange auf die gesundheitlichen Risiken hinzuweisen, bis es ihnen von Staats wegen endlich verboten worden ist. Gefrühstückt hat an diesem Tag noch keiner von ihnen und sie tun es auch jetzt nicht. Sie gönnen sich nur eine kleine Pause.
Regina Funke hat ihren Dienst um sechs Uhr früh angetreten und die letzten Notfälle aufgenommen. Punkt acht Uhr hat sich das Marienhospital für dieses Mal von der Notaufnahme verabschiedet, und Regina Funke hat sich ihren sonst üblichen Aufgaben zugewandt. Sie hat an der Fallbesprechung im Konferenzraum teilgenommen und zwei Darmspiegelungen durchgeführt. Nun trinkt sie Kaffee, um Christian Fischer kennenzulernen, mit dem sie künftig zusammenarbeiten wird.
Als Akademisches Lehrkrankenhaus ist das Marienhospital der Universität angegliedert und bildet angehende Ärzte aus. Christian Fischer ist ein solcher und hat Ende Oktober sein Praktisches Jahr begonnen, von dem er sechzehn Wochen in der Inneren Medizin verbringen wird. Im entsprechenden Auswahlverfahren ist er der onkologischen Station von Dr. Ingrid Lauenfels-Bopp zugeteilt worden. Er interessiert sich für Tumorerkrankungen und liebäugelt damit, später seinen Facharzt in diesem Bereich zu machen. Am vergangenen Donnerstag ist ihm jedoch über das Sekretariat von Professor Gössner überraschend mitgeteilt worden, dass er künftig in der Gastroenterologie bei Dr. Regina Funke weitere Erfahrungen sammeln soll. Diese Versetzung trifft ihn hart, zumal er sich den Grund dafür nicht erklären kann. Er hat das Wochenende damit verbracht, darüber nachzugrübeln, ob er vielleicht versagt hat.
Seit einiger Zeit plagen Christian diffuse Ängste. Zweifel an sich und seiner Berufswahl hat er schon einmal gehabt und zwar in seiner Famulatur, als er zum ersten Mal konkret mit der Krankenhauswelt in Berührung gekommen ist. Dabei hat er bei allen Prüfungen stets hervorragend abgeschnitten, beim Abitur, beim TOEFL-Test für ein Auslandssemester und bei der Ersten Ärztlichen Prüfung am Ende des Vorklinikums. Er kann sich auf seine rasche Auffassungsgabe und sein Gedächtnis verlassen. Mit Beginn des Praktischen Jahres sind die Ängste plötzlich wiedergekommen, aber er überspielt sie und lässt sich nichts anmerken.
»Ich gebe Sie gar nicht gern her, Christian«, sagt Ingrid Lauenfels-Bopp, und ihrem Gesicht sieht er an, dass sie es ehrlich meint. »Sie wissen außerordentlich viel über Tumorerkrankungen und kennen sich auf meiner Station inzwischen wirklich gut aus. Sie sind gewissenhaft und fleißig. Ich hätte Sie gern über den gesamten Zeitraum bis Februar bei mir behalten.«
»Ich bin sehr gern bei Ihnen«, entgegnet Christian und legt beide Hände um seinen Kaffeebecher. »Ich finde es schade, dass ich wechseln muss. Die Onkologie ist ein interessantes Gebiet.« Bei diesen Worten fällt ihm ein, dass seine neue Vorgesetzte zuhört, deshalb fügt er hastig hinzu: »Wobei der Wechsel natürlich auch seine positiven Seiten hat. Ich kann in einem weiteren Bereich der Inneren Medizin meine Erfahrungen sammeln. Sicher werde ich auch bei Ihnen, Dr. Funke, viel lernen.«
Regina Funke nickt wohlwollend, wendet sich aber an Sebastian Fenning. »Wann wird denn nun geheiratet?«, will sie wissen.
Dr. Fenning blickt trübselig in seinen Becher. »Sobald ich den Facharzt in Onkologie habe«, antwortet er düster.
Regina Funke schüttelt sachte den Kopf. »Sie haben die Sache aber auch schleifen lassen, Sebastian. Wie lange arbeiten Sie denn nun schon als Assistent? Zwei Jahre? Fünf? In dieser Zeit hätten Sie sich schon längst an Ihren Facharzt machen müssen.«
»Ich weiß. Aber ich konnte mich nicht aufraffen. Man lebt doch nicht nur, um zu arbeiten. Nach sechzig, siebzig Stunden Dienst pro Woche habe ich einfach genug. Ich brauche Bewegung, muss mich mit Sport austoben, sonst werde ich verrückt. Ich gebe gerne zu, dass ich nicht sehr ehrgeizig bin. Mein Fehler.«
»Keine Sorge. Den Facharzt haben schon andere geschafft, den bringen Sie ebenfalls fertig«, sagt Ingrid Lauenfels-Bopp beruhigend. »Meine Unterstützung haben Sie. Das bin ich meinem Chef und alten Lehrmeister Siegfried Gössner schuldig.«
»Der Professor hat sowohl auf dem Gebiet der Stammzellforschung wie auch der Tumormarker Herausragendes geleistet«, wirft Christian ein. »Haben Sie seine Arbeiten über das Carcino-Embryonale-Antigen gelesen? Ich war davon sehr beeindruckt.« Drei Augenpaare richten sich fragend auf ihn. Mit einem Mal hat Christian das Gefühl, etwas Falsches gesagt zu haben, und verstummt verlegen. Doch bevor das Schweigen peinlich wird, spricht Dr. Lauenfels-Bopp schon weiter.
»Bleibt es dabei, dass Sie erst im Januar bei mir anfangen?«, wendet sie sich an Sebastian Fenning. »Gibt es nicht doch eine Möglichkeit, dass Sie Ihren Dienst früher antreten?«
Der Arzt schüttelt den Kopf. »Ausgeschlossen. Die Tour in die Anden ist fest gebucht. Die lasse ich mir nicht nehmen. Ich brauche noch einmal ein Abenteuer, bevor ich mich an den Facharzt mache und das Ehejoch endgültig auf mich nehme. Danach wird es doch nichts mehr.«
»Dann fehlt mir ein Arzt auf Station«, sagt Dr. Lauenfels-Bopp seufzend. »Mein zweiter Mann ist am kommenden Wochenende für den Nachtdienst eingeteilt und hat danach frei. Was soll ich tun? Ich muss nächsten Montag zur Kuratoriumssitzung nach Baden-Baden und kann meine Patienten doch nicht sich selbst überlassen.«
»Diese Probleme kenne ich nur zu gut«, stimmt Regina Funke zu. »Ich musste Fenning an Sie abtreten und Olaf Röhm zu dieser Fortbildung schicken, weil ihm sonst die CME-Punkte fehlen. Und ich habe vierzehn Betten mehr als Sie. Ich brauche diesen jungen Mann hier. Und zwar ganz dringend.«
Christian Fischer lächelt seiner neuen Chefin zu. »Ich werde mich anstrengen«, sagt er und zwinkert lustig dabei. »Wie soll ich mich denn auf Ihrer Station einführen?«, will er wissen. »Muss ich vor den Stationsschwestern eine kleine Rede halten oder wie wird das bei Ihnen gehandhabt?«
»Bloß nicht«, lacht Regina Funke und droht ihm schelmisch mit dem Zeigefinger. »Ich lasse nicht zu, dass Sie meinen Mädchen den Kopf verdrehen. Nein, das werden wir ganz ohne Brimborium machen«, sie unterbricht sich und blickt auf ihre Armbanduhr. »Kommen Sie doch einfach in etwa einer Stunde auf meine Station runter, dann machen wir gemeinsam die erste Visite.«
»Ich werde noch einmal mit Gössner reden«, meint Ingrid Lauenfels-Bopp und knüllt den leeren Becher zusammen. »So geht es nicht. Für den Nachtdienst muss ein anderer eingeteilt werden. Wenn Sie mit mir kommen, Christian, mache ich gleich Ihre Beurteilung fertig.«
Christian Fischer erhebt sich ebenfalls. Im selben Augenblick schlägt die Angst wieder zu und sie ist so stark, dass ihm der Schweiß ausbricht. Er sieht sich plötzlich an einem Abgrund stehen und weiß, dass irgendetwas schrecklich schiefgehen wird. Am liebsten hätte er laut »halt, nein!« geschrien, aber er lächelt und verdrängt wie immer seine Gefühle.
***
Dagmar hat in der Zwischenzeit zwei weitere Pflegefälle versorgt und bringt die gebrauchten Waschschüsseln in den Wirtschaftsraum. Dabei läuft ihr Wendelin Weihrauch über den Weg, der heute einen himbeerroten Schlafanzug trägt. Er erwidert ihren Blick und es liegt dieselbe leise Trauer darin, die sie vorhin im Zimmer bei Frau Rosenbach verspürt hat.
Wendelin Weihrauch ist ein verrückter, alter Mann, der in einer Welt lebt, die es gar nicht gibt. Ein typischer Fall von Altersdemenz, wären da nur nicht seine merkwürdigen Ansprachen, die einen bis ins Herz treffen und deshalb stets ein wenig unheimlich sind. Vergangene Woche ist er eingeliefert worden, unterernährt und völlig ausgetrocknet. Er hat eine Menge bunter Schlafanzüge mitgebracht und alle tippen darauf, dass sie aus einem Sonderangebot von C&A stammen. Ulrike hat berichtet, dass er nachts in verschiedenen Zimmern herumgeirrt sei und dabei einige Patientinnen schier zu Tode erschreckt habe. »Er hat einen Zwerg gesucht«, hört Dagmar wieder Ulrikes Stimme, »und zwar einen Zwerg mit blauen Augäpfeln. Ist das nicht völlig abgedreht?«
Der alte Mann tut Dagmar leid, denn er kann nichts dafür, dass er verrückt ist, und er hat etwas an sich, das sie rührt. Manchmal versucht sie, ihn den anderen gegenüber zu verteidigen, aber gegen das allgemeine Gespött kommt sie nicht an. Dann macht auch sie sich lustig über ihn und hofft, dass er ihr verzeiht. Insgeheim glaubt sie, dass er weise ist, aber das behält sie lieber für sich.
Marion holt die Tabletts mit den Arzneimitteln aus dem Schrank und sie beginnen mit dem Verteilen des Frühstücks. Sonja sprudelt vor Vergnügen, denn sie hat beobachtet, dass der Krankenpflegeschüler einem Patienten das falsche Gebiss eingesetzt hat, nämlich das von seinem Bettnachbarn.
»Das ist so, als hätte Berthold Hauser einen Kuss von Mado Kerbul bekommen«, erklärt sie und kann kaum an sich halten vor lauter Lachen.
»Woher soll ich denn wissen, wem welche Zähne gehören?«, wehrt sich Freddy. »Die Dosen mit den Prothesen standen nebeneinander auf dem Waschbecken, da kann man sich schon einmal vertun. Irren ist menschlich.«
Dagmar hört nur mit halbem Ohr zu, denn sie überlegt, womit sie nach dem Frühstück weitermachen soll. Der Tagesplan sieht vor, dass alle Patienten bis zum Frühstück gewaschen sind, aber sie haben es wieder einmal nicht geschafft. Wenn Notaufnahme ist, werden nachts keine Patienten gewaschen – was sie sonst tun, obwohl es verboten ist. In der vorgeschriebenen Zeit kommen sie mit der Arbeit aber nicht durch. Es herrscht Einigkeit darüber, dass es immer noch besser ist, nachts einen Menschen aus dem Schlaf zu reißen als ihn den ganzen Tag ungewaschen im Bett liegen zu lassen. Noch dringender sind allerdings die Verbandwechsel, zumal am Wochenende keine gemacht wurden und einige so durchgeschlagen sind, dass Eiter und Wundsekrete nun die Betten verschmieren.
Plötzlich stößt Cornelia einen Schrei aus. Dieser gilt einer dicken Patientin, die, in einen geblümten Morgenmantel gewickelt, auf sie zukommt. Der Schrei weckt Wendelin Weihrauch aus seiner Verlorenheit, denn mit einem Mal sieht er sich überrascht um und macht sich auf den Weg in sein Zimmer.
»Frau Liebich!«, ruft Marion empört. »Was machen Sie denn wieder? Sie wissen doch, dass Sie nicht aufstehen dürfen! Und jetzt laufen Sie schon wieder herum! Wenn Sie so weitermachen, muss Ihr Fuß doch noch amputiert werden.«
»Schimpfen Sie nicht mit mir«, bittet Frau Liebich erschrocken. »Ich wollte euch doch nur sagen, dass die Ute immer noch am Waschbecken sitzt. Frau Kubatzki ist immer so nett zu mir, da wollte ich ihr auch einen Gefallen tun.«
Dagmar sieht Marion an und ihr Blick sagt alles. Sie hat die Kubatzki total vergessen. Ute Kubatzki sitzt seit über einer Stunde am Waschbecken und kommt allein weder in ihre Kleider noch in ihr Bett zurück.
Marion versteht. »Das wissen wir«, ruft sie munter zurück. »Wir kommen in zwei Minuten doch sowieso mit dem Frühstück in Ihr Zimmer. Da wird sich die Dame ja wohl noch ein bisschen gedulden können.«
Was Marion außerdem sagt, hört Dagmar nicht mehr, denn sie ist mit dem nächsten Tablett selber wieder unterwegs. Auf dem Tablett stehen ein Kännchen Kaffee, Tütchenzucker, eine Tasse, abgepackte Kaffeesahne, drei Medikamentenbecher sowie ein mit Zellophanfolie abgedeckter Teller, auf dem sich ein altbacken aussehendes Brötchen, eine Scheibe Vollkornbrot, Wurst, Dreieckskäse und Marmelade befinden.