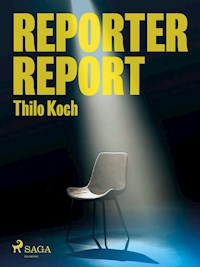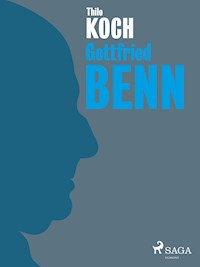
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dieses biographische Essay über den 1956 verstorbenen Arzt und Dichter Gottfried Benn basiert auf exakten Nachforschungen und ist angefüllt mit bezeichnenden und unterhaltenden privaten Details. Keine der vielen Seiten Benns bleibt unbeleuchtet, was den Menschen dem Leser sehr nahe bringt. Diese Biographie stützt sich dabei auf persönliche Eindrücke des Autors, der einen persönlichen Kontakt zu Benn hatte.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thilo Koch
Gottfried Benn
Saga
Gottfried BennCoverbild/Illustration: Shutterstock Copyright © 1986, 2019 Thilo Koch und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788711836149
1. Ebook-Auflage, 2019
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Vorwort 1970
Gottfried Benn starb am 7. Juli 1956 in Berlin. Ich kannte ihn seit 1949. In seinen letzten Lebensjahren sahen wir einander häufig, arbeiteten auch miteinander. Er willigte kurz vor seinem Tode ein, mir sein Leben zu erzählen; ich wollte eine umfassende Benn-Biographie schreiben. Dazu kam es nicht mehr. Was ich über ihn und von ihm wußte, faßte ich in einem biographischen Essay zusammen, der 1957 bei Albert Langen-Georg Müller in München erschien.
Von diesem Buch wurden 10 000 Exemplare verkauft; es ist seit längerem vergriffen. Die Nachfrage hielt an, und deshalb freue ich mich, daß Heinz Friedrich, der Chef des Deutschen Taschenbuch Verlages, diesen Nachdruck veranstaltet. Vor zwanzig Jahren wetteiferten wir – damals beide Rundfunkredakteure – miteinander, den Autor Gottfried Benn unseren Hörern vorzustellen, ihm womöglich noch Unveröffentlichtes zu entreißen.
Ich freue mich über den Neudruck aus noch zwei anderen Gründen: Erstens, er veranlaßte mich, wieder all meine Benn-Papiere zur Hand zu nehmen. Das Ergebnis sind einige hier zum ersten Mal gedruckte Texte – von Benn und über Benn. Zweitens, ich stellte fest, daß mein Benn-Essay mir unter den fünfzehn Büchern, die ich machte, noch immer das liebste Buch ist.
Mein Text aus dem Jahre 1957 wird hier fast unverändert wieder vorgelegt. Ich ergänzte lediglich einige Stellen, die auf Publikationen hinweisen, die inzwischen erschienen sind. Es verdient vielleicht erwähnt zu werden, daß die drei Kapitel – ›Entwurzelungen‹, ›Das gezeichnete Ich‹, ›Der Ptolemäer‹ – damals zuerst gesprochen veröffentlicht wurden, in drei 45-Minuten-Sendungen im Dritten Programm des Norddeutschen Rundfunks. Vom Radio ging im ersten Nachkriegsjahrzehnt eine außerordentliche Wirkung aus, die man im Fernsehzeitalter nicht mehr für möglich halten mag. Die Programme für anspruchsvolle Hörer trugen dazu bei, den heute kaum noch vorstellbaren geistigen Nachholbedarf in Deutschland zu dekken. Ich zum Beispiel kam mit 25 Jahren aus Krieg und Kriegsgefangenschaft nach Hause, ohne den Namen Gottfried Benn jemals gehört zu haben.
Als ein Beispiel für die Rundfunkbemühungen jener Jahre ist hier eine Diskussion zwischen Gottfried Benn und Peter de Mendelssohn abgedruckt. Es war schwierig, die beiden streitbaren Herren an einen runden Tisch und vors Mikrophon zu bringen. Das Thema »Schriftsteller und Emigration« mag heute etwas von seiner damaligen Aktualität eingebüßt haben, wenigstens für uns Deutsche. Jedoch ist die Diskussion für die Benn-Forschung sicher von Interesse. Es sind meines Wissens sonst keine Protokolle von freier Rede des Autors erhalten. Die unredigierte Nachschrift jener Nachtprogrammrunde vom 22. März 1950 erscheint hier zum erstenmal gedruckt.
Dieser dtv-Band bringt noch eine zweite Novität: Den ersten Abdruck einer Nachschrift meines Fernsehinterviews mit Gottfried Benn am Tage nach seinem 70. Geburtstag, am 3. Mai 1956. Es ist der einzige Film, den es mit Gottfried Benn gibt.
Im Zweifel war ich beim Einrichten dieses Buches, ob ich auch einige noch unveröffentlichte Briefe aufnehmen sollte. Ich entschied mich schließlich, alles, was Benn an mich geschrieben hat, im Nachwort zu zitieren, sofern es von öffentlichem Interesse sein könnte. Ferner zitiere ich aus einigen der bedeutsameren Briefe, die ich anläßlich meiner biographischen Benn-Studie erhielt; so unter anderem von Max Rychner, Hermann Kesten, Professor O. Woodtli, Dieter Wellershoff, den Germanisten Grenzmann und Martini, F. W. Oelze, Bruno E. Werner und einem Bruder Gottfried Benns Thomas Benn.
Zu danken habe ich wiederum Frau Dr. Ilse Benn. Sie empfing mich zu einem langen Gespräch über ihren Mann Gottfried Benn, mit dem sie zehn Jahre verheiratet war, 1946 bis 1956. Ich berichte über diesen Besuch bei Ilse Benn im Nachwort.
Dankbar erinnere ich mich hier auch an Hans-Joachim Schondorff, den damaligen Leiter des Langen-Müller-Verlages; er druckte meinen Benn-Versuch mit viel freundlicher Anteilnahme für den Portraitierten sowohl wie für den Portraitisten. Die Zustimmung zu diesem Nachdruck erteilte für den Langen-Müller-Verlag freundlicherweise Herr Dr. Herbert Fleißner.
Dieses Buch mag von Interesse sein für Leser, die einiges von Gottfried Benn kennen und nun wissen möchten, was für ein Mensch dieser Autor war. Aber auch jemand, der Benn besser kennt, wird hier vielleicht einiges erfahren, was sein Bild abrunden oder korrigieren könnte. Es waren junge Leute, die die erste Ausgabe am meisten kauften. Ich wünsche mir für diesen um vieles bisher Unbekannte ergänzten Neudruck vor allem Leser aus der »unruhigen Generation«. Höchst unruhig und beunruhigend war auch Gottfried Benn.
Hausen ob Verena im Februar 1970 Thilo Koch
Biographischer Essay
I Entwurzelungen
Was er zu sagen habe, stehe in seinen Büchern; die persönliche Bekanntschaft mit ihm werde nur enttäuschen. Das war die Antwort Gottfried Benns auf den ersten Brief »jenes Herrn Oelze« aus Bremen, an den er dann während eines Vierteljahrhunderts noch weitere achthundert Briefe richtete; ihre unzensierte Veröffentlichung wird vielleicht noch einmal Aufsehen erregen. Benn hatte den Höhepunkt seines ersten Ruhmes erreicht: 1932, als er seinen treuesten Bewunderer so abweisend beschied. Er habe sich in seinen Schriften ausgedrückt, an die möge man sich halten – das war eine oft wiederholte Antwort des Mannes, der mit seinem siebzigsten Geburtstag am 2. Mai 1956 und seinem Tode kurz darauf, am 7. Juli 1956, spät, aber nicht zu spät als ein deutscher Schriftsteller ersten Ranges endlich allgemein anerkannt wurde. War Gottfried Benn nicht überhaupt der bedeutendste Lyriker seiner Epoche im deutschen Sprachraum – trotz Trakl, Hofmannsthal, George, ja trotz Rilke? Ernst Robert Curtius jedenfalls hielt ihn für »die größte sprachliche Ausdruckskraft der deutschen Literatur der letzten dreißig Jahre«.
Ich habe die letzten fünf Lebensjahre Benns teilweise begleitet, gerade in der allerletzten Zeit kam es zu gemeinsamer Arbeit am Rundfunk, zu vertraulichen Gesprächen, zu dem einzigen Fernsehfilm, den es von ihm gibt. Er gehörte der Generation meines Vaters an; ich lernte ihn überhaupt erst nach diesem Kriege kennen, auch als Autor. Die erste persönliche Begegnung resultierte aus einem Widerspruch. Sein Bekenntnis aus dem Unheilsjahre 1933 zum »Neuen Staat« Hitlers hatte mich aufgeregt und empört, weil ich nicht begriff, wie ausgerechnet der Autor der Statischen Gedichte‹, des ›Ptolemäer‹ hatte versuchen können, das »Dritte Reich« geistig zu legitimieren. Über das Ärgernis an der politischen Haltung des für mich interessantesten Schriftstellers kam ich zur Bekanntschaft mit dem Manne, der mich sofort auch als Persönlichkeit kritisch faszinierte. Hierin ist der Anlaß für diese biographische Studie zu sehen, die eine richtige Biographie hätte werden sollen, mit Hilfe des Autors selbst, der so halb und halb, wie es seine Art war, zugestimmt hatte, mir sein Leben zu erzählen – zu spät.
Nun will ich hier immerhin notieren, was ich selbst noch von ihm habe hören und sehen können und was mir andere über ihn erzählten. Das Autobiographische in seinen Schriften habe ich nur ergänzend herangezogen; dem Kenner des Werkes ist es bekannt; knapp zusammengefaßt macht es jedem zugänglich das Bändchen ›Über mich selbst‹ (Langen-Müller-Verlag). Das hier zum erstenmal über Benn Mitgeteilte verdanke ich zunächst noch Gottfried Benn selbst. Dr. Ilse Benn, seine Frau, und Edith Benn, seine Schwester, berichteten mir manches, woran sie sich erinnern. Herr Dr. F. W. Oelze gewährte mir ein wenig Einblick in seine nahezu fünfundzwanzigjährige Brieffreundschaft mit Gottfried Benn. Ihnen allen darf ich an dieser Stelle danken.
Der alte, eher kleine Herr – genau maß er ein Meter siebenundsechzig –, wie er bedächtigen Schrittes unter großem Hut durch die Bozener Straße in Berlin-Schöneberg zum Zeitungskiosk wandelte, pünktlich und fest, und doch so verloren auch – wie er abends in der Eckkneipe hinter seinem Bier verharrte, ein ironisch blinzelnder Buddha – wie er zwischen Mikroskop und Kofferradio am Schreibtisch saß, in dem kargen, dämmerigen Ordinationszimmer, dessen Fenster zum Hof gingen – das alles sind private Kleinigkeiten im Leben eines großen Mannes. Gehen sie die Öffentlichkeit etwas an? Hatte er nicht recht, auf sein Werk zu verweisen und sich dahinter im Zwielicht seines ›Doppellebens‹ zu halten? Was er zu erklären wünschte, erklärte er es nicht hinreichend selbst in diesem autobiographischen Versuch mit dem provozierenden Titel? Wen interessiert es, daß er viele Kriminalromane las, weil sie ihm ein »Radiergummi fürs Gehirn« waren; daß er gern rote Grütze mit Vanillensauce aß und immer Frauengeschichten hatte, bis ins hohe Alter?
Gottfried Benns Leben verlief äußerlich ohne Sensationen, ohne Glanz und ohne öffentliche Affären. Es sei denn, man wollte ein Schreibverbot der »Reichsschrifttumskammer« 1938 dafür halten oder eine Amerikareise als Schiffsarzt im Jahre 1914, den tragischen Tod zweier Ehefrauen, die Teilnahme an zwei Weltkriegen, das Etikett »führender Expressionist“«. Sensationell oder nicht: diese sieben Lebensjahrzehnte, die ja die bewußt erlittene erste Hälfte unseres Jahrhunderts umgreifen, enthalten so viel exemplarischen Stoff, daß einst die Kulturhistoriker und Germanisten noch bedeutende Theorien über den Geist der Zeiten daraus entwickeln mögen.
Hier ist etwas Bescheideneres beabsichtigt. Daten und Bilder, Tatsachen und Schilderungen sollen festgehalten werden, auf der Suche nach der verlorenen Zeit eines Menschenlebens, dem es vergönnt war, Unverlierbares hervorzubringen.
Es ist ein Garten . . .
Ein mit Hausrat bepackter Leiterwagen bewegt sich im Herbst des Jahres 1886, von Pferden gezogen, quer durch die Mark Brandenburg, von der Elbe zur Oder hin und hinüber. Der junge Pfarrer Gustav Benn mit seiner Frau und zwei Kindern zieht um; von dem Dorfe Mansfeld in der Westpriegnitz nach Sellin, Neumark, »drei Stunden östlich der Oder«. Gottfried ist in Mansfeld geboren, in dem gleichen Pfarrhaus, wo auch sein Vater und sein Großvater zur Welt kamen; es ist ein eingeschossiger, kleiner Backsteinbau, schmale Fenster, eine Holzveranda, ostelbisch kärglich und kaum zu unterscheiden von den Bauernhäusern ringsum. Die Westpriegnitz ist alte Wendengegend, liegt auf halber Strecke zwischen Berlin und Hamburg. Hier war Gustav Benn Hauslehrer bei den Wilamowitz, bevor er die Pfarrstelle des Vaters bekam unter dem Kirchenpatronat der »Gans Edlen Herrn zu Putlitz« – und nun der größeren Aufgabe in Sellin entgegenziehen kann.
Im Schlosse der Wilamowitz lernte der junge Theologe Gustav Benn Caroline Jequier kennen, eine Schweizerin, die als »Mademoiselle«, als französische Erzieherin dort Dienst tat. Caroline, am 20. Juli 1858 in Fleurier geboren, im welschschweizerischen Juragebiet, war ein Jahr jünger als Gustav; sie heirateten am 22. Juli 1884. In Mansfeld wurde ihnen eine Tochter Ruth geboren (am 14. Mai 1885) und ein Sohn Gottfried (am 2. Mai 1886). Die Mutter sang den Kindern französische Wiegenlieder, ihr Deutsch blieb immer romanisch gefärbt. »In der Ehe meiner Eltern vereinigten sich also das Germanische und das Romanische . . . eine arische Mischung, eine in Deutschland vielfach legitimierte, es ist die Mischung der Réfugiés: Fontane, Chamisso . . .« (›Doppelleben‹, S. 17.)
Gottfried ist noch kein Jahr, als seine Eltern umziehen; sein Vater verläßt die engere Heimat, in der seine Vorfahren schon 1704 als Bauern des Dorfes Rambow bei Perleberg im Kirchenbuch stehen, wo auch sein Großvater, der erste Pfarrer der Familie, noch geboren ist. Sie sind ein ungleiches Paar, die neuen Pfarrersleute von Sellin: Caroline rundlich-fest, klein und gütig – der Pastor Benn groß und hager und streng. ». . . mein Vater durchaus der Felsbezwinger, transzendent und tierfremd, Züge des Urjägers der eiszeitlichen Megalithkultur: meine Mutter irdisch, allem Lebendigen nah, die Gärten, die Felder säend und gießend: Ackerbautyp, mit dem realen Sein voll Lächeln und Tränen.« (›Doppelleben‹, S. 17/18.)
Gottfried erbte die Statur der Mutter, die er sehr geliebt hat. Das Verhältnis des ältesten Sohnes zum Vater dagegen war von Anfang an gespannt; erst im Alter dachte Benn in Verehrung und auch in Liebe an den eigensinnigen, hart strafenden Pfarrer von Sellin. Zu einem Bruch kam es nie, das ließ der Respekt nicht zu, in dem die Pfarrerskinder aufwuchsen. Nach Ruth und Gottfried waren das Stephan (geboren 1889, heute Superintendent in Templin, Uckermark), Theodor (geb. 1891), Siegfried (geb. 1892, gefallen 1916), Hansgeorg (als Kind gestorben), Ernst-Viktor (geb. 1898, heute Industriesyndikus in Essen), Edith (geb. 1901, lebt in Berlin). Die Mutter Caroline starb 1912; der Vater heiratete ein zweites Mal und hatte mit seiner Frau Sophie, geb. Kolbe, die noch heute in Cottbus lebt, zwei weitere Kinder, die Söhne Friedrich und Hans-Christoph, die beide im zweiten Weltkrieg fielen.
Das Selliner Pfarrhaus war größer und repräsentabler als Gottfrieds Geburtshaus; später bekam es sogar Wasserleitung. Benn hat diese Heimat seiner Kindheit oft erwähnt: »Es ist ein Garten, den ich manchmal sehe, östlich der Oder, wo die Ebenen weit . . .« Eine der schönsten Stellen im ›Doppelleben‹ ist die Beschreibung dieser »Kindheitserde, unendlich geliebtes Land«. Ich darf hier auf den authentischen Bericht verweisen, der am besten ausdrückt, wie viel dem Autor dieses Dorf Sellin – es hatte 700 Einwohner – bedeutete. Bis ins Alter hatte er Heimweh danach. In einem sehr späten Gedicht – es heißt ›Keiner weine –‹ und ist das Herzlichste, was er je schrieb – spricht er von den Wochen, da er mit einer Mark dreißig auskommen mußte, »Wochen, mit Brot und Pflaumenmus aus irdenen Töpfen, vom heimatlichen Dorf mitgenommen, noch von häuslicher Armut beschienen, wie weh war alles, wie schön und zitternd!«
Seine Schwester Edith berichtet von ihm aus diesen Jugendtagen: »Wir glaubten wirklich, er könne zaubern. Oft erzählte er uns Geschichten. Eine war darunter von einem ›Onkel ohne Haut‹, der im Walde lebte . . . Ich sang einmal das Lied ›Was frag ich viel nach Geld und Gut‹, und bei dem Vers ›Das Laster treibt uns hin und her‹ sang ich statt ›Laster‹ immer ›Pflaster‹; um mir zu erklären, was Laster sei, sagte Gottfried: ›Sieh mich an, das Laster, das bin ich . . .‹ Sein vielleicht erstes Gedicht war ein Kinderreim für mich. Er liebte die Reseden im Garten und nannte mich Edchen: ›Edchen, mein Mädchen, hol mir Resedchen vom Beetchen.‹ Er strahlte immer Ruhe aus, war freundlich zu uns Kleinen, ging gern allein spazieren in die Felder, in den Wald, am liebsten in der Dämmerung. Einmal mußte der älteste Sohn die Eltern vertreten, die ausgegangen waren; er stellte sich eine Axt neben das Bett gegen Einbrecher und hatte für uns eine Tüte Pfefferminzplätzchen zum Beruhigen bereit. Solche Plätzchen hatte er immer bei sich; war er schlechter Laune, ließ er uns nur daran lecken und warf sie dann weg; schließlich kriegten wir aber doch immer eines.«
Es gibt ein Familienbild aus Sellin, da steht auf der Treppe vorm Haus der Vater im Nietzschebart über der großen Kinderschar. Es waren immer auch schwererziehbare fremde Kinder im Pfarrhaus, die mit versorgt wurden; der weithin bewunderte und gefürchtete Pator lud seiner Frau viel auf. Das Einkommen eines märkischen Pfarrers war nicht groß, eine kleine eigene Landwirtschaft mußte helfen. Zwischen Wochenbett, Küche, Stall und Garten erschöpften sich die Kräfte der schweizerischen Uhrmacherstochter. Aber das war das Los der meisten Frauen damals; und Gottfried Benns Mutter hat es mit vorbildlicher Geduld und Freundlichkeit getragen. Das straffe, fast militärische Regiment des Vaters wurde gemildert durch Humor. Humor machte auch das gespannte Vater-Sohn-Verhältnis erträglicher: »Gottfried, du hast ja kein Gesangbuch!« »Ich singe aus dem Herzen, Vater.«
Gustav Benn galt als theologischer Neuerer; er war der Ansicht, ein evangelischer Pastor solle ohne Talar predigen, und tat es auch einmal. Das sah man »oben« nicht gern. Aber über den Sprengel hinaus reichte sein Ruf als machtvoller Prediger, der niemals ablas und glänzend improvisierte. Die Bauern fühlten seine starke Persönlichkeit und glaubten, er könne Unheil und Heil beschwören. Sie holten den Pfarrer zu Geburt und Tod bei Mensch und Vieh und hatten Respekt vor seinem bergeversetzenden Glauben. Auch beim Landadel der Gegend genoß er besonderes Ansehen. Äußerlich dem Vater ganz unähnlich, wiederholen sich in Gottfried dennoch auch manche Charakterzüge des Vaters, nur treten sie im Sohne gebrochen und ambivalent auf: das ausgeprägte Persönlichkeitsbewußtsein; eine starke Sicherheit, ja Souveränität in der Haltung gegenüber nachgeordneten Menschen; starre Formen nach außen, ein weiches Mitempfinden, das verborgen wird; konservative Neigungen für »Zucht und Ordnung« im gesellschaftlichen Gefüge, aber eine aristokratische Toleranz in geistigen und geistlichen Dingen.
Pastor Benn kommandierte bemerkenswerter Weise seine Familie nicht in Glaubensdingen; er ließ den Kindern auch äußerlich freie Hand. Gottfrieds erste und zweite Ehe wurden nicht kirchlich geschlossen; der Vater mischte sich nicht ein. War er ein Despot, so doch – wie der große König seines Landes hundertfünfzig Jahre früher – ein aufgeklärter. Benn sprach kurz vor seinem Tode viel von diesem Vater, achtungsvoll und mit einem späten, heimlichen Einverständnis. Als er sehr krank war und große Schmerzen litt in den letzten Wochen, in Schlangenbad, sagte er eines Tages: »Ich hatte gedacht, heute würde es besser gehen, denn es ist der Geburtstag meines Vaters, der neunundneunzigste, und immer hat er mir an diesem Tage etwas Gutes geschickt. Nun sehe ich, er hat es anders vor mit mir, er will mich zu sich holen.«
Seinen Geschwistern imponierte Gottfried, weil er die Namen der Blumen, der Vögel und der Bäume wußte. Oft ging er lange in der Dämmerung spazieren, ungern im Sonnenlicht. Dann erzählte er abends den Kleinen, wie jetzt die Tiere im Walde frören und so viel Angst hätten. Edith, die Jüngste, war überzeugt, er könne mit den Tieren reden. Mitleid war von klein auf ein dominierender Zug seines Wesens; sein schroffes Sichabwenden war oft nur der Versuch, dieses Mitleid zu überspielen. Trotz seines großen Einsamkeitsbedürfnisses beschäftigte er sich viel mit den kleinen Schwestern und Brüdern: er sagte: »Ich bin euer Diener, was soll ich für euch tun?« Manchmal wurde es ihm auch zuviel, dann erklärte er: »Der Diener hat heute Ausgang.«
Einen auffallend hochmütigen Gesichtsausdruck zeigt Gottfried als Mittelpunkt eines Familienbildes um 1900. Er trägt einen Konfirmandenanzug, das Haupt ist kahlgeschoren, die Nasenflügel sind gebläht – die Nüstern, die er später als ein spezifisches Organ des Lyrikers bezeichnet. »Er muß Nüstern haben – mein Genie sitzt in meinen Nüstern, sagt Nietzsche – Nüstern auf allen Start- und Sattelplätzen, auf dem intellektuellen, da, wo die materielle und die ideelle Dialektik sich voneinander fortbewegen . . ., und da, wo die neueste Schöpfung von Schiaparelli einen Kurswechsel in der Mode andeutet mit dem Modell aus aschgrauem Leinen und mit ananasgelbem Organdy.« (›Probleme der Lyrik‹, S. 38/39.)
In dem schlanken, blassen Jungen des Fotos von der Jahrhundertwende erkennt man nicht den eher korpulenten Herrn der reifen Jahre und des Alters. Diese schwerere Körperlichkeit soll er erst nach 1918 angenommen haben. Ein Bild in Uniform, ein Gruppenbild aus der aktiven Militärzeit, zeigt ihn ebenfalls schmal, drahtig und in einer abweisend zusammengenommenen Haltung. Abweisend und spöttisch mag der junge Mann den Menschen in seiner ländlich-kleinbürgerlichen Umwelt immer erschienen sein: ». . . und Jottfried lächelt im Hinterjrunde . . .«, sagten seine Lehrer und Mitschüler von ihm.
Frühes Doppelleben
Die geistige Erziehung wird bestimmt durch drei Faktoren: das evangelische Pfarrhaus, das preußische Gymnasium, das Berliner Medizinstudium. Später kommt eine äußerst umfangreiche Lektüre hinzu, eine systematische im ärztlichen Spezialfach, in der Psychologie und manchen naturwissenschaftlichen und philosophischen Gebieten und eine wahllose literarische, die sich vom Aktuellen treiben läßt. Musisch war dieser Bildungsgang entschieden nicht. Für Musik zeigte Benn niemals viel lnteresse, sein Geschmack war da unorientiert und manchmal sentimental. ». . . mir zum Beispiel sagt Tosca mehr als die Kunst der Fuge . . .« (›Probleme der Lyrik‹, S. 6). Das Theater hielt er für eine antiquierte Kunst, außerdem scheute er vor dem zu nachdrücklichen Reiz des Dramatischen zurück. Eher ging er ins Kino und hörte Radio.
Was das deutsche Geistesleben speziell dem evangelischen Pfarrhaus verdankt, hat er selbst mehrfach ausgeführt und war stolz auf diesen Ursprung, besonders unter Hinweis auf die einzige geistige Autorität, die er immer treu verehrte: Friedrich Nietzsche. Eigentümlich für das Erbmilieu des deutschen Pfarrhauses ist nach Benn »die Kombination von denkerischer und dichterischer Begabung, die so spezifisch für das deutsche Geistesleben ist . . .« Auch dem Friedrich-Gymnasium in Frankfurt an der Oder bewahrte er ein ehrendes Andenken; denn das doppelt harte Training der alten Sprachen im Gymnasium und der Naturwissenschaften auf der Universität betrachtete er als unerläßliche Voraussetzung für sein Denken. Dennoch hat der Humanist Benn immer beklagt, daß er keine moderne Sprache gut konnte, Englisch gar nicht, Französisch nur bis zum einfachen Verständnis.
Zu Hause war er zusammen mit den Söhnen des Gutsherrn von Sellin unterrichtet worden, den Finckensteins. Nun wohnte er mit Heinrich Graf Fink von Finckenstein zusammen als Pensionsschüler in Frankfurt. Er war kein begeisterter Schüler. Wohl machte er schon mit siebzehn das Abitur, aber er empfand die Schule und das Pauken als drückende Last. Seine natürliche Scheu mag in diesen Jugendjahren zum erstenmal jene krankhaften Grade erreicht haben, die später zu beobachten sind. Er hat offenbar ein angeborenes Bewußtsein von seiner geistigen Befähigung, von der Auszeichnung seines Wesens, von der extremen Sensibilität seiner Sinne. Die kleinen Verhältnisse, in denen er aufwächst, die Armut empfindet sein aristokratischer Sinn als unangemessen, als drückend. Des Vaters patriarchalisches Regiment verstärkt diese Gefühle, und in der Schule mag denn ein regelrechter Minderwertigkeitskomplex entstanden sein. Hier bildet sich das Wurzelgeflecht, aus dem später vielfältige Ressentiments erwachsen, die soziologisch zum Typus des emporstrebenden bürgerlichen Intellektuellen gehören. Da liegt auch begründet, was Dr. Oelze Benns »diffidence« nennt.
Er schämte sich seiner ländlich gekleideten Eltern, wenn sie ihn einmal in Frankfurt besuchten. Es muß ihn gequält haben, daß seine adligen Altersgenossen und Mitschüler wohl manchmal auf ihn herabgesehen haben. Vielleicht begann es schon damals, daß er sich komisch fand. Später geht der schon berühmte Mann nicht aus, weil er plötzlich seinen Umriß unter dem Hut im Spiegel wahrnimmt und die Erscheinung albern findet, »Oft unterließ ich einen Einkauf, da ich meinen Umriß unter der Hutkrempe im Augenblick als zu absonderlich empfand.« (Weinhaus Wolf, in ›Der Ptolemäer‹, S. 18.) Es mögen auch erste Liebesgefühle unerwidert geblieben sein; in der Tanzstundenzeit hat er Liebesgedichte gemacht; er war früh von den Frauen fasziniert, litt aber manchmal darunter, daß er gerade auf diejenigen wenig Eindruck machte, die ihn besonders anzogen: die erotisch Attraktiven, die »beauties«, wie er sie später nennt. An Oelze schreibt er einmal Jahrzehnte später, er habe im D-Zug einer schönen Frau gegenübergesessen, mit der er gern angebändelt hätte, aber: »Sie schnitt mich eisig, weil sie in mir den alten Roué witterte.« Nun, er war kein Roué – viel eher sah er die Liebe als Mediziner –, und ganz sicher war er kein »infernalischer Snob«, wie er sich abwehrend, aber gerne nennen hörte. »Schon (meine) erste Gedichtsammlung brachte mir von seiten der Öffentlichkeit den Ruf eines brüchigen Roués ein, eines infernalischen Snobs und typischen – heute (1934) des typischen jüdischen Mischlings, damals des typischen – Kaffeehausliteraten, während ich auf den Kartoffelfeldern der Uckermark die Regimentsübungen mit marschierte und in Döberitz beim Stab des Divisionskommandeurs im englischen Trab über die Kiefernhügel setzte.« (›Doppelleben‹, S. 22.)