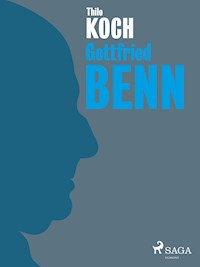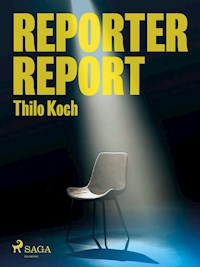
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In diesem Buch diskutiert Thilo Koch viele spannende politische und gesellschaftliche Situationen der 70er Jahre, der Zeit in der das Buch veröffentlicht wurde. In Kombination dazu hinterfragt er die Aufgaben und Verpflichtungen der Reporter. Dazu benutzt er eine einfallsreiche Methode, denn er interviewt sich selbst in seiner Position als Fernsehjournalist und berichtet dabei von seinen Erfahrungen.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thilo Koch
Reporter, Report
Saga
Reporter, ReportCoverbild / Illustration: Shutterstock Copyright © 1973, 2019 Thilo Koch und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788711836453
1. Ebook-Auflage, 2019
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
Herr Koch, Sie haben eingewilligt, mir ein 144-Seiten-Interview zu geben und von Ihrer Arbeit zu berichten. Darf ich gleich mit einer brenzligen Frage beginnen?
Ja.
Waren Sie als Reporter einmal in Lebensgefahr?
Ja, aber davon möchte ich nicht gleich am Anfang erzählen. Ein gutes Interview ist so ähnlich wie ein guter Boxkampf. Die Zuschauer mögen kein K. o. in der ersten Runde.
Dann eine andere brenzlige Frage. Haben Sie sich bei Ihrer Tätigkeit als Reporter einmal richtig verliebt?
Ja, aber ein gutes Interview hat stets etwas von einer Lovestory, und bei einer guten Lovestory dürfen sich die Partner nicht gleich in der ersten Szene in die Arme sinken.
Sie wollen also auch diese Frage lieber später beantworten.
Ja.
Dann fangen Sie mit dem Thema an, das Sie für richtig halten.
Wenn Sie erlauben: so sollte man ein Interview nicht führen. Der Interviewer muß schon wissen, was er will.
Sind Sie als Reporter ‒ und Interviewer eigentlich manchmal etwas schulmeisterlich, Herr Koch?
Ich hoffe nicht, aber wer kennt sich schon selbst ganz genau.
Nun, wir wollen Sie in diesem Interview hier näher kennenlernen.
Mich oder meine Arbeit und wie es »hinter den Kulissen des Fernsehens« aussieht?
Man kann bei Ihrer Arbeit Person und Sache nicht voneinander trennen.
Das stimmt.
Dann möchte ich Sie jetzt fragen: Was war Ihrer persönlichen Meinung nach die beste Reportage, die Sie je gemacht haben?
Diese Geschichte will ich Ihnen gern erzählen. Gern? Nun ja, es war eigentlich eine in doppelter Hinsicht traurige Geschichte. Stellen Sie sich vor: Ein Novemberabend in Washington. Es ist schon kühl und die Blätter fallen. Die Fenster des Weißen Hauses sind erleuchtet. Ich stehe mit meinem Kamerateam auf dem gutgepflegten Rasen vor dem Weißen Haus, aber schon innerhalb der Einzäunung, und warte.
Sie haben den Präsidenten der Vereinigten Staaten erschossen, ein paar tausend Kilometer entfernt von hier, in Texas, in der Stadt Dallas. Ich bin total übermüdet, denn seit jenen verhängnisvollen Schüssen aus einem Gewehr mit Zielfernrohr, denen John F. Kennedy zum Opfer fiel, gab es kaum Schlaf. Ich saß stundenlang am Telefon und vor dem Bildschirm, und ein Anruf aus Deutschland jagte den anderen. Ich mußte für den Hörfunk berichten, hatte einen langen Artikel für meine Zeitung über den Fernschreiber gejagt, und natürlich wollte das Fernsehen zu Hause möglichst viel aus Amerika haben, denn das Attentat auf Kennedy hatte rund um die Welt einen schweren Schock ausgelöst, besonders auch in Deutschland. An diesem Novemberabend schien nichts Bemerkenswertes mehr zu passieren, und ich sagte zu meinem Kameramann Fritz, er möge sein Gerät zusammenpacken.
Fritz Roland, in Wien geboren, aber schon als Kind mit den Eltern nach Amerika emigriert, war ein Veteran unseres Gewerbes. Er trug schon damals einen schwarzen Spitzbart und hatte stets einige Redewendungen parat, die uns allen viel Spaß machten. Sie fielen ihm immer dann ein, wenn die Lage total verfahren oder unsere Stimmung unter den Nullpunkt gesunken war.
The whole Mischmasch war eine dieser Redensarten, eine Kombination aus Amerikanisch und Jiddisch-Deutsch. So sagte er denn auch jetzt zu seinem Assistenten Bill und dem Tonmops Andy: »Get your whole Mischmasch people, we’ll leave!«
Aber dann sah er mich mit seinen traurig-verschmitzten dunklen Augen nachdenklich an und sagte zu mir: »Idon’t know, Thilo, irgendwas liegt hier noch in der Luft.«
»Ja«, sagte ich, »Regen, Fritz.«
In der Tat fing es nun auch an zu tröpfeln. Wir standen zwar unter einem der herrlichen großen alten Bäume, die das Weiße Haus in Washington umrahmen. Aber da sie nicht mehr allzu viele Blätter hatten, war das kein ausreichender Schutz.
In diesem Augenblick hörten wir das Flop-Flop-Flop eines Hubschraubers über uns. Es war schon so dunkel, daß wir den Copter nicht mehr erkennen konnten, aber wir sahen seine Positionslichter und wußten sofort, daß er zum Landen auf dem White House Lawn, dem Rasenplatz hinter dem Weißen Haus, ansetzte.
Ich trabte los. Fritz, Bill und Andy hatten in wenigen Sekunden ihr Gerät geschultert, und nach drei Minuten waren wir zur Stelle. Ungewöhnlich, daß um diese Zeit ein Hubschrauber hier ankam. Das mußte etwas Besonderes sein.
Einen Teil des Nachmittags und des Abends hatten wir im Presseraum des Weißen Hauses darauf gewartet, ob irgendein Mitarbeiter des toten Präsidenten oder des Vizepräsidenten Lyndon Johnson, der schon im Flugzeug als Nachfolger vereidigt worden war, uns etwas Neues mitteilen würde. Vergeblich. Die Kollegen waren jetzt alle weg, und so standen nur ein paar Leute, einige in Uniform, einige in Zivil, hier auf dem Rasen, um den Helikopter zu empfangen. Einige Scheinwerfer waren aufgeflammt, und Fritz meinte, das Licht würde reichen für das hochempfindliche Schwarzweißmaterial, das er in der Kamera hatte.
Vorsichtshalber ging ich in Position, Andy hatte mir schon das Mikrofon um den Hals gehängt, Bill stand bereit mit einer Handlampe, und der Regen war nicht zu schlimm.
Der Helikopter hatte sanft aufgesetzt, der Rotor kam zum Stillstand; und das Triebwerk war abgestellt.
»Look«, sagte Fritz, »the body.« Tatsächlich, sie hoben die Leiche des ermordeten Präsidenten aus dem Hubschrauber.
»Kamera läuft«, sagte Fritz, und ich blickte in die Kamera und sprach in mein Mikrofon, was mir gerade einfiel.
Die Situation läßt sich schwer beschreiben. Ich kann nicht leugnen, daß ich ergriffen war und, wie gesagt, auch übermüdet. Seit jenen Mittagsstunden des 23. November 1963 war ich pausenlos damit beschäftigt, mich mit diesem Attentat, seinen Hintergründen und seinen Folgen zu befassen. Aber hier, in diesem Augenblick, bewegte mich etwas anderes. Die Erschütterung brach durch, die Erschütterung darüber, daß ein junger Mann, an den sich in aller Welt so viele Hoffnungen knüpften, plötzlich dort in dem Sarg lag, tot. Es war die Erschütterung über die Familientragödie der Kennedys: Jackie und die beiden Kinder waren nun allein. Aber es war auch die persönliche Erschütterung, denn ich hatte diesen Präsidenten auf all seinen Auslandsreisen begleitet, wohl keine seiner wöchentlichen Pressekonferenzen versäumt, und obwohl er auch viele Fehler gemacht hatte, glaubte ich daran, daß er den seltenen Typ des Politikers verkörperte, der es ehrlich meinte, der klug und kraftvoll war, vorsichtig und friedfertig, ein Mann meiner Generation zudem, die am eigenen Leibe erfahren hatte, was Krieg ist.
Die Scheinwerfer erloschen, die Männer mit dem Sarg waren im Weißen Haus verschwunden. Wir standen unter einem kleinen Vordach, Andy hatte das Tonband zurückgespult, und wir hörten ab, was ich gesagt hatte.
»Knapp zwei Minuten«, sagte Andy. Fritz schaute mich an und ‒ soll ich es sagen? Nun gut, ich sage es: ihm standen Tränen in den Augen.
»Get going people«, sagte Bill etwas rauher als nötig, packte Film und Tonband in die vorbereitete Blechbüchse, tat die Blechbüchse in den vorbereiteten Luftpostsack mit der großen leuchtendroten Aufschrift »Tagesschau« und rannte los. Alles kam jetzt darauf an, daß Bill noch ein Flugzeug nach New York erreichte und daß das Päckchen in New York schnell ins richtige Flugzeug nach Deutschland umgeladen wurde, damit die Reportage am nächsten Abend in der Tagesschau laufen konnte.
Als ich zu Hause war, rief ich noch Erika an, meine Sekretärin, und bat sie, ein Kabel nach Hamburg zu schicken mit der Ankündigung der Reportage. Dann schlief ich zum erstenmal seit Tagen eine Nacht tief und fest durch.
Ich will es kurz machen. Die Reportage wurde nie gesendet. Sie hatten in Deutschland alles vorbereitet, um das Material im Luftpostbeutel sofort aus der gelandeten Maschine zu holen, in den Entwickler zu stecken, auf den Schneidetisch zu bringen und in der 20-Uhr-Abendausgabe zu senden. Die Boeing aus New York war pünktlich, aber sie hatte den Beutel nicht an Bord. Irgend jemand in New York hatte es nicht fertigbekommen, die Sendung von der Maschine aus Washington auf die Maschine nach Deutschland umzuladen. Das aber war unsere einzige Chance gewesen. Einen Tag später war die Reportage sauer, weil dann bereits über die Beisetzungsfeierlichkeiten berichtet werden mußte. Kühl und geschäftsmäßig, wie so etwas beim Fernsehen ist und auch sein muß, wurde das Material, das dann irgendwann später doch noch eintraf, weggeworfen, weil man ja in den Archiven Zuwachsen würde, wenn man jede überholte aktuelle Story aufbewahren wollte.
Fritz sagte »merde«, denn wenn er ganz wütend war, sprach er französisch. »This whole Mischmasch. . .« Er machte eine vielsagende Geste und knurrte noch: »Es war die beste Reportage, die wir je gedreht haben.«
Herr Koch, das Weiße Haus, das ist so ein Begriff. Sie sagten, Sie hätten da auf dem Rasen des Weißen Hauses gefilmt, vorher im Presseraum gewartet. Darf denn ein normaler Sterblicher überhaupt in dieses Allerheiligste der amerikanischen Politik?
Nun, man muß den richtigen Ausweis haben, einen sogenannten White-House-Paß, dann macht es gar keine Schwierigkeiten, in dem für die Presse offenen Teil des Gebäudes ein und aus zu gehen. Schwierig ist es, diesen White-House-Paß zu bekommen. Die spezielle Sicherungsgruppe der Geheimpolizei, die fürs Weiße Haus und für den Schutz des Präsidenten zuständig ist, kümmert sich erst einmal sehr genau um den Antragsteller. Man wird »gescreent«, wie es heißt, Erkundigungen zu Hause werden eingeholt, die deutsche Botschaft in Washington wird befragt, man muß einen sehr umfangreichen Fragebogen ausfüllen, Fingerabdrücke hinterlassen, wird in einer bestimmten Weise fotografiert, und erst nach einiger Wartezeit bekommt man dieses kleine Kärtchen, das dann allerdings wirkt wie ein Zauberschlüssel.
Es hat mir gute Dienste getan nicht nur beim Betreten des Weißen Hauses, sondern auch dann, wenn ich militärische Anlagen besichtigen wollte, wenn ich Probleme mit dem sehr pingeligen amerikanischen Zoll hatte, wenn ich ein dringendes Telefongespräch durchbringen wollte und manchmal sogar, wenn ich nicht genug Geld bei mir hatte, um ein Fernschreiben direkt zu bezahlen, weil ich gerade die entsprechende Kreditkarte nicht bei mir hatte. Der White-House-Paß muß jedes Jahr erneuert werden. Ich habe meinen letzten als Erinnerung aufgehoben, obwohl er längst ungültig geworden ist, und es war in der Tat der wirksamste Ausweis, den ich je besessen habe.
Im übrigen ist das Weiße Haus, jedenfalls Teile davon, durchaus auch für das Publikum zugänglich. Einige der Repräsentationsräume im unteren Stockwerk sind eine Art nationales Museum, und zu bestimmten Stunden kann man, von uniformierten Wächtern begleitet und geleitet, auch als normaler Bürger und ohne nach einem Ausweis gefragt zu werden, durchpilgern.
Der Präsident der Vereinigten Staaten ist neben seinen vielen anderen Funktionen auch so eine Art Ersatzmonarch, und der american citicen, der amerikanische Bürger, sieht sich in seinem Präsidenten repräsentiert. Man kann nicht gerade sagen, daß ein Kult mit dem Präsidenten getrieben wird, aber ein besonderer Respekt ist doch spürbar, der sonst keiner anderen Amtsperson in den USA entgegengebracht wird.
Natürlich kann niemand den Präsidenten einfach anrufen, obwohl die Telefonnummer des Weißen Hauses im Telefonbuch von Washington vermerkt ist. Man gerät an eine Vermittlung, und die verbindet einen mit den zuständigen Stellen des weitverzweigten Regierungsapparats. Im Vorzimmer des Präsidenten bin ich jedoch häufig gewesen, denn das grenzt an die Räume des Pressesekretärs, und die sind für jeden akkreditierten Korrespondenten und Reporter immer offen. Man holt sich da seine Informationen, mündliche oder schriftliche, und man versammelt sich da, bevor man den Präsidenten auf irgendeiner seiner zahlreichen Reisen begleitet.
Waren Sie jemals im berühmten Arbeitsraum des Präsidenten?
Ja, dreimal. Einmal, als Konrad Adenauer dort eine Konferenz gehabt hatte und einige Reporter die abschließenden Shakehands beobachten, fotografieren und filmen durften. Ein zweites Mal, als Willy Brandt, damals noch Regierender Bürgermeister von Berlin, sich vom Präsidenten verabschiedete. Und ein drittes Mal, als der Präsident verreist war und wir die Erlaubnis bekommen hatten, für eine größere Fernsehreportage über den Regierungsstil in Washington Statements vor der Rückseite des Weißen Hauses zu drehen.
Bei dieser Gelegenheit, es war ein heißer Sommertag und Mittagsstunde, kein Mensch war zu sehen, schlenderte ich auch einmal bis an die Tür, die vom Arbeitsraum des Präsidenten, dem berühmten Ovalen Zimmer, hinaus in den sogenannten Rosengarten führt. Die Tür war halb geöffnet, und ich konnte hineinschauen. Nach einer Minute aber trat aus dem Schatten ein schwarzer Polizist auf mich zu und sagte nur fragend: »Yes, Sir.«
Er war über unsere Dreharbeiten informiert, wir lächelten uns an, und ich ging zu meinem Team zurück.
Das Weiße Haus ist ein sympathisches Haus, finde ich, in einem bescheidenen Stil um 1800 erbaut, und es atmet noch heute den biederen Bürgersinn der Pilgerväter, die die amerikanische Demokratie gründeten. George Washington selbst war ein solcher amerikanischer Bürger, obwohl er als General und Gründer der Vereinigten Staaten schon zu Lebzeiten legendäre Verehrung genoß.
Aber man weiß doch, daß eine Weltmacht wie die USA von einer riesigen Regierungsmaschinerie gelenkt wird. Das Weiße Haus aber ist, wie Sie sagen, seit 1800 unverändert geblieben und von bescheidenem bürgerlichem Zuschnitt.
Im Weißen Haus sitzt nur der Präsident selbst, dazu seine engsten Mitarbeiter. Er wohnt auch im Weißen Haus, und seine Familie lebt hier.
Jackie Kennedy, die spätere Mrs. Onassis, hat sich verdient gemacht um eine Renovierung der gesamten Innenausstattung des Weißen Hauses. Sie brachte viel Geld zusammen, und es gelang, die zum Teil mit Bildern und Möbeln aller Stilarten ziemlich überladenen Räume stilecht und wohnlicher zugleich zu gestalten. Dennoch ist das Weiße Haus sicherlich kein sehr gemütliches
Heim für die Familie des Präsidenten, besonders nicht für seine Kinder, zumal wenn sie so klein sind, wie Caroline und Little John-John Kennedy. Das rührendste Bild, an das ich mich erinnere, war ein kleines Dreirad, das beiseite geschoben in einem Gang des Weißen Hauses stand. John-John, wie man den kleinen Sohn John F. Kennedys nannte, schien gerade damit gefahren zu sein. Es stand da, und wenn ich nicht irre, war es der damalige Führer Indiens, Ministerpräsident Nehru, der zwischen Jackie und John Kennedy mit großem prächtigem Gefolge daran vorbeidefilierte zum großen Eßzimmer, wo ein festliches Bankett wartete.
Das Weiße Haus ist nicht der einzige Wohnsitz, wohl aber der Amtssitz des Präsidenten. Richard Nixon hat ein Haus an der Küste in Florida und ein zweites in seiner Heimat Kalifornien und verfügt wie alle Präsidenten über den Sommersitz in der Nähe Washingtons mit dem Namen Camp David. John Kennedy war besonders gern in seiner Heimat Massachusetts, und zwar in dem kleinen Badeort Hyannis Port, wo er mit seiner Familie ein ganz durchschnittliches Ferienhaus bewohnte, in dem freilich spezielle Fernschreib-, Fernsprech- und Funkverbindungen installiert worden waren ‒ darunter der »heiße Draht« nach Moskau.
Ein amerikanischer Präsident muß ja in jeder Sekunde erreichbar sein, denn nur er kann im Falle eines kriegerischen Angriffs auf die Vereinigten Staaten über den Einsatz der sogenannten »letzten Waffen«, der großen Atomraketen, entscheiden.
Das ist wohl die größte Verantwortung, die jemals ein Mensch in der Geschichte tragen mußte, und sie lastet bestimmt schwer auf jedem Präsidenten, er mag noch so sehr das sein, was die Amerikaner einen tough guy nennen, einen »gestandenen Mann«. Wo immer der Präsident sich aufhält, wird er von einem Offizier in Zivil mit einem kleinen Koffer begleitet, dem sogenannten bag man. In diesem Koffer befindet sich der Kode, der Schlüssel für das Einsatzkommando der strategischen Waffen. Dieser Geheimkode wechselt täglich und ist nur dem Präsidenten auf der einen Seite zugänglich und den Generälen vom Dienst, die die interkontinentalen Raketenbasen, die strategischen Bomberkommandos und die raketenbewaffneten U-Boote in aller Welt befehligen.
Sie hatten also einen amerikanischen Kameramann, Fritz, seinen Assistenten Bill und den Tonmann Andy. Besteht ein Kamerateam für Fernsehreportagen immer aus drei Mann, und kann man als deutscher Reporter mit Amerikanern genauso gut zusammenarbeiten wie mit Deutschen?
Um den zweiten Teil der Frage zuerst zu beantworten: Es kommt immer auf die einzelnen Leute an, auf ihr Temperament, ihr Können und auf den gegenseitigen Willen zur Zusammenarbeit.
Im Laufe der Jahre hat sich zwischen Fritz und mir eine Freundschaft und Kameradschaft entwickelt, die sich auch in kritischen Situationen bewährte. Wir waren sicherlich nicht immer einer Meinung über die Art, wie dies oder jenes »optisch gelöst werden sollte, und manchmal war ich enttäuscht, wenn ich auf dem Schneidetisch sah, was Fritz gedreht hatte. Viel öfter aber war ich begeistert, und meistens war ich schlicht sehr zufrieden mit seinem handwerklichen Können. Außerdem war mir sehr wertvoll, daß er Amerika so gut kannte, daß er selbst mit seinen Leuten gut auskam und eben the whole Mischmasch des komplizierten Fernsehbusineß bis in alle Feinheiten beherrschte.
Ist da nicht ein großer Unterschied zwischen amerikanischem und deutschem Fernsehen?
Ganz sicher was die Organisation, die Rechtsform, die Programmgestaltung und vieles andere angeht. Aber im Technischen ähnelt sich alles doch sehr.
Man dreht auf 16-mm-Filmen, schätzt übrigens auch drüben sehr unsere deutsche Arriflex-Kamera, man nimmt den Ton getrennt mit einem Tonbandgerät auf sogenannte »Schnürsenkel« auf, ein relativ schmales Magnettonband, man entwickelt, schneidet und sendet dann das fertige Material auf ganz ähnliche Art wie wir.
Ganz anders läuft natürlich die gesamte Arbeit mit der elektronischen Kamera und der Studiobetrieb ab. Auch hier ähnelt sich das meiste bis ins Detail. Wir in Europa und auch die Japaner haben viel von den USA gelernt, die das erste große Fernsehland der Geschichte waren. So war es zum Beispiel eine Art Revolution in der Fernsehtechnik, als das sogenannte Ampex-Verfahren aufkam, die Möglichkeit, Bilder mit Hilfe magnetischer Signale zu speichern, ganz ähnlich wie Töne, wodurch erst das Aufzeichnen von Bildübertragungen möglich wurde. Bis dahin hatte man nur Zelluloid zur Verfügung, also Filmmaterial, wie es noch heute der Amateur mit seinem 8-mm-Gerät oder wir mit 16-mm- oder auch der Spielfilm mit 35-mm-Material benutzen. Das Ampex-Verfahren ist heute in aller Welt verbreitet, die entsprechenden Geräte werden auch von anderen Firmen als Ampex hergestellt, und gerade die Japaner verfeinerten und verkleinerten viele Details auf höchst praktikable Weise.
Fritz schwärmte immer davon, daß einmal sehr kleine Geräte im Handel sein würden, nicht größer als eine 8-mm-Amateurkamera. »Dann kannst du allein auf Drehreise gehen, Thilo«, sagte er. »Ich will dich doch nicht arbeitslos machen«, entgegnete ich.
»Nett von dir«, sagte er, »aber ich werde dann auch Reporter und führe ein ebenso faules Leben wie du.«
In der Tat bedeutet die Arbeit mit der Kamera schwere körperliche Anstrengung, deshalb findet man auch kaum einen weiblichen Kameramann. Auch die 16-mm-Ausrüstung ist noch schwer genug: Kamera, Stativ, Batterien, Objektivkasten. Ein Kameraasstistent ist also schon deshalb erforderlich, um all das Zeug immer wieder an Ort und Stelle zu schleppen. Man braucht ihn aber auch während des Drehens zum »Schärfe ziehen«, das heißt, der Kameramann, der durchguckt, muß auf den Ausschnitt achten, die richtige Belichtung, auf »die Kunst«. Die Schärfe aber, also die Brennweite, hat der Kameraassistent zu verändern, wenn sich das Objekt bewegt und dadurch die Entfernung größer oder kleiner wird.
Der Kameraassistent, in unserem Fall Bill, muß auch immer einspringen, wenn der Kameramann verhindert ist, und er muß zusätzlich drehen können, wenn zwei Kameras eingesetzt werden. Außerdem hat er dafür zu sorgen, daß immer genügend Filmmaterial da ist, daß es ordentlich in die Kamera eingelegt wird, daß das abgedrehte Material sicher wieder herauskommt, in die richtige Büchse gelegt wird und, wie mein Beispiel von jenem Abend vor dem Weißen Haus zeigte: der Assistent hat das Material zum Flughafen oder sonstigen Bestimmungsort zu bringen, kurz und gut, er ist das Mädchen für alles. In der rauhen und etwas zynischen Sprache der Kameraleute ist er »der Neger« des Teams.
Und ein »Tonmops« zusätzlich erweist sich immer dann als unerläßlich, wenn schnelle aktuelle Arbeit erforderlich ist oder wenn hohe Tonqualität gewünscht wird. Hinter der Kamera haben Kameramann und Assistent fast immer alle Hände voll zu tun, um ein sauberes sendefähiges Bild zu garantieren. Vor der Kamera steht der Reporter. Der Tonmeister oder Tonassistent ist dafür verantwortlich, daß der Ton in guter Qualität und synchron zum Bild läuft ‒ was immer wieder schiefgehen kann.
Zugegeben, es gibt viel Leerlauf bei den Dreharbeiten, lange Wartezeiten. Aber dann, im entscheidenden Moment, kommt es darauf an, daß die Handgriffe sitzen, daß jeder das Seine tut, sein Gerät beherrscht und mit den anderen reibungslos zusammenarbeitet. Macht auch nur einer einen Fehler, dann ist das ganze Mischmasch »im Eimer«. Die Arbeit des Fernsehreporters ist also immer Teamwork.
Ich habe mich oft danach gesehnt, nur für eine Zeitung zu berichten und gelegentlich ein Buch zu schreiben. Was brauche ich da schon. Papier, Kugelschreiber, vielleicht eine Schreibmaschine, ein Telefon, einen Fernschreiber, allenfalls eine Sekretärin. Alles hängt nur von mir selbst ab, von meinem Können, meinem Einsatz, meinem Informationsstand, meinem Verhältnis zur Redaktion, meiner Schnelligkeit, meinem Eifer oder auch meinem Versagen, meinen Pannen. The whole Mischmasch bin ich selbst allein.
Anders beim Fernsehen. Bedenkt man alle Zwischenglieder, bedenkt man, wie viele Rädchen sich in der richtigen Richtung auf die richtige Weise drehen müssen, damit eine Sendung beim Zuschauer einwandfrei ankommt, dann ist es oft ein Wunder, wenn das tatsächlich der Fall ist.
Nehmen Sie mich an jenem Novemberabend vorm Weißen Haus. Ich mußte die richtigen Worte finden. Okay, das ist mein Job. Aber zuvor mußte ich mitsamt meinem Team auch zufällig zur Stelle sein. Die Kollegen hatten schon alle abgebaut, waren abgerückt, saßen zu Hause.
Dann noch Fritz. Er mußte für die schon hereingebrochene Dunkelheit das richtige Filmmaterial in der Kamera haben, Bill mußte es richtig eingelegt haben, denn immer wieder entsteht in der Kamera »Filmsalat«. Das unbedingt notwendige Minimum an Licht mußte bereitstehen, das heißt also, Bill mußte eine Handlampe haben, der Akku mußte aufgeladen sein, die Handlampe mußte funktionieren.
Andys Ton mußte synchron mit der Kamera laufen, er mußte ihn richtig aussteuern und regeln und durfte ihn nicht etwa beim Zurückspielen oder Abhören aus Versehen löschen.
Dann mußte das Material, wie geschildert, den oft schwierigen Transportweg bis zum Sendeort zurücklegen; in diesem Fall scheiterten wir daran. Aber angenommen ‒ und das ist ja der Regelfall ‒, es klappt, was geschieht am Bestimmungsort?
Der Film muß zunächst entwickelt werden, und ich habe leider ein paarmal erlebt, daß er im Entwickler verdorben wurde. Der Ton muß überspielt werden, und ich habe leider auch schon erlebt, daß er beim Überspielen gelitten hat oder gelöscht wurde.
Dann kommt der Film auf den Schneidetisch, und die Cutterin muß ihn nach Anweisung des Redakteurs oder des Reporters schneiden. Mein Statement, meine kleine Reportage vorm Weißen Haus ist kein gutes Beispiel hiefür. Meistens dreht man ja sehr viel mehr Filmmaterial, als nachher gesendet wird, und dieses Mehr muß sinnvoll aus dem Rohmaterial herausgeschnitten werden. Was dann übrigbleibt, ist das, was der Fernsehzuschauer zu sehen bekommt. Ein guter Schnitt trägt oft sehr viel zur positiven Wirkung einer Sendung bei.
Ist dann der Film geschnitten, ist auch der Ton entsprechend verkürzt, zurechtgemacht und angelegt, kann eine Mischung notwendig werden. Dann nämlich, wenn Musik unterlegt wird oder Geräusche hinzukommen, die ganz genau auf das Bild abgestimmt sein müssen.
Das fertiggemischte Material geht dann zur Sendung, und hier kann noch so viel schiefgehen, daß es den Rahmen dieses Interviews sprengen würde, wenn ich das beschreiben wollte. Es würde außerdem auch mein technisches Verständnis übersteigen.
Ich möchte Ihnen jetzt eine ganz andere Frage stellen. Muß man als Reporter frech sein? Kommt also dieser Beruf für einen schüchternen Menschen zum Beispiel gar nicht in Frage? Sie schilderten Ihre Arbeit im Weißen Haus und ums Weiße Haus herum. Sie sagten, Sie hätten den amerikanischen Präsidenten auch auf seinen Reisen begleitet. Wie ist denn einem normalen Sterblichen so zumute, wenn er einem amerikanischen Präsidenten gegenübersteht, dem mächtigsten Mann der Welt?
Wissen Sie, es gibt natürlich sehr verschiedene Typen von Reportern. Da haben Sie einmal den sogenannten »Reporter des Satans«. Das ist so eine Art 007-Figur, ein James Bond mit der Kamera, ein Draufgänger und Tausendsasa, der sich in der Höhle des Löwen am wohlsten fühlt und seine news