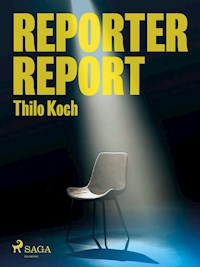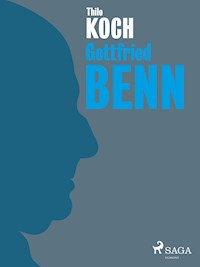Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses unterhaltsame Werk von Thilo Koch enthält kleinere und größere Arbeiten des Autors, die er über viele Jahre hinweg in seiner Tätigkeit als Journalist verfasst hat. Reise-Impressionen, kritische Seitenhiebe, Aufsätze über Sartre, Casanova und Benn, Sprachglossen, Miniaturen und auch elf "Galanterien" sind in dem Buch enthalten. Auf Kochs ganz eigene und spannende Weise verbinden sich die sprachliche Intimität der Skizzen und der nur scheinbar private Gestus mit einer unbeirrten Reflexion, mit welcher der Autor auf das Ganze zielt.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thilo Koch
Zwischentöne - Ein Skizzenbuch
Saga
Zwischentöne - Ein SkizzenbuchCoverbild / Illustration: Shutterstock Copyright © 1963, 2019 Thilo Koch und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788711836125
1. Ebook-Auflage, 2019
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
ORTE
Dolce Fahr’
Dieser spanische Frühling zwingt uns ins Haus. Das kleine Tropengewitter nachts läßt die Quecksilbersäule erstarren. Morgens küßt der Tramontana die Wipfel der noch eingebundenen Palmen, so daß du schnell dir die Hände an dem Kännchen mit Café au lait wärmst. Sonst aber ist alles wie im Urlaub: das Bett zu kurz, die Decke zu dünn, das Wasser nie warm, der Strom schwankend, elektrische Rasur also ungleich.
Genieße den südlichen Frühling, Mallorca, die goldene Insel, flugs fliegt man dich hin, du bist da, du erstarrst. In den Wogen, schneidend wie Nordsee. In den Klippen, traurigkühl wie Solveigs Lied. Auf der Terrasse, kahl wie ein Berliner Hinterhof. Bunt und höhnisch die Interpunktion der Liegestühle: Warte nur, balde . . .
Aber im Hause, da ist ja gut sein. Voll bis zum Rand die lauschige Bar, eingerichtet mit Fleiß und Genie vom französischen Wirt für den Flirt, für Espresso und Knobeln, »Time« und »Life« am Kamin, Pfeife zur Nacht und dazu »Veterano«, billigen, guten, spanischen Cognac: bueno.
Freilich, die Kleinen! Die Kinderchen! Wo, bitte, sollen sie spielen und tanzen, singen und springen, die Süßen? Draußen, der südliche Frühling, tut ihren Hälschen, den zarten, nicht gut. Also herein mit ihnen, laß sie hier schreien. Also zu zweien, zu dreien in die Klubsessel.
Und geduldig steht der schottische Vater am Fenster, gewärtig des heimischen Nebels, des Frühlingsschneefalls, des Geists von Hamlets Vater, allem schlechthin. Jedenfalls ist er gelassen, bedient den Kamin, gründlich: und wenn die ganze Pineta verbrennt – warm wird es doch nicht.
Sehr lebendig dagegen die drei Pariser Familien. Die eine Madame hat den Chic der Concièrge – o la la. Aber Monsieur grübelt so gründlich über der Karte zum Menü, daß er beim Skat, den die drei Herren von der Seine unentwegt spielen – veritablen deutschen »Skat« –, daß er verliert.
Doch der Gattin Brillanten sind echt. Und so fait es rien, daß die drei putzigen Kleinen eben den zweiten Schemel zerkleinern und ihn verheizen. Unter leichtem schottischem Schütteln des Kopfes vom Fenster her, das freilich auf Bewegungen der buschigen Augenbrauen beschränkt bleibt: take it easy, boy.
Anders der deutsche Professor. Er liest, buchstäblich, chinesische Bücher im Urtext – mit einem dicken Bleistift und von rückwärts, also ganz echt chinesisch. Scheu und Ehrfurcht aller Nationen umgeben den Weisen – etwa im Umkreis von ein Meter fünfzig. Selbst das englische Liebespaar aus Kalkutta (ob es da warm ist?) flüstert nur in seinem Rücken, an der Bar, die sehr hübsch aus einer längs abgeschnittenen Bootshälfte besteht. Beim Flüstern muß es sich nahe und immer näher kommen, denn leider – die Kleinen, die europäisch vereinten, spielen »Mikado« jetzt, und das ergibt Streit – Pearl Harbour, Harakiri.
Nur die Stimme des Mannes in kurzen Hosen dringt da noch durch. Wem er eigentlich in schwäbischen Kernlauten von Charkow und »lagen vor Madagaskar«, El Alamein und dem Kuban-Brückenkopf erzählt, ist unerfindlich, da eine große Mutti, dick hollandaise, die deutsche Gruppe verdeckt. Mutti lächelt auf schottenrockrotkarierte Knaben und eigene kleine Meisjes hernieder, gutmütig-lieb, mit ewig schiefgeneigter Schulter und glühenden Wangen.
Sonst gibt es noch zwei Attraktionen: die zweite Pariserin, Gattin im schwarzen Pullover, dazu ihr Anmutig-Parlierendes, schon mit acht Lenzen die ganze erotische Kultur der Nation mit Kußhändchen verschenkend. Und das rote Fräulein aus Vancouver, Kanada. Warum die hier friert und allein, weiß nicht mal Generalissimo Franco, der jede Mallorca-Briefmarke ziert.
Sie blättert, das Engelsgeschöpf, in »Vogue«, Spalte »Reisetips«, »See Europe Now«, und hat wirklich sehr, sehr schöne Fesseln. Auch sonst – alles, was recht ist. Zweiundeinhalb Aphroditen, schaumgeboren. Aber der knappe, schmiegende Badeanzug ruht tief im Koffer, die Brandung brandet allein.
Dieser spanische Frühling – ach ja. Aber balde: »Er kam, er kam ja immer doch . . .« Oder heißt es »noch«? Kein Büchmann – nix Literatur. Du senkst beschämt den ungebildeten Kopf. Aber: patienca – morgen, mañana ist auch ein Tag, Frühlingstag. Mache dich nützlich, Germane. Ich greife entschlossen zur Kaminzange, die Pineta zu schüren. Autsch, das war heiß. Scotchman vom Fenster fragt sachte besorgt: »Are you allright?« Ich grimmassierend, in diesem gemeinsamen europäischen Markt babylonisch verwirrt: »Merci, it’s niente!« Dolce far – aber fahr niente zu früh, in einem Früh-ling, o Reisender aus Alemania.
Die Welt am sechsten Tage
Artischocken und Palmen wachsen wie Unkraut. Grillen, so lang und stark wie ein Männerdaumen, springen dir über den Kopf und zehn Meter weit in die Macchia. Die duftet süß und intensiv, übertroffen nur noch gegen den Abend von der grüngrünen langen Büschelnadel der Schirmpinie am Hang und dem schotenartigen Blatt des Eukalyptus, der hier als Alleebaum dient und Kühlung raschelt. Schwarzer, roter, glitzernd-grauer Granit tritt überall aus den bunten Mosen, den Farnenfeldern, den Disteln, deren gelbe Blüte mannshoch aufschießt. Das uralte Gestein ist vom Meerwind, der Salzluft und den Güssen der Regenzeit modelliert; nun sieht es aus wie Elefantenhaut, und oft beugen sich die Höhenzüge wirklich auch in ihren Konturen wie die Rücken urweltlicher Elefantenherden unter das siedende Goldrot der untergehenden Sonne.
Nach ewigen, ehernen Gesetzen, so spürst du, seit dich die »Tirenia« in Olbia anlandete, steht hier ein unberührtes Land gegen die nagende, kühlende See ringsum, gegen den segnenden, sengenden Himmel darüber. Das Buch der Geschichte? Hier blieb es geschlossen, und die Zeit, die allmächtige, hier verwandelt sie in zehntausend Sommern nur wenig. Asphodelen und Oleander wurden von keiner Hand gebrochen oder gezogen; alle Jahre schießt die Agave aus dem Schoß ihrer dicken, blaugrünen Blätter den Blütenbaum viele Meter in den Wind; Opuntie, der Feigenkaktus, wuchert unendlich; die Herbste duften nach Orangen, Zitronen, und in den Tälern kocht die Traube.
Also doch der Mensch auch hier? Denn die Reben halten sauber am Stock; Schafe in daunenweicher Wolle grasen zwischen mörtellosen Steinmauern hinauf; das dunkel-sanfte Auge brauner Rinder glänzt blicklos über mahlendem Maul aus dem Schatten, und: ein dichtgeschlungenes Netz staubweißer und asphaltener Straßen überzieht die große Insel im Tyrrhenischen Meer. Menschen in den klassischen Berufen – Hirten, Pflüger, Jäger, Viehzüchter. Das einfache Leben mit Schafkäse, Wein und Brot. Menschen ohne Geschichte. Blaues Salzwasser, das den Granit zersägt; ein offener Himmel ohne Gott und voller Götter; in bergenden Muscheln aus Lava oder Basalt fruchtbares Grün, darin der Mensch.
Das denkende Wesen, dessen Spuren sich in »vorzeitlichem« Dunkel verlieren, das so vieles ersinnt, aber nicht seinen Anfang, nicht das Ende der Zeit. »Nuraghen« hat er gebaut auf diesem Stück Erde, als erstes Zeugnis der Macht, die ihn vor allem beherrscht: der Angst. Nuraghen, Türme in kunstvoll simpler Architektur, urtümlich, düster, aus Steinen, die zwei, drei Männer noch gerade bewegen, Fluchtburgen, Gräber, man rätselt; nicht groß, nicht prächtig, aber selbst in drei-, viertausend Jahren noch nicht zerfallen. Du legst die Hand an diese ersten Mauern, die nicht Naturkraft baute, der Stein ist sonnenwarm, wie all die Sommer hindurch, da hier Phönizier, Karthager, Römer, Vandalen, Ostgoten, Sarazenen, Spanier, Genuesen, Pisaner, Habsburger vorbeizogen, eroberten, erpreßten, vergingen – bis Garibaldi die Einigung Italiens brachte.
Nur wenige Meter sind die noch erhaltenen Nuraghen hoch. Die Abendbrise fährt kräftig drüber hin, das Land, das du überschaust, war besetztes Land bis vor hundert Jahren – durch Antike, Mittelalter, Neuzeit, »immer« also –, ohne Begriff von Sieg und Macht, von Selbstbestimmung und Zukunft. Keine Geschichte, keine historischen Aufschwünge, immer nur Material für fremde geschichtsbildende Kräfte. Besetztes Land; durch Jahrtausende besetzt. Begreift man das als freiheitsdünkelnder Mitteleuropäer? Hier ging der Wind über die Halme und knickte sie immer. Brot und Wein im besten Falle; die Berge als Zuflucht, die Macchia, Blutrache, Stolz, einsam durch die Jahrtausende, schwarzer Granit, der Wind und ein trauriges Lied auf der Hirtenflöte zum Abend.
Hart, einfach und groß zwischen Himmel und Meer, laß andere regieren, nur immer neue Eroberer erobern Eroberer.
An tiefblauen Golfen und zwischen silberhaltigen Bergen gibt es nun Städte. Dies Land, größer als die Schweiz, ist leer, aber es wächst doch auch Zivilisation um rasch modernisierte Zentren. Das heiße Wasser fließt zuverlässig ins rosa gekachelte Bad, blütenreine Wäsche wartet über der weichen Matratze. Languste ist zwar in der nächsten Trattoria billiger und besser als im staatlich unterstützten Hotel; aber Telefon in alle Welt, ein eleganter, ganz italienischer Corso gegen acht, das neuste Sportmodell von Alfa Romeo und aus dem Fenster dort drüben »My Heart Belongs to Daddy« sind die Vorzüge der Zivilisationsoasen; du bist in der westlichen Welt, geschützt durch NATO und einbezogen in den vertrauten Kreis von Jazz, Frühstück mit Ei, die neuesten Nachrichten, Krawatte und den zuverlässigen Ölwechsel aller zweitausend Kilometer. Um die Ecke spielt das »Ci« (gleich Cinema) mit Michèle Morgan; der sehr, aber nun schon sehr laute Sprecher vom Platz drüben ist, wie sich glücklicherweise herausstellt, kein Agitator der KPI, der Kommunistischen Partei Italiens, sondern ein Ausschreier auf dem »Mercato di Stoffe«, und die Glocken der Chiesa läuten zuverlässig zu Frühandacht und Vesper.
Sonst nämlich, in der Campagna, sieht es mitunter so gar nicht westlich aus. Es ist das gleiche Licht, ein ähnlicher Geruch nach Hammelfleisch und Holzkohle, die Leute bewegen sich so und blicken über ihren Bärten – wie in Aserbeidschan, auf den Ägäis, an sehr heißen Tagen in Süd-Polen, in Arragonien, an gewissen osmanischen Plätzen. Da fällt das törichte Herumgeschicke des »Grand-Hotel-Kellners« durch drei amerikanische Sekretärinnen vom Hauptquartier in »Naples« ins schweigende Nichts. Immerhin signalisieren die Ladies Zivilisation, und die ist angenehm, schließlich verteidigenswert, gerade in göttlicher Wildnis, unter Palmen, Disteln, Asphodelen – in der drängenden Nachbarschaft von Nuraghen, Granitbergen, Himmel und Meer.
Sardinien, Insel hinterm Rücken der Geschichte, stolz und leer, stark und lieblich, unentdeckt und doch uralt: dein Reiz liegt darin, daß du die Welt bist am sechsten Schöpfungstage – aber zierlich gehalten von blauen Bändern aus Asphalt.
Zwischen Jungfrau und Mönch
Im Herzen Europas, denkst du, herrscht eitel Zivilisation. Vier Wochen maßvolles Wohlsein bei Alpenmilch und »Grüet Sie alle miteinand!« Doch Wildnis, verwegne, bedroht auch hier, so lernst du, humane Idylle und liebliches Gleichmaß der Ferien. Paar tausend Meter entfernt vom Kuhläuten, roten Asphalt und traulichen Giebel deines Chalets – bleckt Arktis knurrend die Zähne, ragt Eiswelt, dürftig verdeckt unter brauenden, nördlichen Nebeln.
Sie grüßten als art’ge Kulisse beim Frühstück herüber, die stummgigantischen Viertausender des Berner Oberlandes. Nun aber schnurrt auf stählernen Zahnstangen die elektrische Bahn mit dir zum Joch der meistens in Wolken gehüllten Jungfrau. Hybris, sinnst du, menschlicher Übermut, fahrplanmäßig hier U-Bahn zu fahren durch Marmormassive, den längsten Tunnel Europas hinauf zum höchsten Bahnhof des alten Erdteils (3454 m über dem Meer). Einige tausend Tonnen drücken da auf das Köpfchen, und oben ist die ozonige Luft schon recht dünn.
Polarhunde, Eskimoschlitten – das mag wohl nur fromme Prospektlegende gewesen sein. Doch leibhaftig knurrt es und grönländisch finster vom Mönch her, und wie ein Geisterzug rasselt und hechelt der Schlitten an dir vorbei, im Schneesturm, im Wolkendunst weiß. Sechs arktische Hunde, kein Zweifel, ein mähniger Mann mit Schneebrille und Urlauten am Ende und lenkend. Inmitten verloren die Schatten von drei, vier Touristen.
Da ließest du lächelnd und mählich unten in Sommer und Urlaub, bei Alpencreme-Schoko nebst allfälliger Südfrucht, die Kinderchen glücklich, die Gattin. Dreitausend Meterli knapp über ihnen west hier das Urtum, die schneidende Kälte, Gletschergefahr und wildes Getier. Wie herbestellt pfeifen finstere Dohlen schwarz und gezackt um das Berghaus.
Drinnen beim wärmenden Kaffee sieht die Sache normal aus, wenn auch noch immer bizarr. Vor den Fenstern wölkt und brodelt der weiße Ozon distanziert, der riesige Steinadler schaut griesgrämig drein – an der Wand, ausgestopft. Aber es harren die Wunder ihres Betrachters. Vor zwanzig Jahren zum Beispiel haben ein paar Schwyzer Bergmannen die Eishöhle geschlagen, von Hand, in den Gletscher, ins fünfzig Meter tiefe Eis hinein, Gänge und Nischen, einen riesigen Saal für Schlittschuhtänze, und seither steht die kalte Pracht da – unbewegt, verzaubert, denn die Temperatur ist immer frigide hier drinnen.
Oben nur taut der Schnee weg bisweilen, ewig starren Felsen und Eis. Sonne? Die sahen sie stumm wohl millionenmal kommen und sinken, bis zum Halse zugeknöpft meistens, der »Mönch« und die »Jungfrau«, die da Äonen schon nebeneinander koexistieren. Tragen die Namen zu Recht. Wie freiwillig blind kommst du dir vor in dieser weißen Finsternis. Aber warte, du wirst belohnt, es ist keine Sage, das alte Hohelied alpiner Bergschönheit. Ein lässiger Hauch gibt für Minuten den Blick frei auf die beiden Silberhörner des ungeheuren Massivs: du schauderst. Stehst, starrst und schauderst.
Das lohnt vielleicht sogar das Bohren mit Preßlufthämmern durch Jahre, bis der Tunnel stand. Manchmal sind es über zweitausend Leute pro Tag, die viele Fränkli und Rappen spendieren, um einmal im Leben trockenen Fußes einem Viertausender zum Greifen nahe zu sein. Kein Wort ist da, um die erhabene Eleganz, das ironische Blinzeln aus königlicher Unnahbarkeit wiederzugeben, mit der diese Jungfrauhörner – Diamanten auf Blau – niederglänzen zum sterblichen Pilger.
Abwärts rasselnd zum Irdisch-Gemeinen, nistet sich ein Gedanke in deinen Kopf. Das mit den Hunden, ein Jux – man fährt eine Schleife und hat sein Stück Nordpol, mitten im Sommer Europas. Das mit der Bahn, Sight-seeing, ein technischer Gag von Format. Unvergeßlich: Gipfelironie und das unendlich weiße geschmeidige Gleißen der Firne, der Schneefelder zwischen den Riesen, niemals getaut.
Die Erde, ein erkalteter Stern, ist aus Stein, Eis und Meeren. Alles Grün, alles Leben – ist es denn mehr als ein loser, ein flüchtiger Schleier, in den diese Erde sich für einen Weltraumaugenblick zu hüllen beliebt? Und der Mensch? Zwischen Jungfrau und Mönch begreift er sich nur noch als Auge, geschaffen zu warten auf jene wenigen Blicke, vor denen Natur sich enthüllt, um doch gesehen zu werden. Wozu? So fragt das Auge. Die Gipfel sind stumm.
Felix Helvetia
Eine eidgenössische Feuerwehrkapelle spielt im Pavillon am See flotte Märsche, und wie ein weißer Gänsekiel steht die berühmte Fontäne neben dem Pont du Mont-Blanc. Die Rhône fließt kühl und eilig wie immer aus dem See heraus, nach Frankreich hinunter. Noch sah ich niemanden baden. Aber in den Cafés holen sich parlierende Müßiggänger, die es hier immer in Fülle gibt, die erste Sonnenbräune.
Funkelnde, glitzernde, in Akkorden weich hupende, dahingleitende, regenbogenfarbig glänzende Rudel von Automobilen, weiße, schwarze Pneus auf rotem Asphalt. Blitzende Lichtgirlanden über Straßen, Cafés, Promenaden. Lachende Seitenblicke aus dunklen Augen, schmiegsames Jerseygewebe gibt weiße Schultern frei, modelliert Taillen und mehr. Rauchende Herren in spitzen Schuhen, doppelt geschlitztem Rock und kurzem Kraushaar. Ein südlich perlendes Idiom garniert zierlich leere Höflichkeiten um den ganzen süßen Tanz.
Luxus – es gibt ihn hier ganz beiläufig. Und er ist angenehm. Für die exklusive Creme, die ihn hat, vielleicht weniger als für den Zuschauer, der ihn bewundert – wie ein kunstvoll inszeniertes Stück auf dem Theater, eine Geschichte aus den Tausendundein-Nächten. Dort unter den hundertjährigen Platanen sitzen und der Harmonie eines Abends mit halbgeschlossenen Augen zuhören . . .
Es sei auch hier nicht alles vierzehnkarätig, und was da gleißt, wäre billig? Warum Neid? Ist es nicht schön, daß Watteau »die Einschiffung nach Kythera« gemalt hat? Wird’s weniger schön dadurch, daß niemand diese rosa-him-melblau verdämmernde Insel der Seligen je erreichte? Die happy few, sollen sie doch glücklich erscheinen; denn wer von ihnen wandelt schon wirklich »droben im Licht«.
Das Verlangen nach dem dreihundertpferdigen Wagen, der Villa am Meer, der geheimnisvollen Dame dort drüben hinter dem Eisbecher, unter der rot-weißen Markise – das alles ist harmloser als der finstere Hunger nach Macht, der immer die verzehrt, die das läßlich egoistische Menschenvolk bessern, gewaltsam zu Sittenstrenge und Einfachheit erziehen wollen.
Gleichmütig rückt der Zeiger der großen Blumenuhr im Englischen Garten von Sekunde zu Sekunde. Hier stand ich schon einmal, vor einigen Jahren: Eisenhower traf Bulganin und Chruschtschow. Viele tausend Stunden zeigte diese einzigartige Uhr inzwischen an. Wie ihr Zeiger, so drehte sich um die eigene Achse und kam kein Stück von der Stelle auch: die deutsche Frage. Und nun? Vier großmächtige Außenminister sind versammelt, um abermals den Stein den Berg hinaufzuwälzen.
Eine unzählbare indische Familie, dunkel getönt und sahribunt in einem riesigen Plymouth mit Haifischflossen; ein Zwei-Meter-Neger neben mir im Zoll auf dem Flughafen; flinke Japaner mit Brille unter jeder Arkade – das ist seit den selig-unseligen Völkerbundzeiten jahrauf, jahrab so. Internationale Konferenzen? Kein Genfer Bürger fragt danach.
Die schweizerische Akkuratesse wird in Genf gemildert durch einen Stich romanisches »Laisser-aller«. Da bröckelt schon mal der Putz, und das »merci« des Telefonfräuleins klingt zwitschernd wie in Paris. Die jungen Mädchen mit den Augen im Trauerrand, den blaßrosa Lippen und der Nymphenmähne haben das Zwei-Parteien-System: hie Bardot, hie Vlady. Es wippt der Rock im Frühlingshauch, und weiter oben schwankt es auch (das Herz).
Das männliche Gegenstück, die Studenten, sind ein Cocktail aus »St.-Germain-des-Prés-Existentialismus« und Texas. Die amerikanische Note dominiert, obwohl die Eidgenossen nicht in der NATO sind. Kennzeichen: Jeans, Haltung: relaxed und Hindenburg-Frisur.
Aus der Espresso-Bar tönt’s wie in München und Hamburg: »Ciao, Ciao, Bambina . . .« Ich ziehe abends das »Bavaria« vor, ein Münchner Bier unter Karikaturen von Stresemann und Briand. Hier haben die einmal den Silberstreifen »Frieden« mitsammen erstritten – beim deutschen Bier. Auch damals ging’s um Erbfeindschaft. Heute sehe ich keinen Minister mit dem Kollegen von der Gegenseite ins »Bavaria« gehen. Den Genfern ist’s Wurscht – Felix Helvetia . . .
Verlorene Zeit – wiedergefunden
Die Zeit der Könige und ihrer Schlösser scheint für unser politisches Gefühl Jahrtausende zurückzuliegen. Und doch hat unsere ältere Generation noch den Trommelwirbel der farbenprächtigen Wachablösung im Ohr, die goldene Equipage der Hoheiten vor Augen. »Fridericus Rex, unser König und Herr . . .« – das mag begeistert oder mürrisch gesungen worden sein, oft und oft, auf dem Exerzierplatz vorm Charlottenburger Schloß. Pferde bestimmten noch das Straßenbild, in dem es an kokettierenden Demoisellen, stutzerhaften Rokoko-Kavalieren, schnauzbärtigen Gardekürassieren nicht fehlte.
Aus alten Kupferstichen tritt uns diese Welt noch entgegen. Und aus den königlichen Parks, Lusthäuschen, Galerien und Kuppeln, die erhalten blieben. Ein Schimmer vom Glanz versunkener Epochen stimmt uns lyrisch. Gern, vielleicht allzugern vergessen wir die Not, die Unterdrückung feudaler Jahrhunderte vor den majestätischen Proportionen, dem gediegenen Luxus. Berlins Schlösser wurden vom Kriege besonders hart verwüstet. 1943 brannte das schönste vollkommen aus, das Charlottenburger. Napoleon fand 1806, als er Berlin erobert hatte und hier wohnte, es sehe Versailles sehr ähnlich. Unersetzliche Porzellane, Tapeten, Möbel, Stuckarbeiten und Intarsien gingen verloren. Ganz unwiederbringlich die Fresken von Pesne an Decken und Wänden.
Fünfzehn Jahre nach der zerstörenden Bombennacht erhob sich aus dem musterhaft gepflegten Park eine glänzende neue Fassade. Kupfergedeckt ragt die 48 Meter hohe Kuppel Eosanders von Goethe über dem Mittelteil; die steinernen Gladiatoren hüten das äußere Tor. In der Mitte des Hofes: Andreas Schlüters »Großer Kurfürst«. Dieses riesige Bronze-Reiterstandbild hat im Baedeker zwei Sterne; es ist eines der schönsten Bildwerke des ganzen europäischen Barock. Früher stand es auf der Langen Brücke, versank dann auf einem Transport für drei Jahre im Wasser. Nun thront der schwere Kurfürst wieder auf seinem schweren Pferd und blickt ins Weite; es scheint ihn nicht zu kümmern, daß sein Brandenburg in den Staub sank – für immer. Rechts ist der lange Flügel, den Friedrich der Große von seinem Baumeister Knobelsdorff anfügen ließ, ebenfalls ganz wiederhergestellt – und zentralgeheizt, denn hier gibt es jetzt die schönsten Sonderausstellungen der Inselstadt Berlin.
Die »Nationalgalerie der ehemals Staatlichen Museen« zeigte hier zuletzt Lovis Corinth, aus Anlaß seines hundertsten Geburtstages. Bisher gab es wohl noch nie eine solche Zusammenfassung der besten Werke des Ostpreußen, der zusammen mit Liebermann und Slevogt das große Berliner Dreigestirn der Zeit vor dem ersten Weltkrieg bildete. Die derbe Sinnlichkeit Corinths muß damals schockiert haben. Die Akte und Stilleben, die Blumenstücke bersten vor Kraft und Farbe. Überraschend geistig, ja psychologisch, daneben die Porträts: Eduard Graf Keyserling, Friedrich Ebert – vor allem aber: er selbst. Nach dem Schlaganfall im 54. Lebensjahr ist die dionysische Fülle dahin, die Sinnlichkeit vergessen, der starke Puls nur noch matt. Aber das letzte Selbstbildnis und die »Ausgeschütteten Blumen« des Todesjahres 1925 sind die schönsten Stücke der Ausstellung. Er war teilweise gelähmt, als er das schuf, seine Hand zitterte. Und doch sprach erst jetzt ganz unabgelenkt sein Genius. Früher schäumt und brodelt die Lebensfreude so stark, schlägt sein Realismus manchmal so wild zu, daß übertriebene, manchmal sogar kitschige Effekte die Bilder schreien lassen. Jetzt entstehen Landschaften aus dem Alpenvorland, die zu den ewigen Meisterstücken der Malerei zählen: die Komposition apollinisch souverän, die Farbe aber noch kühn und saftig; über allem jedoch der gebrochene Schimmer des Bewußtseins der Vergänglichkeit, der verklärt und bewegt.
Der Blick aus den tiefen Fenstern des Knobelsdorff-Flügels schweift ungehindert durch den vorfrühlingshaft kahlen Park. Spaziergänger in warmen Mänteln noch, die die Stille und heiter gemessene Kultur dieser Oase im Trubel der großen Stadt genießen. Freilich wird es dauern, bis die jungen Linden und Blumen den erneuerten Stein in jenes poetische Grün wieder einbetten, das erst ganz die Illusion zurückgibt von einer guten, alten, verlorenen und wiedergefundenen Zeit.
Frühlingssignal
Alles klingt heute ganz anders. Die S-Bahn unterm Bürofenster schmettert übers Gleis. Die Kinderstimmen von der Nebenstraße tragen plötzlich bis hier herauf in den vierten Stock. Und natürlich die Vögel. Auf der Kastanie am Platz drüben wird ein veritables Madrigal durchjubiliert. Drossel hat die Dominante.
Heute Hochgelehrtes, Tiefgedachtes, Ferngefühltes ins Tagebuch zu tragen, will nicht passend scheinen. Mag’s töricht sein oder ein bißchen sentimental, ganz ungeistige Frühlingsempfindungen alle Jahre wieder in die Feder fließen zu lassen – nur Dickhäuter können einem solchen Tag widerstehen.
Zwischen zwei Kühltürmen eines Kraftwerks ist in der Morgensonne die feine, zierliche Silhouette des Funkturms zu sehen. Am U-Bahn-Eingang der alte Ahorn hat über Nacht dicke Blattknospen aufgesteckt. Eine junge Dame auf glitzerndem Motorroller gleitet vorbei, ihr nilgrüner Schal versucht vergeblich, die schwarzen Locken festzuhalten.
Die Cafés am Kurfürstendamm haben wieder die Stühle herausgestellt. Manchmal ist die Sonne schon so intensiv, daß sie ihre rot-weiß gestreiften Sonnensegel aufspannen. Zwischen vier und sechs flaniert man wieder wie eh und je zwischen Uhlandstraße und Joachimstaler. Ich sitze eine Weile träge in meinem gelblackierten Stuhl und sehe nur auf die Füße der Vorübergehenden. Da klickt ein wohlgepflegter Herrenschuh mit Boulevardbeschlag heran. Öfter sehe ich billiges Ersatzlederschuhwerk aus dem Osten.
Ein bißchen Sonne verzaubert die ganze große Stadt. Jeder, der vom Urlaub aus den Bergen kommt, fällt natürlich noch immer genauso auf wie in den trübsten Wintertagen. Niemand traut sich so recht, diese Luxusbräune ganz unbefangen zu präsentieren. Sie erinnert die Berliner daran, daß man »raus« kann. Wenn man kann. Es gehört Kleingeld dazu, gewiß – wie überall. Aber es gehört hier doch noch ein kleines bißchen mehr dazu, nach Bayern oder nach Österreich zu fahren: das Passieren einer Grenze, der einzig wirklich hinderlichen Grenze, die es heute in Europa noch gibt.
Uff, das war aber auch ein Winter! Und nun glänzt das auf, schimmert, breitet sich hin, wagt sich vor. Der Hund frißt irgendein würziges Unkraut. Die warmen Socken gehen das letztemal in die Wäsche; der Hut bleibt am Nagel.
Es ist nicht das taufrische Licht allein – auch von innen her sehen die Gesichter der Leute in der U-Bahn, selbst abends noch, glatter aus. Großstädter erleben das Steigen des Jahres, die Rückkehr von Fruchtbarkeit und milder Luft vielleicht dankbarer noch als Landbewohner.