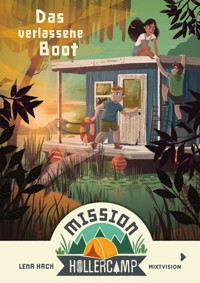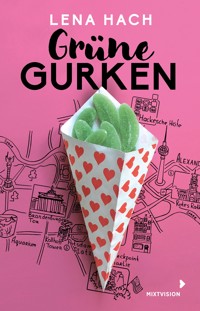
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mixtvision
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Berlin, mitten in Kreuzberg: Lotte, neu in der Stadt, ausgesprochen tollpatschig, herrlich selbstironisch, normal begabt und total verknallt. In Vincent von Grüne Gurken. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall in den Typen, der immer montags im Kiosk gegenüber auftaucht und genau 10 Grüne Gurken kauft. Eine Geschichte über das, was wirklich wichtig ist: die richtige Stadt, der richtige Typ und die richtige Sorte Weingummis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Tür fällt hinter mir ins Schloss. Im gleichen Moment wird mir klar: Ich habe nicht an den Schlüssel gedacht. Der baumelt entspannt am Brett auf der anderen Seite. Natürlich habe ich auch kein Handy dabei. Das ist mal wieder typisch. Zu Hause – und mit zu Hause meine ich mein Dorf in Hessen und werde es immer meinen – hätte ich jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich könnte zu Daniel fahren. Ich könnte zu Daniel laufen. Oder den Ersatzschlüssel aus dem Blumenkasten buddeln. Aber in diesem Mietshaus gibt es keinen Blumenkasten – nur jede Menge Müllcontainer. Da wird zwar alles reingestopft, aber garantiert kein Zweitschlüssel für das 2. OG rechts.
Leider habe ich keine Ahnung, wann meine Eltern zurückkommen. Sie sind mit irgendwelchen neuen Kollegen zum Abendessen verabredet und wenn es gut läuft, gehen sie anschließend noch in eine Bar. Fast schon peinlich, wie versessen die beiden darauf sind, hier in Berlin direkt Anschluss zu finden.
Mein Magen knurrt. Das erinnert mich daran, warum ich überhaupt im Treppenhaus stehe. Ich habe wahnsinnigen Hunger. Seit wir hierhergezogen sind, kochen wir abends kaum noch zusammen. Dabei ist das eigentlich unser Familiending. Mama ist fürs Gemüse zuständig, ich für die Kräuter und Papa darf Zwiebeln schnippeln. Ausgefallene Pasta-Soßen sind unsere Spezialität.
Doch vorhin hatte ich auf einmal totales Verlangen nach Milchreis. Weil der dem Magen und der Seele guttut. Ich habe mich also aus meinem neuen Zimmer in unsere Küche bequemt, um die Zutaten zusammenzusuchen. Vor allem der Reis ist entscheidend. Am besten nimmt man Rundkorn, mit viel wasserlöslicher Stärke; das gibt eine richtig schöne Pampe. Je größer die Körner sind, desto mehr Milch wird aufgesaugt. Im Kühlschrank habe ich jedoch nur Sekt und Orangensaft entdeckt – und diese Limonade, die sich Brause nennt. Aber keinen einzigen Tropfen Milch. Kurz, ganz kurz, habe ich in Erwägung gezogen, die Reiskörner roh in mich hineinzuschaufeln. Wenn es zu sehr knirscht, hätte ich einfach O-Saft hinterhergegossen. Da fiel mir der Kiosk auf der anderen Straßenseite ein. Ich war zwar noch nie drin, aber mit etwas Glück gab es da nicht nur Bier und Hipster-Limo, sondern auch das ein oder andere Molkereiprodukt. Also habe ich mir trotz der sommerlichen Hitze Papas Mantel übergeworfen – weil der meinen Pyjama komplett verdeckt – und mir mein Portemonnaie geschnappt. Nur an den Schlüssel habe ich nicht gedacht. Und jetzt steh ich hier also ratlos im Treppenhaus, in meinen Krümelmonster-Hausschuhen.
Ich versuche, mich mit dem Gedanken zu trösten, dass es schlimmer sein könnte. (Und es war schon oft schlimmer!) Ich könnte zum Beispiel nackt hier stehen. Oder in dieser hautfarbenen Unterwäsche von Oma. Stattdessen trage ich einen Pyjama und einen Dufflecoat, handgemacht, gefüttert und mit Abstand das beste Kleidungsstück meines Vaters. Schon klar, ich versinke fast in dem Ding. Aber meine Fensterstudien haben ergeben, dass sich die Berliner in den unmöglichsten Klamotten aus dem Haus wagen. Vor allem Jogginganzüge sind schwer angesagt. Da falle ich in meinem Zelt garantiert nicht auf. Also setze ich mich in Bewegung. Denn Hunger habe ich ja immer noch. Ich schlurfe durch das Treppenhaus, auf die Straße. Um mich im Kiosk mit ordentlich Proviant einzudecken. Wer weiß, vielleicht gibt’s dort ja sogar diesen Fertigmilchreis. Wie super wäre das denn bitte?!
Ich werfe einen Blick hoch zu unserer Wohnung. Nur in meinem Fenster brennt Licht. Also, ich weiß, dass es mein Zimmer ist. So wie ich weiß, dass man nicht durch null dividieren kann. Oder sich beim Baden nicht die Haare föhnen sollte. Es ist bloß: Das Zimmer fühlt sich nicht wie meins an. Obwohl ich es mir selbst aussuchen durfte. Es ist das beste der ganzen Wohnung. Ein schwacher Trost, wenn die Stadt die falsche ist. (Allerdings immer noch besser als ein schlechtes Zimmer in der falschen Stadt.)
»Lotte, du brauchst Geduld! Natürlich musst du dich noch einleben«, sagt Papa, wann immer ich mich beschwere. Also ständig. »Wir wohnen hier erst seit zwei Wochen.«
Mir ist selbst klar, dass ich mich erst an alles gewöhnen muss. Das nennt man Akklimatisation, ein normaler Prozess eines jeden Organismus, der sich an veränderte Umweltfaktoren anpassen muss. Ich behaupte einfach mal: Größer als in meinem Fall kann eine solche Veränderung gar nicht sein. Von dem Einbruch einer plötzlichen Eiszeit einmal abgesehen.
Ich habe den Verdacht, dass mich Berlin nicht leiden kann. Fest steht, dass die Stadt einen schlechten Einfluss auf mich hat: Ich bin hier noch ungeschickter als in meinem Heimatkaff. Kaum zu glauben, dass das möglich ist. Doch die Vorfälle sprechen für sich. Ein Beispiel? Als ich das Bild aufhängen wollte, das Daniel mir zum Abschied geschenkt hat – ein ironisches Einhorn in Acryl –, habe ich mir mit dem Hammer auf den Daumen gehauen. Ein Klassiker, ich weiß, und nicht mal besonders einfallsreich. Klar, dass ich Daniel ein Foto von dem Matschfinger geschickt habe – seine Antwort kam prompt: »Lotte, ich bin erleichtert. Du bist noch ganz die Alte.« Dann empfahl er mir Jod, Pflaster und Kühlpack. Ich bezweifle, dass all die Maßnahmen wirklich nötig gewesen sind. Aber Daniel hat eben einen ausgeprägten Hang zur Dramatik. Wahrscheinlich kriegt er auch deshalb jede Hauptrolle in der Theater-AG. Mittlerweile muss er dafür nicht mal mehr vorsprechen.
Trotzdem habe ich ihn sehr lieb. Ich habe sogar zu meinem besten Freund gehalten, als er diese schwierige James-Dean-Phase hatte und unablässig dessen Weisheiten wiedergab: »Träume, als ob du ewig leben würdest. Lebe, als ob du heute sterben würdest.« Oder: »Tu nie so ›als ob‹. Wenn du eine Zigarette rauchst, dann rauche sie. Tu nicht so, ›als ob‹ du eine Zigarette rauchst.« Das hat Daniel genau einmal versucht. Richtig zu rauchen. Dann ist er auf Schokoladenzigaretten umgestiegen. Jedenfalls habe ich ihm auch von der letzten doofen Sache erzählt, die mir hier passiert ist: Die Dielen haben meinem Fußballen einen fetten Splitter verpasst. Durch den Socken! Der Splitter sitzt immer noch in meiner Haut. Ich bin gespannt, ob sich das Ding entzündet. Daniel meinte, ich solle mir vorsichtshalber den Fuß amputieren lassen. Und Mama wollte mir mit einer Nadel zu Leibe rücken.
Mit angehaltenem Atem öffne ich die Kiosktür. Wahrscheinlich wäre ich trotz meines Looks wirklich nicht aufgefallen. Wenn ich darauf verzichtet hätte, das Regal mit den Konserven umzureißen.
»Oh nein, nein, bitte nicht«, murmle ich. Das interessiert die Dosen natürlich kein bisschen. Die fallen trotzdem. Bestimmt 30 Stück – alles Kichererbsen. Ich stehe da wie gelähmt und weiß nicht, was ich tun soll. Mich sofort auf den Boden knien und die Dosen aufsammeln? Oder erst mal nach hinten gehen und mich entschuldigen? Der Typ hinter dem Tresen tippt angestrengt auf seinem Handy herum – als wäre nichts passiert. Hat er den Krach nicht gehört? Ist das überhaupt möglich? Ich frage mich gerade, welche Rolle seine potenzielle Schwerhörigkeit für mein weiteres Vorgehen spielt, als der Typ zu fluchen beginnt.
»Scheiße!«, ruft er. »Verdammte Scheiße!«
Der Typ ist gigantisch. Groß und breit. Seine Haare sind so kurz, dass man es wohl schon Glatze nennt. Außerdem hat er nur ein Unterhemd an. Also obenrum. Die Wahrscheinlichkeit, dass er auch eine Hose trägt, ist zugegebenermaßen hoch. Nur kann ich die von hier aus eben nicht sehen. Am auffälligsten sind seine Arme: Von der Schulter bis zum Handgelenk schlängeln sich dunkle Muster über die Haut. Dadurch wirkt er fast schon wieder richtig angezogen.
»So eine verdammte Scheiße!«, ruft der Typ noch einmal.
»Tut – tut mir leid«, stammle ich. »Ich kauf die Dosen.« Ess ich für den Rest meines Lebens halt Hummus.
»Was?«, fragt der Typ. Wie in Zeitlupe legt er sein Handy zur Seite. Er scheint grundsätzlich eher von der langsamen Sorte zu sein.
»Ich kauf die Dosen«, sage ich.
»Was denn für Dosen?«
Ist das sein Ernst? Anstatt eine Antwort zu geben, wedele ich mit beiden Händen in der Luft herum. In etwa dort, wo eben noch das Regal stand. Da kapiert der Typ endlich. Er zieht die Augenbrauen zusammen, bis sie sich fast berühren. Und dann beginnt er zu lächeln.
»Du kaufst die Dosen nicht«, sagt er. »Du verkaufst die.«
»Hä?«, mache ich. Inzwischen bin ich mir sicher, dass der Typ einen an der Waffel hat. In dieser Stadt gerate ich ständig an so Leute, vor allem in der Bahn. Im Ernst, meine Trefferquote, mich neben den einzig Verrückten im Abteil zu setzen, ist enorm hoch. Jetzt schwingt der Typ sich über den Tresen. Und da sehe ich auch seine Hose. Eine helle Jeans, eindeutig zu eng. An den Füßen trägt er rosa Flipflops. Mit großen Schritten läuft der Typ zu mir.
»Hast du Erfahrungen im Einzelhandel?«, will er wissen.
»Ähm, ja. Als Kundin.«
»Gut«, sagt der Typ. »Ist auch nicht schwer. Gibt nur drei Regeln.«
Ich will protestieren, aber der Typ hebt die Hand und ich halte die Klappe.
»Erste Regel«, sagt er. »Das Rückgeld wird sofort nachgezählt. Spätere Beschwerden gehen dir am Arsch vorbei. Klar?«
Ich nicke. Denn was soll ich sonst tun? Flucht ist jedenfalls keine Option. Zwar ist unsere Wohnung direkt gegenüber, aber da komme ich ja nicht rein!
»Zweite Regel: Leute in deinem Alter immer im Auge behalten. Ihr klaut wie blöd.«
Ich überlege, ob ich beleidigt sein soll. In meinem ganzen Leben habe ich noch nichts geklaut. Nicht mal ungefragt geborgt. Aber wahrscheinlich würde der Typ mir so oder so nicht glauben. Er fasst mich an den Schultern und schiebt mich hinter den Tresen. Ich entdecke die strategisch platzierten Spiegel.
»Damit hast du alles im Blick«, erklärt der Typ. »Und jetzt kommt schon die letzte Regel: Der Laden wird nicht dichtgemacht, egal, was passiert. Es ist Freitagabend! Klar?!«
»Klar«, sage ich. So viel Entschlossenheit ist ansteckend. Der Typ holt unter dem Tresen einen dunkelblauen Fahrradhelm hervor. Er setzt ihn auf, dreht mir den Rücken zu und geht etwas in die Knie.
Was jetzt? Soll ich ihm auf die Schultern klettern? Der Typ zeigt auf seinen Nacken.
»Das Licht« murmelt der Typ. Da sehe ich es. Hinten am Helm ist ein herzförmiges Blinklicht befestigt.
Als ich mit dem Zeigefinger einmal darauf tippe, leuchtet es.
»Funktioniert«, melde ich. Ohne ein weiteres Wort richtet der Typ sich auf und geht zur Tür. Er steht schon fast auf der Straße, da dreht er sich noch mal zu mir um.
»Ich hab eine Regel vergessen«, brummt er. »Finger weg vom Radio!« Und dann lässt er mich wirklich allein.
Keine Frage, den Abend hatte ich mir anders vorgestellt. Aber immer noch besser, hier hinter dem Tresen zu stehen als drüben vor der Tür zu sitzen. Andererseits müsste ich mir da nicht diese Musik reinziehen, die aus dem Radio neben mir dudelt. Die Musik ist wirklich ... interessant. Man könnte auch sagen: gewöhnungsbedürftig. Oder schrecklich. Den Text verstehe ich nicht; ich glaube, das ist Türkisch. Aber es ist klar, dass die Sängerin leidet. Und zwar sehr. Nur meinen Ohren geht es in dem Moment wahrscheinlich noch schlechter. Ich überlege, ob ich das Gerät nicht doch einfach ausschalten soll. Aber es ist komplett verstaubt. Egal, auf welchen Knopf ich drücke, ein Abdruck wird bleiben. Der Typ braucht nur einen Blick auf sein Radio zu werfen und schon weiß er, dass ich doch daran herumgefummelt habe. Die Sache ist die: Mit jemandem, der mir mit einem einzigen Fingerschnips alle 24 Rippen brechen kann, lege ich mich lieber nicht an.
Ohrenstöpsel wären jetzt ideal. Ob es die hier gibt?
Ich lasse meinen Blick durch den Laden schweifen und entdecke die Uhren. Fünf mächtige Bahnhofsuhren, die nebeneinander an der Wand hängen. Berlin, Moskau, Tokio, New York steht unter den ersten. Mond unter der letzten. Noch merkwürdiger als diese letzte Beschriftung ist das leere Ziffernblatt. Außerdem sind die zwei Zeiger der Mond-Uhr genau gleich lang. Welcher davon ist für die Stunden zuständig? Welcher für die Minuten? Oder sind auf dem Mond möglicherweise ganz andere Einheiten gefragt? Und wer legt eigentlich fest, welche Uhrzeit irgendwo ist? Das interessiert mich wirklich. Deshalb beschließe ich, ein bisschen zu dem Thema zu recherchieren. Sobald ich wieder ein Gerät mit Internet zwischen den Fingern habe.
Ich inspiziere den Laden genauer. Anders als erwartet entdecke ich keine Drogen, die vertickt werden wollen. Auch keine Robbenbabys. Aber sonst gibt es alles. Vom Milchreis einmal abgesehen. Neben dem Vollkornbrot lagern Tampons, neben den Chips Bleistifte in fünf verschiedenen Härtegraden und bei den Tütensuppen stapelt sich ultra-softes Toilettenpapier. Ich hoffe inständig, dass mich niemand fragt, wo irgendetwas Bestimmtes zu finden ist. Erstens wüsste ich bei dieser Ordnung sowieso keine Antwort. Und zweitens kann ich die Leute, mit denen ich seit meinem Umzug gesprochen habe, an einer Hand abzählen. (Meine Eltern eingerechnet.) Wenn es nach mir geht, kann das ruhig so bleiben. Irgendwie befürchte ich, dass hier alle viel cooler sind. Lässiger, erfahrener. Anders formuliert: Wenn man nach Berlin zieht, sollte man vorher mindestens in London gelebt haben. Noch besser wäre San Francisco oder New York. Aber ich komme aus einem Kaff in Süddeutschland! Und in den USA war ich noch nicht mal im Urlaub.
Die nächste halbe Stunde verbringe ich damit,
aus den Kichererbsen-Dosen eine Art Fernsehturm zu bauen. Dabei stelle ich fest, dass die Dosen nächsten Monat ablaufen. Die Dinger müssen also schon eine ganze Weile darauf warten, gekauft zu werden ...
Ich merke, wie ich sauer werde. Weil ich eine Parallele erkenne zwischen den bescheuerten Dosen und mir. Wer weiß, wie lange ich hier noch ausharren muss? Da haut dieser Kiosk-Typ einfach ab, ohne einen Grund zu nennen, und hält es auch noch für selbstverständlich, dass ich mich in seiner Abwesenheit hinter den Tresen stelle. Und mir seine Scheißmusik reinziehe! Woher weiß er eigentlich, dass ich nichts Besseres zu tun habe?
Ich beschließe, dass mir Verpflegung zusteht. Im Kühlregal entdecke ich haufenweise pinke Würstchen, Scheibenkäse, Radiergummis (!) und einen gesalzenen Joghurtdrink, der sich Ayran nennt. Alles nichts, was mich jetzt glücklich macht. In meiner Verzweiflung öffne ich eine Tüte Erdnussflips. Futternd baue ich an meinem Dosen-Wahrzeichen weiter und überlege mir Dinge, die ich dem Typen – wenn er jemals zurückkommt – nur in meiner Vorstellung an den Kopf werfe. Als ich da so auf dem Boden sitze wie ein schmollendes Kleinkind mit Bauklötzen, betritt sie den Laden: meine erste Kundin.
Sie könnte direkt von einem Filmset kommen, so interessant sieht sie aus. Und schön. Sie hat blondes Haar, das ihr bis über die Schultern reicht; ihre vollen Lippen sind knallrot geschminkt. Die Klamotten sind allerdings alles andere als tussihaft. Sie trägt eine kurze Lederjacke, eine schwarze Jeans und abgeranzte Rocker-Stiefel. In der einen Hand hält die Frau einen mattschwarzen Motorradhelm. Ich habe mich noch nie in eine Frau oder in ein Mädchen verliebt. Aber das ist der Moment, in dem es beinahe passiert.
»Sie wünschen, bitte?«, fragt mein Mund. Im gleichen Moment ist meinem Gehirn ein Stück weiter oben klar: Das ist nichts, was man in einem Kiosk fragt. Zumindest nicht in dieser Stadt. Da hält man seine Klappe. Wenn jemand reinkommt, wird allerhöchstens genickt. Und das ist dann schon ein richtiger Gefühlsausbruch. Am besten macht man unbeeindruckt weiter mit dem, was man halt gerade tut, zum Beispiel aufs Handy starren oder bescheuerte Türme bauen. Die Frau guckt mich irritiert an. Auf ihrer Stirn, zwischen den sanft geschwungenen Augenbrauen, erscheint eine Falte. Selbst die ist gelungen. Nicht zu tief und ganz gerade, wie mit einem Lineal gezogen. Die Frau lässt ihren Blick kreuz und quer durch den Laden gleiten.
»Tampons sind beim Vollkornbrot«, platzt es aus mir heraus. Im gleichen Moment würde ich gern in dem klebrigen Boden versinken. Ich kann es nicht fassen! Mein Hirn hat mal wieder eine seiner wilden Verknüpfungen hergestellt. Ich versuche eine Rekonstruktion: Ohne Zweifel sucht die Frau etwas. Allerdings fragt sie nicht direkt. Das spricht dafür, dass ihr das Gesuchte unangenehm oder in irgendeiner Weise peinlich ist. Alle mir bekannten Mädchen finden vor allem eines peinlich: ihre Regel. Sie schämen sich irrsinnigerweise für alles, was damit zusammenhängt. Zum Beispiel für Hygieneartikel. Daraus hat mein übereifriges Hirn nun kombiniert, dass meine erste Kundin nur eines suchen kann: Tampons. Eigentlich ganz logisch, oder?
»Was hast du gesagt?«, fragt die Frau.
»Dass die Tampons beim Brot stehen?«
»Ja, ist das nicht unglaublich!«, ruft die Frau. »Beim Vollkornbrot! Keine Ahnung, wie das bei dir ist. Aber wenn ich menstruiere, brauche ich Schokolade. Tampons müssen zum Süßkram! Das habe ich Yunus schon oft gesagt. Aber die Ordnung hier ist eben speziell.«
»Genau wie die Musik«, murmle ich, einigermaßen eingeschüchtert. Schließlich habe ich soeben die coolste Frau der Welt kennengelernt.
»Ja«, sagt sie und lacht. Jetzt kann ich die Lücke zwischen ihren Schneidezähnen sehen. Und es ist genau dieser kleine Makel, der sie so richtig interessant macht. »Das mit dem Radio ist schlimm.« Sie nimmt sich ein paar Flips aus meiner Tüte. »Ich bin übrigens Miri.«
»Lotte«, sage ich.
Die Frau namens Miri nickt. Dabei sieht sie mich so aufmerksam an, dass klar ist: Sie merkt sich meinen Namen auf Anhieb. Das ist etwas Besonderes. Die meisten Menschen brauchen zwei, drei Anläufe für so was.
»Und wo steckt Yunus?«, fragt sie mit vollem Mund.
Ich zucke mit den Schultern. Ich habe absolut keine Ahnung.
Außerdem kann ich nur vermuten, dass sie den tätowierten Riesen meint, der mich hier sitzen gelassen hat. Er hat mir ja nicht einmal seinen Namen verraten.
»Bestimmt hat er mir geschrieben«, sagt Miri. Seufzend zieht sie ein uraltes Handy aus der Jackentasche und schließt es an ein Ladekabel hinter dem Tresen an. »Der Akku macht ständig schlapp ... Wie lange ist er denn schon weg?«
Ich schaue zur Berlin-Uhr.
»Vielleicht eine Stunde?«, schätze ich. »Auf jeden Fall hatte er es ziemlich eilig.«
Miri kratzt sich an der Nase.
»Ungewöhnlich«, sagt sie. »Für einen Freitagabend.« Sie geht zum Kühlregal, nimmt sich einen Joghurtdrink heraus und trinkt ihn leer, ohne einmal abzusetzen. Ob ich jetzt Geld von ihr verlangen soll? Ich weiß ja nicht mal, wie viel. Außerdem ist Miri echt nett. Und Yunus wirkt nicht gerade so, als hätte er seine gesalzenen Joghurtdrinks abgezählt. Sicher ist das natürlich nicht. Vielleicht hat er ein fotografisches Gedächtnis. Vielleicht nimmt er auch alles mit einer Überwachungskamera auf.
»Keine Sorge«, sagt Miri, die offensichtlich nicht nur schön und cool und nett ist, sondern auch Gedanken lesen kann. »Mir stehen zwei Ayran pro Tag zu.« Sie grinst. »Ursprünglich war es nur einer. Aber als ich mit Yunus zusammengekommen bin, hab ich erfolgreich nachverhandelt.«
Wow. Dann sind die beiden also zusammen? Keine Ahnung, warum. Aber das überrascht mich. Miris Handy wacht auf, es gibt einen kleinen Piep von sich. Und dann noch einen und noch einen und noch einen.
»Was zur Hölle –«, beginnt Miri. Sie schnappt sich das Handy und drückt darauf herum. »Scheiße!«, ruft sie keine Sekunde später – in dem Moment klingt sie genau wie Yunus. »Verdammte Scheiße!« Als Miri mich ansieht, ist wieder diese Falte auf ihrer Stirn.
»Lotte, ich muss ins Krankenhaus«, sagt sie. »Kriegst du das hier allein hin?«
Ich zucke mit den Schultern.