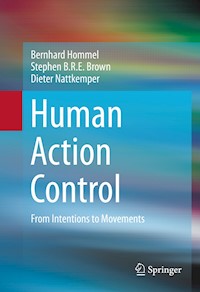16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Sprache: Deutsch
Dass insbesondere Minderheiten vor Diskriminierung zu schützen sind, gilt als Konsens in unserer Gesellschaft. Die sogenannte Identitätspolitik, die sich diesem Ziel verschrieben hat, stößt jedoch immer wieder auf Widerstand, auch aus dem progressiven Lager. Nicht wenigen gilt sie gar als ungeeignet, ihre selbstgesteckten Ziele zu erreichen. Warum ist das so? Anschaulich und verständlich erklärt der Psychologe Bernhard Hommel die aktuellen Diskussionen über soziale Gerechtigkeit, Diskriminierung, Rassismus, Gendern oder fluides Geschlecht. Hommel befürwortet in all diesen Fragen zwar die Ziele, hinterfragt aus psychologischer Sicht aber die Sinnhaftigkeit der Wege, die derzeit diskutiert und beschritten werden, um diese zu erreichen. Wie schaffen wir es, die Menschen auf dem Weg zu einer wirklich gerechteren Gesellschaft mitzunehmen und nicht unterwegs aufgrund zu starker Polarisierung zu verlieren?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ebook Edition
Bernhard Hommel
Gut gemeint ist nicht gerecht
Die leeren Versprechen der Identitätspolitik
Mit Zeichnungen von Anastasia Van Dolder
Mehr über unsere Autor:innen und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-86489-897-6
© Westend Verlag GmbH, Frankfurt / Main 2023
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Satz: Publikations Atelier, Dreieich
Inhalt
Titel
Einleitung
Meinungen
Der Ursprung unserer Meinungen
Meinung und Verhalten
Argumente
Identität
Skalierung und Auflösung
Freiheit oder Gerechtigkeit
Diskriminierung
Diskriminierung und Handlungsziel
Erfahrung und Vertrautheit
Gruppe und Bewertung
Strukturelle Diskriminierung
Betroffenheit und Urteilskraft
Repräsentativität
Sprache
Bedeutung als Abbild
Bedeutung als Vorstellung
Bedeutung durch Interaktion
Sprache und Sichtbarkeit
Wort und Tat
Klischee und Stereotyp
Klischee, Stereotyp und Wirklichkeit
Stereotyp und Verhalten
Stereotyp und Orientierung
Was nun?
Problemverständnis
Therapiemethoden
Belohnung statt Strafe
Selbstermächtigung statt Opferkultur
Gewöhnung statt Konfrontation
Nachwort
Literatur
Einleitung
Meinungen
Argumente
Identität
Diskriminierung
Betroffenheit und Urteilskraft
Repräsentativität
Sprache
Klischee und Stereotyp
Was nun?
Orientierungspunkte
Titel
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Ich bin in einer Zeit groß geworden, in der es noch relativ einfach war, sich politisch zu orientieren. Es gab nur drei Parteien, die sehr unterschiedliche Auffassungen darüber hatten, wie Menschen sind, was sie antreibt und welche persönlichen und politischen Verhältnisse sie anstreben. Es gab Ost und West, fast gleichbedeutend mit Gut und Böse – je nachdem, auf welcher Seite man stand. Auch gab es in meiner frühen Kindheit nur ein einziges Fernsehprogramm, und das war (im visuellen und im übertragenen Sinne) schwarz-weiß. Die politische Konfrontation auf der Straße fand zwischen Ewiggestrigen, übrig gebliebenen Nazis auf der einen und zukunftsgewandten progressiven Kräften auf der anderen Seite statt, so war jedenfalls mein Eindruck. Auch wenn ich gewissermaßen zwischen die generationsbezogenen Stühle geraten bin – für einen Achtundsechziger war ich etwas zu jung und für einen Glamrocker oder Punk etwas zu alt –, habe ich doch in den experimentierfreudigen, noch vom Hippiegeist durchdrungenen frühen Siebzigern im damals noch »roten Hessen« ein aufgeklärtes gesellschaftspolitisches Zuhause gefunden.
In den letzten Jahren kommt mir meine politische Orientierung jedoch zunehmend abhanden. Bewegungen und politische Nischen, die ich mit Blick auf ihre Zielsetzung und ihren Wertekanon vor nicht allzu langer Zeit als meine natürlichen Verbündeten eingeschätzt hätte, werfen mir und ähnlich Denkenden vor, den gesellschaftlichen Fortschritt aufzuhalten, frauenfeindlich und rassistisch zu sein. Selbst Eigenschaften, für die ich nichts kann, werden mir auf einmal als eine Art gesellschaftspolitischen Vergehens vorgeworfen: weiß zu sein, alt zu sein und sowohl biologisch als auch sozial männlich zu sein. Und ich dachte, unser gemeinsames Streben nach mehr sozialer Gerechtigkeit hatte zum Ziel, derart oberflächliche Kategorien zu überwinden. Völlig unabhängig von meiner tatsächlichen Biografie und meinem konkreten täglichen Tun wird mir und solchen wie mir auf einmal vorgeworfen, gegen Minderheiten zu sein und sie aktiv zu unterdrücken. Wie konnte es dazu kommen?
Dabei könnte es sich natürlich um einen der üblichen Generationenkonflikte handeln. Jede neue Generation muss in einem gewissen Sinne mit der vorigen brechen, um sich selbst zu definieren und herauszufinden, was ihr nun eigentlich wichtig ist. Das führt notwendigerweise dazu, dass älteren Menschen wie mir manchmal das Verständnis für die neu geschaffenen Normen und Werte fehlt, ohne dass man sich darüber größere Sorgen machen müsste. Aber mein Eindruck ist, dass es sich bei den jüngeren Entwicklungen nicht nur darum handelt. Auch weil sich enthusiastische Befürworter der gesellschaftspolitischen Bewegung, die ich meine, in beinahe allen Altersgruppen finden. Diese Bewegung hat einen Namen und ein Ziel: Identitätspolitik. Konkret zu definieren, um was es sich bei Identitätspolitik handelt, ist aus verschiedenen Gründen schwierig. Einmal handelt es sich bei Identitätspolitikern nicht um Mitglieder einer bestimmten Partei oder einer bestimmbaren Bewegung, und sowohl die Themen als auch die Allianzen innerhalb der mit Identitätspolitik beschäftigten Personen variieren ständig. Ganz allgemein gesagt geht es Identitätspolitikern um die Bedürfnisse einer bestimmten Gruppe von Menschen, wie etwa Frauen, Personen mit bestimmten Hautfarben oder geschlechtlichen Neigungen, mit bestimmten Geschlechtsdefinitionen und Ähnlichem. Und darum, die gesellschaftliche, politische und/oder die ökonomische Situation dieser Gruppe zu verbessern. Manchmal sind Identitätspolitiker Teil dieser Gruppe, manchmal aber auch Außenstehende. Manchmal ist die betreffende Gruppe erkennbar organisiert, manchmal reden aber auch nur Betroffene oder Außenstehende im Namen einer bestimmten Gruppe, ohne ein erkennbares Mandat dafür bekommen zu haben. Es gibt zwar Überschneidungen mit bekannteren, etablierteren Bewegungen, wie etwa dem Feminismus oder der Black-Lives-Matter-Bewegung, aber diese Überschneidungen sind nicht immer groß und nicht immer erheblich.
Dass Identitätspolitik von beobachteten Unterschieden ausgeht, versteht sich von selbst. Betroffene haben oft erst langsam und schmerzlich erfahren, dass andere sie aufgrund von Merkmalen ablehnen und beleidigen, die ihnen selbst zunächst einmal gar nicht bedeutsam und wesentlich vorgekommen sind. Schließlich unterscheidet sich jeder Mensch von allen anderen Menschen durch eine ganze Reihe von Merkmalen, und die meisten davon werden im weiteren Leben keine besondere Rolle spielen. Unterschiede an sich sind also zunächst einmal nicht notwendigerweise bemerkenswert. Wenn aber Kränkungen systematisch mit einem bestimmten eigenen Merkmal gekoppelt sind, wie etwa der Hautfarbe, dem Geschlecht oder der sexuellen Orientierung, dann wird diese Tatsache ganz automatisch die eigene Aufmerksamkeit auf dieses Merkmal lenken. Aber auch aus der Außenperspektive werden manche Merkmale die Aufmerksamkeit stärker auf sich ziehen als andere. Mädchen und Jungs, Männer und Frauen verhalten sich oft systematisch unterschiedlich, und diese Unterschiede sind in manchen Kulturen noch auffälliger als etwa in Mitteleuropa. Damit muss man kein Werturteil verbinden, und es muss jemanden nicht unbedingt in allen Fällen umtreiben. Aber es ist sicher wahr: Manche Unterschiede zwischen Menschen gehen mit Unterschieden in der Art und Weise einher, in der sie sich selbst verhalten und in denen andere ihnen begegnen. Diese Unterschiede sind wichtiger als andere, um das Verhalten der betroffenen Personen vorherzusagen – was, wie ich später erläutern werde, wesentlich für die Ausbildung von gegenseitigem Vertrauen in einer Gesellschaft ist. Auffällig an den jüngeren identitätspolitischen Bewegungen ist also nicht, dass sie von bestimmten Unterschieden zwischen Menschen ausgehen und dass sie motiviert sind, die unterschiedliche gesellschaftliche Behandlung von Trägern bestimmter Merkmale auszumerzen. Vielmehr auffällig ist die Forderung dieser Bewegungen, die betreffenden Unterschiede zwischen Bevölkerungsgruppen immer wieder zu betonen und diese Betonung auch von denjenigen zu fordern, die sich eigentlich nicht darum scheren. Die Betonung dieser Unterschiede sei wichtig, so liest man überall, um die gesellschaftliche Bedeutung dieser Unterschiede zu überwinden. Der offensichtliche logische Widerspruch in dieser Behauptung hat mich interessiert, persönlich und auch wissenschaftlich. Was steckt dahinter?
Viele lesenswerte Artikel und Bücher über diese Frage sind bereits erschienen. Manche erklären die Bedeutung der Identitätspolitik, andere haben sie kritisiert. Wieder andere haben versucht, die historischen Hintergründe der Formierung von Identitätspolitik nachzuzeichnen. Und wieder andere haben sich die Frage gestellt, ob diese Politik eigentlich gerechtfertigt ist und vernünftig mit allen Beteiligten umgeht. Aus all diesen Artikeln und Büchern habe ich viel gelernt. Mein eigenes historisches, politisches und vor allem soziologisches Wissen ist aber nicht ausreichend, um dieser Literatur etwas Originelles über die Fragen hinzuzufügen, wo Identitätspolitik herkommt, wo sie hinführt und ob sie gesellschaftlich legitimiert ist. Meine eigene Zuständigkeit liegt hingegen in der wissenschaftlichen Psychologie und mein Wissen bezieht sich auf die psychologischen und neuronalen Mechanismen, mithilfe derer Menschen wahrnehmen, denken, entscheiden und handeln. Es ist dieses Wissen, was mich an vielen Diskussionen über das Für und Wider der Identitätspolitik bzw. ihrer Forderungen hat verzweifeln lassen. Lassen Sie mich erklären, warum.
Aus psychologischer Sicht stellen die von der Identitätspolitik geforderten Maßnahmen und Interventionen, wie etwa das Gendern oder das Umgehen mit Homosexualität oder unterschiedlichen Hautfarben, so etwas wie gesellschaftliche Therapien dar.* Bei Individuen oder kleineren Gruppen haben Therapien das Ziel, einen von den Betroffenen oder anderen als problematisch erachteten Zustand in einen anderen zu überführen, der weniger problematisch scheint. Wenn Sie also zum Beispiel so traurig sind, dass Sie die Kraft für ein produktives Leben nicht mehr regelmäßig aufbringen können, dann wäre eine Therapie nützlich, die Ihnen diese Trauer teilweise nimmt und Sie dadurch in die Lage versetzt, die nötige Kraft in Zukunft aufzubringen. Oder wenn Sie mehr essen, trinken oder rauchen, als Sie es für wünschenswert halten, dann kann eine Therapie Ihnen helfen, dies in Zukunft weniger oder gar nicht mehr zu tun. Um beurteilen zu können, ob eine Therapie nützlich ist, sind dreierlei Dinge wichtig zu wissen: ob das eigentliche Problem gut und vernünftig beschrieben worden ist, ob die Therapie tatsächlich geeignet ist, dieses Problem zu verringern, und ob der dadurch erzielte Zustand tatsächlich besser ist als der vorherige.
Das mag trivial klingen, ist aber in der Wirklichkeit nicht immer einfach zu bestimmen. So haben viele Gesellschaften bis vor Kurzem noch gedacht, bei Homosexualität handele es sich um eine Persönlichkeitsstörung, die dringend therapiert werden müsste, und in einigen Gesellschaften existiert dieser Glaube immer noch. Hier ist das Problem nicht gut definiert, besteht es doch offensichtlich weniger in der sexuellen Orientierung der betroffenen Person als in der gesellschaftlichen Akzeptanz dieser Orientierung: »Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt«, lautet der Titel eines Filmes von Rosa von Praunheim, der sich mit genau dieser Frage beschäftigt. In anderen Fällen ist das Problem einigermaßen gut definiert, aber es fehlt an geeigneten Maßnahmen, um es zu lösen. Das gilt sowohl für die klinische Praxis als auch für die gesellschaftliche Realität. Wie wir sehen werden, mangelt es selten an Vorschlägen. Aber nur sehr wenige Vorschläge beruhen auf einer systematischen Argumentation und auf wissenschaftlicher Evidenz, also auf dem Wissen über wissenschaftliche Fakten – denken wir an die Rituale der Teufelsaustreibung oder die Folter der Inquisition. Nicht anders verhält es sich mit der identitätspolitischen Literatur, die voll von willkürlichen Annahmen, Setzungen und therapeutischen Ideen ist, deren Wirksamkeit den betreffenden Autoren so offensichtlich scheint, dass ihnen deren wissenschaftlicher Nachweis überflüssig vorkommt. Aber auch der erreichbare Zielzustand ist von Bedeutung, und dies natürlich vor allem dann, wenn die Wirksamkeit des therapeutischen Vorschlags noch nicht hinreichend belegt werden konnte. Oft wissen wir nicht wirklich, wohin diese Vorschläge uns führen. Aber auch wenn wir es wissen, wie etwa im Falle von Quoten für Frauen oder Minderheiten, ist nicht immer klar, ob dieser Zustand wirklich zur Lösung des konstatierten Problems beiträgt.
Diese drei Fragen nach der Definition der durch identitätspolitische Beiträge konstatierten Probleme, nach der Wirksamkeit der vorgeschlagenen gesellschaftlichen Therapie, um diese Probleme zu lösen, und nach dem wahrscheinlich erreichbaren Zielzustand, haben mich in diesem Buch umgetrieben. Wenn beispielsweise das sprachliche »Gendern« tatsächlich eine wirksame gesellschaftliche Therapie sein sollte, was wäre dann genau das Problem und was das angestrebte Ziel? Diesen Fragen bin ich zunächst einmal aus ganz persönlichem Interesse nachgegangen. Ich habe zu Beginn die konstatierten Probleme, therapeutischen Vorschläge und angestrebten Ziele vieler gesellschaftlicher Diskussionen nicht wirklich verstanden und ich vermute, dass es vielen anderen auch so geht. Dieses fehlende Verständnis trägt meines Erachtens erheblich zur abnehmenden wirklichen Kommunikation innerhalb unserer Gesellschaft und zu deren zunehmenden Zersplitterung bei. Beides hat mit einem Wandel der Akteure und den Triebfedern politischen Handelns zu tun. Während gesellschaftliches Denken und politisches Handeln für viele Jahrzehnte auf breit geteilten und langfristigen Ideologien, Visionen und (zum Beispiel religiösen) Überzeugungen beruhte, wird inzwischen die Agenda vor allem von kurzfristigen Frustrationen, kaum hinterfragten thematischen Setzungen und losen identitätspolitischen Gruppen mit einer starken Konzentration auf die eigenen Bedürfnisse bestimmt. Politik besteht zunehmend aus der bloßen Reaktion auf diese partikularen Interessen gesellschaftlicher Gruppierungen. Einerseits wird diese erhöhte Berücksichtigung »des Bürgerwillens« als Gewinn für die Demokratisierung unserer Gesellschaft gefeiert. Andererseits passen viele Überlegungen politisch Handelnder bei näherem Hinsehen einfach nicht gut zusammen, sodass unaufhörlich emotional aufwühlende Reibungen entstehen.
Viele identitätspolitische Vorschläge folgen guten, breit geteilten, hehren Zielen, wie der Stärkung der individuellen Freiheiten, der Beseitigung jedweder Diskriminierung und der Vergrößerung gesellschaftlicher Toleranz. Tatsächlich kann ich kaum irgendwelche Ziele erkennen, die ich persönlich nicht teilen würde. Aber wie schon Kurt Tucholsky anmerkte: Das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint. Und so führen tatsächlich viele gut gemeinte Vorstöße zu größerer, nicht zu geringerer gesellschaftlicher Unruhe, und dies zunehmend selbst bei Sympathisanten der jeweiligen gesellschaftlichen Ziele – wie mir selbst. Dass etwa ausgeprägt konservative Bürger der Einführung eines dritten Geschlechts oder einer Frauenquote skeptisch gegenüberstehen, ist weder verwunderlich noch notwendigerweise ein gesellschaftliches Problem. Denn die kontroverse Auseinandersetzung über ein Thema birgt ja immer auch das Potenzial, die Vielfalt der Aspekte eines Problems besser kennen zu lernen. Dass sich aber Angehörige derselben politischen Lager zunehmend gegenseitig anfeinden und erbittert mit Shitstorms überziehen, wie zum Beispiel bei der Diskussion des jüngsten Buches von Sahra Wagenknecht (in dem sie die zunehmend identitätspolitische Ausrichtung der Linken kritisiert), sieht zumindest von außen nicht wie eine konstruktive gesellschaftliche Entwicklung aus.
Warum ist das so? Die These, die ich in diesem Buch entwickeln möchte, geht davon aus, dass viele der wesentlichen Vorstöße von Aktivistengruppen nicht zu Ende gedacht sind. In einigen Fällen bleibt die Definition des zu lösenden Problems bei näherer Analyse unklar, sodass wir uns fragen müssen, warum so viel Aufhebens darum gemacht wird. In anderen Fällen gibt es tatsächlich gut definierbare Probleme, aber die vorgeschlagene gesellschaftliche Therapie scheint bei näherem Hinsehen vollkommen ungeeignet, um diese Probleme zu lösen. Und in wieder anderen Fällen werden wir sehen, dass die wahrscheinlichen Zielzustände weniger vorteilhaft sind, als von identitätspolitischen Vorschlägen vermutet wird. Diese Zusammenhänge herauszuarbeiten, ist mein Ziel in diesem Buch. Ich werde mich also mit der Bewertung von Fragestellungen und Zielsetzungen zurückhalten und mich eher mit der gewissermaßen technischen Beziehung zwischen Zielen, Methoden der Zielerreichung und der Zielerreichung selbst befassen. Denn das entspricht der Rolle eines wissenschaftlichen Psychologen, die ich in diesem Buch einnehmen möchte.
Natürlich habe ich auch persönliche Meinungen zu den hier behandelten gesellschaftlichen Problemen, aber die sollen in diesem Buch keine Rolle spielen. Zum einen, weil es für die Beurteilung von Problemdefinitionen und von den Qualitäten von Methoden der Problemlösung völlig unerheblich ist, wie man zu dem definierten Problem steht. Selbst wenn ich es etwa persönlich unproblematisch fände, Angst vor Spinnen zu haben, so ist es doch ein legitimes Ziel anderer, sich dieser Angst zu entledigen. Die Aufgabe wissenschaftlicher Psychologen wäre es dann, die verfügbaren therapeutischen Möglichkeiten zur Überwindung dieser Angst hinsichtlich ihrer Effizienz und dem Maße ihrer Zielerreichung kritisch zu bewerten und entsprechende Empfehlungen auszusprechen. Dies gilt für Therapien zur Lösung persönlicher Probleme ganz genauso wie für Therapien zur Lösung gesellschaftlicher Probleme, um die es in diesem Buch gehen soll. Zum anderen weil, wie ich im nächsten Kapitel zeigen werde, Meinungen bei näherem Hinsehen keinen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Kommunikation liefern. Die meisten unserer Meinungen haben wir ohne jede Ahnung darüber, woher sie kommen und warum wir sie haben. Warum sollten wir sie also wichtig finden?
Wir werden sehen, dass sich bei streng wissenschaftlicher Analyse viele Problembeschreibungen als unlogisch und inkonsequent herausstellen. Ein Grund dafür besteht darin, dass identitätspolitische Vorstöße zur Frage der gesellschaftlichen Gerechtigkeit oft durch eine von zwei Erfahrungshintergründen geprägt und motiviert sind. Die eine ist die persönliche Erfahrung, sei es als Frau, als Mitglied einer diskriminierten Gruppe oder als Teil einer benachteiligten Bevölkerungsschicht. Persönliche Erfahrungen Betroffener werden wegen ihrer Authentizität geschätzt, was nachvollziehbar ist, und als Basis für gesellschaftspolitische Verallgemeinerungen benutzt, wofür es keinerlei wissenschaftlich plausible Gründe gibt. Warum das so ist, werde ich in dem Kapitel über Betroffenheit und Urteilskraft näher behandeln. Der andere Erfahrungshintergrund ergibt sich aus der Auseinandersetzung mit gesellschaftswissenschaftlichen Analysen. Tatsächlich stammen viele in der Diskussion vorherrschende Problemanalysen aus wissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit allgemeinen gesellschaftlichen Sachverhalten beschäftigen, wie der Soziologie oder der Politologie. Viele dieser Analysen sind rein theoretisch und entziehen sich jeder direkten experimentellen Prüfung. Ihre Richtigkeit lässt sich daher nicht direkt belegen und kritisch überprüfen, sondern sie haben eher zum Ziel, historische und aktuelle Entwicklungen in einen Sinnzusammenhang zu bringen, unsere Geschichte und unsere Erfahrungen also verständlich zu machen.
Die fehlende Möglichkeit, einzelne Aspekte derartiger Theorien kritisch zu testen, hat in den ausschließlich theoretischen wissenschaftlichen Disziplinen zu Schulenbildungen geführt. Wissenschaftler neigen also zu der einen oder anderen Theorie, ohne dass man an entscheidende kritische Prüfungen denken könnte. Dies unterscheidet sich grundlegend von Disziplinen der Naturwissenschaften und naturwissenschaftlich geprägten Sozialwissenschaften, zu der ich die moderne Psychologie rechne. Hier beziehen Theorien ihre Plausibilität aus dem Maße, in dem sich ihre Annahmen in experimentellen Prüfungen anderer belegen lassen. Wissenschaftliche Theorien dieser Art müssen also immer grundsätzlich widerlegbar sein, was für viele Theorien identitätspolitischer Initiativen nicht zutrifft. Für die oft zu findende Unterstellung, dass wir alle durch eine Art koloniale Erbsünde rassistisch geprägt seien und Angehörige anderer Rassen unbewusst diskriminieren, gibt es keinerlei Anhaltspunkte, aber auch keine Möglichkeit zur kritischen Überprüfung diese Annahme (wie ich in dem Kapitel über Diskriminierung näher erläutern werde). Mit anderen Worten, diese Annahme ist so konstruiert, dass man sie durch keine Beobachtung dieser Welt jemals widerlegen könnte, was sie wissenschaftlich gesehen vollkommen wertlos macht. Man kann sie nur glauben, was aber tatsächlich viele tun.
Ein weiteres Problem der Tatsache, dass viele identitätspolitische Theorien aus gesellschaftspolitischen Überlegungen hervorgegangen sind, besteht in der Korngröße der Analyse. Gesellschaftspolitische Betrachtungen beziehen sich auf sehr große Gruppen von Personen, wie Gesellschaften, Länder, Schichten oder Bevölkerungsgruppen. Bei diesen Betrachtungen spielt die einzelne Person keine bestimmte Rolle, sie ist lediglich über ihre Zugehörigkeit zu der analysierten Gruppe definiert. Konkrete politische Maßnahmen treffen aber immer konkrete Einzelpersonen, die offensichtlich durch die Zuordnung zu einer Gruppe nur unvollständig und unzureichend beschrieben werden. In wissenschaftlichen Analysen sind die dadurch entstehenden Ebenenprobleme nicht nur bekannt, sondern auch vielfältig. So entsteht zum Beispiel eine Revolution immer durch die Zusammenwirkung verschiedener Einzelmenschen, aber es ist schier unmöglich, durch die Analyse aller beteiligten Einzelmenschen zu erklären, wie es zu einer Revolution kommen konnte. Es ist also kaum möglich, die individuelle Analyse direkt auf die gesellschaftliche Analyse zu beziehen, und umgekehrt, was auch der Grund dafür ist, dass sich verschiedene wissenschaftliche Disziplinen nicht aufeinander reduzieren lassen. Auch andere Ebenen sind übrigens davon betroffen: So besteht Ihr Bewusstsein letztlich aus der Kommunikation zwischen neuronalen Verbänden Ihres Gehirns, aber bislang ist es nicht gelungen, eine eindeutige Beziehung zwischen analysierten Neuronen und bestimmten Bewusstseinszuständen herzustellen.
Warum ist das für unsere Fragestellung von Bedeutung? Weil identitätspolitische Vorstöße in der Regel Maßnahmen fordern, die durch soziologische bzw. politische Betrachtungen entstanden sind, sich aber auf konkrete Einzelpersonen auswirken. Wie wenig Identitätspolitiker diese Komplikation berücksichtigen, wird dadurch deutlich, dass die vorgeschlagenen Therapien zur Bewältigung gesellschaftspolitischer Probleme oft auf keinerlei Kenntnis psychologischer Mechanismen beruhen. So kann man beispielsweise im Zusammenhang mit spektakulären Gewalttaten oft hören und lesen, dass »auf Worte Taten folgen«, dass also beispielsweise gewaltverherrlichende Kommunikation zur Ausführung von Gewalttaten motiviere. Gleichzeitig existieren aber weder theoretische Vorstellungen noch gesicherte empirische Hinweise darauf, welcher konkrete psychologische Mechanismus derartige Folgen zuwege bringen könnte. Es besteht also immer die Gefahr, dass derartige Schlussfolgerungen auf der Verwechslung von Korrelation (dem gemeinsamen Auftreten von Merkmalen) und Kausalität (des direkten Einflusses eines Merkmals auf ein anderes) beruhen. Denn nur weil spätere Täter eine Neigung zu einer aggressiven Wortwahl an den Tag gelegt haben, müssen es nicht diese Worte gewesen sein, die ihre Taten hervorgerufen haben. Diesen wichtigen Punkt werde ich später wieder aufgreifen, schicke aber voraus, dass die Verwechslung von Korrelation und Kausalität in identitätspolitischen Schriften gang und gäbe ist. Eine kausale Beziehung zwischen zwei Merkmalen lässt sich nur dann nachvollziehen und wirklich verstehen, wenn wir eine Idee darüber haben, wie denn das eine das andere ganz konkret beeinflussen könnte. Die Lösung soziologisch definierter Probleme durch die Erreichung soziologischer Ziele ist also ohne die Kenntnis psychologischer Mechanismen unmöglich. Denn nur wenn die vorgeschlagenen gesellschaftspolitischen Therapien bei konkreten Menschen auch konkret wirken, können wir gesellschaftspolitische Ziele erreichen. Um beurteilen zu können, ob und wie diese Wirkungen erzielt werden können, müssen wir aber verstehen, wie Menschen konkret funktionieren. Würde man diesem tatsächlichen Funktionieren besser Rechnung tragen – so wird mein Argument sein –, könnte man nicht nur öffentliche Diskurse wesentlich fruchtbarer und kreativer führen, sondern auch gesellschaftspolitisch motivierte Therapien deutlich zielführender gestalten.
Bei meiner Analyse werde ich versuchen, zwei Betrachtungsperspektiven miteinander zu verbinden. Die eine bezieht sich unmittelbar auf die psychologischen Mechanismen, die zur Definition des Problems, zur Beurteilung der Therapiemethode und für unsere Einschätzung möglicher Zielzustände von Bedeutung sind. Die andere ist weniger psychologisch als vielmehr allgemein wissenschaftlich. Denn um überhaupt beurteilen zu können, welche psychologischen Mechanismen in einem bestimmten Zusammenhang möglicherweise eine Rolle spielen, müssen Problem, Therapiemethode und Zielzustand nachvollziehbar und logisch widerspruchsfrei erfasst und verstanden werden. Wie wir sehen werden, ist dies aber nicht immer möglich. Während bei der Einzelbetrachtung viele identitätspolitische Forderungen berechtigt und nachvollziehbar erscheinen, beißen sie sich mit tatsächlichen oder naheliegenden Forderungen anderer identitätspolitischer Forderungen. In manchen Fällen mag das mit objektivierbaren Interessenkollisionen zusammenhängen: Höhere Löhne bedeuten notwendigerweise höhere Ausgaben aufseiten der Arbeitgeber, mehr Partizipationsmöglichkeiten für Frauen können mit Einschränkungen aufseiten der Männer einhergehen und so weiter. Derartige Konflikte zu lösen ist die Aufgabe der Politik, und darin will ich mich an dieser Stelle nicht versuchen.
In anderen Fällen entstehen Widersprüche und Konflikte aber auch dadurch, dass an sich vernünftige und breit geteilte Ziele nur wenig mit dem beschriebenen Problem zu tun haben oder durch unüberlegte Maßnahmen erreicht werden sollen. Das geschieht oft dadurch, dass die Übersetzung von Zielen in Maßnahmen einem wichtigen Kriterium zur Vermeidung von Konflikten nicht genügt: dem, was man in der Wissenschaft je nach Perspektive Konsistenz, Widerspruchsfreiheit oder Generalisierbarkeit nennt. Tatsächlich basiert diese Übersetzung oft auf nicht weiter belegten Annahmen und Setzungen, die bei weiterem Nachdenken wenig Sinn ergeben, weswegen die durch die Übersetzung entstehenden Maßnahmen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch dann nicht zielführend sein werden, wenn sie an sich funktionieren. Um dies zu erkennen, braucht es keinen wissenschaftlichen Sachverstand, denn letztlich hat der Philosoph Immanuel Kant uns mithilfe seines kategorischen Imperativs bereits den Weg gewiesen, wie man inkonsistente, nicht generalisierbare Überlegungen auch im Alltag identifizieren kann. Eine Handlung ist dann moralisch, so schreibt Kant, wenn sie einer Maxime folgt, die für alle, jederzeit und ohne Ausnahme anwendbar ist. Nun geht es mir in diesem Buch nicht um Moral, sondern um die psychologisch sinnvolle Lösung gesellschaftlicher Probleme, aber Kants Überlegung lässt sich natürlich auch dafür fruchtbar machen: Lassen Sie uns also politische Forderungen nur dann akzeptabel finden, wenn sie einer Maxime folgen, die für uns alle, jederzeit und ohne Ausnahme (d. h. ohne Ansehen der Person, wie es in der Bibel heißt) anwendbar ist, so wie wir dies für die Rechtsprechung in demokratischen Gesellschaften selbstverständlich finden. Und lassen Sie uns alle Forderungen kritisch hinterfragen, auf die das nicht zutrifft.
Was ich also im Folgenden tun werde, besteht darin, einige hochaktuelle identitätspolitische Themen hinsichtlich meiner zwei Perspektiven zu durchleuchten: Geht es hier um Probleme, Therapien und Ziele, die einer konsistenten, allgemeingültigen Maxime folgen, und um geforderte Maßnahmen, die der menschlichen Psychologie hinreichend Rechnung tragen, um Erfolg zu versprechen? Dabei wird es des Öfteren auch darum gehen, die den Forderungen zugrunde liegenden Maximen und die offenbar zugrunde liegenden Vorstellungen menschlichen Denkens und Handelns überhaupt erst freizulegen und zu charakterisieren, denn die werden wegen der großen Korngröße der verwendeten theoretischen Positionen selten explizit erläutert. Dementsprechend werde ich manchmal auf Vermutungen angewiesen sein, aber entsprechend meiner wissenschaftlichen Perspektive werde ich versuchen, die Gründe für meine Vermutungen offenzulegen. Bevor ich mich den aktuellen Themen zuwende, scheint es mir doch erforderlich, auf einige grundsätzliche, leider weit verbreitete Irrtümer einzugehen, die bei der Beurteilung identitätspolitischer Überlegungen eine wichtige Rolle spielen: dass nämlich Meinungen das tiefste Innere der Meinungsträger widerspiegeln und somit einen wichtigen Beitrag zum öffentlichen Diskurs repräsentieren und dass sich von Meinungen auf Handlungen schließen lässt. Diesen Themen sind daher die zwei folgenden Kapitel über Meinungen und Argumente gewidmet, um sozusagen den argumentativen Raum abzumessen, in dem ich die darauffolgenden Themen behandeln möchte.
Meinungen
»BILD Dir Deine Meinung«, fordert uns die größte deutsche Tageszeitung täglich auf und auch anderweitig stehen unsere Meinung hoch im Kurs: Jedes Mal, wenn ich eine Reise mithilfe entsprechender Buchungssoftware plane, wird meine Meinung zu beinahe jedem Schritt eingeholt: Wie fand ich den Buchungsvorgang? Wie die entsprechende Buchungs-App? Wie das gebuchte Hotelzimmer? Wie hilfreich fand ich die auf der Website angegebenen Meinungen anderer Besucher? Wie habe ich die Fahrt dorthin erlebt? Wie großartig war das Erlebnis der Buchung dieser Fahrt? Auch umfangreiche Gutachten werden gern gesehen, manchmal sogar durch Gutscheine belohnt: Was waren die Vor- und Nachteile des Zimmers, wie seine Lage, seine Sauberkeit und was ist meine allgemeine Empfehlung? Aber auch professionelle Meinungsforscher sind systematisch hinter unserer Meinung her: Jede Woche sollen wir alles Mögliche einschätzen, wie etwa unsere allgemeine Zufriedenheit mit uns selbst und mit der Weltlage, mit Politikern und Parteien, mit den Aktivitäten unseres Fußballklubs und den Entscheidungen des Bundestrainers. Kurzum, unsere Meinungen scheinen uns selbst, aber auch vielen anderen außerordentlich wichtig zu sein.
Dieses starke Interesse an unseren Meinungen hat scheinbar offensichtliche Gründe: Firmen wollen mithilfe der Einschätzungen ihrer Kunden ihre Produkte optimieren, um die Produkte dadurch an die Kundenwünsche anzupassen und ihren Umsatz zu steigern. Politiker brauchen Stimmen zur Wiederwahl, und die sind von zufriedenen Wählern leichter zu bekommen. Es gibt also viele Gründe für andere, uns unser Innerstes nach außen kehren zu lassen, um transparent und lesbar für sie zu werden. Wenn wir schon so voller Meinungen sind, so die Überlegung, dann sollten andere, deren Geschäftsmodell von unserem Verhalten und unseren Entscheidungen abhängt, besser mehr darüber wissen. Aber stimmt diese Überlegung eigentlich? Sind wir so voller Meinungen, Auffassungen, Präferenzen, Vorlieben und Abneigungen? Und wenn ja, kann man diese durch mehr oder weniger systematische Befragung herausbekommen? Es gibt gute Gründe, an beiden Annahmen zu zweifeln.
Der Ursprung unserer Meinungen
Zunächst einmal gibt es keinen Beleg für die Annahme, die jede Befragung im Grunde unterstellt: dass wir vor der Befragung bereits eine Meinung über das Thema der Befragung hatten. Das kann sein, muss aber nicht. Das können Sie selbst experimentell überprüfen: Fragen Sie doch mal andere nach ihrer Meinung über einen nicht existierenden Sachverhalt, wie zum Beispiel dem andauernden Krieg zwischen Saudi-Arabien und Marokko (der zu der Zeit, in der dieses Kapitel entstand, jedenfalls nicht existierte – überprüfen Sie das aber besser vorher!). In den meisten Fällen werden Sie Antworten auf Ihre Fragen und Einschätzungen bekommen, obwohl die entsprechende Meinung angesichts des fiktiven Charakters der Frage mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht vorher bestand. Das legt nahe, dass es in vielen Fällen erst die Befragung ist, die Meinungen erzeugt. Den Kern dieses Sachverhaltes hat der Schriftsteller Heinrich von Kleist schon früh erkannt und in seiner Schrift »Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden« beschrieben. In diesem Brief an seinen Freund Otto August Rühle von Lilienstern beschreibt Kleist, wie es ihm in der Anwesenheit einer anderen Person so viel besser gelingt, sich klar über seine eigenen Gedanken zu werden. Dabei ist das Wissen der anderen Person weniger wichtig als ihre bloße Anwesenheit und der damit verbundene Zwang, seine eigenen Gedanken nicht nur assoziativ zu äußern, sondern systematisch zu strukturieren und logisch darzustellen. Tatsächlich ist es oft die Äußerung eines vermeintlichen Gedankens, die diesen Gedanken erst entstehen lässt, sodass die sich äußernde Person ihre eigene Meinung erst durch die Äußerung aktiv konstruiert. Natürlich setzt dies eine gewisse Redefähigkeit voraus, wie auch Kleist anmerkt, und es ist sicher nicht so, dass der Redefluss mit der redenden Person überhaupt nichts zu tun hat. Sicherlich spiegelt die Rede das Wissen und die Erfahrungen der redenden Person wider, aber sie verbalisiert nicht einfach nur das, was vorher schon da war. In jedem Fall erhärtet die Beobachtung von Kleist den Verdacht, dass viele Meinungen erst während und durch deren Mitteilung entstehen.
Der Denkpsychologe Jonathan Haidt hat in seinem Buch »The Righteous Mind« den Versuch unternommen, diese Überlegungen näherungsweise zu formalisieren. Wie in Abbildung 1 erläutert, sind Meinungen und Entscheidungen nicht die Folge von Überlegungen, von Abwägungen der Argumente, sondern deren Voraussetzung. Seinem »sozial-intuitiven« Modell des Denkens zufolge stehen am Anfang unserer Meinungen und Überzeugungen Intuitionen, also bloße Empfindungen, was in einer Situation richtig und angemessen sein könnte. Diese Empfindungen können falsch oder richtig sein, repräsentativ für die eigene Persönlichkeit oder nicht, vielleicht auch bloß eine Widerspiegelung der momentanen Stimmungslage. Dementsprechend müssen die Urteile, die auf diesen Intuitionen beruhen, weder logisch noch plausibel noch persönlich relevant sein. Sind sie aber erst mal gefällt, dann tritt die Person in den sozialen Diskurs ein. Denn während die Intuition ja privat bleibt und sich unbemerkt jederzeit verändern kann, sind die Urteile, die eine Person fällt, in der Regel für andere Personen wahrnehmbar. Dies ist für die urteilende Person der Anlass, das Urteil sozial zu verteidigen und andere gegebenenfalls von dem Wert des eigenen Urteils zu überzeugen. Da die urteilende Person die eigentlichen kausalen Ursachen ihrer Intuitionen nicht kennt, können Informationen darüber kein Teil dieser Diskussion sein. Sie muss also erst mögliche Gründe entwickeln, um das eigene Urteil gegenüber anderen zu rechtfertigen. Außerdem ist das eigene Urteil ein möglicher Anlass, auch selbst darüber zu reflektieren, was seinerseits in die soziale Diskussion einfließen kann. Bei dem Gegenüber spielt sich prinzipiell derselbe Prozess ab: Die Rechtfertigung der anderen Person führt zu einer eigenen Intuition, die ihrerseits wiederum ein Urteil möglich macht und einen entsprechenden Eintritt in die soziale Verteidigung der eigenen Position.
Abbildung 1. Wie Meinungen entstehen
Die linke Spalte zeigt die herkömmliche Auffassung darüber, wie Meinungen entstehen. In dem Beispiel werden Claudia und Bernhard mit einem neuen Virus konfrontiert (A1). Sie denken mehr oder weniger tief und mehr oder weniger lange über die neue Situation nach und überlegen sich mögliche Handlungsoptionen (A2). Claudia setzt hohes Vertrauen in die Wissenschaft und neigt zu wissenschaftlich fundierten, logischen Überlegungen und Lösungen. Bernhard ist hingegen skeptisch, sorgt sich um Einflüsse von Lobbyisten, hält zumindest manche Wissenschaftler für korrupt und misstraut der Presse. Als Claudia und Bernhard schließlich ein Impfangebot von einem Arzt erhalten, willigt Claudia begeistert ein, während Bernhard dankend ablehnt (A3).
Die rechte Spalte zeigt dasselbe Szenario aus der Perspektive der sozial-intuitiven Entscheidungstheorie von Jonathan Haidt. Claudia und Bernhard werden also mit dem neuen Virus konfrontiert (B1) und entwickeln spontan eine positive oder negative Einstellung gegenüber der Idee, sich impfen zu lassen. Claudia findet die Idee spontan gut und wird daher das Impfangebot annehmen, während Bernhard ängstlich und abwartend bleibt und das Impfangebot (zunächst?) nicht annimmt (B2). Als sie beide anschließend gefragt werden, warum sie sich auf diese Weise entschieden haben, überlegen sie sich mehr oder weniger plausible Gründe für ihre jeweilige Entscheidung (B3).
Der wesentliche Unterschied zur herkömmlichen Idee menschlichen Entscheidens besteht in der Annahme, dass »Gründe« nicht mehr den Ausgangspunkt von Entscheidungen darstellen, sondern nur zur sozialen Rechtfertigung von in Wirklichkeit schon längst intuitiv (also »aus dem Bauch heraus«) gefällten Entscheidungen dienen.
Dieses Szenario stellt unser Selbstverständnis in Bezug auf unsere eigenen Urteile vollständig auf den Kopf: Wir gehen, so erläutert Haidt weiter, nicht wie Alltagswissenschaftler zu Werke und fällen unser Urteil erst nach Abwägung vielfältiger Sachverhalte. Sondern wir verhalten uns eher wie Strafverteidiger, die die bereits erfolgte Tat im Nachhinein durch vielerlei Argumente zu erklären und zu rechtfertigen suchen. Für Gegenargumente sind wir in der Regel ähnlich empfänglich wie ein Strafverteidiger – nämlich gar nicht. Ein Musterbeispiel für den Einfallsreichtum, mit dem Menschen ihre eigene Meinung gegen offensichtlich gegenläufige Fakten abschirmen können, wurde von dem Sozialpsychologen Leon Festinger und Kollegen in ihrem Buch »When Prophecy Fails« berichtet. Darin schildern sie ihre Beobachtungen der Aktivitäten einer religiösen Gruppe aus Chicago, den Suchenden(seekers). Die Mitglieder dieser Gruppe waren von dem baldigen Weltuntergang überzeugt, aber auch von der Möglichkeit, selbst durch außerirdische Wesen gerettet zu werden. Wie von den Forschern erwartet, blieb der Weltuntergang am vorhergesagten Termin aus. Dadurch ergab sich die Möglichkeit zu verfolgen, wie sich die Gruppe angesichts einer ganz offensichtlichen Widerlegung ihrer zentralen Annahmen verhalten würde. Mit erheblicher gedanklicher Kreativität gelang es den Gruppenmitgliedern, die Faktenlage derart umzudeuten, dass der ausbleibende Untergang keineswegs als Falsifizierung ihre Annahmen, sondern im Gegenteil als Beleg für deren Richtigkeit gelten konnte.
Es waren vor allem diese Beobachtungen, die Festinger und Kollegen zu der Schlussfolgerung nötigten, dass Menschen hochgradig selektiv mit der ihnen verfügbaren Informationen umgehen. Und nur die Information berücksichtigen, die mit ihren weiteren Überzeugungen übereinstimmt. Vor diesem Hintergrund ist unmittelbar verständlich, warum die Informationskampagnen der deutschen Bundesregierung während der Corona-Pandemie nicht besonders erfolgreich in ihrem Bemühen waren, Impfgegner zum Impfen zu bewegen. Diese Kampagne ging offensichtlich von einem rationalistischen Menschenbild aus, demzufolge der Unwille zur Impfung lediglich durch falsche oder unzureichende Information zustande kommen konnte, sodass die Darreichung umfangreicherer und besserer Information zur Meinungsänderung beitragen müsste. Wenn dieser Unwille aber nicht durch die Abwägung unvollständiger oder nicht vollständig korrekter Information zustande gekommen ist, sondern durch Ursachen, die die Betroffenen in Wahrheit wahrscheinlich selbst nicht kennen, wird weitere Information keinen Unterschied machen. Vor allem deswegen, weil sie sich (genau wie die Geimpften) die nötigen Gründe in der Zwischenzeit kreativ zusammengetragen haben werden.