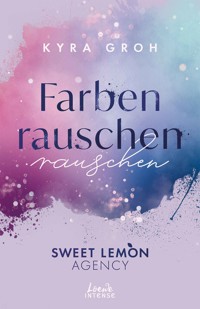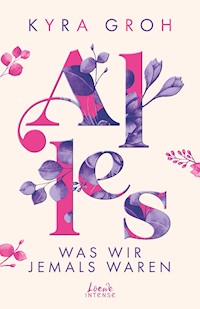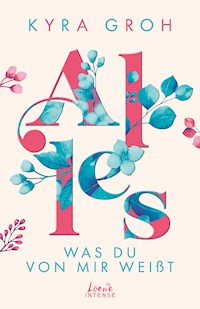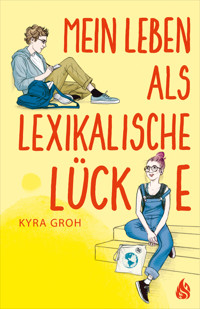4,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Manchmal kann das Leben ganz schön anstrengend sein. Und manchmal führt es genau die richtigen Menschen zusammen. Max und ihre Zwillingsschwester könnten unterschiedlicher nicht sein. Denn während Jo wunderschön und beliebt ist, hat Max anscheinend nur die öden Gene abbekommen. Zum Beispiel muss sie BHs der Marke Zauberflöte tragen – zieht man sie aus, geht der ganze Zauber flöten. Noch dazu ist sie seit Jahren unglücklich in ihren besten Kumpel verknallt. Ihr Leben könnte also besser laufen. Doch dann taucht Moritz auf. Der wäre gern Fotograf, versauert aber als Fahrradkurier und hat eine Exfreundin, die ihm das Leben schwer macht. Und er hätte mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass er sich in Max verliebt. Denn als Max und Moritz sich das erste Mal um halb drei bei den Elefanten im Zoo treffen, ändern sich ihre Leben für immer..."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Halb drei bei den Elefanten
Die Autorin
Kyra Groh wurde 1990 in Seligenstadt am Main geboren. Nach einem kleinen Umweg über die Uni Gießen, verschlug es sie 2012 nach Frankfurt, wo sie Trambahnen, Apfelwein und Supermärkte, die bis Mitternacht geöffnet haben, zu schätzen lernte. Sie behauptet gerne, neben dem Schreiben keine weiteren Talente zu haben – daher veröffentlicht sie nicht nur seit einigen Jahren humorvolle Liebesromane, sondern treibt auch hauptberuflich als Texterin ihr Unwesen. Sie hat eine Schwäche für gutes Essen, Instagram und Bilder von gutem Essen auf Instagram. Außerdem liebt sie Schachtelsätze, Erdnussbutter, Netflix und – aus Gründen, die ihr selbst manchmal schleierhaft sind – Sport.
Das Buch
Max und ihre Zwillingsschwester könnten unterschiedlicher nicht sein. Denn während Jo wunderschön und beliebt ist, hat Max anscheinend nur die öden Gene abbekommen. Zum Beispiel muss sie BHs der Marke Zauberflöte tragen – zieht man sie aus, geht der ganze Zauber flöten. Noch dazu ist sie seit Jahren unglücklich in ihren besten Kumpel verknallt. Ihr Leben könnte also besser laufen. Doch dann taucht Moritz auf. Der wäre gern Fotograf, versauert aber als Fahrradkurier und hat eine Exfreundin, die ihm das Leben schwer macht. Und er hätte mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass er sich in Max verliebt. Denn als Max und Moritz sich das erste Mal um halb drei bei den Elefanten im Zoo treffen, ändern sich ihre Leben für immer...
Von Kyra Groh sind bei Forever erschienen:Mitfahrer gesucht - Traummann gefundenGar keine Plan ist auch eine LösungHalb drei bei den ElefantenTage zum SternepflückenPinguine leben nur einmal
Kyra Groh
Halb drei bei den Elefanten
Roman
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
Neuausgabe bei ForeverForever ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinFebruar 2020 (1)
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2020Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © FinePic®Autorenfoto: © privatE-Book powered by pepyrus.com
ISBN 978-3-95818-495-4
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
Leseprobe: Gar kein Plan ist auch eine Lösung
Empfehlungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
1. Kapitel
1. Kapitel
in dem ich versuche, diese ganze Jonas-Geschichte in Worte zu fassen
Ich schaue in den Kühlschrank. Das mache ich immer, wenn ich nichts Besseres zu tun habe oder mal kurz nachdenken muss. Ich vermute, dabei handelt es sich um eine Art Urinstinkt. Der Mensch muss sich in regelmäßigen Abständen vergewissern, dass genug Nahrung vorrätig ist.
Der Blick in unseren Kühlschrank ist allerdings ernüchternd. Eine Packung Toast fristet ein trauriges Dasein neben einer Flasche Aperol und einem Eierkarton.
Anzahl der darin enthaltenen Eier: schätzungsweise null.
Dabei befinden wir uns keineswegs in einem klassischen Studentenhaushalt, Marke Budget beschränkt. Nein. Hier ist nichts provisorisch, und alles, was man braucht, ist auf magische Weise einfach da. Wir müssen nie etwas zweckentfremden, nie etwas bei den Nachbarn borgen. Nicht mal putzen müssen wir selbst. Kein Wunder, dass es meiner Schwester und mir noch nicht gelingt, den Lebensmitteleinkauf selbstständig zu organisieren, seit wir alleine in der Wohnung leben, die wir uns bis vor einem Jahr mit unserer Mutter geteilt haben.
Nur keine Panik. Es ist ja nicht so, als würde unser Kühlschrank seit zwölf Monaten leer stehen. Nö. Leer steht eigentlich nur Mamas Schlafzimmer. Was so auch nicht ganz richtig ist. Denn sie konnte unmöglich all ihre Schuhe, Taschen und Schmuckstücke mitnehmen, als sie beschloss, meine Zwillingsschwester Josephine und ich seien nun wahrlich alt genug, um alleine auf hundertzwanzig Quadratmetern zu hausen. Für sie dagegen sei es an der Zeit, endlich zu ihrem spanischen Liebhaber José nach Mallorca zu ziehen. Man mag es am Unterton heraushören: Ich bin bis heute nicht überzeugt von der Korrektheit dieses Beschlusses. Und das behaupte ich nicht nur deshalb, weil ich die Tatsache, dass meine dreiundvierzigjährige Mutter einen neunundzwanzigjährigen Liebhaber namens José hat, furchtbar klischeehaft finde. Es liegt auch nicht am leeren Kühlschrank. Es liegt – ich mach’s kurz – an ALLEM.
Ich schließe den Kühlschrank wieder und lehne mich mit dem Rücken dagegen.
Kann hier nicht alles ein bisschen gewöhnlicher sein? Muss das Edelstahlmonster in meinem Kreuz so groß und teuer sein wie ein Kleinwagen, wenn es dann doch nur trockenes Toastbrot beherbergt? Müssen Jo und ich in einer Maisonettewohnung am Frankfurter Museumsufer leben, in die eine vierköpfige neureiche Familie viel besser passen würde? Und muss ich wirklich so angenervt sein – von Dingen, nach denen sich jeder andere sehnt?
Jo hüpft die Wendeltreppe aus dem oberen Stockwerk herunter, und wie immer, wenn sie auftaucht, wird der Raum ein bisschen freundlicher und strahlender.
»Kann ich so gehen?«, fragt sie und dreht sich um die eigene Achse.
In Gedanken spiele ich meine Antwortmöglichkeiten durch. Ich könnte …
a) … lügen und Nein sagen. Es würde Jo verletzen, sie würde nach oben eilen, sich mehrmals umziehen und mich folglich noch xmal nach meiner Meinung fragen. Meistens bohrt sie so lange nach, bis sie irgendwann schmollend feststellt: »Warum frage ich eigentlich dich? Du hast doch eh keine Ahnung von Mode!« Womit sie recht hat. In meinem Gehirn ist nämlich kein Platz für modisches Gespür.
b) … das lilafarbene Kleid mit einem Gartenschlauch vergleichen und sie damit bis auf die kokosnussbehangene Krone der sprichwörtlichen Palme bringen. Der Vergleich ist durchaus berechtigt, denn Jos Kleidchen ist sehr eng und sehr schlauchförmig. Das Ganze würde in einen Streit ausarten, Türen würden knallen und böse Worte fallen, und unser beider Abend wäre versaut.
c) … sie schlicht und einfach bestätigen und die Sache damit wesentlich abkürzen.
Wenn ich gerade nicht so genervt wäre, würde ich ihr sogar ein Kompliment machen. Komplimente lösen in Jo Glücksgefühle aus. Nur leider habe ich es damit nicht so. Ich will ihr ja sagen können, dass sie in ihrem lila Schlauch perfekt aussieht und viele Blicke auf sich ziehen wird. Ich will ja zugeben, wie schön ich ihr Haar finde, wenn sie es wie heute mit dem Lockenstab frisiert hat. Ebenso, dass ich sie um ihre langen Beine, großen Brüste und vollen Lippen beneide. Aber ich kann’s nicht. Fast so, als würde es auch nur das Geringste an ihrer Schönheit ändern, wenn ich ihr vorhalte, dass ihr Kleid einem Gartenutensil gleicht.
Ich antworte emotionslos. »Ja.«
Meine Schwester schnaubt unzufrieden und dreht sich vor dem großen barocken Spiegel mit Goldrahmen, einer der wenigen Änderungen, die wir an der Einrichtung vorgenommen haben, seit unsere Mutter sich auf die spanische Finca verpisst hat. Der Spiegel stand zuvor in ihrem Schlafzimmer. Da sich darin aber nun niemand mehr bewundert, beschloss Jo, er könne genauso gut direkt neben der Eingangstür stehen, damit man kurz vorm Verlassen der Wohnung noch mal sein Äußeres kontrollieren könne. Jo findet das total praktisch. Ich dagegen finde das, vor allem montagsmorgens auf dem Weg zur Uni, mit einem Wochenende auf dem Buckel, das sich deutlich in meinen Augenringen spiegelt, nicht besonders schmeichelhaft.
»Was soll ich sonst antworten? Ja, Jo, du bist wunderschön! Deine Schönheit darf den gaffenden Männern in dem Snob-Club nicht vorenthalten werden.«
Sarkasmus. Zynismus. Übertreibung. Alles hilfreiche rhetorische Mittel, um meinen Dauerfrust zu übertünchen. Wie so oft kann Jo hinter meine Fassade schauen. »Reg dich nicht so künstlich auf«, sagt sie mit einem Lächeln, lässt ihr Spiegelbild eine letzte Pirouette drehen, wuschelt mir anschließend durch die Haare und ruft auf dem Weg zur Treppe: »Komm mit! Du sollst meine Schuhe aussuchen.«
Es ist ein Relikt aus unserer Kindheit, dass ich mich immer noch ein wenig geehrt fühle, wenn meine Schwester mich nach meiner Meinung fragt. Jo hatte immer die cooleren Freunde, den besseren Geschmack und die großartigeren Pläne. Aber das alles hätte sie jederzeit fallen gelassen, wenn ich mich dagegen ausgesprochen hätte. Sie braucht meine Einschätzung genau so sehr wie ich es brauche, dass sie mich darum bittet. Ich hingegen frage sie nicht oft um Rat, weil Jo, die mich besser kennt, als mich je ein Mensch kannte, kennt oder kennen wird, bei mir einen Hang zu schonungsloser Ehrlichkeit hat. Aus diesem Grund ist sie auch der einzige Wettbewerber in unserem Ankleidespiel, der Spielzüge vornimmt.
Ist ja nicht so, als hätte ich heute Abend nicht auch eine Verabredung, denke ich und werfe einen Blick auf meine Armbanduhr, aber was Jo von meiner Kleiderwahl hält, weiß ich auch ohne nachzufragen. Ihre Begeisterung ist ähnlich hoch wie die Nahrungsmitteldichte im Kühlschrank.
Ich folge meiner Schwester in ihr Zimmer, das so anders aussieht als mein eigenes: Schuhschränke statt Bücherregale, Schminkspiegel statt Desktop-Computer, Schmuck- statt CD-Sammlung.
In weiser Kenntnis ihrer wirklich, also wirklich, wirklich, großen Schuhkollektion klappe ich zielsicher den ersten Schuhschrank auf und ziehe ein mörderisch hohes Paar schwarz- und pinkfarbener Peeptoe-Pumps heraus. In Anbetracht der Tatsache, dass Pink und Lila zur selben Farbfamilie gehören, denke ich mir pragmatisch: passt schon. Mal davon abgesehen, dass Fünfzehn-Zentimeter-Stilettos nur sehr wenig mit Pragmatismus zu tun haben.
In diesem Moment klingelt es, und ich blicke erneut mit wachsender Nervosität auf die Uhr. Es ist kurz vor neun. Das muss er sein.
Ich rappele mich auf, aber Jo kommt mir zuvor.
»Ich mach schon«, sagt sie, tappt barfuß aus dem Zimmer in den Flur, wo direkt neben dem Treppenaufgang ein Hörer für die Gegensprechanlage angebracht ist.
Als ich höre, wie sie »Hi, Jonas, komm doch hoch« hineinsagt, wird es in meinem Kopf kurz nebelig. Ich stürze aus dem Raum, bemerke, wie mein Puls steigt, und drücke Jo im Vorbeihasten die Schuhe in die Hand.
»Das ist eine sehr gewagte Kombination«, urteilt Jo und beäugt das Schuhwerk, »aber sie gefällt mir. Hey, Max, vielleicht hast du ja doch Potenzial.« Sagt’s und guckt kritisch an mir herunter.
»Kein Wort gegen meine Doc Martens«, ermahne ich sie und hopse im Gleichtakt mit meinem Herzschlag die Wendeltreppe hinab.
»Das sind Skinhead-Schuhe!« Sie setzt sich auf die oberste Stufe und schlüpft in die Peeptoes.
»Skinhead-Schuhe?«, beginne ich und bereite mich auf eine rohrspatzwürdige Schimpftirade vor. »Ich hab schon mehr Skinheads in schwarzpinken Klackerhacken gesehen als …«
Jo schneidet mir die Luft ab. »Schon gut, Maxi, schon gut. Ich bin stolz auf dich, weil du einen Rock trägst. Bloß schade, dass du keinen schlichten schwarzen Pump dazu anhast.«
Überkritisch ziehe ich die linke Augenbraue hoch. Klar! Ich habe derart viele Pumps im Schrank, dass ich sie nach der Farbe auswählen kann. Sicher doch. Ihr Kompliment kann mich nicht aufmuntern. Das Mädchen in mir macht sich plötzlich Gedanken, ob ich gut genug angezogen bin.
Papperlapapp. Natürlich bin ich gut genug angezogen. Jonas hat mich schon eintausendmal in meinen Doc Martens gesehen. Jonas liebt diese Schuhe. Das hat er zumindest mal behauptet. Davon abgesehen ist es ihm sowieso egal, was ich anhabe – und das meine ich jetzt leider nicht positiv. Wahrscheinlich würde es ihm nicht mal auffallen, wenn ich nackt im Türrahmen stünde.
Ich mache die Wohnungstür auf, weil ich aus Erfahrung weiß, dass der Aufzug mit Jonas jeden Augenblick bei uns im obersten Stockwerk ankommen muss, und schaue direkt in sein grinsendes Gesicht.
»Können wir los?«, fragt er mit kindlicher Vorfreude.
»Vergiss nicht, dass wir morgen um halb elf mit Papa verabredet sind, Max. Wo geht ihr überhaupt hin?«, fragt Jo schräg hinter mir. Sie hat ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Barockspiegel gelenkt und überprüft die Gesamtwirkung der Schlauch-Klackerhacken-Kombination.
Dadurch wird Jonas auf sie aufmerksam. Er schiebt sich an mir vorbei in die Wohnung und sagt: »Hey, Jo, wow, krasses Kleid.«
»Hey, Jonas, klar, komm doch rein. Schön, dich zu sehen. Ich hab auch einen Rock an«, murre ich sarkastisch, während ich die Tür schließe.
»Danke«, zirpt Jo, streicht sich effektvoll eine Haarsträhne hinters Ohr und wirft Jonas einen flirtenden Blick zu.
Ein ekelhaftes Brennen in der Magengegend durchzuckt mich.
Ich sehe Jonas an, seine Pupillen wandern zwischen Jos Dekolleté und ihrem Hintern hin und her.
Auf einmal fühle ich mich wie damals bei ihm zu Hause, als wir zu zweit im Haus seiner Eltern auf dem Balkon saßen, Bier tranken und einem wahren Spektakel an Sonnenuntergang beiwohnten, das der Frankfurter Himmel uns präsentierte. Es war einer von jenen Momenten, in denen ich felsenfest davon überzeugt war, dass wir uns endlichendlichendlich küssen würden. Die Luft war lauwarm, und wir hatten es uns in einer fast kuschelähnlichen Sitzposition auf der altmodischen Hollywoodschaukel bequem gemacht.
Jonas beugte sich zu mir und dachte wohl, er würde den Witz des Jahrhunderts machen, als er zu mir sagte: »Max, wusstest du, dass du das BH-Modell Zauberflöte trägst?« Ich fragte mich noch, woher er den Modellnamen meines schnöden H&MBHs kannte, den ich selbst nicht mal wusste, da brachte er die Pointe. »Wenn du ihn ausziehst, geht der ganze Zauber flöten.«
Einem Stoffel wie mir kommt natürlich nichts gelegener, als wenn Jonas mir in einem Moment ersehnter Zweisamkeit mitteilt, dass ich quasi flacher bin als ein Brett. Zum Dank für diese Erläuterung trat ich ihm die Bierflasche aus der Hand, die sich prompt auf sein schniekes Marken-T-Shirt ergoss. Jenes T-Shirt, von dem Jonas glaubt, dass er darin aussieht wie jemand, der wohlbetucht ist, sich aber nicht darum schert. Dabei trifft weder das eine noch das andere zu.
»Wir gehen ins Zoom. Da spielen heute ein paar britische Indie-Bands, wird ’ne Mega-Sache«, preist Jonas unser Abendprogramm an, als hoffte er, Jo würde ihren Ausflug in die Frankfurter Clubszene gegen eine Nacht voll Britpop im Zoom eintauschen.
»Sollen wir dich irgendwo absetzen?«, fragt er sie.
»Nein. Ein Freund holt mich ab. Steffen … Er fährt einen Ford Galaxy.«
Ich bin mir sicher, Jo hat keinen Plan, dass ein Ford Galaxy ein familientauglicher Siebensitzer ist.
»Ja, wir müssen dann auch los«, bereite ich der Sache ein Ende und schiebe Jonas zur Tür hinaus – nicht ohne zu bemerken, dass er Jos Brüsten noch schnell mit tiefen Blicken Lebewohl sagt.
Im Aufzug schweige ich ihn so lange an, bis er seufzt und fragt: »Du bist mir doch nicht böse, weil ich mir manchmal vorstelle, wie es wäre, mit ihr zu schlafen, oder?«
Eine Frage wie ein Schlag in die Magengegend. Mit einem Baseballschläger. Oder einem Morgenstern.
»Du bist mir doch nicht böse, weil ich mir manchmal vorstelle, wie es wäre, deinen Kopf so lange gegen die Wand zu schlagen, bis dein Sexualtrieb nur noch eine ferne Erinnerung ist, oder?«
»Doch, da wär ich böse. Das würde ja bedeuten, du willst, dass ich unglücklich bin.«
»Oh, du Ärmster.«
Wir sind im Erdgeschoss angekommen, und ich stürme aus dem Haus in Richtung Straßenbahnhaltestelle, ohne darauf zu achten, ob Jonas mir folgt.
Dieser Vollidiot. Dieser vollkommen taktlose Vollidiot. Ich hasse ihn. Merkt er denn nicht, dass er für mich immer noch mehr ist als ein Typ, mit dem ich gerne Bier trinke und Musik höre? Manchmal möchte ich, dass er es merkt. Jonas scheint es aber gar nicht merken zu wollen. Und selbst wenn … Ich bin mir nicht sicher, ob sich sein Verhalten mir gegenüber dann merklich verändern würde.
Wenn Jonas mehr von mir wollen würde als Freundschaft, dann hatte er wahrlich schon genügend Gelegenheiten, mir das zu zeigen.
Ich kenne Jonas seit der fünften Klasse, und ich liebe Jonas seit der fünften Klasse. Solange ich mich erinnern kann, macht mich der Gedanke wahnsinnig, er könnte eine andere Frau mehr mögen als mich. Weil ich es aber in zehn Jahren des Werbens und Anbietens nicht geschafft habe, ihn auch nur zu einer klitzekleinen Dummheit mit mir zu bewegen, bin ich eben, seit wir vierzehn sind, seine beste Freundin. Und diesen Thron lasse ich mir nicht streitig machen. Von niemandem.
Zur Zeit meiner Thronbesteigung, der vierzehnjährige Körper voller Pubertätshormone, fingen meine Gefühle für Jonas an, Kapriolen zu schlagen. Damals musste ich zum ersten Mal mit ansehen, wie jemand mir Jonas streitig zu machen versuchte. Wir waren auf Klassenfahrt, sie hieß Elena Eberhard, war einmal sitzen geblieben, liebte Kurt Cobain und trug Netzstrumpfhosen. Kurzum: Jonas vergötterte sie. Nachdem er mir wochenlang von ihr vorgeschwärmt hatte, riet ich ihm auf besagter Klassenfahrt, direkt auf sie zuzugehen und sie zu küssen. Wie sich bald herausstellte, war das ein ganz ausgezeichneter Rat. Denn anders als erhofft, führte mein Vorschlag nicht etwa dazu, dass Elena Eberhard Jonas den Vogel zeigte, sondern dazu, dass ich Zeugin von seinem ersten Kuss wurde. Erste Küsse sind vermutlich nie schön anzusehen, aber in diesem Fall war es besonders bescheiden.
Die Beobachtung der intimen Szene beschwor jedoch einen Wunsch in meinem Inneren herauf, den ich seither nicht wieder losgeworden bin: Eines Tages will ich diejenige sein, die Jonas küsst.
Kurzer Einschub
um zu erklären, warum Jo tanzen geht, während ich ein Indie-Konzert besuche
Vorab ein Schwank aus unserer Kindheit:
Am 14. September 1995 um 10.17 Uhr morgens bekam ich zum ersten Mal die Fingernägel professionell lackiert. Das Datum weiß ich deshalb so genau, weil es mein fünfter Geburtstag war. Die Uhrzeit habe ich gerade dazugedichtet, um einen dramatischen Effekt zu erzielen.
Wer jetzt glaubt, dass es 1995 noch gar keine Einrichtungen gab, in denen man sich die Nägel feilen-Slash-lackieren-Slash-frenchstylen lassen konnte, der irrt. Ich weiß es besser, denn ich war dort. Und es war furchtbar.
Es war ein Geburtstagsgeschenk unserer Mutter an mich und meine Schwester. Rückblickend denke ich heute, dass sie mich damit bestrafen wollte. Falls nicht, so zeugt es zumindest davon, dass sie mich nicht besonders gut kannte – ein Umstand, der sich seither nicht frappierend geändert hat.
An jenem Morgen musste ich ein rosa Dirndl anziehen, was alles nur noch furchtbarer machte. Ich hasse Dirndl bis heute. Ich habe nie verstanden, warum Frauen so etwas Scheußliches anziehen. Die Dinger sind nicht schön, sie sind nicht bequem, und deine Brüste pushen sie auch nur dann, wenn du welche hast. Fünfjährige haben übrigens keine Brüste. Nun ja, für mich hat sich da bekannter maßen nicht viel geändert – Stichwort Zauberflöte.
Meine Mutter schnürte mich damals also in dieses bescheidene Dirndl, ich wehrte mich mit Händen und Füßen, aber es half alles nichts. Meine Schwester trug ein identisches rosafarbenes Ungetüm. Im Gegensatz zu mir war Jo aber schon immer ein Fan von Kleidchen, je rosaner und rüschenbeladener, desto besser. Für sie war die Kombination aus diesem Outfit und dem Nagelstudio der Inbegriff eines perfekten Geburtstages. Bester Laune stolzierte Jo in ihrem Dirndl herum wie die Königin von Bayern – wohlbemerkt auf hessischem Boden –, den Blick bewundernd auf die farblich passenden Glitzernägel geheftet. Ich dagegen kreischte, fluchte, heulte und hätte mir am liebsten das Kleid vom Körper und die rosa lackierten Nägel aus dem Fleisch gerissen.
Am 14. September 1995 um 10.17 Uhr morgens bekam ich auch zum letzten Mal die Fingernägel professionell lackiert. Eine halbe Stunde später fing ich an, an den Nägeln zu kauen. Irgendwie musste der Kram ja weg.
Bevor ich weitere Details zu mir und meiner Schwester verrate, muss ich etwas über meine Eltern loswerden.
Mit einundzwanzig lernte meine Mutter meinen Vater kennen, als sie 1989 in der Boutique meiner Großmutter als Verkäuferin arbeitete.
Ich sag’s lieber gleich: Die Familie meines Vaters gehört zum alten Geldadel. Klingt saubekloppt, ich weiß.
Aber es gibt auch noch außerhalb des ehrenwerten Hauses von Anhalt und fernab von ARD-Vorabendserien Adelige. Allerdings habe ich nie gehört, dass mein Vater sich selbst als »adelig« bezeichnet hätte. Im Prinzip ändert es auch nichts. Außer, dass meine Familie väterlicherseits eine Menge Kohle hat und ein wahnsinnig schickes von vor dem prestigeträchtigen Nachnamen trägt. Manchmal landen sie auch in der Klatschpresse.
Meine Mutter wusste sehr wohl, dass ihre Chefin eine Adelige war, die ihre Edelboutique einzig und allein, um nicht vor Langeweile zu sterben, führte. Als in dem Laden irgendwann ein Typ auftauchte, der Theodor von Steinacker hieß und somit den gleichen Nachnamen trug wie ihre Chefin, hat sie zugegriffen. Eines kam zum anderen, und kaum ein Jahr nach der ersten Begegnung der beiden waren meine Schwester und ich auch schon da. Wie das so ist, wenn man ungeplant Kinder in die Welt setzt: Man heiratet, nur um sich irgendwann scheiden zu lassen. Sowohl die Hochzeit als auch die Scheidung meiner Eltern erregten tatsächlich die Aufmerksamkeit einiger Zeitschriften. Als wir sieben waren und zwischen unseren Eltern der Rosenkrieg tobte, druckte sogar die Gala ein Bild von Jo und mir gemeinsam mit unseren Großeltern väterlicherseits ab. Jo bewahrt es bis heute in einer alten Kiste auf, aber sie weiß nicht, dass ich das weiß.
Dass meine Eltern sich wieder getrennt haben, hat mich – seit ich ein Bewusstsein und die Fähigkeit zur Reflexion erlangt habe – nie gewundert. Bis heute glaube ich, dass meine Mutter nur eine Sache an meinem Vater so richtig anziehend fand: seinen Namen. Den bekam sie durch die Heirat, und die Heirat bekam sie durch die Kinder. Doch genug davon.
Meine Eltern sind grundverschieden.
Meine Mutter ist ziemlich groß für eine Frau, mein Vater für einen Mann eher klein.
Sie ist eine klassische Schönheit, er eher nicht.
Sie hat blonde, glatte Haare, er hat rötliche Locken. Sie flucht viel und meckert, er ist die Ruhe selbst.
Seine weiblichen Verwandten sind mit großartigen Kurven ausgestattet, ihre nicht.
Sie ist sportlich, er nicht.
Er ist musikalisch, sie nicht.
Er studierte, übernahm die Marketingfirma seines Vaters und machte aus ihr die Werbe- und PR-Agentur schlechthin, der Job in der Edelboutique war ihr letzter.
Als meine Eltern anno 1989 meinten, ungeschützten Geschlechtsverkehr haben zu müssen, warfen sie dieses ganze genetische Material in einen Topf, fügten zwei Eizellen hinzu, rührten nicht besonders gründlich um, und heraus kamen ein paar Monate sowie eine Hochzeit später Jo und ich.
Meine Schwester ist groß und im klassischen Sinne schön. Sie hat goldblonde Wellen, ein sanftes Gemüt, und egal, wohin sie geht, alle verfallen ihr sofort. Mit »alle« meine ich natürlich Männer, denn Frauen reagieren auf überdurchschnittlich attraktive Geschlechtsgenossinnen wie Jo bekanntlich mit Abneigung und neiderfüllter Lästerei. Jo ist nicht einfach nur schön. Sie ist perfekt vom Scheitel bis zu den pedikürten Füßen, besonders wegen des dazwischen liegenden Bereichs. Sie hat eine Figur wie ein Stundenglas. Ein Stundenglas mit Körbchengröße C.
Ich bin einen grandiosen Meter und zweiundsechzig Zentimeter klein und habe die roten Haare abbekommen, wobei mir selbstverständlich der Haarschwung, das Volumen und die Welle verwehrt geblieben sind. Meine Haare sind strack, bügelglatt, langweilig, strohig. Mir würden eine Million Adjektive einfallen, um sie negativ zu beschreiben.
Von einem ruhigen Gemüt kann bei mir genauso wenig die Rede sein wie von Körbchengrößen. Wen interessiert es da schon, dass ich die Sportlichkeit und Musikalität abbekommen habe und mein Abitur ein Jahr vor Jo in der Tasche hatte.
Niemanden interessiert das. Besonders die Männerwelt nicht. Bevor ich nämlich betonen kann, dass ich Ballgefühl habe oder weiß, was der Unterschied zwischen Dur und Moll ist, und einen Abi-Schnitt von eins Komma sechs habe, sind sie bereits an mir vorbeigelaufen, um Jo anzusprechen.
Wie erwähnt, ich bin kein besonders geduldiger Mensch. Ich bin auch nicht immer besonders höflich. Und nicht sonderlich feminin. Ich bin weder die, der man hinterherguckt, noch die, die man in der Disco auf einen trendigen Rum-Cocktail einlädt. Ich bin anders. Ich bin die, mit der man Bier trinkt, und die, die man fragt, ob es cool käme, die Blondine in dem Minirock dort drüben mal an zuquatschen und auf einen trendigen Rum-Cocktail einzuladen. Ich bin die, die dann sagt: »Halt die Fresse«, ehe sie einen Vortrag über billige Outfits hält, um ihre geschundene, aufmerksamkeitsheischende Seele dahinter zu verstecken.
Ich könnte auf der Stelle etliche Dinge aufzählen, die ich an der Welt im Allgemeinen und an mir im Speziellen nicht leiden kann. Ich neige dazu, »hassen« zu sagen, obwohl ich der Meinung bin, dass »hassen« ein schreckliches Wort ist. Man sollte eigentlich nichts und niemanden hassen. Deshalb kann ich auch Leute nicht verstehen, die den Ausspruch von Kurt Cobain, »Life sucks and then you die«, als ihr Lebensmotto reklamieren.
In Wahrheit glaube ich, dass mich meine vielen Macken gar nicht stören. Ich will mich schlicht nicht ändern. Ich will nicht zu einem dieser miniberockten Mädchen werden, die sich den ganzen Abend Drinks bezahlen lassen. Mich stört nur, dass ich bisher nicht auf diesen einen Menschen gestoßen bin, der mich mitsamt meinen Eigenarten zu etwas einlädt. Zwar fand mich mein bisher einziger ernst zu nehmender Freund David irgendwie gut, aber ich habe mich noch nie angekommen gefühlt. Immer nur wie bestellt und nicht abgeholt. Wie bestellt und dankend angenommen fühle ich mich eigentlich nur bei Jo. Bei Jonas fühle ich mich eher wie Reklamationsware.
Gott sei Dank gibt es auch eine Menge Dinge, die ich sehr mag, allen voran meine Schwester. Egal, wie verschieden wir sind, wie oft wir uns streiten, wie kategorisch ich mich manchmal von ihr distanziere – ich liebe sie.
Ich weiß, diese Geschichte ist ein alter Hut: Zwillingsmädchen, die völlig unterschiedlich sind, sich aber tief im Innern von Herzen lieben. Doch so ist es nun mal. Ich brauche Jo genauso, wie sie mich braucht. Sie ist meine Festung, wenn das Leben mich umwirft. Sie ist beständig, wenn alles wankt, wenn Männer kommen und gehen und Jonas irgendwie immer bleibt, wenn Mütter nach Spanien abhauen und Väter so langsam ihr eigenes Leben aufbauen. Jo ist da und wird immer da sein. Das ist ein unglaublich beruhigendes Gefühl. Aber manchmal … Manchmal geht sie mir bloß ziemlich auf die Nerven.
2. Kapitel
in dem klar wird, dass Jo, im Gegensatz zu mir, ziemlich scharf auf Babys ist
Der nächste Morgen ist ein Samstag. Als wäre es nicht schlimm genug, vor dem Weckerklingeln aufzuwachen – an einem Samstag ist es besonders schmerzlich. Ich wickele mich in die Decke und kneife die Augen zusammen. Aber der verfluchte Schlaf kommt nicht wieder. So, wie es sich anfühlt, habe ich meinen Schädel gestern im Zoom an der Bar vergessen. Aua. Ich hab Kopf.
Ich starre auf den Wecker. Halb zehn. In zehn Minuten klingelt er.
Unser Vater will uns um halb elf abholen, um mit uns frühstücken zu gehen. Die Sache ist die, dass er- nach dem Grundsatz »Zehn Minuten vor der Zeit ist die rechte Pünktlichkeit« erzogen wurde und außerdem vor Verabredungen derart ungeduldig wird, dass er grundsätzlich viel zu früh losfährt. Immerhin könnte Stau sein, das Wetter könnte umschlagen, vielleicht muss man auf halbem Weg umkehren, weil man etwas vergessen hat, der Dritte Weltkrieg könnte ausbrechen, sämtliche Straßen könnten über Nacht die Richtung geändert haben. Er plant immer alle Eventualitäten ein. Obwohl er sich für halb elf angekündigt hat, wird er also gegen fünf nach zehn bei uns auflaufen.
Unten höre ich die Dusche rauschen. Jo ist schon auf.
Logisch. Sie braucht für gewöhnlich eine halbe Stunde, um sich die Haare zu föhnen.
Ich krieche aus dem Bett, wanke über die Wendeltreppe nach unten und betrete ohne anzuklopfen das Bad. Das Gute daran, sich neun Monate lang einen Mutterbauch geteilt zu haben, ist nämlich, dass du voreinander alles tun kannst und nichts verheimlichst. Auch nichts, was die Körperhygiene betrifft. Die Dusche ist verstummt, und eine munter klingende Jo wünscht mir flötend einen guten Morgen, während ein schabendes Geräusch darauf hindeutet, dass sie sich gerade die Beine rasiert. Jetzt mal ehrlich: Wie viele Mikrometer können die Stoppeln seit gestern Abend gewachsen sein? So ungefähr null Komma drei?
Jo steigt aus der Dusche, vollführt diverse rhythmische Vorwärtsbewegungen und singt dazu einen öden Chart Song.
»Wieso bist du so fit? Das verstehe ich nicht«, knurre ich und halte mir den Kopf.
»Erstens: Ich bin schon eine Stunde wach. Zweitens: Ich habe kalt geduscht. Drittens: Ich hatte gestern total viel Spaß und habe deshalb immer noch gute Laune.«
Jo und ich sind vergangene Nacht, oder besser gesagt heute früh, fast zeitgleich nach Hause gekommen. Ich hatte die Haustür gerade mühsam hinter mir geschlossen, als Jo sie wieder öffnete und mir freudig von ihrem Abend und diesem Typen erzählte, der sie in seinem Siebensitzer nach Hause gefahren hat.
»Ich hatte auch Spaß.«
»Max, du warst total besoffen. Das heißt nicht automatisch, dass du Spaß hattest.«
»Besoffen? Mach dich nicht lächerlich …«
»Ich weiß, dass es dir leichter fällt, dich Jonas gegenüber zu öffnen, wenn du was getrunken hast. Trotzdem solltest du die Taktik überdenken. Sonst wirst du noch zur Alkoholikerin.«
Ich starre sie mit großen Augen an. »Was redest du denn da?«
»Du weißt ganz genau, was ich da rede. Geh duschen. Wenn Papa halb elf sagt, dann ist er um fünf nach zehn hier.«
Kurz mache ich mir Gedanken, ob Jonas meine Taktik ebenfalls durchschauen könnte. Unmöglich. Dafür besitzt er nicht genügend Einfühlungsvermögen. Außerdem ist er ein Mann. Männer bemerken sowieso nie irgendwas, das ihnen Anlass dazu geben müsste, ihre Handlungen und-Slash-oder Gewohnheiten zu überdenken.
Eine Stunde später sitzen wir irgendwo, wo es teuer ist. Genauer sitzen wir über den Dächern der Stadt in einem nach dem Understatement-Prinzip eingerichteten Restaurant, in dem ein Frühstück für eine Person so viel kostet wie andernorts ein ganzes Familienmenü. Weißer Stoff und silberne Kerzenständer, so weit das Auge reicht.
Hastig verschlinge ich ein Brötchen mit Schinken und Rührei, um das Wabern in meinem Kopf durch Fett und Kohlenhydrate auszugleichen, während Jo Abertausende exotische Früchte mit fremden Namen in mundgerechte Stücke schneidet, pellt und zupft. Die Früchte landen in einer Schüssel und werden anschließend mit Sojajoghurt, Bio-Müsli und Leinsamen vermischt. Ich verkneife mir die Frage, ob sie Verdauungsprobleme habe oder warum sie sich sonst Leinsamen zu ihrem Körnerfraß bestellt hat. Bestimmt isst sie dieses Frühstück aus den gleichen Gründen, aus denen sie auch Yoga macht, vegane Brotaufstriche kauft, Peta unterstützt und auf die Inhaltsstoffe ihrer Kosmetika achtet. Ob sie sich wirklich für ein gesundes, nachhaltiges Leben interessiert oder nur auf einer Trendwelle mitschwimmt, habe ich bisher nicht herausfinden können. Da sie aber auch Blogs und Zeitschriften mit ähnlichen Inhalten verfolgt, glaube ich fast, sie ist tatsächlich mit Eifer dabei.
Ein Pinguin kommt vorbei und fragt Jos Brüste, ob es noch etwas sein dürfe. Ja, ein Strick bitte.
»Momentan nicht, vielen Dank«, antwortet Papa und verscheucht ihn mit freundlichen Blicken.
Als wäre es nicht schlimm genug, dass man uns mit »Aaaaaaach, der Herr von Steinacker mit seinen wunderhübschen Töchtern. Tisch am Fenster?« begrüßt hat, nun kommt auch noch alle zwei Minuten ein anderer Pinguin vorbei und erkundigt sich, ob er meinem Vater in den Allerwertesten kriechen dürfe.
Papa fragt amüsiert: »War wohl ’ne heiße Nacht gestern?«
»Frag nicht«, brumme ich.
»Okay. Wahrscheinlich will ich es gar nicht wissen.« Er lacht.
Sein linker unterer Schneidezahn steht ein Stück hinter den anderen Zähnen. So wie bei mir. So wie bei Jo … bevor sie es vor einem Jahr hat korrigieren lassen.
»Was gibt’s denn zu besprechen?«, fragt meine Schwester, und ein merkwürdig farbloses Fruchtstück wandert in ihren Mund.
Papa grinst breit und voller Vorfreude. So guckt er, wenn er Geschenke für uns hat. Kaum etwas auf der Welt macht ihm so viel Spaß wie Geld für uns auszugeben. Er greift in seine Aktentasche und stellt Jo und mir je ein braunes Lederetui mit Schleife vor den Teller. »Aufmachen und aufsetzen«, fordert er.
Als ich mein Etui öffne, hellt sich meine Miene auf.
»Cool. Wow!«, sage ich und setze mir die dunkelbraune Sonnenbrille auf die Nase. »Eine Wayfarer. Nicht schlecht, Papa, du hast echt Geschmack.«
»Hey, so eine hatte ich schon vor zwanzig Jahren. Ich bin eben ein Trendsetter.«
Auf Jos Nase sitzt eine große, goldumrahmte Pilotenbrille.
»Ich wollte deine eigentlich in Schwarz nehmen, Max, aber als die Verkäuferin gehört hat, dass du meine Haarfarbe hast, hat sie gesagt, braun sei besser.«
»Très chic, die Damen …« Der Pinguin wieder.
»Wir haben alles, danke«, schneidet Papa ihm gleich das Wort ab, und er verschwindet.
»Nun sag schon, Papa, worüber willst du mit uns sprechen?«, fragt Jo, während sie sich in einem dem Tisch gegenüberhängenden Spiegel bewundert.
»Also«, er faltet die Hände, »Kristin und ich bekommen ein Baby.«
Oh. Juhu.
Papa ist seit anderthalb Jahren mit Kristin zusammen. Vor sechs Monaten hat er ihr einen Antrag gemacht – mit einem halbkarätigen Diamantring, eingebacken in ein Schokoladensoufflé, das sie in einem Pariser Straßencafé zu sich nahmen. Eins muss man unserem Vater lassen: Er weiß, wie man den Bogen so sehr überspannt, dass das Endergebnis fast schon wieder romantisch ist.
Die beiden haben sich bei der Arbeit kennengelernt. Kristin war – ganz klassisch – seine Tippse. Also nicht seine persönliche Tippse. Sondern die Tippse der Tippse seiner Tippse. Oder so ähnlich. Sagen wir’s mal so: In der Nahrungskette stand sie nicht sonderlich weit oben. Allerdings ist sie hübsch. Sehr hübsch sogar. »Rattenscharf« hat Jonas sie mal genannt. Aber auf sein Urteil darf man bekanntlich nicht viel geben. Sie ist gerade einmal zweiunddreißig, also stolze vierzehn Jahre jünger als mein alter Herr, und hat die Optik eines Supermodels. Ohne Scheiß. Neunzig, sechzig, neunzig, blonde lange Haare und all solche Sachen. Und mein Vater? Blasse Haut, eine Hornbrille und hellrote, wellige Haare mit Geheimratsecken.
Kristin ist nett. Wirklich. Aber sie ist und bleibt eine überattraktive Blondine, die als untergeordnete Sekretärin gearbeitet hat, bevor sie angefangen hat, mit dem Firmeninhaber zu schlafen. Nun, da die beiden verlobt sind, rückt der beschissene Nachname für sie in greifbare Nähe. Sie trägt ihn gewissermaßen schon unter dem Herzen. Was kommt wohl danach? Der Wonneproppen wird einen tollen, mit dem Nachnamen perfekt harmonierenden Vornamen wie Josephine oder Maxime bekommen, und Kristin kann ihre Altersvorsorge in den Armen wiegen. Mein Vater wird sie vorschnell heiraten, sie werden sich scheiden lassen, und ein weiterer von Steinacker wird durch die Gegend watscheln und der Frau Mama nette monatliche Alimente bescheren.
Ich blinzele unseren Vater verwirrt an. »Ein Baby?«, frage ich nur.
Sein Gesicht leuchtet in tausend Farben.
Jo dagegen ist komplett aus dem Häuschen. »Ein Baby! Wisst ihr denn schon, was es wird? Wann soll es denn kommen? Wie soll es heißen? Wird es ein Junge? OH GOTT, MAX, WIR WERDEN SCHWESTERN!«
»Und ich werde noch mal Papa, was sagt man dazu?«
Ja. Was sagt man dazu? »Papa … Glückwunsch! Also … ich freu mich für euch«, sage ich dazu.
Weil man das so macht.
3. Kapitel
in dem sich nicht daran gehalten wird, dass es das Persönlichkeitsrecht verbietet, fremde Menschen ohne ihr Einverständnis zu fotografieren
Nach dieser Nachricht brauche ich erst mal einen Moment, um mit mir, Babys und der Welt klar zukommen. Also benutze ich das schöne Wetter als Ausrede vor Jo, um die Wohnung, kaum dass uns Papa zu Hause abgesetzt hat, auch schon wieder zu verlassen. Meiner Schwester erzähle ich, ich wolle Jonas besuchen. In Wahrheit will ich nur weg von ihr und ihrer Baby-Euphorie.
Jonas ist jedenfalls nicht mein Ziel, als ich in meinem Polo in Richtung Taunus brettere.
Zwar habe ich meine Unisachen mitgebracht, aber ich weiß ziemlich genau, dass ich nicht lernen werde. Das zweite Semester meines Geschichtsstudiums liegt hinter mir, und ich befinde mich mitten in der Klausurenphase. Eigentlich müsste ich mich intensiv darauf vorbereiten. Vor allem die Klausur über Otto III. und der Lateintest, die ich beide nächste Woche für den Bereich Mittelalterliche Geschichte schreiben und im Idealfall auch bestehen muss, fordern meine ganze Aufmerksamkeit ein. Bisher weiß ich noch nichts über Otto III., außer dass er der Dritte seines Namens in seinem Amt (welches auch immer) war.
Dass ich ein lateinisches Verb fließend im Konjunktiv konjugieren oder einen Ablativus absolutus
a) erkennen und
b) übersetzen konnte, ist auch schon etwas länger her. Seit der elften Klasse sind meine Lateinkenntnisse, nun ja, eingerostet. Non vitae, sed scholae discimus? Von wegen!
Die bunt bedruckte Stofftasche, in der ich die Bücher und Hefte transportiert habe, liegt neben mir auf der Bank, die kleine Umhängetasche baumelt um meine Schulter. Auf meinen Ohren sitzen riesige Kopfhörer, die für den Gebrauch in einem Tonstudio geeignet wären. Die Leute schauen mich komisch an. Guckt ihr ruhig, denke ich, dafür muss ich euch alle nicht hören. Sämtliche Geräusche sind vollkommen ausgeblendet. Alle bis auf die Songs von Kings Of Leon. Ich starre ins Elefantengehege, das sich wie ein tiefer Graben vor mir auftut. Die Sonne strahlt fast zu warm für einen hessischen Juli.
Früher waren wir an den sogenannten Papa-Wochenenden oft im Opel-Zoo. Wir hatten Dauerkarten, und die Frau im Tickethäuschen kannte sogar Jos und meinen Namen. Als ich eben Eintritt gezahlt habe, bei einem pickeligen Teenager, der weder meinen Namen noch Höflichkeitsfloskeln wie »Hallo« und »Viel Spaß« kannte, war ich deshalb ein wenig wehmütig. Warum muss sich bloß alles verändern?
Oh Gott, ich werde nostalgisch!
Ich krame mein Handy aus der Umhängetasche, weil ich mir wünsche, irgendjemand wollte Kontakt zu mir aufnehmen. Ich fühle mich ein klein wenig albern, wie ich da auf einer Bank im Zoo sitze, ganz allein, bis auf eine Jutetasche voll mittelalterlicher Geschichte und Sprache.
Das Handydisplay ist schwarz, zeigt keine Nachrichten oder Anrufe an. Ich schiebe das Telefon in die Hosentasche.
Nachdenklich ziehe ich die Beine unters Kinn und umfasse die Knie. Mit der Hand fahre ich mir durch die Haare, die sich halb aus dem Zopf gelöst haben.
Ein Baby. Ein Baby! Er macht doch den gleichen Fehler schon wieder! Ich sehe es kommen, dass Papa genauso handeln wird wie damals, als er mit Anfang zwanzig meine Mutter geschwängert hat. Wie damals wird die Klatschpresse darüber berichten, wenn Kristin ihn schwanger zu irgendwelchen Events oder mit Säugling zu einem seiner schrecklichen Golfturniere begleitet. Das war bei Jo und mir ganz genauso! Soll es allen Ernstes noch ein Baby geben, das in zwanzig Jahren mal denken wird, dass es nur ein Mittel zum Zweck war?
Aus dem Augenwinkel bemerke ich plötzlich ein Blitzen. Ich drehe den Kopf und entdecke etwa fünfzig Meter von mir entfernt einen Mann mit einem Fotoapparat. Für einen kurzen Moment denke ich, er hätte mich fotografiert.
Was für ein Blödsinn. Ich weiß doch gar nicht, wer der Typ ist. Fremde Menschen fotografiert man nicht. Darüber steht bestimmt was im Grundgesetz. Schutz der Privatsphäre oder so ähnlich.
Er richtet das große Objektiv auf die Elefanten und lässt es erneut blitzen. Der Fotograf kommt näher. Als ihm mein Blick auffällt, grinst er freundlich. Ich verziehe die Mundwinkel zu einem klitzekleinen Lächeln und schaue in die entgegengesetzte Richtung.
Vor mir steht eine Familie mit drei Kindern. Das Jüngste jauchzt vor Freude, als sich ein Elefantenjunges aus dem Stall wagt und eine Runde durch das Gehege dreht.
Kristin ist bereits im vierten Monat. Das heißt, in weniger als einem halben Jahr ist das Baby da.
Ich weiß beim besten Willen nicht, was ich dazu sagen soll. Liebend gerne würde ich mit jemandem darüber sprechen. Aber Jo ist völlig aus dem Häuschen vor Freude, und Jonas versteht es sicher nicht. Ich will mich mit diesem Problem nicht an ihn wenden, weil ich dann sicher losheulen würde. Ich kann in seiner Gegenwart nicht weinen. Er würde mich in den Arm nehmen, Witze machen, um mich abzulenken, und irgendeine Unternehmung vorschlagen, die ich mag. Er würde alles richtig und es dadurch nur noch schlimmer machen. Manchmal ist eine Umarmung von Jonas alles, was ich will – und zugleich das Letzte, was ich gebrauchen kann.
Mein Telefon vibriert in meiner Hosentasche, und ich ziehe die Kopfhörer ab, um den Anruf anzunehmen. Es ist Jonas. Ich gehe ran und lächle ein bisschen, weil ich es für Gedankenübertragung halte.
»Hi …«
Willst du herkommen? Willst du mich doch vielleicht in den Arm nehmen? Willst du mir sagen, dass ich mich verdammt noch mal nicht so anstellen soll?
»Hey. Du, Max, bist du zufällig in der Nähe von der Hanauer Landstraße?«
»Äh, nein?!«
»Wo bist du denn dann?« Er klingt, als wäre ich sonst rund um die Uhr dort.
»Ich …« Im Taunus, auf einer Bank im Opel-Zoo, wäre die korrekte Antwort, aber weil das bescheuert klingt, schweige ich.
»Na, egal. Wenn du heute zufällig noch an der Hanauer vorbeikommst, kannst du dann an dem Musikladen haltmachen und mir zwei, drei Sets Vic Firth mitbringen? Die, die ich immer hab.«
Ich schlucke und sage: »Jonas, ich bin gerade nicht auf der Hanauer.« Mein Orientierungssinn sendet sogar die Warnmeldung, dass es kaum einen Ort innerhalb der Stadtgrenze von Frankfurt gibt, von dem ich zurzeit weiter entfernt bin.
»Ich mein ja nur. Wär halt gut, wenn ich Neue hätte. Wenn wir am Montag proben, muss ich Neue haben. Und du weißt nun mal, welche ich brauche.«
Jonas spielt Schlagzeug in einer Band, die er vor ein paar Jahren mit seinem Bruder Oli und seinem Schulfreund Daniel, den alle nur Buzz nennen, gegründet hat. Ich bin sehr oft bei den wöchentlichen Proben dabei. Und mit sehr oft meine ich: eigentlich jede Woche. Ich erfülle bei diesen Treffen keine konkrete Aufgabe. Hin und wieder schwärme ich Jonas an – gut versteckt unter großspurigen Sprüchen natürlich. Ich rede mir ein, dass die Jungs meine Meinung schätzen. Sie gehören zu meinen engsten Freunden, und ich glaube, dass ich ebenfalls ihre Freundin bin. Wie man es auch dreht und wendet, es gehört nicht zu meinen Aufgaben, Jonas ̀ Equipment zu besorgen. Soll er sich doch in die S-Bahn setzen und selbst hinfahren! Das jedenfalls hätte ich mit einem amüsierten Unterton jedem anderen meiner Freunde vorgeschlagen. Wobei ich vermute, dass mich kein anderer Freund angerufen hätte, um mich um einen – objektiv betrachtet – derart unverschämten Gefallen zu bitten.
»Vielleicht komme ich auf dem Heimweg dran vorbei.« Es ist eine Schande, dass das, was ich denke, und das, was ich laut ausspreche, oft so wenig deckungsgleich sind.
»Gut, bis dann. Bist die Beste, weißte, ne?«
Bevor ich das bestätigen, infrage stellen oder verneinen kann, hat Jonas aufgelegt.
Mit einem drückenden Gefühl im Magen setze ich die Kopfhörer wieder auf, verstaue das Handy in dem Jutebeutel und frage mich zum gefühlt millionsten Mal: Warum Jonas? Warum ich? Warum kann ich mich nicht mit unserer tollen Freundschaft begnügen? Und wo genau habe ich den Absprung verpasst?
Plötzlich berührt mich jemand an der Schulter. Ich sehe, dass der Fotograf neben mir steht und mit mir spricht. Seine Lippen bewegen sich, aber ich höre keinen Ton. Schnell schiebe ich die Kopfhörer nach hinten.
»Sorry«, entschuldige ich mich und verdränge die Miesepeter-Miene für eine kleine Sekunde zugunsten eines Miniaturlächelns.
Er ist in meinem Alter, schätze ich, hat aber ein sehr jungenhaftes Grinsen.
»Kein Ding. Ich wollte bloß fragen, ob es okay ist, wenn ich mich kurz hier drauf stelle.« Er deutet auf den freien Platz neben mir.
»Äh … ja, klar.« Ich verstaue die Jutetasche unter der Bank. Gut so. Dort kann sie mich nicht an all das erinnern, was ich noch nicht über Otto III. weiß.
Der Blitz ist jetzt ausgeschaltet, aber ich höre den Auslöser viele Male leise klicken. Zuerst glaube ich, er fotografiere das Elefantenbaby. Aber die Kamera, diesmal mit kleinerem Objektiv, ist auf die Familie gerichtet. Er fotografiert sie von oben. Als er mein Starren bemerkt, wird aus seinem Lächeln ein Grinsen. Er geht auf der Bank in die Hocke und zeigt mir das Bild, das er eben geschossen hat. Eine Nahaufnahme des jüngsten Kindes mit weit aufgerissenen Augen und einem breiten Lächeln.
Das erste ehrliche Lachen umschmeichelt meinen Mund. »Schön«, murmele ich, doch es kommt kaum mehr heraus als ein kehliges Hauchen.
Den Fotografen freut es trotzdem. Er wirkt amüsiert, als er sein rechtes Auge wieder hinter dem Sucher verschwinden lässt und weiter die vollkommen ahnungslose, aufs Glücklichsein konzentrierte Familie ablichtet.
Interessiert beobachte ich ihn dabei, wie seine schlanken Finger Knöpfchen drücken und Rädchen drehen, wie er sich auf der Rückenlehne der Bank niederlässt, das Objektiv austauscht, sich dabei die Baseballmütze vom Kopf zieht und die rötlich-blonden Strubbelhaare rauft. Er wirkt durch und durch zufrieden. Jeder Handgriff, jedes Drücken des Auslösers lässt ihn glücklich aussehen. Und ich? Ich hänge hier rum, den Kopf voller Dinge, die ich gerade an mir, der Welt und Otto III. nicht leiden kann.
Ich weiß nicht, wie lange ich ihm zusehe. Zwei, fünf oder fünfzehn Minuten. Ich weiß auch nicht, was mich an seiner Arbeit so fasziniert. Doch als er sich zu mir herabbeugt und flüstert: »Neugierig, was?«, übermannt mich plötzlich Unsicherheit. Mit einem beschämten Achselzucken schüttele ich den Kopf, schiebe mir wieder die Kopfhörer über die Ohren, schalte den iPod in meiner Handtasche auf Play und verlasse fast schon fluchtartig die Szenerie. Memo an mich: sollte mir bei Gelegenheit unbedingt mehr Selbstvertrauen und die Fähigkeit zulegen, locker mit Fremden zu sprechen. Ach ja: Wenn ich schon mal dabei bin, nehme ich auch gleich noch eine Portion Selbstachtung. Denn auf dem Heimweg fahre ich an dem Musikladen auf der Hanauer vorbei und kaufe drei Sets Schlagzeugsticks. Warum? Vielleicht weil ich Jonas eine Freude machen will. Oder einfach nur, weil ich bescheuert bin. Weil ich die tadelnden Worte meiner Freunde und von Jo seit Jahren ignoriere und mir selbst einrede, dass ich nicht aufgeben darf, da es durchaus noch im Bereich des Möglichen liegt, dass Jonas eines Tages aufwacht und plötzlich verliebt in mich ist.
Am nächsten Morgen kennt Jo nur ein Thema: Baby, Baby, Baby. Patentante will sie werden, und das Babyzimmer will sie einrichten. Eine Babyparty will sie schmeißen, ganz nach amerikanischem Vorbild, und zur Geburt will sie dem Baby ein Armkettchen mit einer Namensgravur schenken.
»Hey, Max, wenn ich dann mit dem Baby unterwegs bin, denken die Leute bestimmt, es wäre meins, oder?«
»Erstens denken die Leute eh immer, was sie wollen.
Zweitens: So abwegig wäre es gar nicht.«
»Wie meinst du das? Wirke ich etwa schwanger?« Sie streichelt ihren alles andere als schwanger aussehenden Bauch unter dem Sporttop, das sie noch von ihrer Yoga-Stunde trägt.
»Na ja, sexuell aktiv bist du immerhin schon seit ein paar Jahren. Und wenn man mal nachmittags den Fernseher einschaltet, bekommt man durchaus den Eindruck vermittelt, dass wir gut sechs Jahre über dem Altersdurchschnitt der Erstgebärenden liegen.« Ich durchforste mein Zimmer nach der Chronik über das elfte Jahrhundert, die ich aus der Unibibliothek ausgeliehen habe. Ich muss den Sonntag nutzen, um etwas mehr über diesen dämlichen dritten Otto rauszufinden.
»Sag mal, Jo, du hast nicht zufällig meine Tasche genommen?«
»Welche Tasche?«
»Diese bunte Stofftasche. Mit meinen Unisachen drin.«
»Nee.«
»Sicher? Hast du sie weggelegt? Da sind sauteure Bücher drin.«
»Nein! Was sollte ich denn damit?« Gutes Argument.
Na, super. Ich suche überall, finde die Tasche jedoch nicht. Vielleicht sollte ich Jonas anrufen und ihn fragen, ob ich sie bei ihm liegen gelassen habe, als ich gestern Abend noch kurz bei ihm war, um die Sticks abzuliefern und bei ihm zu sein. Ich hatte gehofft, bei Jonas zu sein, dumme Sprüche zu machen und Musik zu hören, würde dazu führen, dass es mir besser geht. Die Hoffnung wurde enttäuscht. Als ich Jonas die Sticks gegeben habe, hat er gesagt, er wisse nicht, was er ohne mich tun solle. Daraufhin war mir wenigstens wieder kurzzeitig bewusst, warum ich mich für ihn zum Trottel mache.
Aber als ich Jonas anrufen möchte, ist mein Handy unauffindbar.
Mit den Fingerspitzen reibe ich mir über die Schläfen und erschrecke zu Tode. Mein Gehirn hat soeben eine Eilmeldung rausgegeben: Okay, Max, reg dich jetzt bitte nicht auf, aber dein Handy war in der Stofftasche.
Ich gehe zurück in mein Zimmer, wo Jo immer noch sitzt, und will sie bitten, mir ihr Telefon zu leihen. Doch bevor ich auch nur ein Wort sagen kann, klingelt ihr iPhone mit dem Sound eines Elektro-Songs, den sie heiß und innig liebt.
»Da steht: ›Max ruft an.‹« Sie schaut mit fragendem Blick erst auf das Display und dann auf mich. »Hallo?«, fragt sie in ihr Handy, schweigt einen Augenblick und sagt dann irritiert: »Ähm, ja, Moment bitte.« Sie hält den Hörer zu und reicht ihn mir. »Jemand hat deine Tasche samt Handy im Opel-Zoo gefunden. Was bitte hast du im Opel Zoo gemacht?«
Meine Tasche samt Handy und einem Stapel superteurer Bücher! Ich bin erleichtert.
»Und warum hast du dein iPhone nicht passwortgeschützt?«
»Weil … keine Ahnung!« Wahrscheinlich damit man mich in Fällen wie diesem unter der am häufigsten gewählten Nummer erreichen kann: Jos. »Ist da der Zoo dran?«, frage ich und nehme eilig das Telefon entgegen.
»Nee, irgend so ’n Typ.«
»Hallo?«, sage ich etwas zurückhaltend in den Hörer.
»Hi«, erwidert eine fremde, nervös klingende Stimme am anderen Ende der Leitung. »Ich … ich habe deine Tasche gefunden. Im Opel-Zoo, bei den Elefanten. Vielleicht weißt du’s noch, ich hab da gestern Fotos geschossen.«
Der Fotograf!
»Oh. Äh … danke!«
»Ja, kein Ding. Also ich hab deine Tasche mit nach Hause genommen. Ich kann sie dir vorbeibringen, wenn du willst.«
»Nee, Quatsch, ich hol sie ab. Du musst dir keine Umstände machen.«
»Das ist gar kein Problem. Wo wohnst du denn? Ich bin heute sowieso unterwegs, ich … äh … ich bin Fahrradkurier.«
Dann ist der Fotograf also gar kein Fotograf?
»Dein Ernst? Das wäre … total nett.«, füge ich hinzu und zucke mit den Schultern, als Jo mich fragend ansieht. Dann nenne ich ihm meine Adresse.
»Ich bin heute in der Gegend. So gegen fünf. Ich bringe dir alles vorbei. Bis später.«
Schon hat er aufgelegt. Ich kann nicht mal mehr Danke sagen, ihn nach seinem Namen fragen oder meinen eigenen nennen.
4. Kapitel
in dem ich eine kranke Fantasie mit Leberwurst habe
Ich bin völlig ungeübt darin, einen Mann bei mir zu Hause zu empfangen. Noch dazu einen, dessen Namen ich nicht einmal kenne. Dabei muss man mir natürlich zugutehalten, dass normalerweise keine wildfremden Männer vor der Tür stehen und um Einlass bitten – GEZ-Beamte, städtische Gas-Wasser-Ablese-Menschen und die Zeugen Jehovas einmal ausgenommen. Deshalb bin ich überfordert, als der Minutenzeiger sich am Nachmittag behände auf die Fünf-Uhr-Marke zubewegt.
Der Elefantenfotograf-Slash-Jutetaschenkurier ist nach bisherigem Kenntnisstand zwar überdurchschnittlich zuvorkommend und freundlich, aber wissen kann man trotzdem nie. Wieso hat er darauf bestanden, mir die Tasche persönlich vorbeizubringen? Diese Frage hat mich nach seinem Anruf schwer beschäftigt, während Jo ganz verzückt von seiner Höflichkeit war und ich an ihn denken musste. An ihn und die Fotografie von dem strahlenden Kindergesicht, die er mir auf der Bank des Opel-Zoos gezeigt hat. Ist es traurig, wenn man sich nicht einmal mehr vorstellen kann, dass Menschen einfach nur des Nettseins wegen nett sind? Oder dient gesundes Hinterfragen der Selbsterhaltung? In letzterem Fall könnte ich gar nichts dafür, dass ich an den Motiven des Fotofuzzis zweifle.
Ich kann auch nichts dafür, dass ich allen Ernstes geduscht, mir die Haare geföhnt und dreimal das T-Shirt gewechselt habe, als der Stundenzeiger auf die Vier zeigte. Doch seltsamerweise gab es da diese Windung in meinem Gehirn, die mir aufgetragen hat, mich bloß nicht in Jogginghosen zu präsentieren. Ob auch das der Selbsterhaltung dient? Ich weiß es nicht. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass ich mich für einen GEZ-Beamten, städtischen Gas-Wasser-Ablese-Menschen oder die Zeugen Jehova nicht umgezogen hätte.
Noch bevor ich Kopf und Körper für den Fünf-Uhr-Besuch bereit gemacht habe, habe ich mit meinen verbliebenen Uni-Unterlagen den Esstisch in Beschlag genommen und eine Lerneinheit eingelegt. Der monströse, indisch anmutende Tisch aus schwarz schimmerndem Mahagoni do miniert fast unsere gesamte Wohnküche. Er steht schräg vor der rot lackierten Kücheninsel, über der eine Dunstabzugshaube schwebt, deren Brummen ich im letzten Jahr nicht sehr oft gehört habe. Die Tischplatte verschwindet nun unter einem Meer aus Papier, Notizen und aufgeklappten Büchern. In einem Anflug von Klausurpanik versuche ich seit etwa drei Stunden (unterbrochen nur durch die männerbesuchindizierte Körperpflege), meine Lateinkenntnisse wiederzubeleben. Wie im Erste-Hilfe-Kurs gelernt, pumpe ich zum Beat von »Saturday Night Fever« auf meinem klinisch toten Latinum herum und brülle theatralisch: »Komm schon! Bleib bei mir!« Doch bisher ist mir lediglich wieder eingefallen, dass ich in der Schule lieber Französisch hätte wählen sollen.
Ich brauche dringend die Jutetasche zurück. Darin befindet sich neben einer geliehenen, sehr alten Chronik über die Wallfahrten von Otto III. nämlich auch ein Buch mit dem Titel Latein für das Grundstudium. Ein Crashkurs.
Jo sitzt hinter mir auf der Couch und surft auf ihrem Tablet-PC im Internet. Wenn ich sie fragen würde, was sie da tut, würde sie sicher behaupten, sie recherchiere nach einem Studienplatz. Papa hat ihr das Ultimatum gestellt, sich für diesen September irgendwo einzuschreiben, wenn sie nicht mit schlimmen Folgen rechnen wolle. Sie hat mir nicht verraten, womit er ihr gedroht hat, aber ich spekuliere darauf, dass das Schlagwort »Kreditkarte« gefallen ist. In Anbetracht der Tatsache, dass wir bereits Juli haben, ist Jo etwas spät dran. Ich vermute stark, dass sie deshalb gerade auch eher auf den Seiten von Zalando und Co. unterwegs ist, um die gezählten Tage mit ihrer Kreditkarte noch mal so richtig zu genießen.
Ich schaue zur Uhr hinüber. Der Minutenzeiger hat die Zwölf bereits passiert. Mein Blick wandert weiter zum Spiegel neben der Eingangstür. Meine Haare sehen stumpf und langweilig aus. Na, klasse!
»Hoffst du, dass dein Spiegelbild lateinische Verben im Plusquamperfekt Indikativ Passiv deklinieren kann?« Jo muss schon den ganzen Nachmittag meinen Tiraden auf das Bildungssystem lauschen, deshalb schenkt sie mir ein nicht ganz ungehässiges Lächeln. Sie fläzt sich in einem breiten Schneidersitz im Sofa und schafft es, dabei trotzdem noch feminin und anmutig zu wirken. Wo war ich bloß, als dieses Gen verteilt wurde? Bestimmt an der Bar, an der sie die Allele für miese Haarstruktur ausgeschenkt haben.
»Verben kann man nicht deklinieren«, murre ich und knabbere am linken Daumennagel, während ich mit der rechten Hand versuche, mein Haar aufzuhübschen. Vergeblich.
»Na, siehst du! Du hast ja doch nicht alles vergessen.«
Das Türläuten schneidet mein verzweifeltes Lachen ab und lässt Jos Gesicht aufleuchten.
»Ist er das?« Sie springt auf. »Oh, lass mich aufmachen.
Bitte!«
»Nur zu«, biete ich großzügig an und spüre, wie ich tatsächlich aufgeregter werde. Eine Aufregung, die gewiss nichts mit meinem Freund Otto oder seiner Amtssprache zu tun hat.
Jo schwebt zur Tür, grinst mich noch einmal an und reißt sie dann so ekstatisch auf, als erwarte sie eine Schar durchtrainierter Spitzensportler in Muscle-Shirts.
Vor ihr steht lediglich mein Fotograf, der im Moment sehr viel mehr nach Kurier als nach Künstler aussieht. Er trägt Cargoshorts, eine Windjacke und eine wasserdichte Messenger Bag, die er langsam von den Schultern zieht. Er mustert Jo und unseren Wohnbereich äußerst interessiert.
»Hi«, grüßt er sie, öffnet den Rucksack und zieht meine Tasche heraus. »Die wollte ich hier abgeben.«
»Das ist echt lieb von dir. Meine Schwester ist schier am Verzweifeln, weil sie keine Verben mehr deklinieren kann.«
Ich verfolge, wie Jo den Rücken durchbiegt und kokett eine Hand in die Hüften stemmt. Sofortige Schlussfolgerung: Ich muss intervenieren.
Ich haste zur Tür, lege meiner Schwester eine Hand auf die Schulter und drücke sie sanft zur Seite.
»Danke«, zische ich ihr zu und widme mich dann dem neckischen Grinsen meines Retters in hochschulverzweifelter Not.
»Ich gehe dann mal«, flötet Jo, »hat mich sehr gefreut.«
»Mich auch«, sagt der Rotschopf höflich und reicht ihr tatsächlich die Hand. Manieren hat er also auch noch.
Ich folge Jo mit einem sehr genervten Blick. Sie setzt sich wieder auf die Couch und vertieft sich in ihre Suche nach einem Paar Schuhe, das zu ihren Vorstellungen und Zielen passt. Habe ich Schuhe gesagt? Ich meine natürlich Studiengang.
»Sie ist manchmal etwas durchgedreht«, sage ich mit einer winkenden Bewegung an den Kurier gewandt, weil ich irgendwie das Gefühl habe, Jos übertrieben breites Grinsen rechtfertigen zu müssen.
»Schon gut. Das finde ich cool. Ich mag durchgedrehte Leute.« Er zuckt mit den Schultern. »Leute, die mutterseelenallein auf einer Bank im Zoo fürs Studium lernen und dann ihre Bücher liegen lassen, zum Beispiel.«
Mit einem absolut werbespottauglichen Lächeln hält er mir nun die Tasche hin.
»Vielen Dank«, antworte ich und höre förmlich den Stein von meinem Herzen plumpsen. »Ich … ja … also ich schreibe bald eine Klausur für mittelalterliche Geschichte, und die Bücher hier drin sind dafür echt wichtig. Ich kann nämlich wirklich keinerlei Verben mehr deklinieren. Konjugieren! Ich meine konjugieren.«
»Ziemlich altes Lateinbuch«, sagt er und deutet auf die Tasche.
»Nein. Das ist eine Chronik über Otto den Dritten. Wurde Ende des neunzehnten Jahrhunderts verfasst.«
Das interessiert ihn offenbar weniger. Dafür interessiert mich umso mehr die Tatsache, dass er in meine Tasche geschaut hat. Ob er doch ein Stalker ist? Nein, Max, ruhig! Sieh nicht in allem das Schlechteste. Hätte er es nicht getan, dann hätte er das Handy nicht gefunden und dich nicht erreichen können. Wäre das nicht eingetreten, hättest du der absolut unerträglichen Bibliothekarin erklären müssen, wohin die Chronik über Otto III. verschwunden ist.
Damit hat mein Gewissen natürlich vollkommen recht. Besagte Bibliothekarin, die einige meiner Kommilitonen meist in einem Atemzug mit Adjektiven wie »untervögelt« erwähnen, hat mir dieses seltene, kaum ersetzbare Buch nur ausgeliehen, weil ich meinen allertreudoofsten Hundeblick aufgesetzt habe. Bei einem Verlust hätte sie mich bestimmt umgebracht. Wenn nicht Schlimmeres.
Unser Gespräch ist am Ende einer Sackgasse angekommen. Doch während ich bereit wäre, den Fotofuzzi ziehen zu lassen, greift er die Unterhaltung notdürftig wieder auf.
»Ich musste im ganzen Haus klingeln und fragen, ob jemand einen Fahrradkurier mit einer Tasche erwartet. War lustig«, sagt er zusammenhanglos. »Ich hätte dich am Telefon noch fragen sollen, wie du heißt. Oder welche Wohnung deine ist. Oder wie nennt man das hier? Loft?«
»Keine Ahnung. Ja. Loft könnte passen. Aber ich bin kein Architekt.« Ich bin so was von mies im Small Talk.
War das eben die angedeutete Frage, wie ich heiße? Will er mehr Details über unser Zuhause wissen? Interessiert er sich für den Wohnungsmarkt am Sachsenhäuser Mainufer? Will er bei uns einziehen? Ich weiß es nicht. Warum sind Männer bloß so schwierig?
»Was bist du dann?« Er hat ein herausforderndes Lächeln aufgesetzt.
»Dankbar, dass ich meine Tasche wiederhabe. Das eine Buch aus der Unibibliothek kostet vermutlich ein Vermögen.«
»Du studierst Geschichte, oder?«
Ich nicke stumm und drehe Würstchen aus den Henkeln meiner Stofftasche. Bin ich jetzt dran mit fragen? Aber ich weiß doch schon, was er macht. Er ist Fotokurier und Fahrograf … oder so ähnlich. Ob er gemerkt hat, wie schlecht ich in Small Talk bin?
Hat er. Er schwingt die Messenger Bag dynamisch zurück auf seine Schulter und verabschiedet sich. »Dann mal schönen Tag noch.«
»Danke. Auch fürs Herbringen.«
»War echt kein Ding.« Er kehrt mir den Rücken zu, wird kleiner und kleiner auf dem Hausflur, während ich in der Lofttür stehe und ihm nachsehe. Warum hab ich ihn nicht gefragt, wie er heißt? Oder ob er Feierabend hat? Oder ob er auch studiert? Ob er sich für Geschichte interessiert? Ob er mir Nachhilfe gibt? Das ganze weite Feld an Small-Talk-Fragen war vor mir ausgebreitet, und ich entscheide mich für ein saudämliches, nichtssagendes Nicken. Na, gute Nacht. Aber Hauptsache, ich habe vorher dreimal das T-Shirt gewechselt, aus lauter Nervosität und der Angst, einen schlechten Eindruck zu hinterlassen. Hätte ich ihn mal lieber in Jogginghosen empfangen und wäre dafür charmant gewesen!