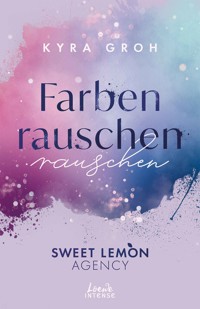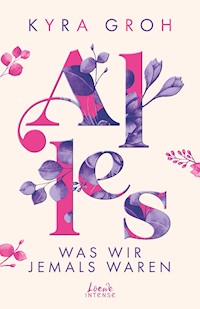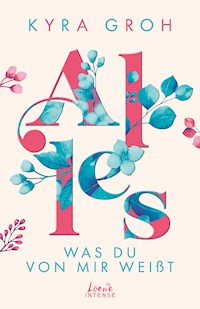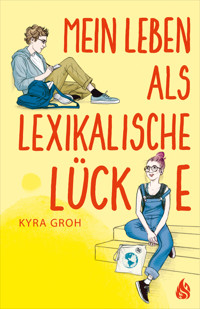
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arctis Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Benni macht ein Praktikum im Frankfurter Krankenhaus und hat Angst, dass er es nie schaffen wird: Blut abzunehmen, vom nerdigen Benni zum coolen Ben zu werden, den allgegenwärtigen Kruzifixen in der beengten Wohnung seiner Mutter zu entkommen. Eingeengt fühlt sich auch Jule, und zwar von dem Weltbild ihrer Eltern. Denn die haben absolut kein Verständnis für vegane Ernährung, Freitagsdemonstrationen oder Anti-Rassismus-Plakate. Und sie würden schon gar nicht verstehen, dass ihre Tochter eigene Ideale vertritt und Teil einer Veränderung sein möchte, die die Welt so dringend braucht. Als die beiden innerlich zerrissenen Teenager aufeinandertreffen, wird ihr Leben bunter, komplizierter, aber auch so viel erträglicher!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Kyra Groh
Mein Leben als lexikalische Lücke
Roman
© Atrium Verlag AG, Imprint Arctis, Zürich 2021
Alle Rechte vorbehalten
© Text: Kyra Groh
© Cover: Anja Stiehler-Patschan
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
ISBN978-3-03880-144-3
www.arctis-verlag.com
Folgt uns auf Instagram unter www.instagram.com/arctis_verlag
Für Nono,
das schönste neue Wort in meinem Lebenslexikon.
Sollte ich je vergessen, was es heißt, dir zuzuhören – zeige mir dieses Buch.
SobremesaSubstantiv, spanisch: die Zeit nach einer gemeinsam eingenommenen Mahlzeit, in der man noch zusammensitzt und sich unterhält
Benni
Als ich am Morgen des 1. September aus der Trambahn aussteige, bin ich mir nur weniger Dinge in meinem Leben zu einhundert Prozent gewiss. Gewissheit Nummer eins: Mein Name ist Benjamin Wecker, aber alle nennen mich Benni. Das muss sich ändern, weswegen ich mich, beginnend mit heute, nicht mehr als Benni vorstellen werde. Gewissheit Nummer zwei: Ich sehe mit meiner neuen Brille bestimmt aus wie jemand, der sich viel zu viel Mühe gibt. Gewissheit Nummer drei: Ich hätte nicht zu diesem angesagten Optiker gehen sollen. Angesagte Dinge wirken an mir einfach nicht angesagt, was daran liegt, dass alles an mir mehr oder weniger unmodisch ist. Aber irgendwie hat mich – und das wäre dann wohl Gewissheit Nummer vier – urplötzlich der Drang gepackt, etwas an mir zu verändern, um für den ersten Tag im neuen Job besser gerüstet zu sein. Also musste mein in die Jahre gekommenes Drahtgestell dran glauben. Die neue Brille habe ich für eine echt gute Idee gehalten, bis meine Mutter mich gefragt hat, ob mein Modevorbild Erich Honecker sei.
Aus irgendeinem Grund bin ich mir – fünftens – auch noch ziemlich gewiss, wie das Vaterunser geht. Seit ich aus dem Haus gegangen bin, schwirren mir die religiösen Zeilen im Kopf herum, die ich quasi aufsagen kann, seit meine Mutter mit mir den Kreißsaal verlassen hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein … bla, bla, bla. Ich habe oft Ohrwürmer von Worten, Sätzen, Zitaten und ganzen Gedichten. Doch dass ich ausgerechnet heute, wo ich mein Praktikum an einem Ort der Wissenschaft antrete, einen vom Vaterunser habe, ist wirklich äußerst unpassend. Geheiligt werde dein Name? Wohl eher: Geheiligt werde das Penicillin. Amen.
Während der Fahrt in der Straßenbahn habe ich eine Liste in mein schwarzes Notizbuch geschrieben. Darauf steht, vor der Öffentlichkeit sicher versteckt zwischen zwei ledernen Buchdeckeln:
Das Praktikum wird großartig.
2.Medizin zu studieren, ist mein Traum, mein ganz persönlicher Traum. Es hat nichts mit meinem Vater zu tun, definitiv nicht.
3.Der Uni in Groningen eine vorläufige Absage zu erteilen, war die richtige Entscheidung.
4.Mama wird es gut gehen.
5.Es wird leicht sein, im Krankenhaus Anschluss zu finden.
6.Keiner wird mich für einen Nerd halten. Oder für Erich Honecker.
7.Ich werde Leute finden, mit denen ich die Mittagspause verbringen kann.
8.Mama wird es definitiv gut gehen.
9.Niemand wird mich wegen der Brille aufziehen.
10.Es ist nicht wichtig, wie ich aussehe.
Wenn ich ehrlich bin, könnte dies genauso gut eine Liste all der Dinge sein, der ich mir nicht gewiss bin. Aber darüber muss ich mir ein andermal den Kopf zerbrechen. »Ein andermal« ist zu einer inflationär gebrauchten Floskel in meinem Sprachgebrauch geworden. Seit ich vor drei Monaten die Schule beendet habe, verschiebe ich ständig irgendwelche Entscheidungen auf »ein andermal«. Wo ich studieren werde. Wer ich sein will. Wann ich erwachsen werde.
»Kannst du mal weitergehen!«, schnaubt ein Typ mir zu.
Ich stehe mitten auf dem Gehweg vor dem Haupteingang zum Krankenhaus und bin in eine Art Trance verfallen.
»Oh, Verzeihung«, entschuldige ich mich und gehe einen Schritt zur Seite.
»Oh, Verzeihung«, äfft mich der Typ leise nach und im Vorbeigehen nennt er mich noch einen Penner. Ich ziehe entnervt einen Mundwinkel zur Seite. Nett sein fällt den meisten Menschen in etwa so schwer wie mir soziale Interaktionen. Die Tatsache, dass ich aber wenigstens in der Lage bin, höflich zu sein, gibt mir den entscheidenden Ansporn. Ich hake meine Daumen unter den Trägern meines Rucksacks ein und steige die Treppe zum Haupteingang empor.
Jetzt stell dich nicht so an und geh da einfach rein!
Meine innere Stimme hat es sich angewöhnt, in einem ziemlich ruppigen Ton zu mir zu sprechen. Aber vermutlich hat sie recht. Was ist schon dabei? Ich gehe einfach an den Empfang und stelle mich vor. Einfach hingehen und vorstellen. Einfach … Mehr denn je hasse ich den Umstand, dass man das Wort »einfach« im Deutschen sowohl als unterstützende Partikel als auch als Synonym zu »leicht« verwenden kann. Die meisten Angelegenheiten, denen man sich einfach stellen muss, sind nämlich alles andere als leicht.
Als sich die Glastüren hinter mir schließen, nebelt mich der typische Krankenhausgeruch ein, den viele Menschen so hassen. Ich mag ihn eigentlich. Vermutlich, weil ich keinerlei negative Assoziationen mit ihm verbinde. Wenn der Geruch nach Desinfektionsmitteln in meine Nase dringt, erinnert sich mein Gehirn nicht an einen Verwandten, den ich in einer solchen Umgebung verloren habe, und auch nicht an eine Blinddarm-OP, die ich in meiner Kindheit hatte. Ich war immer ein kerngesunder Junge. Das sagt meine Mutter bis heute und vermutlich wird sie es noch sagen, wenn ich einundfünfzig bin. Mein kerngesunder Junge.
Für diesen kerngesunden Jungen riecht es hier einfach nach Zukunft.
Nach der richtigen Entscheidung.
Nach Erwachsenwerden.
Die Frau am Empfang sitzt hinter einem kleinen Fenster, das sie öffnen muss, um mit jemandem zu sprechen. Sie sieht mich mit skeptischen Augen an. Was erwartet sie? Dass ich brülle »Schnell! Ein Arzt! Ich wurde angeschossen!«?
Ich harre einige Sekunden aus, erwarte, dass sie mich fragt, wie sie mir helfen kann. Doch sie fragt nicht. Sie kommt mir keinen Schritt entgegen, ich muss es wohl einfach allein hinkriegen.
»Äh … hallo, guten Morgen. Ich bin Benjamin Wecker, ich bin wegen meines studienvorbereitenden Praktikums hier?« Ich ärgere mich, dass ich am Ende des Satzes mit der Stimme hochgegangen bin, so als wäre ich mir selbst nicht sicher.
»Zweites OG, ins Personalbüro.« Sie streckt eine Hand durch das Fenster und zeigt mit einem Kugelschreiber auf einen einlaminierten Plan des Krankenhauses, der auf der schmalen Ablage des Empfangstresens aufgestellt ist. »Diesen Aufzug nehmen, zwei drücken, den Gang durch, dann links an der Inneren vorbei, ganz hinten. Ist ausgeschildert.« Sie sagt es mit der monotonen Stimme einer Frau, die in ihrem Leben schon viele Wege erklärt hat und es allmählich leid ist.
»Okay«, sage ich und füge mit einem Blick auf ihr Namensschild hinzu, »ich danke Ihnen, Frau Wrobel.«
Sie schaut jetzt noch argwöhnischer drein, zieht eine Augenbraue hoch und murmelt: »Na, da nicht für, Herr Praktikant.« Ich entschließe mich, dieser Spitze keine Beachtung zu schenken, und folge ihrer Wegbeschreibung.
Das Personalbüro ist leicht zu finden. Und auch wenn ich am liebsten schreiend davonlaufen würde, klopfe ich ohne Zögern an die geschlossene Tür und werde hereingerufen. Die Personalerin, die mich begrüßt, ist zu meiner Überraschung nur ein paar Jahre älter als ich. Maximal zweiundzwanzig. »Wollen wir einfach Du sagen? Ich bin die Rebecca, duale Studentin hier.«
Ihre unerwartete Freundlichkeit entlockt mir das erste Lächeln des Tages.
»Ja, gern«, erwidere ich. »Ich bin Benni.«
»Hi, Benni, na, dann erkläre ich dir mal alles.«
Erst als sie meinen Namen wiederholt, fällt mir auf, dass ich mich schon wieder mit dem kindischen Kosenamen vorgestellt habe, den ich endlich loswerden wollte.
Na, das fängt ja toll an, Bennilein, du kerngesunder Junge.
Jule
»Julia, nu nimm doch mal diesen bescheuerten Kasten weg!«
Wirklich nur meine Mutter nennt ein Handy noch einen Kasten. So als wäre es eine brandneue Erfindung. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie niemals Zugang zu Geräten gefunden hat, die ohne Kabel funktionieren. Sie liebt es, Predigten darüber zu halten, wie abhängig wir doch alle von diesem Kasten sind. Früher hätte es so was nicht gegeben, bla bla. Wenn es eines gibt, über das in diesem Haus wirklich viel zu viel geredet wird, dann ist es, wie viel besser »früher« alles war. Je nach Thematik kann sich dieses früher vor einem Jahrhundert, einer Dekade oder letzte Woche abgespielt haben. Hauptsache, es liegt in der Vergangenheit.
Ich schiele kurz über den Rand meines iPhones zu ihr rüber. Sie sitzt mir am runden Esstisch gegenüber und sieht mich vorwurfsvoll an. So sollte sie Papa ansehen, wenn er mal wieder an seinem Tablet rumdaddelt. Aber ich verstehe schon: Das läuft unter dem Label »Das ist etwas ganz anderes«.
Ich betrachte noch einmal kurz die »Profil Bearbeiten«-Oberfläche meiner Instagram-Seite und lese zum hundertsten Mal die Worte, die ich eben im Badezimmer für meine Bio ausgewählt habe:
JULE. 16.
FEMINIST. ACTIVIST. VEGAN.
Das bin ich. Oder? Das passt doch ziemlich gut zu mir. Oder? Was, wenn es jemand bescheuert findet? Was, wenn meine Eltern das irgendwann lesen und mich fragen, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe? Feministinnen – für meinen Vater sind das Frauen, die keinen Typen abbekommen haben, weil sie sich weigern, ihre Beine zu rasieren. Von seiner Meinung über pflanzliche Ernährung will ich gar nicht erst anfangen.
Mit einem mulmigen Gefühl irgendwo zwischen Brust und Bauchnabel ergänze ich noch das Blatt-Emoji, das die vegane Szene als Erkennungszeichen nutzt, und klicke kurz entschlossen auf »Speichern«. Mein Herz flattert ein bisschen. Ich weiß, dass das total bescheuert ist. Es ist ja nur meine belanglose Selbstdarstellung auf einer Plattform, auf der eh fast alles Fake ist. Vielleicht ist es aber auch deswegen so wichtig. Weil ich nicht mehr Fake sein will. Weil ich zu dem stehen möchte, was mir wichtig ist. »Stell dir vor, jemand klickt auf dein Profil und etwas, das du dort geschrieben hast, inspiriert sie oder ihn dazu, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.« Diese Worte hat Zeynep Aydin, die Umweltaktivistin, die meine beste Freundin Kris und ich lieben, gestern in ihrer Instagram-Story geteilt. Das hat etwas in mir ausgelöst. Es war spät, als ich die Story geschaut habe, fast schon halb zwei, aber als ich einen Screenshot davon an Kris geschickt habe, hat sie sofort geantwortet: »Sie hat recht. Wir müssen auch sichtbarer werden.«
Sichtbar. Dieses Wort erschien mir zunächst furchtbar befremdlich. Weil es in meinem Wortschatz bisher nicht gebraucht wurde. Ich benutze immer nur das Gegenteil, unsichtbar. Und vielleicht ist genau das das Problem: Zu viele Menschen denken, sie seien unsichtbar.
Eine halbe Stunde lang habe ich darüber nachgedacht, was es bedeutet, sichtbar zu sein, und mit jeder Minute schwoll das Wort in meinem Kopf an, entfaltete seine Bedeutung und wurde so viel mehr als nur ein Gegenteilwort. Also habe ich noch einmal mein Nachtlicht angeschaltet, einen Kugelschreiber gezückt und es der langen Liste an deutschen Worten hinzugefügt, deren Sinn mehr wird, wenn man darüber nachdenkt. Direkt unter: überwältigend, Erinnerungskultur und toll. Mein Notizbuch ist voll von solchen Begriffen.
Es fühlt sich aufregend, gut und besorgniserregend an, meine Ideale öffentlich und mich damit auch angreifbar zu machen. Aber vermutlich ist das die Lehrbuchdefinition von Sichtbarkeit.
»Julia, jetzt leg das Ding weg und ess.«
Leg das Ding weg und iss, will ein kleiner Teil von mir korrigieren. Aber meine Eltern mögen es überhaupt nicht, wenn ich sie verbessere. Wenn ich »klugscheiße« – wie sie es nennen. Also habe ich das schon lange aufgegeben.
Mein Vater guckt mich nicht an, als er sein Machtwort spricht, er hat sein Gesicht nämlich selbst hinter einem Ding versteckt. Einer großen, bunt bedruckten Tageszeitung, mit rot unterstrichenen Headlines in Fettschrift, dazu Bilder, auf denen täglich Autocrashs, dubiose Typen oder halb nackte Frauen zu sehen sind. Ich hasse dieses Blatt so sehr, auch wenn heute kein menschenfeindlicher Aufmacher auf dem Titel prangt. Eine bekannte Schauspielerin ist gestorben und Fotos von ihr nehmen fast die komplette Seite eins ein. In der Überschrift steht etwas von »großem Verlust« und ich muss unwillkürlich schnauben. Hätte es gestern Nacht irgendwo einen Zwischenfall gegeben, in den ein Mann mit einem nicht urdeutschen Vornamen involviert gewesen wäre, dann hätte der große Verlust dieser Prominenten das Schmierblatt herzlich wenig gekümmert. Man hätte sie auf Seite vier oder fünf verbannt und stattdessen das unverpixelte Gesicht des Mannes auf der Titelseite veröffentlicht.
Als ich nicht reagiere, knickt mein Vater das Papier routiniert mit einem Ruck seiner Handgelenke ein und sieht mich darüber hinweg vorwurfsvoll an. »Ich habe gesagt, du sollst es weglegen und essen.«
Ich will widersprechen, zu meinen Idealen stehen, ihn darauf hinweisen, dass er diese Dreckschleuder von einer Tageszeitung nicht unterstützen sollte. Doch stattdessen gebe ich klein bei. Ich platziere das Handy mit dem Display nach oben neben meinem kitschig bedruckten Frühstücksbrett (»Lächle und der Tag gehört dir!«) und starre auf das Menü vor mir. Es gibt hellrosa Mortadella, rosa gefleckte Jagdwurst und dunkelrosa Salami. Auf allen Plastikverpackungen prangt das Logo vom Discounter. Daneben Butter, Nutella und Toastscheiben, die für meinen Geschmack zu dunkel geraten sind. Mit einem gekünstelten Lächeln greife ich nach dem am wenigsten verkohlten Toast und beiße eine Ecke ab.
Mein Vater zuckt mit dem Kopf und fragt: »Sind wir hier bei armen Leuten, oder was?«
»Ich mag diese Sachen nicht.« Ein kaum merkliches Nicken zur Vollversammlung aus rosa Fleischabfall, Kuhmilch und Palmfett.
»Und wieso nicht, Miss Etepetete?«
Sag es! Sei sichtbar, Jule, sag es!
Ich zögere eine Sekunde, ringe mit mir, denke an Kris und Zeynep Aydin und meine Instagram-Bio, doch dann sage ich einfach nur: »Gerade keine Lust.«
Mein Vater schnaubt und verkriecht sich hinter dem Blatt. »Sandra, mach mal noch Kaffee.«
Er soll ihn sich gefälligst selber machen! Sag es ihm, Jule!
Aber ehe ich den Mut finde, meinen Vater darauf hinzuweisen, dass Mama nicht seine Dienstmagd ist, ist sie schon aufgesprungen, um ein Pad in die Maschine zu legen und ihm einen zweiten Kaffee zuzubereiten. Er hätte dazu nicht mal aufstehen müssen! Unsere Küche ist so klein und vollgestopft, dass er das Knöpfchen für »Große Tasse« ohne Weiteres erreichen könnte. Aber es geht auch nicht darum, ob er an die Maschine herankommt. Es geht darum, die Fronten zu klären. Er muss gleich zur Arbeit, meine Mutter macht den Kaffee, so ist der Deal.
Mir ist wieder einmal der Appetit vergangen. Selbst wenn der trockene Toast nicht viel zu fad schmecken würde, bekäme ich in dieser Atmosphäre keinen Bissen mehr herunter.
»Pah!«, macht mein Vater plötzlich und schlägt von hinten gegen die Zeitung. »›Tarek Mansour erinnert sich an seine geliebte TV-Mutter‹«, liest er vor. »›Sie wird mir so schrecklich fehlen. Ich bin stolz, dass ich drei Jahre lang ihren Sohn spielen durfte.‹ Das ist der größte Schwachsinn, den ich je im Fernsehen gesehen habe, dass sie uns den Mansour als Sohn von der … von der Dings verkaufen wollten.«
Ich kneife die Augen zusammen, weiß ganz genau, worin Papas Zorn gründet.
»Du weißt doch, wie das ist, Stefan, die wollen im Fernsehen jetzt alle immer politisch korrekt sein«, wirft Mama ein, doch in ihrem Tonfall fehlt jede Spur von echtem Aufklärungswillen. Sie macht sich lustig. Meine Eltern haben die TV-Verwandtschaft der verstorbenen Schauspielerin und ihres Film-Sohns schon häufiger diskutiert. Sie sprechen sowieso ständig darüber, was wie im Fernsehen zu sehen ist. Eigentlich ist das auch kein Wunder. Fernsehen ist praktisch das einzige gemeinsame Hobby, das meine Eltern haben.
Mein Vater schnaubt noch einmal laut seine Missbilligung darüber hinaus, dass der Sohn der berühmten deutschen Schauspielerin nicht von einem Hans Müller oder Daniel Bauer gemimt wird, und nimmt dann die neue Tasse Kaffee entgegen. Ich würde ihm gern sagen, dass das Getränk, das er da zu sich nimmt, im Gegensatz zu Tarek Mansour keineswegs aus Deutschland kommt und er damit doch auch kein Problem hat. Aber ich weiß schon, dass er dann sagen würde, dass das »was anderes ist«.
Benni
Rebecca ist außerordentlich nett. Zwar nennt sie mich jetzt Benni, aber das habe ich mir selbst eingebrockt. Ich werde noch als Benni vor den Traualtar treten und auf meiner Todesanzeige wird ebenfalls dieser Name stehen. Und wahrscheinlich werde ich auch niemals aufhören, mein Leben in christliche Sakramente zu unterteilen, obwohl ich überhaupt nicht mehr an Gott, geschweige denn an die katholische Kirche glaube. Kann ich eigentlich irgendetwas durchziehen, das ich mir selbst vorgenommen habe?
Wie um mich zu erinnern, dass die Antwort auf diese rhetorische Frage »Nein« lautet, führt Rebecca mich in eine Art Pausenraum und stellt mich vor: »Hallo, ihr Lieben, ich bringe euch den Benni vorbei.«
Der Benni, also ich, verpasst den Moment, etwas wie »Ihr könnt auch Ben zu mir sagen!« einzuwerfen, und grüßt stattdessen schüchtern: »Hallo …« Um es noch ein bisschen unprofessioneller zu machen, bleibt mir die Hälfte dieser jämmerlichen fünf Buchstaben im Hals stecken und meine Stimme bricht.
»Der Benni ist für die nächsten sechs Monate bei uns … sechs Monate stimmt doch, Benni, oder?«
»Ja. Stimmt.«
»Super. Also, ich übergebe dich jetzt mal dem Benil«, sie deutet auf einen Bär von einem Mann, der direkt neben uns an einem hellgrünen Tisch ein Käsebrot verspeist. Benil schaut ein wenig genervt auf und Rebecca grinst. Ich weiß sofort, dass sie jetzt einen Witz über die Kombination unserer Namen machen wird. Benni und Benil, das klingt zusammen nämlich wie das Moderatorenduo einer Kinder-Quizshow.
»Benni und Benil«, gluckst sie dann auch sofort, »das passt ja super! Ihr werdet bestimmt ein Megateam.« Benil verzieht das Gesicht noch ein wenig mehr, was ihn noch genervter, noch bärenhafter und vor allem ganz und gar nicht wie einen Kindershow-Moderator aussehen lässt. Er erhebt sich ächzend von dem Stuhl, der unter seinem massigen Körper die Dimensionen eines Grundschulmöbels annimmt. Benil ist mindestens einen Meter fünfundneunzig groß und wiegt locker doppelt so viel wie ich. Viele Menschen – Männer wie Frauen – sind größer und schwerer als ich. Ich kämpfe schon immer mit meinem Gewicht. Die Tage, an denen ich über sechzig Kilo wiege, sind selten, meistens falle ich darunter. Meiner Mutter missfällt das sehr. Oft setzt sie bei meinem Anblick ein vorwurfsvolles Gesicht auf und sagt so etwas wie: »Ich muss dich aufpäppeln, Bennilein«, und dann gibt es eine Woche hochkalorische Gerichte mit Fleisch und Fettaugen. Super.
Kaum ist Rebecca weg, wünsche ich sie mir zurück. Es war irgendwie angenehm, jemanden mit im Raum zu wissen, der genau wie ich nicht vom medizinischen Fach ist. Und der ebenfalls unter einhundert Kilo wiegt. Benils Präsenz jagt mir Angst ein. Ich komme bei diesem Typ Mann oft nicht gut an. Bei dieser Art maskulinem Homo sapiens, die von Motorrad- und Aftershavewerbung angesprochen werden soll. Wobei ich den vermutlich total netten Benil hier gerade absolut nach seinem Äußeren vorverurteile, was kein guter Schachzug von mir ist. Nur weil Benils Bartschatten darauf hindeutet, dass er die Klinge in seinem Nassrasierer etwa neunzig Mal so oft wechseln muss wie ich, heißt das noch lange nicht, dass er ein Chauvi ist. Vor allem, weil ich eh kein Maßstab in Sachen Rasierklingenverbrauch bin. Ich brauche meinen Rasierer praktisch nie und besitze nur einen, weil meine Mutter es für ein irrwitziges Geschenk zum Namenstag gehalten hat. Dass ich Geschenke zum Namenstag erhalte, ist so eine andere Sache, die mich nicht gerade zu einem Maßstab macht.
Benil schiebt sich den Rest seiner Stulle in den Mund und sagt dann knapp: »Ich hoffe, du weißt, worauf du dich hier einlässt.« Als hätte er meine Gedanken gelesen oder einen Blick in mein Notizbuch geworfen, hat er genau ins Schwarze getroffen.
Ich sage einfach nur »Ähm«, weil meine Wortgewandtheit, die mir meine Grundschullehrerin schon im Zeugnis der ersten Klasse attestierte, zurzeit anscheinend nicht abrufbar ist.
»Na, wir wer’n ja sehen.« Er geht an mir vorbei aus dem Raum, hält hinter der Tür kurz inne und betätigt den Hebel eines Desinfektionsmittelspenders, der auf Brusthöhe angebracht ist. »Kommst du jetzt oder hast du’s dir doch anders überlegt?«
Ich folge ihm, reiße dabei einen Stuhl um und stolpere fast. Na, das würde noch fehlen, dass ich an meinem ersten Tag im Krankenhaus mit einem Kieferbruch selbst eingewiesen werden muss. Benil kichert, ein Geräusch, das seltsam hoch wirkt, als es aus seinem großen Körper kommt, und geht dann den Gang entlang. In Eile verlasse ich den Raum, betätige ebenfalls den Hebel, spritze mir das Desinfektionsmittel gefühlt überall hin, nur nicht in die Handinnenfläche, und imitiere dann die Art und Weise, wie Benil die Flüssigkeit verreibt. Dass ich einen Patienten mit eingeschleppten Streptokokken oder etwas Derartigem infiziere, würde mir noch fehlen.
Mit welchem Programm ich an meinem ersten Tag gerechnet habe, kann ich nicht genau sagen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich es mir vielleicht ein bisschen wie eine Einschulungszeremonie vorgestellt. Mehrere Praktikanten, die nebeneinander aufgereiht und nacheinander zum Klassenlehrer – oder eben zum Praktikumsbeauftragten – gerufen werden, wo sie formell begrüßt und in die Arbeit eingeführt werden. Doch Benil scheint nicht der Typ für ein festliches Zeremoniell zu sein.
Für einen ausführlichen Anfängerkurs übrigens auch nicht. Sein Motto scheint eher »Learning by doing« zu sein, denn er lässt mir keine drei Minuten Zeit, um mich zu akklimatisieren. Er führt mich in einen Raum mit Spinden und fragt, ob mir jemand gesagt habe, dass ich mein eigenes Schloss mitbringen muss. Als ich verneine, seufzt er nur: »Typisch.« Ich weiß, dass dieser Tadel nicht an mich gerichtet ist, aber es fühlt sich trotzdem so an. Er zieht eine Schublade an einem vergilbt aussehenden Aktenschrank auf und gibt mir daraus ein Vorhängeschloss, in dem ein Schlüssel steckt.
»Ausnahmsweise«, mahnt er wortkarg. »Morgen bringst du dein eigenes mit.« Erneut will ich mich nicht persönlich angegriffen fühlen, tue es aber trotzdem. Vermutlich bin ich einfach nur zu empfindlich.
»Arbeitskleidung hast du vermutlich auch keine, oder?«
Habe ich nicht. Ich erhalte auch hier eine Leihgabe und muss versprechen, mich mit eigener Pflegerkleidung einzudecken. Dann muss ich mich vor Benil umziehen und meine Straßenkleidung in den Spind packen, was mir ziemlich unangenehm ist. Nicht nur, weil ich so dünn bin, sondern auch, weil ich mich in mehr als einem Sinne unbedeckt fühle. Zunehmend kommt es mir vor, als hätte ich ein wichtiges Schreiben mit Vorabinformationen nicht erhalten. Oder als hätte ein Briefing-Meeting stattgefunden, zu dem ich nicht eingeladen wurde. Das wäre nichts Neues für mich, ich wurde in den bisherigen achtzehn Jahren meines Lebens schon zu diversen Events nicht eingeladen.
Mit der Liste an Dingen, die ich nicht mitgebracht habe (Vorhängeschloss, Arbeitskleidung, Information, Erfahrung, Hoffnung), wächst auch Benils Unmut, mich auf seinem anstehenden Rundgang mitzuschleppen. Als wir den Raum mit den Spinden verlassen, trippele ich in meiner zu großen, geliehenen Kleidung hinter ihm her und spüre förmlich seine Abneigung. Dennoch folge ich stur seinem breiten Rücken und frage mich, wie mein Dad es fände, dass ich heute hier bin.
Dieser Gedanke macht alles ein bisschen besser.
Jule
Ich habe mir die Oberstufe irgendwie hoffnungsvoller vorgestellt. Ich dachte, es läge zwei Jahre lang ein gewisses Gefühl von Endgültigkeit in der Luft, kombiniert mit einer frischen Brise von etwas Neuem, das bereits am Horizont aufzieht. Stattdessen wabert dieselbe schlechte Laune wie in den vorangegangenen zehn Jahren in der abgestandenen Luft herum und die einzige Brise, die ich wahrnehme, ist der Dunst von altem Frittierfett aus der Cafeteria. Alle sagen immer, dass man die Schulzeit später mal vermissen wird. Doch was genau meinen sie damit? Ich werde es vermissen, tagein, tagaus meine Freunde um mich zu haben. Aber etwas anderes als das? Das kann ich mir beim Anblick der Wochenkarte unserer Schulküche nur schwer vorstellen. Hackfleisch war diese Woche anscheinend im Sonderangebot. Es wird in Form von Chili con Carne, als Auflauf und als etwas, das sich Hack-Pizza schimpft, angeboten.
Nach unserem schrecklichen Familienfrühstück (bei dem zum Glück mein Bruder nicht anwesend war, sonst wäre mir vermutlich wirklich der Kopf explodiert) und zwei Doppelstunden in Mathe und Englisch stehe ich jetzt also gemeinsam mit meinen Freunden vor den Türen der Cafeteria und fühle mich auch hier kulinarisch nicht so ganz abgeholt.
Vielleicht sollten wir anfangen, uns für mehr vegetarische Alternativen einzusetzen, überlege ich. Vor Kurzem habe ich mit Kris angefangen, T-Shirts und Stoffbeutel zu bedrucken. Kris’ Mum ist Künstlerin und mit ihrer Hilfe konnten wir uns ein kleines Siebdruck-Set kaufen. Am liebsten denken wir uns Motive und Sprüche aus, mit denen wir gesellschaftliche Totalausfälle verarbeiten, und wir werden immer besser darin, die Designs zu erstellen und auf Stoff zu bringen. Wir könnten doch eine neue Kollektion entwerfen, mit der wir der heiligen Dreifaltigkeit des Hackfleischs an unserer Schule den Kampf ansagen?
Ich bin schon im Begriff, diese Idee vorzuschlagen, bremse mich jedoch im letzten Augenblick. Es könnte die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass ich unsere bereits vorhandenen Produkte nicht allzu oft trage. Was ich aber ändern möchte, das nehme ich mir fest vor. Ich bin wirklich stolz auf unsere Arbeit, weil ich durch sie endlich das Gefühl habe, etwas zu bewegen. Seit gut einem Jahr beschäftige ich mich mehr und mehr mit aktivistischen Themen. Ich habe alles über den Klimawandel gelesen, was ich finden konnte, und jede Doku über Veganismus angeschaut, die mein Magen verkraftet hat. Doch erst das T-Shirt- und Taschen-Projekt mit Kris hat mir das Gefühl gegeben, nicht nur eine von denen zu sein, die stumm dabei zusehen, wie der Planet den Bach runtergeht. Aber egal, wie viel ich lese, sehe oder unternehme, es fällt mir schwer, öffentlich zu meinen Idealen zu stehen und sie wortwörtlich zur Schau zu tragen. Kris hingegen ist das scheißegal. Sie steht darauf, Leute zu provozieren, und würde sich Taschen umhängen, die viel krassere Botschaften verkünden als »Not your Mum, not your milk«. Sie kann alles tragen, nicht nur im modischen Sinne. Kann im Sinne von »sie hat die Möglichkeit dazu«. Weil sie eben eine coole Künstler-Mum hat (die sie sogar Mum nennt), die ihr Dreadlocks und Piercings und jede Art von Kleidung erlaubt. Kris’ Mutter ist stolz auf sie, wenn sie einen Spruch wie »Feminism is my Second Favourite F-Word« raushaut und ihn in neonpinker Druckfarbe auf ein weißes T-Shirt bannt. Ich will nicht sagen, ich würde einen Mord begehen, um so eine Mutter zu haben. Aber ich würde schon eine leichte bis mittelschwere Straftat dafür verüben. Dass es bei mir zu Hause so ganz anders abläuft als bei Kris, macht es mir oft schwer, richtig offen zu meiner besten Freundin zu sein. Obwohl ich ihr nach einer Situation wie heute Morgen am Frühstückstisch am liebsten sofort eine Sprachnachricht aufnehmen würde, in der ich mich zwischen Verzweiflung und Zynismus über den Alltagsrassimus meiner Eltern aufrege. Aber ich kann nicht. Falsch, ich könnte schon – im Sinne des Wortes –, aber ich traue mich nicht. Was, wenn sie es auf mich überträgt? Was, wenn sie dann nicht mehr mit mir befreundet sein möchte?
Nicht nur Kris würde mich vermutlich aus ganz anderen Augen betrachten, wenn sie wüsste, wie meine Familie tickt. Auch ihr Freund Lennard und unser gemeinsamer bester Freund Niklas, den allerdings niemand so nennt, hätten ganz klar etwas gegen die Einstellung meiner Eltern. Immerhin sind Kris und Lenn letztes Jahr auf einer Demo gegen ein neues, nicht zufriedenstellendes Klimagesetz zusammengekommen. Und Niklas sieht schon aus wie der wahr gewordene Albtraum meiner Eltern. Er hat lange gewellte Haare und seit einer Weile einen für sein Alter ungewöhnlich dichten Vollbart. Weil er damit an Jesus erinnert, haben wir ihm einen neuen Kosenamen verpasst: Jesus – allerdings in der englischen Betonung. Und damit das unweigerlich klar wird, haben wir Niklas’ Spitznamen in Lautschrift transkribiert. Inzwischen nennt ihn jeder nur noch Dschieses.
»Manchmal frage ich mich ja, ob sie wenigstens jeden Montag eine neue Fleischpampe aufsetzen oder ob die Bolognese die klein gehäckselte Hack-Pizza von der Woche davor ist.« Dschieses steht ganz außen in unserer Viererkette und wirkt wie immer ernst und belustigt zugleich. Eigentlich eine unpassende Kombination, aber wenn man aussieht wie Jesus, der eine Vintage-Adidas-Jacke trägt, ergibt sie Sinn. »Ich meine: ernsthaft? Wo fängt diese Kette an? Beinhaltet unsere Bolognese vielleicht noch mikroskopisch kleine Stückchen der Hack-Pizza, die schon unsere Eltern hier verspeist haben?«
»Dschieses!«, flucht Kris. Es passt einfach perfekt, dass man seinen Namen auch als Fluch verwenden kann, denn Dschieses sagt oft Dinge, für die er einen Anpfiff verdient. »Kannst du bitte aufhören, mir diese Gedanken in den Kopf zu pflanzen? Seit Trump Präsident ist, kann ich auch so nachts schon kaum mehr schlafen!«
»Es gibt auch noch belegte Brötchen«, überlegt Lenn mit einem erneuten Blick auf die ausgehängte Speisekarte.
»Auf denen Salatblätter liegen, die unsere Eltern schon auf ihren Tellern haben liegen lassen«, kommentiere ich. Wir vier werfen uns Blicke zu und lachen dann.
»Lasst uns einfach in den Supermarkt gehen. Wenn ich nicht gleich etwas Essbares sehe, das nicht aus Hack gemacht ist, dann kotze ich.« Kris nimmt Lenn und mich je an eine Hand, ich greife nach Dschieses’ heiliger Rechter und so gehen wir raus aus dem Schulgebäude und machen einen kurzen Spaziergang zum benachbarten Laden.
Auf dem Weg laufen Kris und ich ein paar Meter hinter den Jungs her (wir laufen schließlich nicht dauerhaft in kitschiger Handketten-Formation herum) und unterhalten uns noch einmal über die bewegende Instastory unserer Lieblingsbloggerin von gestern.
»Zeynep hat einfach recht!«, ruft Kris zum x-ten Mal. »Wenn man tagein, tagaus die Klappe hält, darf man sich nicht beschweren, dass die Welt immer beschissener wird.«
Zwei Frauen im Oma-Alter kommen uns entgegen und sind mit uns genau dann auf einer Höhe, als Kris das Wort »beschissener« ausspeit. Sie gucken pikiert und drehen im Vorbeilaufen die Köpfe zu uns um.
»Das meine ich!«, sagt Kris daraufhin so laut, dass die Omis es einfach hören müssen – selbst wenn sie auf beiden Ohren halb taub sind. »Es gibt immer noch Leute, die so tun, als wäre es ein Verbrechen, eine Sechzehnjährige zu sein, die ihre Meinung sagt.«
Ich sehe ihnen nach und bemerke, wie eine der Frauen tadelnd den Kopf schüttelt. Vermutlich sind wir für sie der Inbegriff »der Jugend von heute«, von der sie in den Medien gelesen hat, dass sie die Schule schwänzt, nur weil die Eisbären bald keine Heimat mehr haben. Vor allem Kris’ Außenwirkung ist für konservativere Menschen oft gleichbedeutend mit Verlotterung und schlechtem Benehmen. Dabei haben Kris’ Nasenpiercing, die Dreadlocks und die engen, karierten Leggings natürlich überhaupt nichts mit ihrem Benehmen oder gar ihrer Intelligenz zu tun. Sie ist nämlich einer der cleversten Menschen, die ich kenne. Sie ist die Beste in unserem Jahrgang, gut in Sprachen, Geistes- UND Naturwissenschaften. Selbst in Sport und natürlich in Kunst. Kris ist ein Universalgenie, so wie E.T.A. Hoffmann, dessen Buch Der Sandmann wir gerade in Deutsch durchnehmen. Kris könnte die Entstehungsgeschichte der EU aufsagen und nebenher noch eine PowerPoint-Präsentation über aromatische Kohlenwasserstoffe halten – und das alles, während sie auf dem Stufenbarren etwas vorturnt. Ich bin okay in der Schule, würde ich sagen, aber nur, wenn man meine Noten als Mischkalkulation betrachtet. Ich bin gut in Sprachen und allen Fächern, in denen man etwas durch Wortmeldungen ausgleichen kann (Geschichte und Politik zum Beispiel), aber ich habe überhaupt keinen Peil von Mathe und Physik. Ich verstehe zeitweise nicht mal, worin bei diesen Fächern überhaupt der Unterschied besteht. In einem Essay von einer feministischen Schriftstellerin, den ich mal gelesen habe, hieß es, dass es ein strukturelles Problem sei, dass Mädchen häufiger gut in Sprachen und dafür schlecht in Mathe sind, während es bei Jungs andersherum ist. Uns Mädchen würde nämlich von Anfang an klargemacht werden, dass es wichtiger ist, Konversation zu betreiben, als Kurven zu diskutieren. Wenn da etwas dran ist, bin ich wieder einmal kein besonders gutes Beispiel, um das Patriarchat Lügen zu strafen. Ich bestätige einfach nur die Regel.
Benni
Mein Vormittag ist eine nicht enden wollende Aneinanderreihung von Stolperfallen.
Ich gehe nicht mehr, ich falle nur noch. Von einem Krankenzimmer ins nächste. Von einer unangenehmen Situation in die andere. Vom Neuen ins noch Neuere. Nicht ein Erlebnis an diesem Vormittag ist mir bekannt. Dabei kann ich ahnen, dass der heutige Vormittag im Vergleich zu den sechs Monaten, die mir noch bevorstehen, nur ein kleines Horsd’œuvre ist. Benil ist Pfleger auf der Abteilung für innere Medizin. Und die soll mal mein Fachgebiet werden. Wieso, weiß ich nicht genau, vermutlich, weil es sehr umfassend ist. In einem drin gibt es ja recht vieles, das krank werden kann, und ich mag Herausforderungen. Das war schon in der Schule so: Sollte ich ein Referat über den 14. Juli halten, habe ich über die komplette Französische Revolution referiert. Fragen mich Mädchen, wie es mir geht, sage ich nicht nur schlicht »gut, und dir« – ich antworte tatsächlich, meist mit einer Menge Details (zumindest, wenn ich nicht zu aufgeregt bin, um überhaupt etwas zu sagen), die erfahrungsgemäß niemanden interessieren, schon gar nicht Mädchen. Nicht mal normal lange Sätze kann ich bilden, ich muss einfach immer übertreiben. Meine Mutter sagt, das mache mich zu einem sehr klugen jungen Mann. Meine Erfahrung sagt mir: Es macht mich zu einem absoluten Vollnerd, der nur wenige Freunde hat und in seinem ganzen Leben erst ein Mal mit Zunge geküsst hat.
Ich habe Benil dabei beobachtet, wie er Medikamente verteilt, Spritzen verabreicht und mit zwischen die Finger genommenen Tropfkammern die Lauflänge einer Infusion kontrolliert hat. Wenn wir ein neues Zimmer betreten, sagt er: »Ich habe heute einen Praktikanten dabei, wundern Sie sich nicht, Frau Soundso, der beißt nicht, der will hier nur was lernen.« Diesen Satz sollte ich mir wohl auf mein Namensschild schreiben: »Ich beiße nicht, ich will hier nur was lernen.« Wir müssen sehr schnell von Bett zu Bett eilen und haben kaum Zeit für Erklärungen oder gar für Small Talk. Manche Patienten sehnen sich regelrecht nach einem Gespräch, andere gucken kaum hin, wenn Benil ihnen eine Tablettendose anreicht. Manche der Gesprächigeren möchten mich in eine Unterhaltung verwickeln, in der jedes Mal mein Alter zum Thema wird. Die Älteren schätzen mich alle viel zu alt ein und fragen, was ich studiere oder ob ich ein fertig ausgebildeter Pfleger sei. Die weniger betagten Patienten hingegen halten mich alle für jünger, als ich in Wahrheit bin. Eine Frau Mitte zwanzig, der gestern der Blinddarm herausgenommen wurde, will wissen, ob ich hier gerade mein dreiwöchiges Schulpraktikum mache, woraufhin ich so baff bin, dass ich sie mit weit aufgerissenen Augen ansehe.
»Mund zu, es zieht«, raunt Benil mir zu. Er mag Floskeln. Das ist mir schon aufgefallen. Seit wir losgezogen sind, hat er zu fünf verschiedenen Patienten bei der Tablettenausgabe gesagt: »Heute gibt’s drei zum Preis von zweien.« Und mehr als einmal habe ich ihn sagen hören: »Sie haben heute aber ’nen ordentlichen Zug drauf«, wenn eine Infusion schon weiter aufgebraucht war, als er es offenbar erwartet hatte.
Weil ich nicht besonders schlagfertig bin, schließe ich auf Benils Kommentar hin nur meinen Mund, schaue beschämt aus dem Fenster und sage dann kleinlaut zu der Frau ohne Blinddarm: »Ich bin achtzehn.«
»Oh«, sagt sie. Diese Reaktion deckt sich mit meiner. Denn ich bin es zwar gewohnt, dass mir niemand mein wahres Alter ansieht. Doch dass sie mich für einen Schülerpraktikanten hält, kränkt mich schon sehr. Soweit ich weiß, steht diese Art Berufsschnupperkurs laut Schulplan nämlich in der achten Klasse an. Ich war dreizehn, als ich den absolviert habe. Ich sehe nicht aus wie dreizehn. Oder?
Der Gedanke lässt mich nicht los …
Ab halb zwölf verteilen Benil und ich gemeinsam das Mittagessen. Für die meisten Patienten gibt es verkochte Kartoffeln und Kaisergemüse mit einer Soße, deren Farbe der des Krankenhausfußbodens erstaunlich nahe kommt. Vielleicht, damit man es nicht direkt sieht, wenn etwas heruntertropft. In der Soße liegt ein dünnes Stück Fleisch. Mich interessiert, ob die Patienten theoretisch auch ihr eigenes Essen zu sich nehmen dürften. Ob es möglich wäre, sich eine Pizza kommen zu lassen oder einen Verwandten mit einer Tupperdose herzubeordern. Aber ich habe das Gefühl, dass ich diese Frage lieber nicht laut stellen sollte. Die Redensart »Irgendwo anders sterben Menschen« kommt mir dabei in den Sinn und sie scheint einen nie geahnten Wahrheitsgehalt zu haben. Irgendwo anders sterben Menschen bedeutet hier nicht nur, dass es wichtigere Probleme gibt als Mittagessen. Hier sterben wortwörtlich Menschen. Während ich über Tupperdosen nachdenke.
Ich bin überfordert.
Benils Reaktionen helfen mir nicht gerade dabei, das zu ändern. Er lässt unterdrückte Seufzer los, wenn ich extra langsam gehen muss, um auf den Essenstabletts nichts zu verschütten. Er guckt komisch, wenn Patienten mich nach Inhaltsstoffen der Mahlzeit fragen und ich verwirrt um seine Hilfe bitte. Er sagt dann so etwas wie: »Herr König, Sie haben den Essensplan doch bekommen, Ihre Tochter hat Kassler für Sie ausgesucht.« Aber Herr König und seine Gleichgesinnten können sich meist nicht mehr erinnern. An ihre Töchter oder ans Kassler oder an beides.
Als Benil den Karren mit dem Mittagessen eine Tür weiter schiebt und ungefähr zum zehnten Mal seufzt, eröffnet er mir: »Kleiner, dir steht auch ’ne Mittagspause zu. Erster Tag. Da machen wir mal halblang, okay?« Es fühlt sich an, als wolle er mich loswerden, schließlich sind wir noch gar nicht fertig mit dem Verteilen der Speisen. Im ersten Moment fühle ich mich nutzlos und dumm. Ich fühle mich oft nutzlos. Normalerweise erlebe ich solche Momente aber auf Partys oder wenn es darum geht, in ein Sportteam gewählt zu werden. Dass ich mir zu dumm oder nicht klug genug für etwas vorkomme, passiert hingegen selten. An dieses neue Gefühl muss ich mich erst gewöhnen. Vielleicht ist deshalb ein kleiner Teil von mir erleichtert, als Benil mich in die Pause schickt. Ich täusche keinen Widerwillen vor oder zeige mein Bestreben, bereits am ersten Tag Überstunden zu schieben. Stattdessen starre ich auf den Boden und murre: »Okay.«
Ich lasse Benil bei dem Ausgabewagen allein und verziehe mich in den Raum, in dem ich meine Sachen eingeschlossen habe. Außer mir ist niemand hier, den ich fragen könnte, wie die Mittagspause verbracht wird. Es gibt natürlich eine Art Cafeteria hier im Krankenhaus, aber dort gehen bestimmt nur die Besucher hin. Breche ich eine Etikette, wenn ich dort ebenfalls zu Mittag esse? Verdammt … Ich wusste, dass das Thema Mittagessen zum Problem wird. Mein Leben imitiert einfach zu oft amerikanische Highschool-Komödien: Dein Status als Mensch entscheidet sich danach, wo und mit wem du den Lunch einnimmst.
Ich öffne mein geliehenes Schloss und ziehe meine Jacke und meinen abgegriffenen Schulrucksack aus dem Spind. Kurz bin ich verunsichert, ob ich meine ebenfalls geliehene Kleidung anbehalten darf oder ob sie mit Keimen verunreinigt wird, wenn ich mit meinem mitgebrachten Pausenbrot daraufkrümele. Vorsichtshalber ziehe ich mich also um.
Im Aufenthaltsraum, in den mich Rebecca vorhin gebracht hat, sind ein paar Personen in Arbeitskleidung. Pflegerinnen und Pfleger, die miteinander sprechen und schnell einen Kaffee trinken. Ein paar sehen hoch, als ich vorbeigehe und einen schüchternen Blick in den Raum werfe. Mir fällt besonders eine von ihnen auf. Klein, zierlich und mit rotblonden Haaren. Sie erinnert mich an eine Klassenkameradin, in die ich eine Zeit lang geglaubt habe, verliebt zu sein. Aber dass eine meiner damaligen Schulfreundinnen Gefühle zu mir erwidern würde, war ebenso unrealistisch, wie dass ich binnen eines Vormittags durch Zauberhand erlerne, fünf Tabletts mit Krankenhausfraß auf einmal zu balancieren. Also habe ich das vermeintliche Verliebtsein irgendwann bleiben lassen. Überhaupt: Aus manchen sozialen Gepflogenheiten sollte ich mich einfach per se raushalten. Ich kann es schlicht und ergreifend nicht. Verlieben. Flirten. Über mein Alter reden. Essen verteilen. Allesamt fremde Begriffe in meinem recht gut sortierten Vokabular.
Die Rothaarige schaut auf und lächelt mir zu.
Jetzt, Benni, denke ich, jetzt ist die Chance, sie zu fragen, wo und wann und mit wem man hier normalerweise die Mittagspause verbringt! Doch kein Ton verlässt meine Kehle.
Super, klar, wieso auch nicht, Benni, sei einfach wieder der Weirdo.
Ich versuche mich an meine Liste von heute Morgen zu erinnern. An die Versprechungen, die ich mir selbst gemacht habe. Ich blicke beschämt auf meine Schuhe und gehe eilig den Flur entlang gen Aufzug.
Der ganze Vormittag hat sich angefühlt wie ein einziges großes Loch in meinem Magen. Wie die flaue Leere, die man empfindet, wenn man beim Herabsteigen einer Treppe eine Stufe verpasst. Ein kurzer Hüpfer, eine Panik und dann Erleichterung.
Denn das bin ich, als ich durch den Haupteingang nach draußen gehe und den ersten Zug desinfektionsmittelfreier Luft einatme – erleichtert. Keine vier Stunden hat es gedauert, dass ich mich wie ein größerer Versager fühle, als ich es während meiner gesamten Schulzeit je war. Und das soll schon was heißen. Nur dass ich da noch einen Freund hatte, mit dem ich die Zeit außerhalb des Unterrichts verbringen konnte. Jetzt laufe ich allein zum benachbarten Supermarkt, um mir still und heimlich ein Mittagessen zu kaufen.
Mann, ich bin so ein Versager.
Jule
Wenn meine Mutter davon spricht, dass zwei Menschen sich ineinander verknallen, dann benutzt sie die Worte »Sie haben ein Auge aufeinander geworfen«. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich als Kind total angeekelt von dieser Bezeichnung war, weil ich mir zu bildlich vorstellte, wie sich jemand den Augapfel aus der Höhle reißt und ihn seinem Schwarm an den Schädel donnert. Keine besonders romantische Vorstellung. Da hat mir die Floskel »Liebe auf den ersten Blick« schon immer besser gefallen. Am liebsten mag ich jedoch den französischen Begriff: coup de foudre – Blitzschlag. Denn so stelle ich sie mir vor, die Liebe auf den ersten Blick. Wie ein einschlagendes Himmelsgeschoss. Etwas, das Funken sprüht. Wenn ich es mir recht überlege, hat Verliebtsein in meiner Welt also sehr viel mit brachialer Sprache und Gefahrenquellen zu tun. Vielleicht meide ich das Verliebtsein ja genau deswegen, weil es mir zu gefährlich vorkommt.
Das heißt: bis heute. Bis jetzt. Bis wir die Straße zu unserem Stamm-Edeka überqueren, während Lenn und Dschieses lautstark darüber diskutieren, ob sie sich Brezeln und Paprikachips oder Knusperstangen und Schokocookies kaufen sollen. Bis ich diesen Jungen sehe.
Auf einem Platz schräg vor dem Haupteingang zum Markt stehen ein schwarzer, mit einem Hipster-Logo beschrifteter Foodtruck und einige Partybänke, an denen die Gäste fett belegte Burger serviert bekommen. Genau dort sitzt er. Ganz am Rand. Vor sich eine halb aufgegessene Laugenstange, von der er geistesabwesend ein paar Salzkörner abpickt, und ein Becher mit Kaffee. Er sitzt im Schneidersitz auf der schmalen Bank, den Kopf so nachlässig auf der Hand abgestützt, dass ihm seine braune Hornbrille ganz schief auf der Nase hängt. Das Haar fällt ihm in die krausgezogene Stirn. Aber was mich wirklich für ihn einnimmt, ist das aufgeschlagene Buch vor ihm. Ein Notizbuch, das aussieht, als sei es bereits Jahre in Gebrauch. Es liegt ganz flach auf dem Tisch, der Rücken muss unzählige Male durchgebogen worden sein. Das Papier wellt sich und zu allen Seiten gucken Haftnotizen und Zettelchen heraus. Ich kenne Bücher wie dieses. In die schreibt man nicht einfach irgendetwas. Das weiß ich, weil ich selbst seit Jahren solche Bücher führe. Sie sind mein Herz, mein Leben, meine ganze Welt. Jetzt in diesem Moment trage ich ein solches Büchlein mit mir herum. Meines sieht genauso zerliebt aus wie seines. Zerliebt ist mein liebstes Wort für Dinge, die man ein kleines bisschen zu gernhat. Für die man eine Zuneigung empfindet, die an der hauchdünnen Grenze zwischen Liebe und Zerstörung kratzt. Ich erkenne Menschen, die ihre Bücher zerlieben, sofort. Und ich fühle mich immer zu ihnen hingezogen. Aber noch nie war einer von ihnen so süß wie dieser Salzkörner pickende, Kaffee trinkende Kerl dort drüben.
Wie üblich, wenn ich eine Szene beobachte, die einen besonderen Punkt in meinem Herzen trifft, springt in meiner Fantasie eine Art Film an. Wenn ich einen Vater sehe, der sein Kind tröstet, dann stelle ich mir vor, wie er ihm erzählt, dass ihm die ganze Welt offensteht, dass er seinen Schmerz ernst nimmt, dass er da ist. Beobachte ich zwei Menschen, die sich ähnlich sehen, glaube ich, Geschwister in ihnen zu erkennen, und male mir aus, welche Gemeinsamkeiten sie haben. Für den Jungen vor dem Supermarkt überlege ich mir, dass er Amadeus heißt – weil das ein Name ist, den ich mit Kreativität assoziiere. Ich ersinne, dass er all seine Gedanken in dieses Buch schreibt, und stelle mir vor, wie er mir daraus vorliest. Wobei wir feststellen, dass wir genau gleich ticken. Meine Gedanken. Seine Gedanken. Unsere.
»Jule? Bist du bekifft, oder was?« Dschieses schnippt vor meinem Gesicht herum. Er ruft so laut, dass ich Angst bekomme, der Junge könnte uns hören. Aber er scheint in einer anderen Welt zu sein. Ich schaue noch mal zu ihm und beobachte, wie er, ohne richtig hinzusehen, seinen Kaffeebecher an die Lippen führt und dabei weiter die Seiten beschreibt. Der Dampf des heißen Getränks beschlägt seine Brillengläser, aber entweder es stört ihn nicht oder er nimmt es nicht wahr. Natürlich nicht, er schreibt schließlich gerade einen Roman, ein Pamphlet oder ein Theaterstück.
»Sei nicht immer so peinlich«, zische ich meinem Kumpel zu, als ich meinen Blick mit Mühe und Not von Amadeus abwende. Das spornt Dschieses nur dazu an, noch mehr Witze über meinen kurzen Trancezustand abzusondern. »Ich glaube, unser Julchen hat eben vor der Cafeteria zu tief eingeatmet und ’ne ordentliche Nase der jahrzehntealten Hack-Dämpfe abbekommen.«
Die zwei anderen lachen so laut, dass ein paar Leute, die bei dem Foodtruck zu Mittag essen, zu uns rübersehen.
Auch er.
Ich ziehe unwillkürlich die Schultern ein bisschen hoch, möchte in Deckung gehen. Aber wenn man mit Freunden unterwegs ist, von denen die eine hoch aufgetürmte Dreadlocks und ein feministisches Spruch-Shirt trägt und ein anderer aussieht wie der Sohn Gottes, ist es wirklich verdammt schwer, unterzutauchen.
Er sieht mich für einen klitzekleinen Moment an.
Aber der Moment genügt.
Es reicht, dass ich auf einmal all die Floskeln verstehe.
Ich bin wie vom Blitz getroffen, als ich ein Auge auf ihn werfe.
Benni
Die Farben draußen verschwimmen zu einem warmen Indigoblau, als ich endlich in der Straßenbahnlinie 11 sitze und meinen Heimweg antrete. Der Frankfurter Stadtteil Gallus befindet sich gerade mitten im Vorgang der Gentrifizierung. So nennt man es im Städtebau, wenn plötzlich überall neue, identisch aussehende Wohnblöcke mit winzig kleinen Balkonen aus dem Boden sprießen, die neue Mieter mit Geld anziehen und den alten Bewohnern mit weniger Geld Angst vor einer Mieterhöhung machen. So zumindest interpretiere ich es. Weil unsere Wohnung, die ganz am Ende des Viertels in einer Seitenstraße mit einer Reihe von Backsteingebäuden liegt, über einen sozialen Förderverein vermietet wird, müssen wir uns aber zum Glück keine Sorgen über steigende Mieten machen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum meine Mutter die Veränderungen alle ganz toll findet. Sie kann immer neue Menschen auf den Nachbarstraßen beobachten und freut sich über die neue Poststation, die sie zu Fuß noch schneller erreichen kann. Aber Mama versteht auch nicht besonders viel von Politik. Manchmal glaube ich, sie geht mit geschlossenen Augen durch die Welt.
Ich wohne schon mein ganzes Leben in dieser Zweizimmerwohnung. Meine Mutter ist dorthin gezogen, als sie vor knapp neunzehn Jahren mit mir schwanger wurde. Zuvor hat sie mit ihrer Mutter – meiner Großmutter – zusammengewohnt, aber die ist, wenn man Mama Glauben schenken darf, tot umgefallen, als sie von mir erfuhr, also musste sie daheim raus. Meine Großmutter, die ich nie kennengelernt habe, war nicht der einzige Mensch, der mehr als nur verblüfft darüber war, dass meine Mutter ein Kind erwartete. Die meisten Menschen, die sie damals kannten, dachten wohl, Mama würde als Jungfrau sterben oder früher oder später doch in ein Kloster eintreten. Selbst Menschen, die sie nicht kannten, wären wohl nie auf die Idee gekommen, dass meine Mutter noch schwanger werden würde. Sie war sechsundvierzig, als sie mich bekam. Und auf den Bildern in unserem Wohnzimmer, auf denen sie mich als Säugling im Arm hält, sieht sie sogar eher aus wie eine Frau Mitte fünfzig, die ihren ersten Enkel trägt. Die Aussage »Benni, deine Oma ist da, um dich abzuholen« hat mich von der Kita bis zur Verleihung des Abiturzeugnisses verfolgt. Mal als aufrichtiger Fehler, mal als gezielt platzierte Beleidigung. So sauer mich diese Verwechslung als Kind immer gemacht hat, so sehr konnte ich sie später doch verstehen. Mama macht es Menschen nicht gerade leicht, sie für jung geblieben zu halten. Nicht nur, weil sie es mit ihren nunmehr fast fünfundsechzig Jahren auch definitiv nicht mehr ist, sondern weil ihre wadenlangen Röcke, die wollenen Strümpfe und die seltsamen Kopfbedeckungen sie wie eine Frau aus den Vierzigerjahren wirken lassen.
Mein bester Freund Jake war der Einzige, der sich nie über meine Mum lustig gemacht hat. »Dann ist sie eben ein bisschen älter, ist doch egal«, hat er immer gesagt. Und wenn ich dann betonte, dass sie ja nicht nur alt sei, sondern auch alt denke, dann tat er das ebenfalls mit einem Schulterzucken ab. Er konnte ja nicht ahnen, dass es schlussendlich an Mamas Art liegen würde, dass wir unsere Zukunftspläne nicht verwirklichen können. Oder besser gesagt: dass er sie ohne mich verwirklichen muss …
Dieses Jahr im Mai noch hatten wir Pläne geschmiedet. Wir wollten nach dem Ende der Schule ins Ausland gehen, eine WG in Groningen gründen und dort gemeinsam studieren. Ich Medizin, er irgendetwas mit Sport. Es war meine Idee gewesen, wegzugehen. Ich hätte es sogar ohne ihn gemacht. Dachte ich zumindest. Doch letztendlich habe ich es nicht mal mit ihm hinbekommen. Ich wünschte, ich könnte genau sagen, was dazu geführt hat, dass Jake nun in den Niederlanden Sportwissenschaft studiert und ich immer noch hier bin. Mein Abschluss war ziemlich gut, zahlreiche Unis, auch die in Groningen, hätten mich ohne Wartezeit für ein Studium der Humanmedizin aufgenommen. Aber bevor ich eine Entscheidung treffen konnte, machte meine Mutter mir einen Strich durch die Rechnung …
Ich hole das alte Handy hervor, das mein bester Kumpel mir einst geschenkt hat, als er sich ein neues zulegte, und schreibe ihm eine Nachricht auf WhatsApp.
Erster Tag im Krankenhaus. Es war … heftig. Richtig viel zu tun, aber die Mittagspause war ruhig …
Wie immer druckse ich um das herum, was ich eigentlich sagen möchte. Dass ich alleine war. Dass ich mir dumm vorkomme. Dass ich das Gefühl habe, dass Luft plötzlich zu dünn zum Atmen ist. Vielleicht würde ich es Jake sagen, wenn er hier wäre. Aber das ist er nicht.
»Ich bin da«, rufe ich durch die kleine Wohnung, sobald die Tür hinter mir ins Schloss gefallen ist. Dreihundertfünfundsechzig Tage im Jahr rufe ich »Ich bin da«, obwohl das Zuschlagen der Tür Anzeichen genug dafür sein könnte. Mama wird panisch, wenn ich dieses Ritual ausfallen lasse.
»Bennilein, ich bin hier.« Jeden Tag singt sie diesen Satz in einer immer gleichen Akkordabfolge mit einem astreinen Oktavsprung auf dem Wort »hier«.
Ich setze ein Lächeln auf und betrete das Wohnzimmer. Es beinhaltet fast alle Möbel, die zwei Menschen zum Leben brauchen. Eine alte Couch, eine wuchtige Schrankwand für Fernseher und Bücher, eine dazu passende Kommode und in der Ecke ein schmales Bett, in dem meine Mutter schläft. Es ist keine besonders traditionelle Raumaufteilung. Auch dass Mama und ich einen gemeinsamen Kleiderschrank haben, der in meinem Zimmer untergebracht ist, ist nicht unbedingt Schema F. Aber ich kenne es nicht anders, deswegen habe ich es lange Zeit nicht hinterfragt. Ähnlich wie beim Alter meiner Mutter war auch die Skurrilität unserer Lebensumstände etwas, das mir erst durch die fiesen Sprüche anderer Kinder bewusst geworden ist. Deswegen ist es auch sehr lange her, dass ich Besuch bekommen habe. Es ist noch dazu ein wenig kompliziert, Freunden erklären zu müssen, wieso die Kommode im Wohnzimmer aussieht wie ein gottverdammter Altar und weshalb über jeder Tür Kruzifixe und im Flur Heiligengemälde hängen. Leichter, als das zu erklären, ist es, einfach niemanden mehr einzuladen.
Jule
Es ist nicht das erste Mal, dass ich jemanden gesehen habe und danach nicht aufhören kann, an ihn zu denken. Einmal ist es mir in der neunten Klasse passiert. Es war vermutlich meine erste richtig große Verliebtheit. Er war zwei Jahre älter als ich und in der Jahrgangsstufe meines Bruders (Dustin war damals noch auf dem Gymnasium) und bis heute habe ich kein Wort mit meinem damaligen Schwarm gesprochen. Das mag traurig klingen, aber für mich war es perfekt. Er war perfekt. Ein Junge, mit dem man nicht spricht, ist immer perfekt. Denn man kann so niemals herausfinden, dass er sich von seiner Mama die Unterhosen kaufen lässt, einmal die Woche ganz ironisch den »Dönerstag« zelebriert oder noch nie in seinem Leben ein Buch gelesen hat und darauf auch noch stolz ist.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt einen Freund haben möchte. Aber ich mag es, in jemanden verliebt zu sein. Ohne dass ich mich auf ihn einlassen muss. Ohne dass er sich auf mich einlassen muss. Wenn ich einen Jungen aus der Ferne liebe, ist es immer genau so, wie ich möchte. Unsere Beziehung so intensiv, wie ich es zulasse.
Es gibt für mich viele Gründe, Jungs lieber nur mit Sicherheitsabstand anzuhimmeln. Der wichtigste: Keiner von ihnen kann mein Leben erschüttern. Keiner von ihnen kann mich verurteilen. Oder meine Familie.
Ich halte inne und setze schließlich den Füller, den Kris’ Mutter mir zum letzten Geburtstag geschenkt hat, auf das weiche Papier meines Notizbuches: Amadeus kann mein Leben nicht erschüttern. Er kann mich nicht verurteilen.
»JU-LI-A!« Jedes Mal, wenn Mama zum Abendessen schreit, stelle ich mir vor, wie in ihrem Kopf die Feststelltaste aktiviert wird. Meine Mutter ruft nie in Kleinbuchstaben. Sie donnert einfach immer alles heraus, obwohl unsere Wohnung so klein ist, dass ich sie auch verstünde, wenn sie bei geschlossenen Türen in Zimmerlautstärke meinen Namen sagen würde. Ihr Brunftschrei zum Abendmahl ist vermutlich auch der Grund, wieso sie sich weigert, mich bei meinem Spitznamen zu nennen. Wenn man die Kinder mahnend zum Abendessen ruft, zählt jede Silbe. Jeder Buchstabe sorgt für ein kleines bisschen Autorität. Ich kann also glücklich sein, dass sie mich nicht Katharina-Hubertina-Eleonora oder so genannt hat.
Ich klappe mein Buch zu und schiebe es mit dem Füller unter die Bettdecke. Das Buch darf nie offen herumliegen. Meine Gedanken derart zu entblößen, würde sich anfühlen, als laufe ich selbst nackt rum. Stöhnend rappele ich mich vom Bett auf und gehe Richtung Küche. Wieso muss ausgerechnet meine Familie immer noch diesen Gemeinsames-Abendessen-Mist durchziehen? Wir machen doch sonst nichts gemeinsam. Reichen meinen Eltern diese zwanzig Minuten am Esstisch, um sich einzureden, dass unter diesem Dach so etwas wie Liebe herrscht?
Wie alt muss man eigentlich werden, um derart heuchlerisch zu sein? Merkt man es selbst, wenn es eintritt? Oder ist es so wie der Übergang zwischen Kindheit und Pubertät, den man sich vorstellt wie eine feierliche Zeremonie, obwohl sich eigentlich gar nichts ändert und niemand einem eine Urkunde überreicht? Man stellt nur einfach irgendwann fest, dass die Eltern nicht mehr jeden Scheiß loben, den man gebastelt hat, dass man Schulhefte plötzlich selbst kaufen muss und dass die eigene Meinung nicht mehr als drollig empfunden, sondern mit »Wo hast du nur diesen Schwachsinn her?« kommentiert wird. Ich weiß nicht, ob meine Eltern irgendwann bewusst beschlossen haben, uns anders zu behandeln. Nicht mehr wie Kinder. Ich jedenfalls konnte gefühlt dabei zuschauen, wie sich in unserer Familie alles verändert hat. Halte ich es etwa selbst mit ihrem Motto »Früher war alles besser«? Oder war ich früher einfach nur jung, naiv und blind?
Statt durch seine Zeitung zu blättern wie heute Morgen, scrollt Papa jetzt auf seinem Tablet durch Facebook. Ich wünschte, ich könnte es einfach nur lustig finden, dass mein Vater unbeholfen über den Screen wischt und dabei jedes Mal so aussieht, als hole er mit dem Zeigefinger Schwung. Und das würde ich vielleicht auch, wenn er auf Facebook nur komische Häschenvideos oder pseudo-deepe Motivationssprüche von Fußballprofis teilen würde. Aber ich kann ihm ansehen, dass er politische Postings liest. Er malmt mit den Backenzähnen, obwohl er noch gar nicht mit dem Essen begonnen hat. Bestimmt wird er gleich etwas rezitieren, dem ich widersprechen müsste.
Aber ich weiß, dass ich es mich wieder nicht trauen werde.
Diesmal sitzt Dustin mit an dem viel zu kleinen Esstisch. Er sieht noch angewiderter wegen des gemeinsamen Abendessens aus als ich. Dustin war regelrecht schockiert, als ihn sein achtzehnter Geburtstag nicht von der Pflicht entbunden hat, so oft wie möglich mit unseren Eltern abends geschmierte Brote essen zu müssen. Er hat Mama sogar seinen Ausweis unter die Nase gehalten, weil er dachte, er könne dann seine Abende so verbringen, wie es ihm beliebt. Papa hat ihn dafür mächtig zusammengeschissen und den unsouveränsten Klischeespruch von allen gebracht: »Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst« und so weiter. Dustin hat darauf die – das muss ich ihm zugestehen – recht clevere Erwiderung gehabt, dass es ihm genau darum ginge, seine Füße fortan nicht mehr unter diesen Tisch zu stellen. Aber mit Schlagfertigkeit ist man bei Papa noch nie weit gekommen. Er hat Dustin so finster angeguckt, dass mein Bruder schneller auf seinem Platz neben mir saß, als er gucken konnte. So wenig liebevoll meine Gefühle für meinen großen Bruder auch sind – in dem Moment konnte ich mich gut in ihn hineinversetzen. Wenn Papa diesen Blick auspackt, fallen einem keine Argumente mehr ein.
Mama stellt ein Glas Gurken auf den Tisch, dieselben Plastikverpackungen mit billiger Wurst wie heute Morgen, eine Packung Käse und die gesprungene Keramikschale, in der wir, solange ich denken kann, die Butter aufbewahren. Es folgen ein Holzbrett mit dick geschnittenen Brotscheiben und eine Flasche Bier, die sie meinem Vater öffnet und vor ihm abstellt. Wieso kann er das nie selbst machen?
»Ich will auch eins!«, fordert Dustin und klingt dabei kurz so, als mache er sich tatsächlich Hoffnungen.
»Du spinnst ja wohl«, fährt Papa ihn an. »Was hast du heute bitte geschafft?« Papa geht es keinesfalls um Dustins Alter – er darf immerhin legal trinken –, aber für ihn ist Biertrinken etwas, das man sich durch tüchtiges Tagewerk verdienen muss. Dustin arbeitet jedoch bereits seit Monaten gar nichts mehr.
Mein Bruder weicht der Frage aus und nimmt sich schmollend eine Scheibe Brot. Mama stellt eine Fasche No-Name-Cola auf den Tisch, setzt sich dazu und schenkt Dustin ungefragt von der braunen Flüssigkeit ein.
»Ich hab dich was gefragt?«, keift Papa, ohne von der Facebook-App aufzusehen. Er ist so vertieft darin, dass es mich wundert, dass er sich den Gesprächsfetzen von eben überhaupt gemerkt hat. Ich denke an heute früh, als er sich darüber aufgeregt hat, dass ich nur ganz kurz auf mein Handy geguckt habe. Es gibt Regeln in dieser Familie, sagt Mama immer, und schon seit ich sehr klein bin, weiß ich, dass nur die wenigsten davon auch für Papa gelten.
»Ey, ich hab ’ne Bewerbung geschrieben, ich schwör!«, beteuert Dustin.
»Ich schwör, ich schwör«, äfft Papa ihn nach. »Du schwörst so viel, du könntest glatt Politiker werden.« Das Wort Politiker speit Papa so angewidert aus, dass es wie »Politicka« klingt. In diesem Haushalt ist es gewiss kein Lob, wenn einem Talent für die Politik attestiert wird.
Ich sehe, wie Dustins Mundwinkel zuckt. Er ist verleitet, etwas zu sagen, verkneift es sich aber. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Genauso dankbar wie für die Stille, die dann folgt. Alle schmieren, belegen, kauen und niemandem fällt auf, dass ich schon wieder nur trockenes Brot esse. Keiner hat meine veränderte Ernährung in den letzten Wochen bemerkt. Vor einigen Monaten habe ich meiner Familie gesagt, dass ich kein Fleisch mehr essen möchte. Die Diskussionen darüber sind so ausgeufert, dass ich noch am selben Abend zur Beruhigung aller einen Chicken Wing mitgegessen habe. Danach glaubten sie, meine angekündigte Ernährungsumstellung sei nur ein äußerst kurzer Anfall von Rebellion gewesen, den mir »dieser Künstlerhippie von einer Frau« eingebläut hätte. Damit meinen sie Kris’ Mutter. Das war der Abend, an dem ich zum letzten Mal Fleisch gegessen habe. Und es war der Abend, an dem mir klar wurde, dass es in meiner Familie einfacher ist, Dinge heimlich durchzuziehen, statt sie anzusprechen. Dass ich sagte, ich wolle Vegetarierin werden, war ein Drama. Als ich es einfach wurde, sagten sie nichts. Aus dieser Erfahrung habe ich gelernt und verschweige deswegen auch jetzt, dass ich gar keine tierischen Produkte mehr esse. Über Kris und ihre Mutter spreche ich aus denselben Gründen auch nicht mehr viel.
Manchmal frage ich mich, wie weit das Ganze noch geht. Irgendwann … irgendwann werden wir einfach gar nicht mehr miteinander sprechen.
LagomAdjektiv, schwedisch: gerade richtig, nicht zu viel und nicht zu wenig, genau passend, die ideale Balance
Benni
Ich lerne schnell, dass im Krankenhaus vor allem eines Mangelware ist. Und das ist nicht farbenfroheres Essen oder Luft, die nicht nach Desinfektionsmittel riecht. Es ist Zeit.