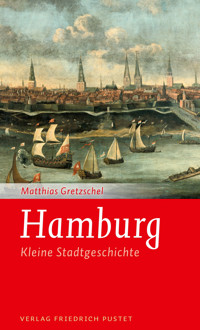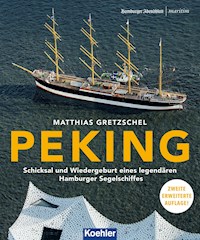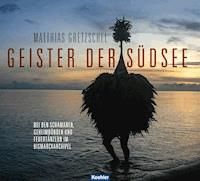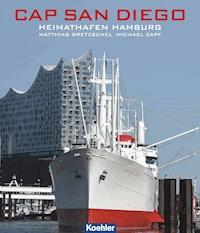Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Koehlers Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als der Autor, Dramaturg und Regisseur Michael Batz 1999 die Fassaden der Hamburger Speicherstadt erstmals illuminierte, begann sich das nächtliche Gesicht der Hansestadt zu verändern. Bei permanenten wie temporären Lichtprojekten wie "Blue Goals" und "Blue Port" entdecken Bewohner und Besucher die Stadt seither auf faszinierende Weise neu und erleben auch vertraute Bauwerke und Architekturensembles viel eindrücklicher, als das bei Tageslicht möglich wäre. Michael Batz, der inzwischen spektakuläre Lichtprojekte von Shanghai bis Sao Paulo realisiert, bezieht sich in seinem Wirken auch auf die Geschichte des öffentlichen Lichts. Diese begann in Hamburg im Jahr 1382 und hat die Stadt auf der Grundlage der jeweiligen technischen Möglichkeiten in ihrer Alltags- und Festkultur zunächst fast unmerklich, später jedoch dramatisch verändert. Mit aufschlussreichen Texten des Journalisten und Autors Matthias Gretzschel stellt der opulente Band die inzwischen weltweit bekannten Projekte des Lichtkünstlers vor, erklärt seine Motive und Ideen und erzählt zugleich die spannende Kulturgeschichte des städtischen Lichts. Die faszinierenden Fotografien von Michael Zapf ergänzen das Werk perfekt und machen es zu einem wahren Blickfang. Der Titel erscheint als fixed ebook. +++Achtung bei diesem Titel handelt es sich um eine fixed Layout-Version. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf darüber, ob Ihr Gerät diese Datei öffnen und korrekt darstellen kann.+++
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 86
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Blue Goal, das sich auf der Binnenalster vor dem Jungfernstieg spiegelt, wirkt hier wie das Entree zur Innenstadt.
Während des Blue Port 2010 gab es mit dem Hafen eine große Bühne und in seiner Nachbarschaft sehr viele kleine Schauplätze und Separees. Wer die Möglichkeit eines Besuchs der Kirchtürme hatte, konnte wie hier in der Katharinenkirche das Panorama genießen und zugleich Teil des Lichtkunstwerks werden.
INHALT
WIE HAMBURG DAS LICHT AUFGING
IM DUNKEL DER NACHKRIEGSZEIT
WIE LICHT ZUR ERZÄHLUNG WIRD
WIE DAS LICHT DIE STADT ZUR BÜHNE MACHT
DAS SPEICHERSTADT-PROJEKT
KULTUR UND KIRCHE IN NEUEM LICHT
WIE FARBE INS SPIEL KAM
DAS BLAUE WUNDER
WIE LICHT HALTUNG ZEIGT
JENSEITS VON HAMBURG
DIE AUTOREN
WIE HAMBURG DAS LICHT AUFGING
EINE KLEINE GESCHICHTE DER ÖFFENTLICHEN BELEUCHTUNG
Zum nächtlichen Beginn einer großen Hochzeitsfeier sollten zehn junge Mädchen dem Bräutigam mit Lampen entgegengehen. Fünf von ihnen hatten vorgesorgt und zusätzliches Öl mitgebracht, die anderen fünf aber nicht. Als die Feier zu weit vorgerückter Stunde endlich begann, waren deren Lampen heruntergebrannt. In ihrer Not eilten sie zwar noch zum Händler, doch als sie mit frisch aufgefüllten Lampen, aber deutlich verspätet am Hochzeitssaal erschienen, blieb dessen Tür für sie verschlossen.
Das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen aus dem Matthäusevangelium war den Menschen im mittelalterlichen Hamburg wohl vertraut. Wenn sie in St. Petri den Altar, den Bertram von Minden 1379 bis 1383 geschaffen hatte, zu hohen Festtagen in geöffnetem Zustand betrachteten, standen ihnen die fünf jungen Frauen mit den brennenden und ihre fünf unglücklichen Gefährtinnen mit den verloschenen Lampen als Schnitzfiguren deutlich vor Augen. Und obwohl der biblische Text damals schon etwa 1300 Jahre alt war, unterschied sich die Lebenssituation der Menschen im Hamburg des späten 14. Jahrhunderts kaum vom Alltag in der Antike. Das öffentliche Leben vollzog sich zwischen dem Sonnenaufgang und dem Einbruch der Dunkelheit. Das Tageslicht war die Voraussetzung für Arbeit und gesellschaftliches Leben, künstliche Lichtquellen waren selten, teuer und schwer verfügbar. Der Kienspan oder das Talglicht im privaten Haus wurden nur entzündet, wenn es unbedingt notwendig war. Die Stadt mit ihren Straßen und Gassen versank nach Sonnenuntergang in Dunkelheit. Das Mittelalter betrachtete die Schöpfung als Materialisierung des göttlichen Lichts. Es unterschied dabei zwischen LUX, dem Licht Gottes selbst, in Einheit und Einzahl, und LUMEN, irdische Phänomene des Lichts, in Vielzahl, LUMINA, somit alles, was Licht erzeugt oder körperlich leuchtet, etwa Sonne, Sterne, Kerzen, Öllampen, aber auch Reflexionen auf Oberflächen.
Nachts nie ohne Laterne! Im 17. und 18. Jahrhundert wurde nach Einbruch der Dunkelheit die Begleitung durch einen Lichtträger obligatorisch. Das Kerzenlicht reichte kaum zur Erhellung des Straßenraums, war aber wichtig als Signal für wandelndes Publikum.
Später wurden diese Begriffe zu technischen Maßeinheiten. „Lux” bezeichnet die Maßeinheit der Beleuchtungsstärke auf einer beleuchteten Fläche, „Lumen” ist dagegen die Einheit des Lichtstroms, der von einer Lichtquelle ausgeht. Das lateinische Wort Lux steht nicht nur für Licht, sondern bezeichnet zugleich den Tagesanbruch. Weit über das europäische Mittelalter hinaus war Licht nicht nur Lumen und Lux, sondern eben auch Luxus. Wenn man vom dunklen Mittelalter spricht, ist das durchaus auch wörtlich zu verstehen.
Die Sicherstellung des öffentlichen Lichts war eine hoheitliche Aufgabe. Um nicht für nächtliche Herumtreiber gehalten zu werden, konnten sich die Lampenbesorger mit einer Erkennungsmarke ausweisen. Eine Methode, die in späterer Zeit auch von Beamten der Kriminalpolizei verwendet wurde.
Ein Lampenanstecker bei der Arbeit, die durch Mandat genau geregelt war. Vergeben war die Pflege der öffentlichen Beleuchtung an Pächter, die wegen des schnellen Abbrennens der Leuchtmittel mehrfach in der Nacht ihre Tour machen mussten.
Es begann 1382 in Hamburg mit einer einzigen Öllampe
Nur wenn die Stadt hohen Besuch empfing, wenn Adelige oder Kirchenfürsten ihre Aufwartung machten, ließ der Ehrbare Rat an wichtigen Plätzen und Straßen Pechpfannen aufstellen, die die Wege für die hohen Gäste illuminierten. Reisten sie ab, versank die Stadt nachts wieder in Dunkelheit. Das sollte sich erst im Jahr 1382 ändern, ein Jahr, bevor Meister Bertram sein großartiges Altarwerk für St. Petri vollendet hatte. Damals beschloss der Rat, dass vor dem Rathaus eine Öllampe zu installieren sei, die die ganze Nacht über leuchten sollte. Man kann sich gut vorstellen, dass die Ratsherren ihre Entscheidung reiflich überlegt hatten, schließlich war sie mit erheblichen Kosten verbunden. Es ist überliefert, dass der Betrieb pro Jahr mit 48 Schillingen zu Buche schlug, ein Betrag, für den man auch zwölf Kühe oder 144 Tonnen Bier kaufen konnte. Dennoch markiert die Öllampe vor dem Rathaus, das sich damals noch am Neß neben der Trostbrücke befand, den Beginn der öffentlichen Beleuchtung in Hamburg. Fast 100 Jahre lang sollte es dabei bleiben, erst 1476 erhielten die Reimers- und die Holzbrücke und 1478 auch die Trostbrücke Glaslaternen, die mit Öl betrieben wurden. Für Hamburg waren Brücken besonders wichtige Verkehrsbauten, dass man sie ab Ende des 15. Jahrhunderts kostspielig beleuchtete, war angesichts des wachsenden Hafenverkehrs notwendig geworden. Offenbar ließen sich die Umschlag- und Transportaufgaben im Hafen nicht mehr ausschließlich bei Tageslicht bewältigen, weshalb der Hafen der erste Bereich der Stadt war, in dem immer mehr „Lichtpunkte” installiert und betrieben wurden. Das machte sogar eine neue Berufsgruppe notwendig, die „Luchtenmaker”, deren Zunft am 13. Juli 1541 gegründet wurde. Sie mussten sich nicht nur um das abendliche Entzünden und frühmorgendliche Löschen der Glaslaternen, sondern auch um deren Wartung kümmern.
Das gleißende Licht der Bogenlampen – hier ein Beispiel aus Berlin Ende des 19. Jahrhunderts – verwandelte die Städte, tauchte sie in den Glanz der Moderne und versprach ein Zeitalter eines bis dahin unvorstellbaren Fortschritts.
Mit der Einführung der Reformation 1529 ging für Hamburg zwar das Mittelalter endgültig zu Ende, heller wurde es auf den Straßen und Plätzen der Hansestadt aber zunächst kaum. Und das war in den allermeisten europäischen Städten kaum anders. Nur im damals noch mittelalterlich verwinkelten Paris beschloss die Stadtverwaltung schon 1558, dass die Straßen nachts mit Pech- und Kiefernpfannen zu beleuchten seien. Daran war in Hamburg nicht zu denken, so empfahl es sich, nach Einbruch der Dunkelheit besser im Haus zu bleiben. Denn draußen auf den Straßen trieb sich jenes Gesindel herum, das man als „lichtscheu” bezeichnete. Und wer tatsächlich aus irgendeinem Grund des Nachts auf die Straße musste, war verpflichtet, eine Lampe mit brennendem Licht bei sich zu führen. Das hatte der Ehrbare Rat unter Strafandrohung am 11. Dezember 1657 beschlossen.
1675 führte Hamburg als erste deutsche Stadt die Straßenbeleuchtung ein
Wenig später berichteten aus London heimgekehrte Kaufleute und Kapitäne, dass die englische Hauptstadt des Nachts erleuchtet sei. 1672 hatte das englische Parlament die Einwohner per Erlass verpflichtet, vom Michaelistag (29. September) bis zu Mariä Lichtmess (2. Februar) während der Dunkelheit eine Laterne vor die Eingangstür ihres Hauses zu hängen. In Hamburg taten das einige wenige Hausbesitzer bereits freiwillig und auf eigene Rechnung, dennoch sah nun auch der Rat Handlungsbedarf. So wurde über eine öffentliche Gassenbeleuchtung beraten. Der „Probelauf” fand 1673 im Jakobi-Kirchspiel statt, wo man die vom städtischen Bauhof aus breitem Blech gefertigten Laternen aufstellte. Acht Mark Courant kostete ein Exemplar, ohne den Pfahl, auf dem sie abgestellt werden mussten. Drei Jahre später war es dann so weit: 1675 rühmte sich Hamburg als erste Stadt in Deutschland, eine öffentliche Straßenbeleuchtung zu betreiben. Der Aufwand für den Betrieb der 400 im Stadtgebiet verteilten Laternen war beträchtlich. Außerdem wurde deren Anzahl stetig erhöht, sodass es Ende des 17. Jahrhunderts – Hamburg hatte damals etwa 60.000 Einwohner – 1152 öffentliche Lampen gab. Der städtische Leuchtenversorger Cornelius van der Heyde hatte die Aufsicht über 37 Mitarbeiter: fünf Unterlampenversorger und 32 Leuchtenanstecker. Bezahlen mussten es natürlich die Bürger, die für das „Leuchtengeld” zur Kasse gebeten wurden. Für ein vornehmes Haus betrug diese Abgabe drei, für ein bescheideneres zwei Mark Courant. Wer nur ein kleines Haus besaß, kam mit vier bis maximal acht Schillingen jährlich davon.
Dass Licht vor allem Luxus war, zeigte sich aber vor allem jenseits des Alltags. Während die öffentliche Beleuchtung mehr schlecht als recht dafür sorgte, dass man Hamburgs Straßen und Plätze, vor allem aber die Brücken und den Hafen auch in der Nacht einigermaßen gefahrlos betreten konnte, hatte Licht für die Festkultur schon seit dem 16. Jahrhundert in Europa beträchtliche Bedeutung. Hier war Hamburg allerdings kein Vorreiter, denn natürlich spielten Feuerwerke und aufwendige Illuminationen vor allem bei höfischen Festen in Residenzen wie London, Wien, München und Dresden eine Rolle. Aber auch die wohlhabenden Hamburger Bürger schätzten derartige Vergnügungen und fanden immer häufiger Anlässe, sich am festlichen Licht zu erfreuen.
Die Hamburger Mönckebergstraße im Jahr 1926. Im Wettbewerb der Städte, den es schon damals gab, legte man sich gern den Titel „Stadt im Licht” zu, möblierte die Boulevards mit großformatigen Leuchten, strahlte Fassaden und Türme an. Erstmals wurde die Stadt als Lichtraum definiert.
Schon immer machten sich Regenten und Würdenträger aller Couleur die repräsentative und festliche Wirkung von Licht zunutze. Licht verspricht das Außergewöhnliche – das hat sich bis in die Lichtgestaltung in unserer Zeit nicht geändert.
Eine Illumination für den Papst sorgte für Tumulte
Königin Christine von Schweden, die sich oft in Hamburg aufhielt, konnte sich so etwas natürlich leisten. Obwohl die Hamburger nicht recht verstehen konnten, warum ausgerechnet die Tochter des protestantischen Glaubenshelden Gustav Adolf zum Katholizismus konvertiert war, gehörte die Königin, die 1654 dem schwedischen Thron entsagt hatte, zu den gern gesehenen Gästen der Hansestadt. Sie hielt hier oft monatelang Hof und wurde auch als glänzende Gastgeberin geschätzt. Dass sie am 15. Juli 1667 aber ausgerechnet die Wahl von Papst Clemens IX. zum Anlass für ein Fest nahm, war im lutherisch-orthodoxen und in konfessionellen Fragen ohnehin recht intoleranten Hamburg an sich schon ein bisschen instinktlos. Trotzdem kamen zahlreiche Honoratioren in Königin Christines Haus am Krayenkamp. Und zunächst war auch die Stimmung gut, zumal die Beköstigung keine Wünsche offen ließ. Vor der Tür hatten Diener sogar einen Brunnen aufgebaut, aus dem nicht etwa Wasser, sondern Wein floss. Doch dann brachte ausgerechnet eine Lichtinstallation das sprichwörtliche Fass zum Überlaufen: Nach Einbruch der Dunkelheit wurden an der Fassade des Hauses nämlich 600 Lampen entzündet, die den Schriftzug „Es lebe Papst Clemens IX.” bildeten. Eine wütende Menge warf Steine auf das Haus, aus dem die Diener das Feuer eröffneten. Mit knapper Not konnte die Königin über eine Hintertür entkommen und in der schwedischen Gesandtschaft am Speersort Zuflucht finden. Der Vorläufer einer ‚Medien-Fassade’ hatte ganz offenbar den falschen ‚Content’.
Schon im 17. Jahrhundert wurde die Alster festlich illuminiert