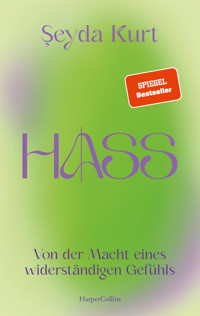
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
WER HAT DIE MACHT ZU HASSEN? – Erkundung eines politischen Gefühls
Der Hass, dieses knirschende, zersetzende Gefühl, ist allgegenwärtig. Er brüllt von den Straßen oder flüstert in gutbürgerlicher Feindseligkeit. Er wächst in Parlamentsreden, Querköpfen und Kinderzimmern, und ganz bestimmt nicht im Verborgenen, auch wenn viele ihn gerne dorthin verdammen würden.
Şeyda Kurt holt den Hass raus aus der Verbannung und begibt sich auf die Spuren seines widerständigen Potentials. Dabei interessieren sie vor allem die Menschen als die Subjekte von Hass in einer kapitalistischen, rassistischen und patriarchalen Welt. Wer sind sie, diese Hassenden, und aus welchen Machtverhältnissen kommen sie? Wer darf überhaupt hassen und wer nicht? Welche Gefühle lähmen, welche Gefühle helfen, nicht zu erstarren, und sich immer und immer weiter zu bewegen auf dem Weg in eine gerechtere und zärtliche Gesellschaft?
Schonungslos, launig und jenseits selbstgerechter Entrüstung erkundet Şeyda Kurt den Hass von seiner schöpferischen Seite: als Kategorie der Ermächtigung, der Menschen in ihrem innersten Unbehagen abholen und mobilisieren kann, als widerständiges Handwerk – und nicht zuletzt als dienliches Gefühl, das uns hilft, uns in einem Ozean aus möglichen Reaktionen auf die Welt zurechtzufinden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Der Verlag hat sich bemüht, alle Inhaber der Bildrechte ausfindig zu machen. Berechtigte Ansprüche bitten wir, beim Verlag geltend zu machen.
Originalausgabe © 2023 by HarperCollins in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg Covergestaltung von Elif Küçük E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck ISBN E-Book 9783749904945www.harpercollins.de
PROLOG
Mama sagt, ich hab zu viel Hass,
zu viel Hass in meinem Herz
Aber werf lieber den ersten Stein
ich duck mich nicht,
Nerven lange tot, aber ich leb
– Apsilon, »Ich Leb«
Dieses Buch setzt dort an, wo das Unbehagen nicht mehr schlicht rumort. Es malmt, es grollt. Aus dem trüben Hintergrundrauschen des Unbehagens bricht ein rohes, klares Geräusch hervor, es drückt auf meine Ohren. Ein Dröhnen, ein Zucken, ein Staunen, ich halte die Luft an. Das ist der Hass. Ich erkenne ihn. Er brüllt von den Straßen und flüstert manchmal in gutbürgerlicher Feindseligkeit seine Zustimmung, wenn Menschen an europäischen Außengrenzen verenden, leise, ganz leise. Ich habe den Hass in dem Geschrei und in den Augen meiner Eltern flackern sehen. Ich entdecke ihn in den Drohbotschaften, die in meinem Posteingang lauern. Und er brodelt in den Rachefantasien, die mich nach dem Lesen begleiten. Ich habe selbst gehasst, ich hasse. Ich atme aus. Der Hass, ich kenne ihn.
Im Sommer 2021 sitze ich vor dem Computer. Zwei Dutzend Gesichter mustern mich vom Bildschirm, Zoom. Die Studierenden einer westdeutschen Kleinstadt haben mich zu einer Online-Lesung meines ersten Buchs eingeladen. Ich erzähle ausgiebig von Zärtlichkeit als politischer Praxis, von einer radikal zärtlichen Gesellschaft, in der sich die politischen Verhältnisse – die Verhältnisse des Lebens, des Wohnens und des Arbeitens – in einer Weise gestalten müssen, dass alle Menschen über die Ressourcen verfügen, sich einander zuzuwenden, ihre Beziehungsweisen zu politisieren, sich in ihrer Abhängigkeit anzuerkennen. Und diese Abhängigkeit bejahend und produktiv zu gestalten. Das ist meine Vision: eine radikal zärtliche Gesellschaft, ach was, eine radikal zärtliche Weltordnung! Frei von Patriarchat, Kapitalismus, Imperialismus und anderen Unterdrückungssystemen, in denen Menschen sich als herrschende und beherrschte Körper begegnen.
Auf meine Lesung folgt eine Fragerunde aus dem virtuellen Publikum, und aus einem Pixelgesicht segeln mir diese Worte entgegen: »Wenn wir für eine zärtliche Gesellschaft sind, bedeutet das dann, dass wir auch Nazis gegenüber zärtlich sein müssen?« Ich starre auf den Bildschirm. Die Zahnräder in meinem Gehirn verkanten, es knackst, vor meinem inneren Auge steigt Dampf auf. Ich kann mich nicht entscheiden, ağlayımmı güleyimmi, soll ich weinen oder lachen? Sie habe das Buch übrigens gar nicht gelesen, schiebt die fragende Person hinterher. Ich wünschte, das könnte mich beruhigen. Denn in den folgenden Tagen wird es in meinem Kopf unaufhörlich dröhnen: Was zur Hölle habe ich falsch gemacht? Was für ein Buch habe ich geschrieben, dass es Menschen überhaupt auf die Idee bringt, Nazis und Zärtlichkeit in demselben Satz zu denken?
Doch in der Onlinelesung antworte ich erzwungen gefasst. Ich versuche, mir nichts von meiner Dampfwolke der Selbstzweifel anmerken zu lassen, die allmählich Richtung Magengrube zieht. Nein, wir sollten Nazis gegenüber nicht zärtlich sein, antworte ich. Denn mit Nazis gibt es keine radikal zärtliche Gesellschaft für alle. Ich sage, dass wir jeden Grund dazu haben, Faschist*innen zu hassen.
Und sie hassen müssen.
Nur wenige Monate später schreibe ich dieses Buch, ein Buch über Hass. Vielleicht will ich manche Dinge geraderücken. Vermutlich weil ich befürchte, als Herzchenhippie in Erinnerung zu bleiben. Mir graut es vor der Vorstellung, nach meinem Tod aus dem Jenseits hilflos zusehen zu müssen, wie meine Zitate aus dem Zusammenhang gerissen auf Instagram-Kacheln landen, Hashtag: #loveistheanswer.
Doch das ist nicht der einzige Grund für dieses Buch. Denn ich habe auch in vielen Gesprächen, die ich führte, und in Nachrichten, die ich erhielt, gespürt, welche Schlagkraft es entwickeln kann, politisch über Gefühle zu schreiben. Wie diese Texte Menschen in ihrem innersten Unbehagen oder Grollen abholen und mobilisieren können. Oder wie es das feministische Kollektiv LASTESIS formuliert: »Mit Gefühlen zu arbeiten ist ein subversives Geschenk an die Welt.« 1
Doch was hält politische Gefühle eigentlich am Leben? Was nützen sie? Wem nutzen sie? Die Zärtlichkeit, das Unbehagen, das Grollen? Als Individuum in einem Kollektiv, in einer Bewegung? Welche Gefühle lähmen, welche Gefühle helfen, nicht zu erstarren, sich immer und immer weiterzubewegen auf dem Weg in eine gerechtere Gesellschaft? Wie müssen sich diese Gefühle als Taten äußern – und andersherum?
Müssen sie explodieren oder sich schleichend festsetzen?
Nun also der Hass. Auf den folgenden Seiten werde ich die Konturen seiner Form und Geschichte abtasten. Und ich werde mir widersprechen, immer und immer wieder. Denn die Geschichte und Gegenwart des Hasses ist eine Geschichte und Gegenwart der Gleichzeitigkeiten.
Es ist nämlich paradox: Einerseits ist der Hass allgegenwärtig. In den Blicken und Gesten, im Alltag und im Sprechen, Hass gedeiht in Parlamentsreden und Kinderzimmern, er fällt nicht vom Himmel und wächst nicht im Verborgenen.
Doch genau dorthin soll er kulturell verbannt werden. Denn – so allgegenwärtig er auch ist – der Hass soll und darf eigentlich nicht existieren. Die Empörung ist noch nobel angesichts der Ungerechtigkeiten der Welt, solange sie die eigene Idylle in der geerbten Eigentumswohnung nicht ins Wanken bringt. Und auch die Wut scheint manchmal in Ordnung zu sein, wenn sie augenzwinkernd, lifestylefeministisch und bloß nicht zu aggressiv daherkommt.
Aber der Hass, dieser knirschende, zersetzende, langatmige Hass, der nicht. Die Empörung schimpft sich aus, die Wut lässt sich ablassen. Der Hass bleibt.
Doch einen Schritt zurück: Woraus besteht der Hass überhaupt, was ist sein Wesen? Als »feindselige Abneigung, starkes Gefühl der Ablehnung und Feindschaft« beschreibt ihn der Duden. Ist das tatsächlich so einfach? Ist der Hass schlichter Unmut, ein schlichtes Empfinden, bloße Feindseligkeit, die sich im Grollen und Zetern äußert?
Der Hass scheint sich immer hinter deutlicheren Begriffen zu verstecken.
Ich habe bereits in meinem ersten Buch über die Enttäuschung meines Philosophiestudiums geschrieben, in dem das Revolutionärste die Jeanshose des Professors war. Jede entschiedene Meinung schien dogmatisch. In meiner Erinnerung wurde jede Gefühlsäußerung im Seminarraum, jede Tonlage, die von dem motorisierten Gemurmel abwich, verdutzt bis angewidert beäugt, als würde der auferstandene Hegel höchstpersönlich im Seminarraum vor aller Augen sein Geschäft erledigen.
Ich will mich nicht wiederholen, ich langweile mich ja schon selbst. Es ist ja auch nicht so, als hätte ich damals rein gar nichts gelernt. Irgendetwas habe ich gelernt, irgendetwas lernt man immer! Damals habe ich die Kunst des Kategorien- und Definitionenabklopfens gelernt, wie sie in der westlichen Philosophie üblich ist. Gattung, Genus, Terminus. Das war bereits eine der Expertisen des antiken Philosophen Aristoteles: die Dinge und Zusammenhänge in der Welt beobachten, sie abgleichen und abgrenzen, kategorisieren, in verständliche Pakete und Tüten abpacken, zuschnüren. Eine Kostprobe werde ich im nächsten Kapitel geben.
Dabei bin ich immer wieder auf altbekannte Sortierschablonen gestoßen, anhand derer das Wesen der Welt erklärt werden soll: die Binaritäten, das System der Zweigliedrigkeit, über das ich auch bereits in Radikale Zärtlichkeit geschrieben habe. Wenn etwas nicht A ist, dann ist es B. Wenn etwas nicht B ist, dann ist es A, das A das Positiv, das B das Negativ. Die Binaritäten folgen einer Hierarchie, und die Dinge und Eigenschaften in der Welt müssen so lange voneinander abgegrenzt und ausdekliniert werden, bis nur noch ihre vermeintlich unaufteilbare, unreduzierbare Essenz übrig bleibt. Ein vermeintlicher Ausbruch aus dem Definitionenkreislauf.
Doch die sozialen, kulturellen und vor allem ökonomischen Rahmenbedingungen, die meiner Ansicht nach die Dinge und Eigenschaften in der Welt eigentlich erst erzeugen, spielen dabei kaum eine Rolle. Und auch nicht, dass diese Verhältnisse eben nicht in Stein gemeißelt, sondern veränderbar sind.
Nichts in der Welt existiert einfach so, losgelöst und um seiner selbst willen. Wie auch die Liebe – wie ich bereits in Radikale Zärtlichkeit schrieb – existiert der Hass nicht im luftleeren Raum. Wer hasst, muss sich in einem Ozean aus möglichen Reaktionen auf die Welt zurechtfinden.
Ich gebe also zu, dass sich der Hass nicht säuberlich aus der Teigmasse von verwandten Emotionen wie Feindseligkeit oder Abscheu ausstanzen lässt wie ein Weihnachtsplätzchen, und auch nicht von der Gewalt. Der Hass ist oft Fühlen und Handeln zugleich. Menschen und die Prozesse in der Welt sind komplex. Der Hass hat kein unumstößliches Wesen.
Und doch glaube ich, dass ich mich mit der Ausstechform in der Hand an den Teig heranwagen und den Hass zumindest in eine Form gießen muss. Denn sosehr mir das ständige Kategorienabklopfen auch zuwider ist, sind Abgrenzungen und Eingrenzungen doch manchmal aufschlussreich, um das eigene Schreiben, das eigene Unbehagen und Grollen zu verorten. Und um etwa die soziale Beschaffenheit unserer kapitalistischen, patriarchalen oder kolonialen Gegenwart in Deutschland und darüber hinaus zu verstehen. Gerade wenn es um politische Gefühle geht.
Die Philosophin Hilge Landweer unterscheidet den Hass etwa von der Verachtung. Der Hass sei mit einem unmittelbaren Vernichtungsimpuls verbunden, während die Verachtung eher mit einem Impuls des Sich-Abwendens einhergehe. Ein Impuls aus einem Gefühl, das hervorragend in die »neoliberale Landschaft« passe, so Hilge Landweer. 2
Denn in dieser verächtlichen Abwendung stecke schlimmstenfalls eine Gleichgültigkeit, die zu einer Entmenschlichung des Gegenübers führe. Die Verachtung, das Naserümpfen, die selbstgerechte Entrüstung passen zu dem weitverbreiteten Überlegenheitsgefühl herrschender Menschen und Klassen, ihr Pochen auf Eigenverantwortung und Selbsterfolg. Ein gewaltvoller, hierarchisierender Gestus der Selbsterhabenheit.
Die Verachtung komme aus einer überlegenen Position heraus, meint Hilge Landweer, beziehungsweise werde die eigene Überlegenheit erst durch die Verachtung hergestellt. Der Hass hingegen komme aus einer unterlegenen Position und lasse Potenziale zur Veränderung frei. Tendenziell werde also in einem gesellschaftlichen Geflecht der Hierarchien und Unterdrückung von unten gehasst und von oben verachtet. 3
Und ja, selbstverständlich gibt es auch den erhabenen, herrschenden Hass, der sich in Staatsformen und Ökonomien niederschlägt. Auch darauf komme ich zurück. Doch Hilge Landweer schenkt mir hier eine Ausstechform, die den Kern meines ganzen Unterfangens in diesem Buch umrandet: Der Hass kann verändern, der Hass kann transformieren. Mich interessiert der Hass zwar auch als eine unterdrückerische, doch noch viel mehr als eine widerständige Handlungsform.
Ich will in diesem Buch über den Hass schreiben – nicht über seine ominöse Natur oder sein angebliches Wesen. Ich werde über reaktionären Hass und strategischen Hass schreiben, über Hass als letztes Mittel, über Hass als Kategorie der Ermächtigung, als widerständiges Handwerk. Ich werde keine eindeutigen Definitionen liefern. Ich werde den Teig kneten und den Hass ausstanzen und wieder vermengen. Denn ich schreibe über den Hass nicht um seiner selbst oder um der Kunst des Definitionenabklopfens willen, sondern im Interesse einer anderen Welt. Dafür muss er vor allen Dingen erst mal sichtbar werden, seine Geschichte wie Gegenwart.
Denn eins gilt immer noch: Der Hass soll ins Verborgene verbannt werden. Denn weder passt er zum Selbstbild einer vermeintlich aufgeklärten und zivilisierten Gesellschaft und ihren christlich-abendländischen Werten. Denn diese will sich eigentlich am liebsten als Heilsbringerin für die ganze Welt betrachten. Noch gibt es in dieser Geschichte Raum für den Hass jener Menschen, die unter dieser Lüge gelitten haben und leiden: Menschen, die ausgebeutet, vernichtet wurden und werden.
Ihr Hass soll nicht existieren, weil er der selbst ernannten Zivilisation gefährlich werden könnte.
Der Hass ist hässlich, heißt es daher, und wie die Hässlichkeit ist er so verpönt, dass er meist nicht mal einer eigenen Geschichte würdig scheint, darauf komme ich im letzten Teil dieses Buchs zurück. Ich bin etwa in der (deutschsprachigen) Philosophie – im Vergleich zu der Liebe – auf keine populäre Ideengeschichte des Hasses gestoßen, die ich hier entlang weniger philosophischer oder soziologischer Superwerke kurzerhand zusammenfassen könnte. Das soll mich selbstverständlich nicht davon abhalten, im nächsten Kapitel genau das zu versuchen. Ich werde in der Geschichte wühlen müssen, Spuren lesen.
Gleichzeitig ist die Feststellung der angeblichen Abwesenheit von Hass nur die halbe Wahrheit. Denn er breitet sich zwar nicht in demselben Umfang wie die Liebe oder ihr verwandte Themen ideengeschichtlich aus, in politischen wie auch philosophischen Theorien. Doch er hat immer eine Rolle gespielt. Wenn auch nur dezent, nur unterschwellig, wenn auch nur in der Benennung oder Markierung dessen, was die westliche, moralische Zivilisation nicht sein will. Und gerade die Abwesenheit von Ideen erzählt manchmal mehr als ihre Anwesenheit und macht sie umso anwesender.
Und doch muss ich ein weiteres Gleichzeitig hinterherschieben: Ja, in den letzten Jahren wurde viel über den Hass gesagt und geschrieben. Alarmierendes. Oft hat er die Schlagzeilen bestimmt. Doch dabei ging es um den Hass, den etwa Rassist*innen und Faschist*innen in Deutschland, Europa und über den Kontinent hinaus verbreiten. PEGIDA, Wutbürger*innen, Verschwörungsideolog*innen. Und die versucht kritische Auseinandersetzung mit diesem Hass verlor sich oft in Floskeln. Weniger Hass, mehr Liebe, hieß es, während in Europa die Rechten immer mehr an Zulauf gewannen. Hass ist krass, Liebe ist krasser, Hass ist laut, Liebe ist lauter. Für mich ist das nichts als verzweifelter Lärm.
In diesem Buch spielt dieser rechte Hass nur eine sekundäre Rolle. Er rückt zwar gezwungenermaßen immer wieder in mein Blickfeld. Doch eigentlich ist dieser Hass nicht mein Maßstab. Mich faszinieren weder seine persönlichen Beweggründe noch seine Subjekte.
Mich interessieren in diesem Buch jene, die nicht nur in den vergangenen Jahren, sondern seit jeher als Objekte und Zielscheiben des Hasses in Erscheinung getreten sind. Sie sind das größte Gleichzeitig des Hasses, das unsichtbar bleibt: widerständige Schwarze, rassifizierte Menschen, Jüdinnen*Juden, arme Menschen und Arbeiter*innen, queere Menschen, weibliche und andere marginalisierte Geschlechter. Revolutionäre. Menschen in Befreiungs- und Klassenkämpfen.
Es sind diese Menschen, die mich als die Subjekte des Hasses in einer kapitalistischen, rassistischen und patriarchalen Welt interessieren. Ihr Hass muss nicht immer berechtigt oder gut sein. Aber es gibt ihn. Mich interessieren jene, die hassen mussten. Jene, denen unterstellt wurde zu hassen. Jene, denen abgesprochen wurde, hassen zu können. Und vor allem jene, die hassten. Hassen. Menschen, die den Hass nicht nur erleiden, sondern ihn wählen.
Ein letztes Gleichzeitig habe ich noch auf Lager: Ich schrieb, der Hass sei verpönt und falle vor allem durch seine konzeptuelle Abwesenheit auf. Das stimmt zwar einerseits, doch andererseits steht er manchmal auch ungünstig im Weg. Der Hass soll dann als Erklärung für Phänomene herhalten, die er aber gar nicht erklären kann, zumindest nicht allein.
Ein Beispiel, dem ich in meiner Arbeit immer wieder begegne, ist die Misogynie, also die systematische Unterdrückung, Vernichtung, Bestrafung und Kontrolle der Körper von Frauen und anderen Geschlechtern, die nach herrschenden patriarchalen Maßstäben von der Mehrheit der Gesellschaft und ihren Institutionen als weiblich und minderwertig kategorisiert werden. Damit geht die konsequente Abwertung aller Eigenschaften, Tätigkeiten und Formen von Arbeit einher, die mit dem Adjektiv weiblich beschrieben werden.
Misogynie wird oft als »Frauenhass« übersetzt. Doch diese Bezeichnung ist verfälschend. Denn erstens trifft Misogynie nicht nur Frauen, sondern vielfältige weibliche und queere Geschlechter. Zweitens hinterlässt die Betitelung durch »Hass« bei vielen Menschen den Eindruck, bei Misogynie handle es sich um eine Frage der Emotionalität, um eine hasserfüllte Beziehung zwischen Individuen, eine Haltung von bösen Menschen mit negativen Vorbehalten, die einfach verlernt und vergessen werden kann. Doch die von Misogynie betroffenen Menschen müssen nicht im alltäglichen Sinne gehasst werden. Sie können begehrte Partner*innen und Freund*innen sein. Auch das schützt sie jedoch manchmal nicht davor, von ihrem Partner ermordet zu werden. Misogynie also allein durch den Hass zu beschreiben, führt schlimmstenfalls dazu, das Unterdrückungssystem zu relativieren, zu entpolitisieren und infolgedessen zu stärken.
Es ist genau diese Verzahnung von Konzepten von Hass und Herrschaft, die mich in diesem Buch interessiert. Wie hängen sie zusammen? Wo bedingen sie einander, wo stört der Hass? Herrschaft ist nicht unbedingt eine unmittelbare, soziale Beziehung, die über Befehle, Gehorsam und Bestrafung funktioniert. Die Herrschaft greift über ein System um sich, mit ihrer Gesamtheit an Strukturen, indirekten Erwartungen, Regelwerken, Mechanismen und Arbeitsteilungen. Die Herrschaft bestimmt manchmal ganz unbemerkt über Körper, Räume und Zeiten.
Ich habe es bereits vorweggenommen: Ich schreibe in diesem Buch über Ökonomien des Hasses, den Hass als Staatsform, als Herrschaftssystem. Ich schreibe aber auch über Hass als Reaktion der Gegengewalt auf die Unterdrückung, als Selbstverteidigung, als notwendiges Mittel der Gerechtigkeit. Der Hass interessiert mich nicht zuletzt dort, wo er mehr ist als ein bloßes Reagieren, wo er sich zu einer schöpferischen Kraft transformiert. Mich interessiert ein Hass, der das, was Menschen entfremdet und entwürdigt, angreift. Ein Hass, der Zärtlichkeit hervorbringt.
Genauso wie die Liebe, das schrieb ich bereits, ist der Hass ein Tun. Es gibt keinen Hass ohne die Hassenden, es gibt keine Hassenden ohne hassende Körper, die sich bewegen und verbünden gegen die inneren und äußeren Widerstände. Und auch an ihrem Hass scheitern.
Die Hassenden treten im letzten Teil dieses Buchs auf die Bühne, in meinem Kopf habe ich Scheinwerfer auf sie gerichtet, nach ihrem Groll und ihrem Flüstern gehorcht, ihrem Hass und Widerstand nachgespürt, ich habe in Erinnerungen, Ängsten und Träumen gewühlt, in Geschichtsbüchern, Archiven, Romanen und Filmen nach ihnen gesucht. Ich habe versucht, die Geschichten zu verweben, um den Hass vergleichen, abgrenzen und vermengen zu können, über Zeiten, Gleichzeitigkeiten und Grenzen hinweg.
Doch, liebe Leser*innen, bevor ich den Vorhang zur Bühne öffne, muss ich noch zu einem historischen Streifzug einladen. Denn ich schrieb, der Hass sei ein Mittel der Herrschaft. Und darauf muss jene Frage folgen: Welcher und wessen Hass herrscht und beherrscht? Woher kommt das herrschende Wissen über den Hass, und wie beeinflusst er unsere Gegenwarten? Das ist die Suche, mit der ich beginne.
HASS
Es ist der Groll im Herzen
es ist die Rache des Verbannten
Im Traum werden Bäume ausgerissen
das Ungeborene wird nicht geboren
die Reisetasche gestohlen der Weg
übers Seil unmöglich geworden
heimatlos der Verstand
– Brigit Keller, »Sehnarben«
Der Hass lässt sich nicht entlang von abgesteckten Pfeilern erzählen, unbeirrt geradeaus, wie an einem Maßband im Zeitraffer aufgestreut. Denn es gibt eben keine Geschichte des Hasses ohne ihre Gleichzeitigkeiten. Ohne dass es unübersichtlich, unruhig wird.
Doch eine Spur der Vergangenheit will ich verfolgen, weil sie sich durch Ideen und Realitäten schlängelt, in der sich Fragen nach Emotionen, Besitz und Herrschaft unweigerlich bedingen. Ich beginne dort, wo jedes scheinbar anständige und langweilige Philosophiestudium in Deutschland ansetzt: in der Antike, bei Aristoteles.
Dieser hat sich in seinen Schriften ausgiebig mit Gefühlen beschäftigt, mit dem Hass, doch vor allem mit dem Zorn. In seinem Werk Rhetorik dient diese Auseinandersetzung einem besonderen Zweck: Aristoteles fragt sich, welche Emotionen gebraucht und aktiviert werden sollten, um andere Menschen oder auch einen Richter zu überzeugen. Nützliche Gefühle und Ideale zählt er dabei zu den Tugenden (Gerechtigkeit, Tapferkeit, Mäßigkeit, Edelmut oder Sanftmut) 4 , während er die Furcht oder den Zorn zu den Affekten zählt.
»Zorn ist also (…) ein von Schmerz begleitetes Trachten nach offenkundiger Vergeltung wegen offenkundig erfolgter Geringschätzung, die uns selbst oder einem der Unsrigen von Leuten, denen dies nicht zusteht, zugefügt wurde«, schreibt Aristoteles. 5 Der Mensch sei erzürnt, so fährt er fort, weil ihm etwas verweigert werde. Sei es etwa dem Durstigen etwas zu trinken. Und so beträfe der Zorn vor allem Menschen in Leid, »in Armut, im Liebesverlangen, im Zustand des Durstes, kurz: immer wenn sie irgendein Verlangen haben und es nicht stillen können, jähzornig und leicht in Wut zu versetzen, am meisten denen gegenüber, die ihren gegenwärtigen Zustand geringschätzen.« 6
Zorn entstehe aus etwas, das uns selbst betreffe. Die Feindschaft hingegen brauche diesen persönlichen Aspekt nicht. Und als eine Form der Feindschaft definiert Aristoteles eben den Hass. Der Zorn richte sich gegen Individuelles, gegen einzelne Menschen, die uns Unrecht tun, aber der Hass richte sich gegen »Gattungen«. Als Beispiel führt Aristoteles die Dieb*innen an, die angeblich jede*r hasse (ob sich Dieb*innen dann auch selbst hassen müssen, lässt er offen, aber ich bezweifle, dass Dieb*innen grundsätzlich die Adressat*innen seiner Philosophie sind).
Den Zorn heile die Zeit, der Hass sei nicht heilbar. Der Zorn sei das Verlangen nach Schmerz, der Hass das Verlangen nach Schaden.
In diesen Gedanken von Aristoteles offenbaren sich die Marker, entlang derer der Großteil westlicher Denker*innen und Theolog*innen in den folgenden Jahrhunderten den Hass kulturell zeichnen: Der Hass schadet. Das ist der Kern seiner Natur. Er schadet dem Menschen und der Gemeinschaft.
Emotionen folgen bei Aristoteles einer eindeutigen Hierarchie der Zweckmäßigkeit und Wertigkeit. Menschen streben nach dem Ideal der Wahrheit und einem guten Leben. Die Tugenden helfen ihnen auf diesem Wege, die Affekte, wie Zorn oder Hass, hingegen stören und müssen durch die Vernunft reguliert werden.
Ich erwähnte bereits, dass die aristotelische Philosophie der Emotionen hauptsächlich in dem Werk Rhetorik Platz findet, also in der Schrift, die von der Kunst der Rede und Überredung handelt, etwa im Rahmen einer Gerichtsverhandlung. Und in genau diesem Zusammenhang ist die Hierarchisierung der Emotionen auch zu verstehen. Denn in Situationen des Streits oder vor Gericht könnten niedere Affekte, wie etwa der Zorn, den Richter reizen. Die Herrschenden reizen.
Die gegebene herrschende Ordnung verlangt keine leidenschaftliche Auflehnung, sie droht ihr mit Bestrafung, und wenn überhaupt erfordert sie von den Angeklagten, sich in ihr kunstvoll zurechtzufinden. Es geht darum, nicht aufzubegehren. Und auch deshalb sind der Zorn und der Hass keine Tugenden, sondern gefährliche Affekte. Sie stören die Ordnung.
Es liegt – wie so oft in den westlichen Philosophien – an der Vernunft, die negativen Emotionen oder Affekte wie Zorn und Hass zu regulieren, die Ordnung zu erhalten. Es ist jedoch bekannt, dass Aristoteles nicht alle Menschen als vernunftbegabt betrachtet, mehr noch handelt es sich dabei eigentlich nur um eine Gattung Mensch, der dieses Talent zugutekommt: der freie, bürgerliche, besitzende Mann (also der, der so große Angst vor Dieb*innen hat).
Das Urteil über den Hass und die Hassenden steht also bereits in der Antike unweigerlich in einer Beziehung zur Herrschaft. Davon zeugt ein weiteres, besonders anschauliches Beispiel aus der Zeit des Frühchristentums. Es handelt sich um eine Schrift aus dem zweiten Testament der christlichen Bibel. In dem sogenannten Römerbrief aus der Mitte des 1. Jahrhunderts – Jesus ist bereits gekreuzigt worden – wendet sich der Apostel Paulus an die junge römische Gemeinde. Diese besteht damals in der Mehrheit aus sogenannten Judenchrist*innen, also aus Jüdinnen*Juden, die an Jesus als Messias glauben. Im römischen Reich sind sie zu dieser Zeit eine verfolgte, unterdrückte Minderheit und auch in ihren ehemaligen Synagogengemeinden oft nicht mehr geduldet.
In dem Brief betont Paulus die christliche Heilsbotschaft und appelliert an die Verfolgten: »Lass dich nicht vom Bösen unterkriegen, sondern besiege Böses mit Gutem: Jeder Mensch soll sich den [staatlichen] Gewalten unterordnen, die an der Macht sind. Denn es gibt keine Macht außer von Gott. Die bestehende ist von Gott eingesetzt. Wer sich gegen die Macht stellt, widersetzt sich deshalb der Anordnung Gottes. Die, die Widerstand leisten, müssen damit rechnen, verurteilt zu werden (…) Wen ihr fürchten müsst, fürchtet. Wen ihr achten müsst, achtet. Dann seid ihr niemandem etwas schuldig – außer einander zu lieben (…) Lasst uns ein gutes Leben führen, das dem Tag entspricht: ohne verschwenderische Trink- und Essgelage, ohne sexuellen Missbrauch und Orgien, ohne Hass und Neid. Zieht Jesus, den Messias, an, dem wir gehören.« 7
Böses mit Gutem besiegen. Liebe statt Hass. Das Überleben und die Antwort auf die Repression verklärt Paulus zu einer Frage des moralischen, gottesfürchtigen Lifestyles. Der Römerbrief in dieser Überlieferung individualisiert und entpolitisiert nicht nur die Antwort auf die Unterdrückung, die die Judenchrist*innen erfahren. Auch liefert der Text in den folgenden Jahrhunderten für die christlichen Kirchen wie auch staatliche Institutionen eine zuverlässige Grundlage, um die Herrschaft der Obrigkeiten, ihre Gewalt und die Erwartung des Gehorsams zu rechtfertigen.
Der Römerbrief verdammt den Hass mustergültig als ein abtrünniges Element des Widerstandes gegen die göttliche, aber auch irdische Ordnung. Das ist eine Botschaft an das religiöse Innen wie Außen. Von den Gläubigen verlangt diese Botschaft Gehorsam und Friedfertigkeit – auch angesichts der Ungerechtigkeiten in der Welt und in den eigenen Reihen. Die Botschaft an das Außen ist: Wir sind eine Religion des Friedens, eine Selbstbeschreibung, die das Christentum wie auch der Islam gleichermaßen für sich beanspruch(t)en – um als selbst ernannte Heils- und Friedensbringer viele Teile der Erdkugel gewaltsam zu kolonisieren.
Körper, beherrschte Körper zu disziplinieren, bleibt ein zentrales Herrschaftsinstrument dominanter christlicher Denkschulen. Der Zorn wird zu einer der sieben Todsünden erklärt. Römisch-christliche Denker wie Augustinus bestehen zwar im vierten und fünften Jahrhundert darauf, dass auch die sogenannten niederen Affekte zur Natur des Menschen gehören. »Gleichzeitig hält er am Ideal einer nicht von Leidenschaften getriebenen Existenz fest«, wie die Philosophinnen Hilge Landweer und Ursula Renz beobachten, »doch hat diese ihren Ort im Paradies oder im Jenseits.« 8
Ab dem 18. Jahrhundert stehen Emotionen, selbst negative Emotionen, dann doch hoch im Kurs, zumindest in ausgewählten Kreisen von Philosoph*innen und Denker*innen. Sie wollen sich auf diese Weise von den dominanten Philosophien der Aufklärung abgrenzen, die Rationalität und Vernunft preisen. Sie hingegen preisen das Gefühl. Es ist die Zeit der Romantik, der Rückbesinnung auf innere Prozesse, die als der eigentlich moralische Maßstab für Richtig und Falsch dienen sollen.
1826 schreibt der berühmte britische Schriftsteller William Hazlitt sogar das Büchlein Über das Vergnügen zu hassen, das sich in verschiedenen Essays dem Genuss und der moralischen Wertigkeit von Hass als Teil der menschlichen Natur widmet.
Das Buch lässt sich in der Sprache junger Menschen bestenfalls als cringe beschreiben. Hazlitt philosophiert darin etwa über seinen Heldenmut, eine Spinne nicht zu töten, obwohl er ihren Anblick hasse (er kommt bei der Schilderung übrigens nicht drum herum hinzuzufügen, dass ein Kind, eine Frau, ein Hanswurst oder ein Moralist9 das kleine Tier zu Tode gequetscht hätte, und ja, das ist tatsächlich die Reihenfolge seiner Aufzählung). Im Laufe der Lektüre offenbart sich mehr oder minder, dass Hazlitt ein beleidigter Zeitgenosse ist, weil seine Freund*innen nicht mehr mit ihm abhängen wollen. Und die Weltliteratur ist dann um ein Werk reicher, in dem ein gekränkter weißer Mann sein verletztes Ego in gewollt philosophischen Ergüssen badet.
Dass William Hazlitt ein weißer





























