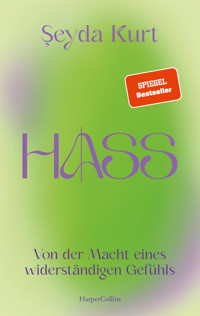13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
What is love? Ist die Liebe Sinn des Lebens, eine politische Allianz, Illusion oder Selbstzweck? Oder ist sie gar unmöglich, weil wir uns zwischen Zukunftsängsten, überhöhten Ansprüchen und diskriminierenden Strukturen völlig zerreiben?
Şeyda Kurt nimmt unsere allzu vertrauten Liebesnormen im Kraftfeld von Patriarchat, Rassismus und Kapitalismus auseinander – und erforscht am Beispiel ihrer eigenen Biografie, wie traditionelle Beziehungsmodelle in die Schieflage geraten, sobald sicher geglaubte Familienbande zerbrechen und hergebrachte Wahrheiten in Zweifel geraten. Denn Liebe existiert nicht im luftleeren Raum. Sie ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. Und sie ist politisch.
Wie also wollen wir wirklich lieben? Wen und wie viele? Wie kann er aussehen, ein radikaler Neuentwurf der Liebe? Und wie können Menschen sich gemeinsam gegen die Ismen unserer Gesellschaft behaupten – als Partner*innen, Familie und Freund*innen? Scharfsinnig, witzig und mit einem feinen Gespür für die zahlreichen Fallstricke und Dimensionen der Liebe erzählt Şeyda Kurt von ihrer Suche nach neuen Narrativen – und einer uns eigenen Sprache der Zärtlichkeit, in der wir mit überkommenden Beziehungsmodellen brechen und ein gerechteres Miteinander wagen können.
»Es macht großen Spaß, sich von ihr den Kopf verdrehen zu lassen.« Alexandra Friedrich, NDR Kultur, 20.04.2021
»Ein zukunftsweisender und gerade wegen seiner Kritik an der Liebe radikal liebevoller Denkanstoß.« Marlene Halser, Berliner Zeitung, 30.04.2021
»Seyda Kurts Buch ist ein überzeugendes Plädoyer für eine Vielfalt von Beziehungsformen – und für die Bedeutsamkeit von Freundschaften.« Inga Dreyer, neues deutschland, 06.05.2021
»Wenn Sie sich diese Frage auch stellen möchten, in welchen Beziehungen möchte ich leben, dann empfehlen wir Şeyda Kurt.« rbb die Literaturagenten, 09.05.2021
»Der langersehnte Befreiungsschlag – komprimiert auf 215 gut recherchierte und noch besser geschriebene Seiten.« Philipp Köpp, Esquire.de, 23.05.2021
»[Ein] Anfang der Auseinandersetzung auf Augenhöhe. ‘Radikale Zärtlichkeit‘ ist beides: radikal und zärtlich.« Mithu Sanyal, WDR5, 21.05.2021
»Es ist ein im positiven Sinne freches Buch.«Natascha Freundel,Rbb Kultur, 01.06.2021
»Ich habe bei der Lektüre sehr viel über mich selbst gelernt.« Linus Giese,GQ, 03.06.2021
»Spannend, humorvoll und absolut empfehlenswert.« Verena Kettner,An.schläge, 06.2021
»Regt zu einer Auseinandersetzung an.« Philipp Schröder,Berliner Morgenpost, 14.06.2021
»Lesenswert!« Marigona Sulejmani, Grazia, 01.07.2021
»Alle sollten es lesen.« Marlene Münßinger,Bücher Magazin, 08.2021
»Ein lesenswertes und hochaktuelles Plädoyer für eine neue Form der Liebe.« Maja Pfeifle, SWR2 Lesenswert, 16.09.2021
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Originalausgabe © 2021 by HarperCollins in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg Covergestaltung von Elif Küçük E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783749950454
www.harpercollins.de
Motto
Want to know you better
Want to push you, baby
But never too far
– No Angels,
»Daylight in Your Eyes«
EINLEITUNG
WARUM LIEBE POLITISCH IST. UND WARUM ZÄRTLICHKEIT RADIKAL SEIN MUSS
Dieses Buch gründet auf einem Unbehagen. Manchmal rumort es, manchmal tobt es. Mal klagt das Unbehagen, mal schweigt es. Doch es verschwindet nie. Es macht sich unerwartet beim Blick auf die Nachrichten bemerkbar. Und manchmal beim Blick auf ein vergessenes Kindheitsfoto. Das Unbehagen und ich, wir sind uns schon länger bekannt.
Als Journalistin schreibe ich über Kunst und Kultur, über Innen- und Außenpolitik, über Diskriminierung und Ausbeutung, (Anti-)Rassismus, Kolonialismus und Feminismus. Ich schreibe, weil ich das Erzählen mancher Geschichten und Perspektiven, aber auch jener Analysen, die all diese Netze verweben, für unerlässlich halte. Ich schreibe, weil mich die Welt zutiefst beunruhigt. Buchstaben machen die Unruhe für mich fassbar. Und ich schreibe, weil ich Veränderung will.
Ein Unbehagen, das ich vor langer Zeit zu spüren begann, betrifft die etablierten Wahrheiten der Liebe. Kurz vor meinem Abitur trennten sich meine Eltern. Ich war erschüttert. Und ich versuchte die zurückgebliebenen Bruchteile meiner Gefühle neu und sinnvoll zu ordnen. Ich begann die Erwartungen, die an mich als Tochter, Partnerin, Frau, rassifizierte Frau, Frau aus einer Arbeitendenfamilie mit vorgeschobenem Dies-und-jenes-Hintergrund gerichtet wurden, neu zu verhandeln. Manche nahm ich an, andere wies ich ab. Ich arbeitete mal auf brüchigem Boden, mal mit ausholenden Schritten an Beziehungen, die auf Fairness und Gleichheit fußen sollten – und tue es immer noch. Und irgendwann auf diesem Weg verabschiedete ich mich von der Monogamie.
Doch das Unbehagen bleibt.
In diesem Buch verknüpfe ich all diese Themen, die mich seit vielen Jahren als Journalistin umtreiben, mit den Wahrheiten und Lügen der Liebe – und mit meinen eigenen Erfahrungen. Denn vor einiger Zeit merkte ich, dass ich lange selbst in die Falle getappt war, meine Beziehungen aus meinen politischen Überlegungen herauszuhalten. Und damit bin ich nicht alleine. Trotz der Impulse der feministischen #MeToo-Bewegung aus den letzten Jahren und der Kritik an diskriminierenden und ausbeuterischen Verhältnissen schließen selbst viele Feminist*innen insbesondere die Sphäre der romantischen Zweierbeziehungen aus diesen Verhandlungen viel zu häufig aus.
Was »romantisch« überhaupt bedeuten soll? Puh. Das ist ein Wort, an dem ich mich in diesem Buch ziemlich abarbeite. Aber so viel sei vorweggenommen: Ich verstehe romantisch als ein historisch gewachsenes Konzept, das die Beziehung von zwei Menschen zueinander normieren will. In unserer Gesellschaft kommt der romantischen Beziehung – zumal in Hetero-Konstellationen – ein Vorrang zu. Eine romantische Beziehung wird als exklusiv, meist monogam und sexuell verstanden.
Andere Konzepte von Intimität, etwa Freund*innenschaften, werden im Gegensatz zur romantischen Beziehung häufig als weniger erstrebenswert betrachtet. Während die meisten bei dem Gedanken an romantische Beziehungen grundsätzlich davon ausgehen, dass die Partner*innen auch Sex haben, sprechen sie Freund*innenschaften sexuelle Intimitäten ab. Somit lebt das Konzept der romantischen Beziehung von gewissen Abgrenzungen und Polarisierungen, die viele oftmals unhinterfragt hinnehmen.
Viel zu selten sprechen wir darüber, wie unser Miteinander anders sein könnte. Vielleicht weil wir zu oft davon ausgehen, dass das Verständnis dafür, etwa für das Phänomen der Liebe und Freund*innenschaft, in uns eingepflanzt ist und nicht zur Neuverhandlung steht. Als gäbe es eine Mechanik der Umgangsformen, die wir nur ab und an mit ein paar Küssen und Worten ölen müssten. Viele denken, weil wir Menschen seien, wüssten wir automatisch, wie wir einander zu begegnen hätten. Doch wenn ich mir einer Tatsache sicher bin, dann dass wir imstande sind zu erkunden, wie wir einander begegnen wollen. Und diese Angelegenheit ist höchst politisch.
»Politisch ist alles, was mit Begegnung, Reibung oder Konflikt zwischen Lebensformen, Wahrnehmungsweisen, Sensibilitäten, Welten zu tun hat, sobald dieser Kontakt einen gewissen Intimitätsgrad erreicht hat«1, schreiben die Autor*innen des Unsichtbaren Komitees in ihrer Streitschrift Jetzt. Reibungen und Konflikte entstehen dort, wo Bedürfnisse und Interessen aufeinanderstoßen. Und infolgedessen stellt sich die Frage, wer imstande ist, sich für diese Bedürfnisse starkzumachen, wer die Möglichkeit hat, diese zu realisieren. Die Frage nach den Möglichkeiten ist immer politisch. Und die Frage nach den Möglichkeiten eines jeden Menschen ist immer die Frage nach Macht und Ohnmacht.
Ich behaupte, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der mächtige Institutionen, Gesetze und das zirkulierende kollektive Wissen unermüdlich daran arbeiten, manche Wahrheiten aufrechtzuerhalten. Auch die Wahrheiten der Liebe. Es sind Wahrheiten, die über unsere Körper herrschen sollen und in ihrem Kern von patriarchalen, rassistischen und kapitalistischen Logiken zusammengehalten werden. Es sind hierarchisierende Muster, die sich tief in die Textur unseres Denkens und Fühlens eingefressen haben. Und sie äußern sich darin, wie wir miteinander kommunizieren. Wie wir einander berühren, ob und wie wir einander schützen. Ich sehe das und erlebe das, auch in meinen eigenen Beziehungen zu anderen Menschen, seien sie sexuell, romantisch oder freund*innenschaftlich.
Eine der gefährlichsten Wahrheiten ist, dass mein Verhältnis zu mir selbst und zu anderen Menschen eben nicht politisch sei. Dass es sich um eine rein private, individuelle Angelegenheit handle, für die ich mich allein verantwortlich zeichne.
Romantische Zweierbeziehungen wie traditionelle Kernfamilien sind dabei so häufig Räume von (Macht-)Missbrauch, weil sie sich als vermeintlich rein private Sphären dem Öffentlichen entziehen. Und weil gefährdete Menschen in gefährlichen Beziehungen auf diese Weise auf sich gestellt bleiben. Ich möchte nicht falsch verstanden werden: Es geht mir nicht darum, dass andere sich ungefragt in meine Beziehungen, in meine Intimsphären einmischen sollen. Aber ich kritisiere den Starrsinn von Logiken, die nur zulassen, zwischen zwei angeblich konträren Polen entscheiden zu können: auf der einen Seite die vermeintlich absolute Freiheit des Privaten und auf der anderen Seite der absolute Zwang des Politischen. Das ist nicht nur absoluter Quatsch, sondern auch eine verkürzte Analyse. Die Politisierung von Beziehungen nimmt uns nicht unbedingt Handlungsräume weg. Ganz im Gegenteil: Sie eröffnet Handlungsräume, weil wir Muster und Machtstrukturen erkennen, die uns gewisse Rollen zuweisen und uns in diesen Rollen gefangen halten.
Denn was folgt aus der Erkenntnis, dass Beziehungen politisch sind? Daraus folgt, dass sie veränderbar sind, genauso wie Politiken veränderbar sind. Und genau das macht jenen, die von der Ohnmacht anderer profitieren, Angst. Sie haben Angst vor der Forderung nach einem Miteinander auf Augenhöhe. Sie haben Angst vor der Forderung nach Zärtlichkeit, wie ich sie verstehe.
Im Haupttitel meines Buches ziehe ich den Begriff der Zärtlichkeit dem Begriff der Liebe vor. Warum? Zärtlichkeit und Liebe sind beides Substantive. Doch mir scheint es, dass dem Wort der Zärtlichkeit eine direktere Aufforderung zugrunde liegt – die des tatsächlichen Zärtlichhandelns. Ich sehe Zärtlichkeit dort, wo Menschen zärtlich zueinander sind, ganz konkret, und diese Zärtlichkeit kann viele Formen haben. Doch immer ist sie von einem Handeln geleitet: ein Sprechen, ein Schauen, eine Bewegung, die – je nach Absprache – nicht immer unbedingt sanft und behutsam sein muss. Es geht um ein Handeln, das einem anderen Menschen zuspielt, mit ihm spielt, bejahend und produktiv, ohne ihm schaden zu wollen. Bei Zärtlichkeit denkt kaum jemand an Gewalt.
Daher ist die Zärtlichkeit mein Ausgangspunkt und mein Ziel.
Mit gängigen Konzepten von Liebe – und damit meine ich insbesondere jene der romantischen – verhält es sich in unserer Gesellschaft oftmals anders. Mit diesen Konzepten beschäftige ich mich, wie der Untertitel meines Buchs verrät, auf dem Weg zu einer neuen Idee von Intimität. Jede*r kennt die Erzählungen von romantischer Liebe als Drama, Hölle, Kampf, Schmerz oder als ein gewaltvolles Naturereignis, dem wir uns beugen und ausliefern müssen – gerade als weibliche Personen –, auch wenn die Konsequenzen uns zerstören mögen.
Filme und Bücher erzählen von der Liebe, selbst wenn sich die vermeintlich Liebenden bekriegen und verletzen, selbst wenn sie sich egoistisch und gewaltvoll verhalten. Und all diese Erzählungen von der romantischen Liebe als Krieg und Kreuzzug gibt es in unserer westlich-europäischen, kapitalistischen Kultur, in deren Gegenwart die koloniale und nationalsozialistische Geschichte dieses Landes konserviert ist, nicht ohne Grund. Sie existieren, weil weiße bürgerliche cis Männer in den letzten Jahrhunderten Gewalt und Macht und infolgedessen Zeit und Muße hatten – jedenfalls mehr Zeit und Muße als etwa ihre Frauen und Bediensteten, deren Arbeitskraft sie im Haushalt und anderswo ausbeuteten –, die romantische Liebe in dieser Form zu imaginieren. In diesen Erzählungen lassen sich über Jahrhunderte hinweg gewachsene vergeschlechtlichte, rassifizierte und andere Herrschaftsverhältnisse und Rollenverteilungen nachspüren. Wer ist aktiv, und wer bleibt passiv? Wer leidet, und wer triumphiert?
Dass die Sphäre der romantischen Liebe dennoch selbst in feministischen Diskursen weitestgehend ausgeklammert wird, wie ich feststellte, ist keine originelle Beobachtung. Sie ist so alt wie feministische Bewegungen selbst. Für die Arbeit der Autorin bell hooks war und ist das Ausfüllen dieser Leerstelle ein zentrales Anliegen. Im Jahre 2000 schrieb sie ihren visionären Bestseller All About Love – Alles über Liebe. Zwar gelingt es dem Buch selbstverständlich nicht, alles über Liebe zu erzählen. Doch alles in diesem Buch handelt von Konzepten der Liebe, Zuneigung und Gemeinschaft. hooks schreibt über (männliche) Macht, Ehrlichkeit, Kapitalismus, Rassismus und entwirft letztlich eine Ethik der Liebe, die sie in ihren Büchern Salvation (2001) und Communion (2002) weiter vertieft. hooks feinfühlige Analysen sind für mein Buch unentbehrlich.
Auch die in Israel lehrende Soziologin und Autorin Eva Illouz beobachtet, dass die feministische Revolution nicht nur nötig und heilsam, sondern auch unvollendet sei: Sie habe eine Quelle des Unbehagens hinterlassen und »die männliche und weibliche Sehnsucht nach Liebe und Leidenschaft«2 nicht erfüllen können. Laut hooks hat sie sogar zuweilen genau das Gegenteil bewirkt. Feminist*innen hätten den Eindruck, dass ihre Sehnsucht nach Liebe antirevolutionär oder uneffektiv sei. »Um ein ausgeglichenes Leben zu führen, sollte sich keine Frau dazu gezwungen fühlen, die Bedeutung der Liebe zu verleugnen«3, schreibt hooks. Das stimmt. Und es stimmt für alle Geschlechter.
Ist das Fazit also: Feminist*innen (und andere), wir brauchen mehr Liebe?! Und dann ist die Revolution vervollständigt?! Ich denke: Nein.
Ich streite nicht ab, dass viele Menschen – und dazu gehöre auch ich – ein tiefsitzendes Bedürfnis nach Gemeinschaft und Nähe haben. Und doch ist die Frage, wer was im Leben braucht, eine höchst individuelle Angelegenheit. Nicht alle Menschen etwa sehnen sich nach romantischer Liebe. Manche sehnen sich nach Freund*innenschaft. Andere nach Verbindung unterschiedlichster Art.
Ich etwa glaube nicht an eine Natur der (romantischen) Liebe, die unterdrückt wird und befreit werden muss – und schon gar nicht glaube ich an eine Sehnsucht nach romantischer Liebe, die per se männlich oder weiblich ist. Ich glaube an eine Vielfalt der Bedürfnisse und Zärtlichkeiten, die unterdrückt und vereinheitlicht werden.
Und Liebe oder Zärtlichkeit allein vervollständigen keine Revolution. Zärtlichkeit allein ändert nichts an rassistischen, sexistischen oder kapitalistischen Strukturen, Besitz- und Produktionsverhältnissen, Gesetzen und Normen, die Menschen diskriminieren, sie ausbeuten, ihre Körper verletzen und zerstören. Die Welt wird nicht allein dadurch besser, dass ich in meinem nächsten Umfeld faire und zärtliche Beziehungen führe. Es muss um Solidarität mit anderen Menschen gehen, die über meine Partner*innen- oder Freund*innenschaft hinausgeht.
Dieser Gedanke beschäftigte mich im Frühling 2020 mehr denn je. Nicht nur, weil ich an meinem Buchmanuskript schrieb. Sondern auch, weil die sogenannte Coronakrise erneut drastisch vor Augen führte, wie gefährlich für viele Menschen unser gesellschaftliches System ist, in dem sich einige in Krisensituationen ins wohlbehütete Heim zurückziehen und andere – gerade jene in schlecht bezahlten, sogenannten systemrelevanten Berufen – unbezahlte Überstunden schieben mussten, damit diese fragilen Strukturen nicht endgültig zusammenbrechen. Unser Gesellschaftssystem funktioniert nur, weil es auf Ungleichheit beruht. Und daher bin ich mir des großen Privilegs bewusst, dass es hauptsächlich dieses Buch war, das mir in diesen Monaten schlaflose Nächte bescherte.
Die politische Krise im Zuge der Pandemie hat bewiesen, mit welcher Gewalt und Ignoranz viele beschworene Normen in unserer Gesellschaft Menschen ausschließen: die Norm, ein Zuhause zu haben. Die Norm, ein Zuhause zu haben, das Schutz bietet. Die Norm, für sich und andere Menschen sorgen zu können. Die Norm der Familie und Partner*innenschaft. Die Norm der Kernfamilie als sicherer Hafen.
Ende 2020 schlugen Opferverbände wie der Weiße Ring Alarm: Im Zuge der Ausgangsbeschränkungen verzeichneten sie zehn Prozent mehr Fälle von (sexualisierter) Gewalt in häuslichen Räumen. Und sie gehen davon aus, dass diese Zahlen steigen werden.4
Etwa gleichzeitig wurde von queeren Menschen Kritik an den Regelungen in vielen Bundesländern zur Kontaktbeschränkung an Weihnachten laut: Wenn Menschen nur mit ausgewählten Personen aus ihrem nächsten Familienkreis feiern dürfen, was gilt dann als Maßstab für diese Form der Verbindung? Blutsverwandtschaft – so ganz archaisch? Was ist, wenn ich die Feiertage nicht mit dem grantigen Naziopa, sondern mit meiner besten Freundin verbringen will, mit der ich mein Leben teile? Was ist mit selbst gewählten Familien, Lebensgemeinschaften, die sich der traditionellen Verbindung durch Blutsverwandtschaft und Ehe entziehen?
Diese Beispiele bringen mich zu meinem ursprünglichen Gedanken zurück. Wenn also die romantische Beziehung und bürgerliche Kernfamilie in unserer Gesellschaft immer noch die Norm schlechthin ist, bleibt doch die Frage: Wer ist aus dieser Norm ausgeschlossen? Und auch für alle anderen Formen von Intimitäten gilt: Wer verfügt über die zeitlichen Ressourcen für Ruhe, Hingabe und Nähe – ob in Pandemiezeiten oder nicht, seien sie körperlicher oder anderer Art? Welche Körper können sich ungefährdet in unserer Gesellschaft bewegen, welche von ihnen sind geschützt? Welche werden begehrt? Wer muss andere Menschen nicht fürchten? Wer kann sich selbst ertragen?
Ich möchte also Zärtlichkeit nicht nur in meinen Beziehungen leben, sondern darüber hinaus ihre Bedingungen hinterfragen. Denn wer nur über Zärtlichkeit spricht, aber zu der Gewalt außerhalb der eigenen Beziehungen schweigt, kann gleich mit dem Naziopa einen Skiurlaub in Ischgl planen.
Das Ziel kann nicht einfach nur Zärtlichkeit sein. Ich will konsequenter denken. Es muss um radikale Zärtlichkeit gehen. Ich verstehe radikale Zärtlichkeit als ein Programm der Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit der Zärtlichkeit in der eigenen Beziehung, den scheinbar privatesten Spielräumen und darüber hinaus, gibt es nur dann, wenn sie für alle gilt.
Doch warum warte ich nicht eine Weltrevolution ab, um dann neu über Freund*innenschaften, Familien und andere Formen der Zärtlichkeit zu verhandeln? Warum schreibe ich dann überhaupt ein Buch über Zärtlichkeit? Und das auf über 200 Seiten! Nun, weil erstens – wie auch andere Autor*innen vor mir anmerkten – die Weltrevolution ein wenig auf sich warten lässt. Und zweitens: Auch wenn wir keine gerechte Gesellschaft schaffen, indem wir allein andere Beziehungen führen, wird diese Welt doch niemals eine gerechte sein, wenn wir nicht lernen, anders miteinander umzugehen und auch in unseren Beziehungen Machtverhältnisse zu reflektieren.
Es geht also um Gleichzeitigkeiten. Es geht um die Gleichzeitigkeit von Zärtlichkeit und Radikalität. Es geht um die Gleichzeitigkeit von Fairness im Privaten und Gerechtigkeit im Politischen. Und darum, dass diese Grenzziehungen irgendwann nicht mehr notwendig sind. Auf den Blick in die Vergangenheit und Gegenwart folgt in diesem Buch daher zwangsläufig ein Blick in die Zukunft. Radikale Zärtlichkeit ist das Eingeständnis der Notwendigkeit von Visionen, die politisch und vielfältig zugleich sind.
Dieses Buch wird weder Beziehungstipps liefern noch einfache Lösungen. Mit diesem Unbehagen müssen wir alle leben. Auch ich. Denn mein Unbehagen ist während des Schreibens nicht kleiner geworden. Außerdem hat sich noch ein anderes Gefühl eingestellt: das des Unwohlseins darüber, dass Autor*innen wie ich, die nicht einer dominanzgesellschaftlichen Norm (weiß, christlich, cis männlich) entsprechen, oft aus einer Betroffenheitsperspektive erzählen – oder erzählen müssen, um ihrer Expertise wiederum Gültigkeit und Gewicht zu verleihen. Diese Strukturen führen zu weiteren Marginalisierungen, weil diese Autor*innen sich selbst in ihren eigenen Texten als anders, als abweichend erzählen. Auch ich tue das in diesem Buch. Dass ich in dieser Position bin, macht mich oft wütend.
Gleichzeitig ist das, was ich weiß und was ich in diesem Buch erzähle, das vorläufige Ergebnis meiner Subjektivität im Rahmen gesellschaftlicher Strukturen. Und genau das ist ja meine Kernaussage: Das Persönliche ist politisch! Und woran könnte ich das stichfester zeigen als an meiner eigenen Perspektive? Oder zumindest, indem ich mit ihr beginne?
Das ist nur einer der Widersprüche, die ich in diesem Buch aushalten muss und die mich weit über dieses Buch hinaus beschäftigen. Als ich begann dieses Buch zu schreiben, wusste ich nicht, wohin mich meine Gedanken führen werden (auch wenn ich meinen Verlag vom Gegenteil überzeugte). Ich folgte lediglich dem Unbehagen. Zum ersten Mal schrieb ich, ohne zu wissen, wo ich am Ende rauskomme. Ich versuchte eigene Fragen, Zweifel und Widersprüche zuzulassen. Das war aufregend. Und neu. Und das ist es immer noch.
Was kommt nach der Entzauberung, wenn das Heilige und Transzendente der romantischen Liebe, wie wir sie gelernt haben, verschwunden ist? Dann kommt vielleicht die Unordnung. Und es kommen die ganzen Widersprüche. Das ist vielleicht das Einzige, das ich wusste, als ich zur ersten Seite dieses Buchs ansetzte: Ich will Unordnung stiften. Oder zumindest ein Unbehagen.
KLEINES GLOSSAR DER KOMPLIZIERTEN BEGRIFFE
Liebe Lesende,
die Welt ist kompliziert. Und manchmal gebrauche ich komplizierte Begriffe, um sie zu beschreiben. Damit Sie mir auf diesem Weg des Unbehagens folgen können, möchte ich vorab einige Begrifflichkeiten klären, die in diesem Buch maßgeblich die Fahrtrichtung mit vorgeben.
Rassismus / Sexismus und andere Ismen: Ich verstehe Rassismus oder Sexismus nicht als ein individuelles Problem aufgrund von Vorurteilen. Es sind historisch gewachsene Ordnungssysteme, also Systeme, die unseren Blick auf uns selbst und auf andere Menschen ordnen und strukturieren. In diesen Ordnungen werden Menschen – durch Gesetze, Institutionen, Normen etc. – je nach Körpermerkmalen, Geschlechtszuschreibungen, Herkunft und anderen Eigenschaften soziale Rollen zugewiesen. Und das von Geburt an. Diese Ordnungssysteme funktionieren nur, weil sie hierarchisch sind, also weil manche Menschen qua bestimmter Eigenschaften systematisch bevorzugt oder benachteiligt werden und ein Machtverhältnis zwischen Menschen etabliert wird. Auch unser kulturelles Wissen, das (etwa auch durch die Wissenschaften) von Generation zu Generation weitergegeben wird, ist Teil dieser Strukturen. Klingt abstrakt und kompliziert? Ja, das ist es. Und ich hoffe, dass diese Sätze im Laufe des Buchs eine konkrete Gestalt annehmen.
rassifiziert: Ich möchte in diesem Buch Formulierungen wie »Migrationshintergrund« oder »Einwanderungsgeschichte« vermeiden, die oft im Zusammenhang mit Menschen, die in unserer Gesellschaft Rassismus erfahren, bemüht werden. Das liegt daran, dass sie bei dem Thema Rassismus nicht den Kern der Sache treffen. Auch niederländische Menschen haben einen Migrationshintergrund, aber sind in Deutschland nicht in demselben Maße von Benachteiligung und rassistischem Terror bedroht wie zum Beispiel Menschen mit Einwanderungsgeschichte aus etwa Nordafrika, Westasien oder wie Schwarze Menschen. Letztere leben teilweise sogar seit Jahrhunderten in Deutschland. Ich bevorzuge daher den Begriff rassifiziert. Warum? Erstens: weil sich Rassismus als Ordnungsschablone Menschen aufzwängt. Sie werden also rassifiziert, indem ihnen vermeintlich unveränderbare Zugehörigkeiten zu Gruppen zugeschrieben werden, weil sie auf eine bestimmte Art und Weise aussehen oder sich verhalten. Infolgedessen werden sie hierarchisiert. Dieses System der Stereotypisierung zielt jedoch nicht lediglich auf Menschen mit Einwanderungsgeschichte ab. Es trifft unterschiedliche Gruppen, die gewissen Normen nicht entsprechen – aufgrund von Hautfarben und anderen körperlichen Merkmalen, aber auch aufgrund von Kleidung und Religiosität. Zweitens: Der Begriff betont, dass es bei Rassismus nicht um eine Biologie angeblich unterschiedlicher Rassen geht, sondern dass diese Kategorien kulturell und historisch erwachsen sind.
Schwarz: Der Begriff ist eine aus antirassistischen Widerstandspraktiken erwachsene Selbstbezeichnung von Menschen afrikanischer oder afrodiasporischer Herkunft. Daher schreibe ich Schwarz auch immer mit großem Anfangsbuchstaben. Das soll auch verdeutlichen, dass es sich dabei nicht um eine faktische Beschreibung einer Hautfarbe handelt, sondern um eine gesellschaftliche Position, die in global wirkenden, rassistischen Gefügen diesen Menschen zugeschrieben wird. Oder wie es die Autorin und Antidiskriminierungsexpertin Tupoka Ogette beschreibt: »›Schwarzsein‹ bedeutet, dass Menschen durch gemeinsame Erfahrungen von Rassismus miteinander verbunden sind und auf eine bestimme Art und Weise von der Gesellschaft wahrgenommen werden.«5
weiß: Auch beim Weißsein geht es nicht um die Beschreibung einer tatsächlich weißen Hautfarbe. Niemand ist weiß wie ein weißes Blatt Papier. Es geht bei der Bezeichnung um eine soziale Position in der hierarchischen, rassistischen Ordnung – und zwar weit oben. Es ist eine Zuschreibung aufgrund der Herkunft und der Erscheinung, die es in unserer Gesellschaft Menschen erlaubt, nicht als weniger wertvolle Andere, Fremde oder Normabweichende wahrgenommen zu werden. Darum schreibe ich weiß auch kursiv, um zu betonen, dass es sich auch hierbei um eine gesellschaftliche Konstruktion handelt, die anpassungs- und wandlungsfähig ist.
Dominanzgesellschaft: Oft wird in Debatten um Diskriminierung der Begriff der Mehrheitsgesellschaft bemüht, um etwa jene Mehrheit der Gesellschaft zu bezeichnen, die weiß und christlich ist, und somit nicht von Rassismus oder Antisemitismus betroffen. Ich finde den Begriff problematisch, da er vorgibt, dass politische Ungleichheiten in Gesellschaften Fragen von Mehrheiten und Minderheiten sind und nicht auch von Macht- und Herrschaftsverhältnissen, die durch Regeln, Normen und Institutionen aufrechterhalten werden. Es gibt etwa Länder, in denen ethnische oder religiöse Minderheiten brutal über Mehrheiten herrschen. Es geht also nicht ausschließlich um Zahlen und Mehrheiten, sondern darum, welche kulturellen Kategorien und Zuschreibungen dominieren. Daher spreche ich von Dominanzgesellschaft oder Dominanzkultur.
binär: Der Begriff binär [allg.: aus zwei Einheiten (Stoffen, Teilen, Ziffern usw.) bestehend]6 wird den meisten aus Diskussionen zum Thema Geschlechtsidentitäten geläufig sein. Eine binäre Vorstellung des Geschlechtersystems geht etwa davon aus, dass es nur zwei Geschlechter gibt: Mann und Frau. Selbst wenn ein sogenanntes Dazwischen zugelassen wird, wird dieses doch entlang dieser zwei Pole eingeordnet, die als eine natürliche Ordnung angenommen werden. Doch von Binarität kann auch in vielen anderen sozialen Gefügen die Rede sein, überall, wo erlernte gesellschaftliche Denkschemata einen angeblichen Gegensatz von zwei Eigenschaften vorgeben, entlang derer gewisse Normen ausbuchstabiert werden (zum Beispiel: homosexuell vs. heterosexuell).
biologistisch: Die Annahme, allein mit biologischen Maßstäben soziale Phänomene in unserer Gesellschaft erklären zu können, nenne ich, wie viele Kulturwissenschaftler*innen, biologistisch. Biologistische Erklärungen vernachlässigen es in der Regel, die Verhältnisse und Rollenverteilungen in unserer Gesellschaft auf ihre historischen und politischen Gründe hin zu analysieren.
Hetero / heteronormativ / heterosexuell: Wenn ich in diesem Buch den Begriff hetero verwende, meine ich damit heteronormativ (es sei denn, ich schreibe explizit heterosexuell). Damit meine ich die Entsprechung einer gesellschaftlichen Norm, in der Mann und Frau eine (romantische) Beziehung führen. Diese zwei Menschen können heterosexuell sein – müssen es aber nicht. Denn auch bisexuelle Menschen können etwa in als hetero wahrgenommenen Beziehungen leben.
cis: cis Menschen sind Personen, denen bei ihrer Geburt ein Geschlecht zugewiesen wurde, mit dem sie sich tatsächlich identifizieren (im Gegensatz zu etwa trans Menschen). Mir wurde etwa bei meiner Geburt das Geschlecht weiblich zugeschrieben, mit dem ich mich grundsätzlich identifiziere. Ich bin also cis. Warum ist diese Hervorhebung wichtig? Das verdeutlicht die Politikwissenschaftlerin Felicia Ewert in ihrem großartigen Buch Trans. Frau. Sein.: »Hiermit soll klargemacht werden, dass cis Personen nicht ›normal‹, sondern eben cis sind. Dies soll die gängige Sichtweise brechen und die Bedingungen ändern, unter denen transgeschlechtliche Menschen stets als Abweichung, als Fehler begriffen werden und sich immer wieder für ihre Geschlechter rechtfertigen müssen.«7
queer: Mit queer bezeichne ich Menschen, die eine Vielfalt an sexuellen und romantischen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten jenseits der cis-hetero-Norm leben und verteidigen. Ich verstehe darunter auch ein politisches Mindset, das Binaritäten als solche infrage stellen will (nicht alle homosexuellen Menschen etwa sind unbedingt queer oder verstehen sich als queer). Auch queer ist ein Begriff, der aus jahrzehntelangem politischem Widerstand und Theorienbildungen als Selbstbezeichnung erwachsen ist.
All diese Definitionen sind natürlich nicht starr und immer eindeutig. Sie dienen lediglich einer Orientierung, sind durchlässig und anpassungsfähig. Wie eben alles im Leben.
EINS: VOM ZWECK DER LIEBE
ÜBER FAMILIE, WAHRHEITEN UND ARBEIT
Ich komme in einer Aprilnacht im Jahre 1992 auf die Welt, im Gebärzimmer eines Kölner Krankenhauses. Während ich kreische, läuft mein Vater entgeistert aus dem Raum. Er hatte sich einen Jungen gewünscht.
Bis zu meiner Geburt hatte der betreuende Arzt meine Eltern über meine Intimorgane im Unklaren gelassen. Meiner Mutter war es egal, meinem Vater nicht. Dann kam ich. »Er war wie vom Esel gefallen«, erzählt meine Mutter heute. Ein Sprichwort, das sie wörtlich aus dem Türkischen übersetzt. Es meint: Jemand hat einen ordentlichen Schreck bekommen.
Ein Trost für meinen Vater war, dass er mir den Namen geben durfte, den er als junger Mann in einem türkischen Gedicht entdeckt hatte: Şeyda [ʃɛÞjdɐ]. Das bedeutet: verwirrt, verrückt vor Liebe. Mein Vater legte die Verwirrung über das Geschlecht, das mir zugewiesen wurde, schnell ab und freute sich über das gesunde Kind.
Meine Mutter war nach einer Fehlgeburt unverhofft wieder schwanger geworden. Die Geburt meiner Schwester war bereits zehn Jahre her. Ein zweites Kind war nicht geplant. Ich war also kein Kind aus Liebe, wie man das so nennt. Im Umfeld meiner Eltern bekamen Menschen ihre Kinder meist aus praktischen Gründen: um Verwandte still zu kriegen, die unangenehme Fragen stellten. Oder weil sie an die Altersvorsorge dachten. Oder einfach, weil es sich ergab.
Das bedeutet nicht, dass ich mich als Kind nicht geliebt fühlte, ganz im Gegenteil. Einen Großteil meiner Kindheit verbrachte ich auf dem Schoß meiner Mutter. Ich wurde gestreichelt und liebkost.
Ich hätte mir sowieso lange nicht vorstellen können, was eine Entscheidung allein aus Liebe überhaupt bedeuten soll. Wenn ich die Haltung zur Welt, die mir meine Eltern vorlebten, in einem Wort beschreiben müsste, wäre es: pragmatisch. Die Wohnung, in der ich aufwuchs, war so eingerichtet: praktisch, stabil, leicht zu säubern, bloß nicht zu teuer. Meine Familie war auch pragmatisch in der Freizeitgestaltung. Wozu teure Sportkurse, wenn die Kinder auch auf dem Spielplatz toben können? Hinter allem stand die Frage: Was soll das nützen? Von sinnlosem Genuss und Rausch hielten meine Eltern nichts. Das war der Pragmatismus arbeitender Menschen.
Meine Mutter kam im September 1972 im Alter von vierzehn Jahren als Tochter von Gastarbeitenden nach Deutschland. Fotos zeigen ein verschrecktes Kind mit einem unbändigen Strauß aus schwarzen Locken auf dem Kopf. Während mein Großvater in den ersten Jahren in den Ford-Werken und meine Großmutter in einer Wurstfabrik am Fließband standen, zog meine Mutter ihre drei jüngeren Brüder auf. 1981 heiratete sie meinen Vater in der Türkei, einen jungen Mann mit Schnurrbart und Schlaghosen, der in den politischen Unruhen des Landes zu versinken drohte und den Weg ins Exil suchte. Es war zwar keine Hochzeit aus Zwang, doch meine Mutter hatte es satt, von ihren Eltern ständig mit neuen Hochzeitsanwärtern genervt zu werden. Also sagte sie Ja zu dem jungen Mann, den sie einmal im Kreise der Familie kennenlernen durfte. Auf den wenigen Hochzeitsfotos sehe ich eine junge Frau mit zarten Gliedern, geschwungenen Augenbrauen, der Haarstrauß scheint gebändigt. Mein Vater daneben, die dunkelbraunen Augen weit aufgerissen. Nun schauen meine Eltern gemeinsam verschreckt in die Kamera.
Ab 1979 arbeitete meine Mutter in Köln als Kassiererin in der Filiale einer Supermarktkette. Sechsundzwanzig Jahre lang schob sie mit der linken Hand Waren über das Kassenband, haute mit der rechten auf die Kassentastatur. Mein Vater arbeitete zunächst in den Ford-Werken wie sein Schwiegervater. Dann als Röntgenassistent in Krankenhäusern.
Meine Eltern kamen beide aus armen, bäuerlichen Verhältnissen. Sie arbeiteten für ein anderes Leben, für sich und ihre Töchter. Sie arbeiteten viel. Mit Anfang fünfzig gingen sie in Rente. Ihre Körper waren kaputt. Zu viele Hunderte Kilometer hatte meine Mutter das Kassenband zurücklegen sehen. Zu viele schwere Körper hatte mein Vater auf die Krankenliege gehievt.
Für mich waren die Körper meiner Eltern arbeitende Körper. Anders kannte ich sie nicht. Die Vorstellung etwa, dass sie sich mit diesen Körpern liebkosten, erschien mir lange unmöglich.