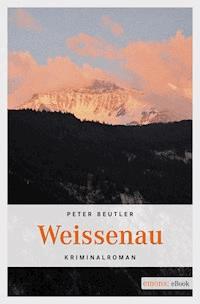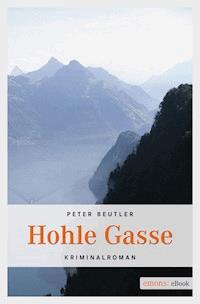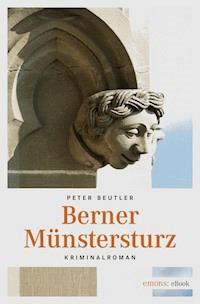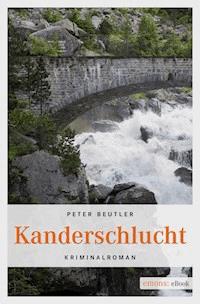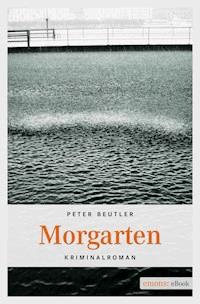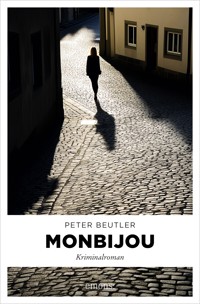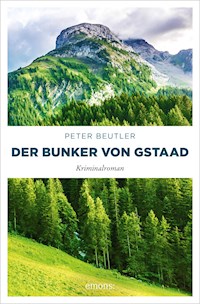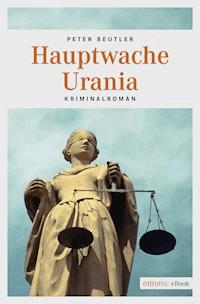
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Whistleblower von Zürich. Vor der Hauptwache Urania kommt ein ehemaliger Beamter der Zürcher Stadtpolizei zu Tode. Kommissar Arno Koch muss sich für die Aufklärung des Mordes tief in die Schweizer Geschichte zur Zeit des Kalten Krieges und in die dunkle Vergangenheit des Opfers begeben. Inmitten eines Netzes aus Korruption und Intrigen stößt Koch auf den Fall von Polizeiwachtmeister Sonderegger, der die Wahrheit zutage bringen wollte und von der Justiz vernichtet wurde - und dessen Schicksalauf unheilvolle Weise mit dem der Toten in Verbindung zu stehen scheint....
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Beutler, geboren 1942, ist in Zwieselberg, einem kleinen Dorf am Fusse der Berner Alpen, aufgewachsen. Als promovierter Chemiker war er Lehrer an einem Gymnasium in Luzern. Er lebt mit seiner Frau auf dem Beatenberg, hoch über dem Thunersee.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Im Anhang befinden sich ein Personenverzeichnis und ein Glossar.
© 2017 Emons Verlag GmbH
© 2017 Peter Beutler
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: denhans/photocase.de
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, Tobias Doetsch
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-275-5
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmässig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Agentur Altas, Bern.
Eine Hommage an Kurt Meier, Detektivwachtmeister der Stadt Zürich. Er hat gegen Behördenwillkür, Günstlingswirtschaft und Amtsmissbrauch gekämpft. Die Politik, die Justiz und die Polizei haben ihm das heimgezahlt, ihn seiner Existenz beraubt. Das geschah in den 1960er und den 1970er Jahren.
1
Vierte Aprilwoche 2014
Der Alte lag auf dem Mühlesteg gegenüber der Hauptwache Urania. Die erste Person, die ihn bemerkte, war eine betagte Dame. Sie führte einen winzigen Hund an der Leine.
«Oh mein Gott … kommt bitte und helft», rief sie mit zitternder, winselnder Stimme. Zwei Polizeimänner, die sich in der Nähe unterhielten, eilten herbei.
Der ältere der beiden, ein grauhaariger Untersetzter mit den Rangabzeichen eines Wachtmeisters, sprach die Frau freundlich an. Doch seine Worte gingen im ohrenbetäubenden Lärm eines Presslufthammers unter. Sein dünner, baumlanger Kollege, ein Gefreiter, eilte zur Baustelle etwa dreissig Meter flussabwärts. Dann wurde es still.
«Was haben Sie gesehen? Ist der Mann gestürzt?», fragte der Wachtmeister.
«Nein, der lag schon da, als ich die Brücke betrat», antwortete die Dame.
Der lange Dünne kam zurück, beugte sich über den am Boden Liegenden und konnte nur noch sein Ableben feststellen. Der kleinere Untersetzte tat es ihm nach. Die beiden Männer sahen einander lange an.
«Ist das nicht der alte Brugisser?», fragte der Gefreite.
Der Wachtmeister nickte.
Minuten später sassen die beiden Polizisten im Büro bei Hauptmann Arno Koch. Er gehörte nicht der Stadtpolizei an. Als Offizier der Kantonspolizei war er in der städtischen Hauptwache Ansprechperson für ungeklärte Todesfälle. Seine Aufgabe bestand darin, festzustellen, ob es sich dabei um vorsätzliches Fremdverschulden einer Zweitperson, also ob es sich um Mord handelte. War das so, musste die Kantonspolizei ermitteln. Der Wachtmeister beschrieb Koch den eigenartigen Vorfall. Brugisser sei tot, darüber gebe es gar keinen Zweifel. Er habe eine klaffende Wunde an der linken Schläfe, die mit grosser Wahrscheinlichkeit von einer Schusswaffe herrühre.
Ob es Spuren vom Täter gebe?, fragte Koch.
So schnell könne man das nicht sagen, bemerkte der Wachtmeister. Möglicherweise habe sich Brugisser selbst in den Kopf geschossen, er sei Linkshänder gewesen, und die Grösse des Einschusslochs spreche dafür, dass die Kugel aus nächster Nähe abgefeuert worden sei.
«Wo ist die Waffe?», fragte Koch.
«Das ist es eben. Wir haben sie noch nicht gefunden», sagte der Wachtmeister.
«Und dennoch schliessen Sie Suizid nicht aus.»
«Nein, das schliesse ich nicht aus. Aber es ist schwer vorstellbar, dass ausgerechnet in der Nähe der Hauptwache, am heiter hellen Tag, jemand einen Menschen erschiesst.»
Es gebe die verrücktesten Dinge; Spinner, die völlig absurde Verbrechen begehen, gab Koch zu bedenken. «Wir müssen zunächst die Ergebnisse der Spurensicherer und des Wissenschaftlichen Dienstes abwarten.»
Am Morgen danach, am Donnerstag, verbreiteten die lokalen Radiostationen folgendes Communiqué der Kantonspolizei:
Zürich, den 24. April 2014. Gestern am frühen Abend wurde vor der Hauptwache Urania der Zürcher Stadtpolizei die Leiche des ehemaligen Kriminalkommissärs, Dr. iur. Werner Brugisser, gefunden. Brugisser war dreiundneunzig Jahre alt. Der Tote wies eine Schusswunde an der Schläfe auf. Nach der Tatwaffe wird derzeit noch gesucht. Ob es sich um Suizid oder Mord handelt, ist Gegenstand der Abklärungen.
Als das Communiqué eine halbe Stunde später, um halb sieben Uhr, im Regionaljournal von Radio SRF zum zweiten Mal verlesen wurde, ergänzte der Nachrichtensprecher die Meldung.
Brugisser erlangte 1967 wegen der Affäre Sonderegger landesweit einen hohen Bekanntheitsgrad. Mathias Sonderegger arbeitete als Detektivwachtmeister der Stadtpolizei Zürich. Brugisser war sein Vorgesetzter. Sonderegger beschuldigte Brugisser eines im Jahre 1963 verübten Gelddiebstahls in der Hauptwache Urania. Brugisser konnte die Tat nie nachgewiesen werden. Sonderegger wurde entlassen und wegen übler Nachrede und Amtsgeheimnisverletzung zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. 1998 ist er vom Zürcher Stadtrat rehabilitiert und mit fünfzigtausend Franken entschädigt worden.
Sonderegger erlag Ende 2006 im Stadtspital Waid einer schweren Krankheit.
Stadtrat Rebstein, der Polizeidirektor, erkundigte sich bei Koch nach dem Stand der Untersuchung im Todesfall Brugisser. Man müsse sich fragen, ob die Stadtpolizei ermitteln sollte, fand Koch. Brugisser habe als Kommissär dieser Polizei gewirkt. Nicht ausgeschlossen sei, dass sein Ableben irgendwie mit dem Diebstahl von 1963 zusammenhänge, er habe ja zu dieser Zeit dort gearbeitet. «Ich finde es besser», sagte Rebstein, «wenn die Kantonspolizei hier Hand anlegt. Könnten Sie, Herr Koch, diese Sache übernehmen? Sie kennen sich bei uns ja gut aus, sind mit den Gepflogenheiten der Stadtpolizei bestens vertraut.»
Das liege drin, er müsse sich aber zuerst mit seinem Vorgesetzten absprechen. Da es sich beim Opfer um Brugisser handle, sehe er kein Hindernis, diesen mysteriösen Hinschied durch die Kantonspolizei abklären zu lassen.
«Mysteriös? Man hat mir angedeutet, es gebe Gerüchte, der betagte alte Kommissär habe aus freien Stücken seinem Leben ein Ende gesetzt», sagte Rebstein.
«Das wird herumgeboten, doch daran glaube ich nicht.»
Nach einem Telefonat Kochs mit seinem Vorgesetzten an der Kasernenstrasse stand fest, dass die Kantonspolizei den Fall Brugisser übernehmen werde. Koch wurde mit den Ermittlungen betraut und angewiesen, dafür eine Arbeitsgruppe aus den Beständen der Kantons- und der Stadtpolizei zusammenzustellen. Je nach Verlauf der Recherchen könnte sie die Funktion einer Mordkommission erhalten.
Koch stieg ins Archiv der Hauptwache hinunter und suchte nach Akten über den Diebstahl von 1963 und über Brugisser. Er fand wenig Brauchbares. Dann startete er den PC, suchte im Intranet und googelte viele Stunden. Danach wusste er zwar mehr über den Diebstahl, aber zum Stichwort «Brugisser» war die Ausbeute mager.
Als Koch am nächsten Tag mit der zehnköpfigen Arbeitsgruppe «Brugisser» zusammensass, erfuhr er einiges über den verstorbenen Kriminalkommissär, den er nur dem Namen nach kannte. Brugisser sei zu einem Sonderling geworden. Die Geschichte mit dem unaufgeklärten Gelddiebstahl soll ihm zugesetzt haben. In all den Jahren seit dem Vorfall habe er immer wieder versichert, nichts mit dem Raub zu tun gehabt zu haben.
Nach seiner Pensionierung vor vierunddreissig Jahren sei er hin und wieder beim Haupteingang der Hauptwache gesehen worden, allerdings ohne diesen jemals betreten zu haben. Er habe jeweils ein Stück Fleisch auf die unterste Stufe gelegt, sich dann in eine Nische verzogen und laut durch die Finger gepfiffen. Momente später sei einer der in diesem Quartier häufig herumstreunenden Stadtfüchse aufgetaucht, habe den Happen weggeschnappt und sich rasch verzogen.
Koch schüttelte ungläubig den Kopf. «Aha – der war das. Und ich dachte immer, das sei ein Penner. Das kann ich mir nicht verzeihen. Schliesslich sitze ich im selben Büro wie er seinerzeit. Tut mir echt leid, dass er von dieser Welt gegangen ist. Warum hat mir niemand gesagt, wer der einsame Mann auf der Treppe vor der Wache war? Ich hätte ihn zu einem Kaffee eingeladen.»
Koch schaute einige Augenblicke lang in die Runde. Er hob beide Hände und verkündete: «Wir müssen dieser Sache nachgehen. Schade, dass es keine einzige Person in diesem Team gibt, die mehr als dreissig Jahre im Dienst ist. Kannte jemand von euch Werner Brugisser?»
Niemand meldete sich.
«Ich weiss nicht, ob der gewaltsame Tod von Brugisser etwas mit dem Diebstahl von 1963 zu tun hat. 1963! Das ist nun einundfünfzig Jahre her. Zu schön wäre es, wenn wir den Fall nochmals aufgreifen könnten, um vielleicht herauszufinden, wer der Dieb war.»
«Oder die Diebin», rief eine junge Polizistin dazwischen.
Koch lächelte. «Damals war es anders. Wir leben heute in einer anderen Zeit. Vor einem halben Jahrhundert gab es nur drei weibliche Wesen in diesem Gebäude. Zwei Putzfrauen und die Sekretärin. Das Reinigungspersonal durfte sich allein während der normalen Bürozeiten in den Räumen der Kriminalpolizei aufhalten, das galt auch für die Sekretärin. Der Diebstahl musste nach sechs Uhr abends stattgefunden haben. Der Täter, so weit bin ich informiert, kann nur einer aus den Reihen der Kriminalpolizei gewesen sein.»
«Das waren aber wenige. Wie viele eigentlich?», fragte ein junger Gefreiter.
Koch seufzte. «Das können wir kaum mehr herausfinden. Die Ermittlungen in diesem Verbrechen sind abgeschlossen. Wir dürfen den Fall nicht wieder aufrollen. Im Archiv des zuständigen Gerichts gibt es zwar mehrere Laufmeter Akten über den Diebstahl von 1963. Wir haben dazu aber nur bedingt Zutritt. Dafür benötigten wir die Bewilligung des Staatsanwaltes. Und diese würden wir nur erhalten, könnten wir einen plausiblen Grund vorweisen. Der fehlt uns aber im Moment. Ganz abgesehen davon, dass das Durchkämmen der Dossiers im Archiv Hunderte von Arbeitsstunden kosten würde. Gäbe es in diesen Papieren nur einen einzigen überzeugenden Hinweis auf den Täter, wäre er längst gefasst worden.»
Ein älterer grauhaariger Detektiv meldete sich. «Nein, im Archiv zu stöbern wäre verlorene Zeit. Das Problem ist, dass schwerwiegende Fehler bei der Untersuchung passiert sind. Man hat nur Polizisten aus den Mannschaftsgraden vom Wachtmeister abwärts verhört. Und die Ermittlung hat der Kommissär höchstpersönlich durchgeführt. Die Polizeioffiziere sind dabei nicht berücksichtigt worden. ‹Ein Offizier stiehlt nicht›, soll er gesagt haben.»
Koch nickte verlegen. «Ich denke, Kollege, da hast du recht, leider. Es stimmt: Die Ermittlungen leitete damals der Chef der Abteilung, in dem das Delikt begangen wurde –»
Einer fiel ihm ins Wort: «Wer war der Kommissär?»
Koch schmunzelte. «Brugisser. Das wäre heute völlig undenkbar. Der Täter war höchstwahrscheinlich ein Polizeioffizier oder einer mit einem Spezialauftrag.»
Ein weiterer Polizist hatte eine Frage. «Könntest du uns erklären, was damals mit Spezialaufträgen gemeint war?»
«Ja, in den 1950er bis 1980er Jahren gab es einige Angestellte mit Spezialaufträgen. Es waren eigentlich gar keine richtigen Polizisten, sondern Zivilisten, die vor allem für Spitzeldienste eingesetzt wurden. Zwielichtige Gestalten, zum Teil mit Vorstrafen. Sie wurden aber mit Glacéhandschuhen angefasst. Nicht auszudenken, dass ein Spitzel so verärgert worden wäre, dass er den Dienst quittiert und Informationen an Dritte weitergegeben hätte. Die Folgen für die Stadtpolizei wären katastrophal gewesen. Damals sind wirklich Schweinereien passiert.»
«Auch das trifft zu», sagte der grauhaarige Detektiv. «Aber das Wissen über diese Machenschaften hilft uns keinen Millimeter weiter. Wir werden wohl nie erfahren, wer der Dieb war. Es sei denn, ihn plagt das schlechte Gewissen so sehr, dass er sich noch vor seinem Hinschied dazu bekennt. Was ich für ausgeschlossen halte. Schon allein die Möglichkeit, dass er noch lebt, halte ich für gering. Trotzdem könnte es hilfreich sein, mehr über diesen Diebstahl herauszufinden.»
Koch machte sich einige Notizen. Das kam bei seinen Mitarbeitern nicht immer gut an, denn sie waren während dieser Zeit zur Untätigkeit verdammt, mussten ausharren, bis ihr Chef alles aufgeschrieben hatte, was er für wichtig hielt.
Nach einigen Minuten nahm Koch den Faden wieder auf. «Ich fasse zusammen: Brugisser hat die Ermittlungen im Fall des Diebstahls selbst geleitet. Nach heutigen Massstäben würde er zum Kreis der Verdächtigen zählen. Nun ist aber ein möglicher Mord aufzuklären.» Da müsse man sich mit dem Umfeld des Opfers bekannt machen. «Wer ist von seinen damaligen Kollegen noch am Leben? Hat er Feinde unter ihnen gehabt? Weiss man von Personen, denen er etwas anvertraut haben könnte? Kennt jemand von euch einen Kripomann von damals? Und so weiter. Ihr wisst ja alle eine Menge über das Detektivhandwerk. Wir treffen uns am Nachmittag um drei Uhr nochmals.»
Es sei ihm bewusst, dass alle im Team noch andere Aufgaben zu erledigen hätten. Zwei von ihm ausgewählte Beamte würden mit der Tochter des Opfers Kontakt aufnehmen, allenfalls auch mit anderen Angehörigen. Brugissers Gattin lebe nicht mehr. Im Übrigen müsse man die letzten Ergebnisse der Spurensicherung und der Obduktion abwarten, was einige Tage in Anspruch nehmen dürfte.
Als Koch am Nachmittag wieder mit der Arbeitsgruppe «Brugisser» zusammensass und sich nach dem Stand der Ermittlungen erkundigte, musste er feststellen, dass niemand wesentlich weitergekommen war. Brugisser hatte ausser seiner Tochter und einem jüngeren Cousin keine Bezugspersonen. Noch lebende ehemalige Polizisten, die mit ihm zusammengearbeitet hatten, gaben sich äusserst wortkarg, oder sie waren offensichtlich dement. Über den Diebstahl von 1963 wollte oder konnte keiner von ihnen reden. Es sei genügend darüber geschrieben, spekuliert und gelogen worden. Am besten vergesse man die Sache. Auf die Frage, ob sie eine Ahnung hätten, wer der Mörder von Brugisser sein könnte, gaben alle unwirsch Antwort. Sie würden sich hüten, diesbezüglich eine Aussage zu machen.
Koch schlug einige Male mit der flachen Hand auf den Tisch und rief ungehalten: «Wo ist die verdammte Tatwaffe, mit der Brugisser umgebracht wurde? Wo? Solange wir die nicht finden, kommen wir nicht vorwärts.»
Es war inzwischen sechzehn Uhr. Koch hatte keine Lust, weiterzuarbeiten. Er machte sich nach Hause auf, zwei Stunden früher als üblich.
Carmen, seine Frau, fragte überrascht: «Ist dir nicht gut?»
«Nein, nein. Alles ist in Ordnung. Ich hatte eine anstrengende Sitzung wegen des Mordes vor der Hauptwache und verspürte nicht die geringste Lust, noch einmal ins Büro zu gehen.»
«Wie wäre es, wenn wir heute ausgingen, zuerst essen, dann ins Kino?», fragte Carmen begeistert.
«Machen wir, das ist eine gute Idee.»
Es war ein schöner, warmer Frühlingsabend. Sie fanden ein dazu passendes Restaurant mit offener Veranda zur Limmat. Dort bestellten sie ein üppiges Abendessen. Koch erkundigte sich bei Carmen nach ihrer Arbeit. Sie war Übersetzerin im Amt für Migration und hatte ungewöhnliche Arbeitszeiten. Vom Morgen bis am frühen Nachmittag arbeitete sie durch, unterbrochen von einem kurzen Lunch. Dreimal in der Woche unterrichtete sie Migranten in einer Abendschule im Fach Deutsch.
Das Ehepaar Koch war kinderlos. Nicht, weil sie sich keinen Nachwuchs gewünscht hätten. Obwohl sie häufig wilde Nächte zusammen verbrachten, wurde Carmen nicht schwanger. Man müsse sich damit abfinden, tröstete Koch seine Frau immer, wenn sie dieses Thema, wie an diesem Abend, anschnitt.
Schade, anders als ihre Eltern und Grosseltern könnten sie sich Kinder gut leisten, meinte Carmen mit einem Lächeln. Es tue ihr so leid, dass sie es nicht hinkriege, ihm einen Jungen zu schenken.
Dann lachte er. «Ich würde mich auch mit einem Mädchen zufriedengeben. Und überhaupt: Wir wissen nicht, ob es an mir oder an dir liegt. Und wir sollen es auch nicht wissen. Deine Grosseltern hast du eben erwähnt. Die Grossmutter ist jetzt neunundneunzig. Wollen wir sie nicht wieder mal besuchen? Bis Winterthur ist es keine Weltreise.»
«Gerne, ja. Am Wochenende? Seit mein Grossvater vor zwei Jahren verstorben ist, fühlt sie sich immer einsamer.»
«Einverstanden. Ich möchte sie nämlich etwas fragen.»
«Was denn? Ich bin gespannt.»
«1963 wurde der Tresor auf der Hauptwache Urania ausgeraubt. Darüber berichtete die Presse in ganz Europa, sogar in Amerika erschienen Zeitungsartikel über diesen Diebstahl. Deine Grossmutter war damals Putzfrau in der Hauptwache.»
Sie erinnere sich gut, wie ihre Mutter oft darüber gesprochen habe, sagte Carmen. Furchtbar sei das gewesen. Man habe die Grossmutter deswegen sogar festgenommen.
«Dafür schäme ich mich jetzt. Ausgerechnet ein Kriminalpolizist wie ich drehte damals deine Grossmama durch die Mangel. Übrigens ist es genau der, den man vorgestern tot auf dem Mühlesteg fand.»
Der Besuch bei Carmens Grossmutter brachte Arno Koch nicht die zusätzlichen Informationen, die er sich erhofft hatte. Die alte Frau wollte nicht daran erinnert werden, was damals geschehen war. Das sei eine dunkle Zeit in ihrem Land gewesen. Sie sei 1939 mit ihrem Mann vor den faschistischen Schergen Francos in die Schweiz geflüchtet und in Zürich herzlich aufgenommen worden. «Die Stadt wurde damals, wie zum Glück heute wieder, rot regiert. Vor Ende des grossen Krieges erhielten wir den Schweizer Pass.» Erst in den fünfziger Jahren hätten rechte Seilschaften begonnen, das Klima in der Stadt zu vergiften.
Carmen unterbrach sie. «Urteilst du nicht ein wenig zu hart?»
«Schon möglich. Aber wer die Gräuel der braunen Scheusale am eigenen Leib erleben musste, der darf sich eine kritische Haltung gegenüber diesem kleinkarierten Gesindel erlauben.»
«Poing», sagte Koch und schlug sich auf die Schenkel. «Grossmama, wie sie leibt und lebt.»
2
19./20. März 1963
Walter Pfenningers Arbeitszimmer auf der Hauptwache Urania war noch nicht vollständig eingerichtet. Das Büchergestell war bis auf zwei dicke Bücher leer. Am modernen Schreibtisch war ein Telefonapparat montiert, auf der Schreibfläche lag ein daumendicker Papierstoss. Ein grosses Fenster mit Sicht auf die Limmat flutete den Raum mit Licht. An den eingebauten Wandschränken steckten noch die Schlüssel, und an der Tür fehlte das Namensschild.
Der gelernte kaufmännische Angestellte Pfenninger sass um sieben Uhr fünfzig behaglich auf dem nigelnagelneuen Sessel. Ein Möbelstück vom Feinsten, Sitzfläche und Lehnen mit schwarzem Leder überzogen. Er schaute gebannt zur Tür, denn er erwartete seinen direkten Vorgesetzten, Major Werner Brugisser, Kriminalkommissär bei der Stadtpolizei.
Punkt acht null null klopfte es an die Tür.
Pfenninger rief: «Herein!»
«Guten Tag, Herr Pfenninger, das ist Ihr neues Reich. Es soll Ihnen an nichts fehlen. Niemand ausser mir, dem Kommandanten der Stadtpolizei und einer weiteren hochgestellten Persönlichkeit in der Stadt weiss von ihrem Sonderauftrag. Sie sind sozusagen eine anonyme Person, die wir von der Öffentlichkeit abschirmen. Sie stehen nicht auf der Gehaltsliste der Stadtpolizei. Den Lohn erhalten Sie am Ende jedes Monats bar auf die Hand. Von mir oder vom Kommandanten der Stadtpolizei. Wir haben keinen Arbeitsvertrag mit Ihnen abgeschlossen.»
«Und wenn Sie mich feuern?»
«Tun Sie, was wir von Ihnen verlangen, dann haben Sie diese Stelle für lange Zeit auf sicher. Sollte kein Bedarf mehr dafür bestehen, werden wir Ihnen eine andere, ebenso lukrative Beschäftigung vermitteln.»
«Was übertragen Sie mir für Aufgaben?»
Brugisser lächelte. «Da werden Sie staunen. Sie werden Dinge tun, die, sollte sie ein normaler Bürger begehen, strafbar sind.»
«Wirklich? Das ist ja spannend. Muss ich jemanden abknallen?»
Brugisser lachte laut auf. «Dachte ich’s mir doch. Wir haben für diese Aufgabe genau die richtige Person ausgesucht. Aber keine Angst. Es ist nicht vorgesehen, dass Blut fliesst. Vorläufig jedenfalls nicht. Und für Massnahmen gegen Leib und Leben wären Sie sowieso nicht ausgebildet. Aber Geld muss zunächst mal fliessen. Sie werden es beschaffen, nach unserer Anleitung. Sie gehen dabei überhaupt kein Risiko ein. Wir überlassen nichts dem Zufall.»
«Was steht als Erstes an?»
Brugisser setzte eine gespielt ernste Miene auf. «Eine verrückte Sache, mein Junge. Sie rauben Ihrem Noch-Arbeitgeber die Kasse aus und stellen sich dabei so dumm an, dass der Bestohlene gleich realisiert, wer der Dieb ist. Man wird Sie vorübergehend festnehmen. In ein paar Stunden werden Sie wieder auf freiem Fuss sein. Wir regeln die Angelegenheit mit Ihrem Boss. Er wird Ihnen kündigen, obwohl er alles zurückerhält, was Sie ihm abgenommen haben. Die Beute dürfen Sie natürlich nicht behalten. Ihr Boss wird Ihnen noch zwei Monate das Gehalt auszahlen müssen. Wenn Sie Glück haben, wird er Sie gleich auf die Strasse stellen. In diesem Fall wären Sie frei für den nächsten Auftrag von uns.»
«Einverstanden. Mache ich gleich.»
«Nur nichts übereilen. Wir werden Ihnen den Zeitpunkt mitteilen, wann Sie diesen Auftrag zu erfüllen haben.»
Es klopfte erneut. Pfenninger blieb vor Staunen der Mund offen. Im Türrahmen stand ein elegant gekleideter Herr.
«Tag, meine Herren. Ist das unser neuer Undercover?»
Der Mann ging auf Pfenninger zu und schüttelte ihm herzlich die Hand. «Haben Sie eine Ahnung, wer ich sein könnte?»
Pfenninger nickte. «Sie sind doch der Stadtrat …»
Der Mann machte mit der rechten Hand ein Stopp-Zeichen. Pfenninger sprach nicht weiter.
«Sie dürfen mich nicht kennen. Alles, was hier gesprochen wird, bleibt unter uns dreien. Sollten Sie mir in der Stadt oder irgendwo sonst begegnen, tun Sie so, als ob Sie mich noch nie gesehen hätten. Ansprechperson und Auftraggeber für Sie ist Major Brugisser. Er mag es, wenn Sie ihn mit ‹Herr Doktor› ansprechen. Majore gibt es weit mehr als Doktoren auf der Hauptwache Urania. Sie werden vielleicht auf Ihre Tätigkeit von Polizisten auf der Hauptwache angesprochen. Sagen Sie, Sie seien der persönliche Mitarbeiter von Brugisser. Könnte sein, dass einer von ihnen Ihren Personalausweis sehen möchte. Wir werden Ihnen selbstverständlich einen ausstellen. Den dürfen Sie aber nicht auf sich tragen, wie das bei den Angehörigen der Stadtpolizei Pflicht ist. Legen Sie ihn in das dafür vorgesehene Fach in der obersten Schublade des Schreibtisches in Ihrem Arbeitszimmer. Den Fragesteller bitten Sie, mit Ihnen zu Ihrem Büro zu kommen. Sobald Sie dort den Schlüssel zücken, um die Tür zu öffnen, wird er sich entschuldigen und Sie nie mehr auffordern, sich auszuweisen.»
3
26./27./28. März 1963
Der Kassenwart der Kriminalabteilung der Stadtpolizei, Gefreiter Franz Beck, sah auf seine Armbanduhr. Achtzehn Uhr fünfzehn, Zeit, um Feierabend zu machen. Er ging zum Schreibtisch, entnahm dem untersten Fach die kleine blaue Blechschachtel, die mit «Stecknadeln» angeschrieben war. Er öffnete sie und klaubte den Doppelbartschlüssel heraus. Er ging in die kleine Kammer nebenan, dort wo der massive, mannshohe Tresor stand, öffnete diesen und schaute hinein. Es war alles da. Die zwanzig Bündel mit Hunderternoten. Banknoten, die am Vortag bei einer Razzia in einem Zürcher Nachtclub beschlagnahmt worden waren. Warum das Geld eingezogen worden war, wem es rechtmässig gehörte, wusste Beck nicht, das hatte ihn auch nicht zu interessieren.
Sein Telefon schellte. Beck widerstand der Versuchung, nicht abzuheben. Es war der Buchhalter der Kripo, der dafür bekannt war, mit vielen Worten wenig zu sagen. Es ging um den Verlauf des Abtransports der neunzigtausend Franken am kommenden Morgen. Das Gespräch zog sich in die Länge. Beck sah immer wieder auf die Uhr und wurde zusehends nervöser, was dazu beitrug, dass er mit dem Buchhalter viel später, als er sich vorgenommen hatte, handelseinig wurde. Endlich konnte Beck auflegen. Eiligst ergriff er Jackett und Mantel, rannte die Kleidungsstücke anziehend die Treppe hinunter zum Hauptausgang, der rund um die Uhr von zwei bewaffneten Polizisten bewacht wurde.
Erst als er im Tram sass, realisierte er, dass im zweiten Schloss des Tresors noch der Schlüssel stecken musste. Immer, wenn er den Tresorraum verliess, drehte er den zweiten Schlüssel und schob ihn in seine rechte Hosentasche. Er kämpfte mit sich, zurückzukehren und die Unterlassung in Ordnung zu bringen. Es war kalt, neblig und nieselte. Wer sollte denn in einer solchen Nacht an zwei Polizisten vorbei unbehelligt in die Hauptwache Urania eindringen?, fragte er sich. Er blieb sitzen und freute sich auf das Abendessen zu Hause, das seine Frau stets pünktlich um sieben Uhr auftrug.
***
Zum Zeitpunkt, als Beck aus seinem Büro stürzte, unterhielt sich der alte Polizist Kari Schütz mit einer jüngeren Frau an einem der Tische, die sich im obersten Stock im Gang befanden. Sie beschwerte sich wegen eines Bussenzettels unter dem Scheibenwischer. Sie war aufgebracht, Schütz gab sich alle erdenkliche Mühe, sie zu beruhigen.
Immer wieder wurde das Gespräch durch einen Herrn gestört, der an den beiden vorbeihastete. Wer denn dieser aufgeregte Kerl sei, wollte die Dame wissen.
«Der Kommissär Brugisser, ein Offizier der Kripo», sagte Schütz. Wahrscheinlich sei etwas Aussergewöhnliches geschehen. Brugisser verhalte sich normalerweise nicht so, er sei ein besonnener, eher ruhiger Mensch.
Am Nebentisch sass Detektivwachtmeister Mathias Sonderegger. Er verhörte den zwanzigjährigen Walter Pfenninger. Er wurde beschuldigt, an seinem Arbeitsplatz tausend Franken entwendet zu haben. Pfenninger bestritt den Diebstahl. Sonderegger legte ihm Beweise vor. Pfenninger beharrte auf seiner Unschuld.
Plötzlich stand Brugisser am Tisch. «Da geht es laut zu und her, was ist denn da los?»
Sonderegger schilderte in wenigen Sätzen, weshalb er Pfenninger vernehme.
Brugisser sah den jungen Mann einige Augenblicke an. «Sie kenn ich doch. Sind Sie nicht der Walter von nebenan?», fragte er auf den Stockzähnen lächelnd.
«Guten Abend, Herr Brugisser. Entschuldigung, Herr Doktor. Ja, der bin ich. Bitte helfen Sie mir. Ich werde für etwas festgehalten, das ich nicht begangen habe.»
Ganz so einfach sei das leider nicht. Der Wachtmeister habe das Recht, eine Person zur Vernehmung abzuführen, wenn sie in Verdacht stehe, ein Delikt begangen zu haben. Es sei aber keine Verhaftung. Zuerst müsse eine Anzeige vorliegen, dann entscheide der Staatsanwalt, ob ein Verfahren eröffnet werde. Nur bei schwereren Vergehen werde ein Haftbefehl ausgestellt. Beim zur Diskussion stehenden Diebstahl handle es sich um keine grosse Sache.
Sonderegger legte seine Stirn in tiefe Falten und wollte etwas sagen. Mit einer dezidierten Handbewegung gab ihm Brugisser zu verstehen, sich nicht dazu zu äussern.
«Diese Vernehmung bringt nichts mehr. Lassen Sie bitte den jungen Mann laufen. Es ist Ihnen unbenommen, später gegen Pfenninger eine Anzeige zu erstatten», erklärte Brugisser.
«Ich werde das Verhör nicht unterbrechen, Herr Major. Im Übrigen protestiere ich gegen die Art und Weise, wie Sie, ohne wirklich über diesen Vorfall informiert zu sein, sich in diese Vernehmung einmischen.»
«Sie … Sonderegger, was fällt Ihnen ein, sich gegenüber einem Polizeioffizier derart respektlos zu benehmen? Wir werden uns in den nächsten Tagen noch über diese Angelegenheit unterhalten.»
***
Am nächsten Morgen öffnete Beck wie üblich um sieben Uhr den Tresor. Ein Schrei des Entsetzens entfuhr ihm. Die Bündel mit den Banknoten waren bis auf drei weg.
Beck lief schnurstracks ins Büro von Brugisser, öffnete die Tür ohne zuvor anzuklopfen, was ihm eine grobe Zurechtweisung des Kommissärs eintrug.
«Das Geld ist weg», keuchte Beck ausser Atem.
«Haben Sie denn die beiden Schlösser nicht verriegelt?»
«Ich muss Ihnen … Ihnen etwas gestehen.» Beck begann zu stottern. «Gestern Abend … Abend liess … liess ich versehentlich den zweiten Schlüssel stecken.»
«Und was ist mit dem ersten?»
«Das erste Schloss habe ich verriegelt und den Schlüssel wie vorgegeben sichergestellt.»
«Sicher?»
«Ganz sicher, ich schwöre es.»
«Schwören? Schwören wollen Sie? Hoffentlich lügen Sie nicht. Nach der groben Pflichtverletzung auch noch einen Meineid. Das könnte Sie Kopf und Kragen kosten, Beck.»
Beck schwitzte vor Angst aus allen Poren. Brugisser entging das nicht. «Gehen Sie jetzt, sonst machen Sie sich in meinem noblen Büro noch die Hosen voll. Zu Ihrer Beruhigung kann ich sagen, Ihnen wird nicht viel passieren. Höchstens eine begrenzte Gehaltsrückstufung. Ein halbes Jahr fünfzig Franken weniger. Mit einigen Überstunden können Sie das locker kompensieren.»
Beck ging es schlagartig besser.
***
Brugisser öffnete seine Mappe, zog das in Fleischpapier Eingewickelte heraus und schritt zum grossen Fenster, das ihm eine schöne Sicht auf die Limmat und den Limmatquai gegenüber bescherte. Er öffnete einen Flügel, lehnte sich hinaus und pfiff kräftig durch die Finger. Lächelnd wartete er zwei, drei Minuten. Dann war er plötzlich unten beim Haupteingang: Meister Reineke. Er sah erwartungsvoll nach oben. Brugisser warf ihm das grosse Schnitzel zu. Das Tier schnappte danach und zottelte mit erhobenem Schwanz davon.
Ein den Eingang bewachender Polizist rief hinauf: «Wie bringen Sie das nur fertig?»
«Es ist Seelenverwandtschaft, die mich mit den Füchsen verbindet.» Brugisser lachte schallend und lange. «Übrigens, wissen Sie, von wo dieses Vieh kommt?»
Der Polizist schüttelte den Kopf.
«Vom nahen Bahnhofareal. Hinter den sieben Gleisen. Dort hat es einige Fuchsbauten. Nützliche Tiere. Sie halten die Gleise sauber, fressen Mäuse, Ratten und die Speisereste, die Bahnpassagiere zum Fenster hinauswerfen.»
Brugisser ging zurück zum Schreibtisch, zog eine Zigarre hervor und brachte sie nach allen Regeln der Kunst zum Glühen.
Es klopfte an die Tür.
«Herein», rief er ausnehmend freundlich.
Es war seine Sekretärin.
Brugisser blies ihr eine Rauchschwade entgegen. «Sie kommen wie gerufen, Anna. Sie glauben es nicht, aber wir haben ein Problem.» Er grinste übers ganze Gesicht.
«So schlimm kann es nicht sein. Sie scheinen sich sogar darüber zu freuen.»
Brugisser versuchte eine finstere Miene aufzusetzen. Er erzählte der Sekretärin, was seit gestern Abend und heute Morgen vorgefallen war.
Die Sekretärin nahm die Nachricht fassungslos zur Kenntnis. «Wie viel wurde denn gestohlen?»
«Gegen hunderttausend Franken.» So genau wisse er es nicht. Er sei lediglich darüber informiert worden, dass diese Summe vorgestern in der «Rütlibar» durch eine Einheit der Kripo beschlagnahmt worden war.
Er wies die Sekretärin an, sich mit dem Kommandanten der Stadtpolizei in Verbindung zu setzen, um eine Krisensitzung zu vereinbaren, die unbedingt diesen Vormittag stattfinden müsse.
***
Am runden Tisch sassen neben dem Polizeikommandanten, Oberst Huber, der Kommissär, Major Brugisser, und ein Gefreiter. Letzterer vor einer grossen Schreibmaschine, um die Sitzung zu protokollieren.
Der Kommissär informierte den Kommandanten über den Diebstahl in der vergangenen Nacht.
Huber, ein impulsiver Typ, verlangte die sofortige Suspendierung Becks. Dieser Mann müsse unverzüglich festgenommen und verhört werden.
Brugisser redete ihm das aus. Wenn einer nicht der Dieb sei, dann Beck. Dieser Mann käme gar nicht auf die Idee, auch nur einen Zwanzigräppler zu klauen. Er sei grundehrlich, ein Bünzli, von bescheidener Intelligenz und gehe jedem Problem, das auf ihn zukomme, sofort aus dem Weg. Er habe einen Fehler gemacht, der jedem anderen auch hätte unterlaufen können.
Huber nickte, zeigte dann auf Brugisser und sagte: «Ich betraue dich mit den Ermittlungen. Offizieller Leiter der Untersuchung bin von Amtes wegen ich.»
Brugisser verwarf die Hände.
«Stell dich nicht so blöd an, Werner. Die ganze Sache bedeutet für dich kaum mehr Arbeit, einige Verhöre. Herausbringen wirst du sowieso nichts. Der Dieb war einer von uns, ein Profi.»
Brugisser protestierte. Er habe nicht wegen der zusätzlichen Arbeit aufbegehrt. Das Problem sehe er vielmehr darin, dass ausgerechnet er mit den Ermittlungen betraut werde. Nicht dass er sich die Fähigkeit dafür abspreche. Aber er sei Chef der Abteilung, in der der Diebstahl verübt worden sei. Er würde es besser finden, die Untersuchung der Kantonspolizei zu übertragen.
Huber lief rot an. «Der Kantonspolizei? Kommt nicht in Frage. Unsere Kriminalabteilung ist derjenigen des Kantons weit überlegen.»
***
Eine Stunde später lag der Entwurf eines Mediencommuniqués von Brugisser auf Hubers Schreibtisch. Er unterschrieb.
Am Mittag wurde im Schweizer Radio die Meldung verlesen:
Landessender Beromünster. Es folgen die Mittagsnachrichten der Schweizerischen Depeschenagentur. In der Nacht vom 26. auf den 27. März wurden in der Hauptwache Urania der Stadtpolizei Zürich neunzigtausend Franken aus dem Tresor entwendet. Von der Täterschaft fehlt zurzeit jede Spur.
Nach einem Sprecher der Polizeidirektion der Stadt Zürich sei es wahrscheinlich, dass der oder die Täter im Gebäude, in dem der Diebstahl stattfand, einer Beschäftigung nachgehe. Man werde in alle Richtungen ermitteln.
Bereits am Nachmittag begann Brugisser die ersten Leute zu vernehmen. Es waren die beiden Putzfrauen. Während der Kommissär die beiden Frauen nacheinander verhörte, wurden in ihren Wohnungen Hausdurchsuchungen vorgenommen.
Beide waren am Abend fix und fertig. In ihrer Verzweiflung suchte eine der beiden Hilfe bei einem Polizisten, den sie als besonders vertrauenswürdig einschätzte, bei Detektivwachtmeister Sonderegger.
Sonderegger hörte sie in seinem Büro geduldig an, tröstete sie und versicherte ihr, man werde sie von nun an in Ruhe lassen, denn gegen sie liege sicher nichts vor. Andernfalls wäre sie bereits hinter Schloss und Riegel.
Nachdem die Frau gegangen war, zog er ein Wachstuchheft aus einer Schublade seines Arbeitstisches, das mit «persönliche Rapporte» angeschrieben war. Er schraubte seinen Füller auf und notierte:
Das darf doch nicht wahr sein. Ausgerechnet der Kriminalkommissär leitet die Ermittlungen im Fall des Gelddiebstahls in den Räumlichkeiten der Kripo.
Dass er als Erstes die beiden Putzfrauen einvernahm und ihre Wohnungen durchsuchen liess, spricht Bände. Ein Ablenkungsmanöver? Ist er selbst der Dieb, oder fürchtet er, ein anderes Kadermitglied der Kripo könnte den Raub begangen haben?
Als ich nach der Pause heute Nachmittag zum Arbeitsplatz zurückkam, lag auf meinem Schreibtisch ein Brief von Brugisser. Das Aufgebot zu einem Verhör für morgen Donnerstag, den 28. März 1963, neun Uhr null null, betreffend «Entwendung eines grösseren Geldbetrages aus dem Tresor der Kriminalpolizei».
Würde die Untersuchung von einer anderen Stelle durchgeführt, der Kriminalabteilung der Kantonspolizei etwa, wäre das einleuchtend. Ich war ja zur möglichen Tatzeit in der Nähe des Tatortes. Brugisser war es auch. Die Personen, die dafür in Frage kommen, sind an zwei Händen abzuzählen. Mehr als die Hälfte davon sind Polizeioffiziere.
M. S., Mittwoch, 27. März 1963
***
Pünktlich zur vereinbarten Zeit klopfte Sonderegger an die Bürotür Brugissers. Dieser wies mit dem Finger zum Sofa. Sonderegger setzte sich. Der Kommissär tätigte noch mehrere Telefonanrufe. Besprach belanglose Sachen. Nach einer Viertelstunde setzte er sich neben Sonderegger. Mit gespielter Freundlichkeit stellte er ihm einige Fragen, die Sonderegger sofort und überzeugend beantworten konnte.
Brugisser ging zurück an den Schreibtisch, zog ein Blatt aus der obersten Schublade und bat Sonderegger, sich auf den Stuhl an der gegenüberliegenden Seite zu setzen. Grinsend reichte er ihm das Papier. «Wachtmeister, unterschreiben Sie bitte unten rechts.»
Sonderegger kullerten fast die Augen aus den Höhlen. Das Vernehmungsprotokoll lag bereits mit Fragen und Antworten vor. Die Antworten – sie bestanden aus «Ja» und «Nein» – entsprachen in etwa denen, die Sonderegger gegeben hatte.
Sonderegger unterschrieb kopfschüttelnd.
«Wachtmeister, Sie dürfen beruhigt sein. Ich hatte Sie nie in Verdacht. Ich musste Sie vernehmen, weil Sie sich zur mutmasslichen Tatzeit in der Nähe des Tatortes aufhielten.»
Brugisser machte eine kurze Pause, schien zu überlegen.
«Da wäre noch die Sache mit dem jungen Pfenninger. Vergessen wir das.»
«In dieser Sache hätte ich nachzutragen –»
Brugisser klopfte mit den Knöcheln entnervt auf die Tischplatte. «Sonderegger, Sie sind ein sturer Bock. Ich gebe Ihnen zwei Minuten, um das loszuwerden.»
«Im Formular, das ich in Sachen Geldklau ausfüllen musste, habe ich etwas Wichtiges vergessen. Als Sie mich anwiesen, Pfenninger gehen zu lassen, stand ich auf und kümmerte mich nicht mehr um ihn –»
Abermals unterbrach ihn Brugisser. «Das ist nicht der Rede wert.»
«Ist es aber. Gestern hat mir ein Polizist, der den Ausgang am Abend des 26. März beobachtete, verraten, ein junger Mann habe das Gebäude mit einer Ledermappe verlassen. Es könnte sich um Pfenninger gehandelt haben.»
Brugisser winkte gereizt ab. Er stand auf, fasste Sonderegger sanft am Arm, geleitete ihn zur Tür, klopfte ihm freundschaftlich auf die Schultern, drückte ihm die Hand und sagte: «Gehen Sie wieder an Ihre Arbeit, und hängen Sie bitte nicht dummen Gedanken nach.»
Sonderegger war wie vor den Kopf gestossen. Was war das für eine Polizei, die sich derart unverschämt über die elementarsten Regeln des kriminalistischen Handwerks hinwegsetzte? Was für eine Justiz, die das tolerierte? Was für Politiker, die – all diesen Ungereimtheiten zum Trotz – einfach wegsahen?
Er ging zurück an seinen Arbeitsplatz, setzte sich an den einfachen Holztisch, stützte den Kopf in die Hände und verharrte so eine gute halbe Stunde. Dann stand er auf und sagte trotzig mit halblauter Stimme: «Ich muss gegen diese Bande ankämpfen, der Gerechtigkeit willen.»
Er beschloss, den Arbeitgeber von Walter Pfenninger aufzusuchen. Das würde eine gute halbe Stunde dauern, denn die kleine Fabrik, eine Kaffeerösterei, in der Pfenninger als Bürolist arbeitete, lag in einer Industriezone am Stadtrand.
Als er das einfache Arbeitszimmer des Firmeninhabers betrat, war bereits elf Uhr vorüber.
«Guten Tag, Wachtmeister. Das ist vielleicht ein Ding. Pfenninger scheint einflussreiche Freunde zu haben. Heute Morgen war ein Herr von der städtischen Polizeidirektion bei mir. Er riet mir, auf eine Anzeige gegen Pfenninger zu verzichten. Pfenninger sei bereit, das Geld, das er versehentlich habe mitlaufen lassen, bis auf den letzten Rappen zurückzuzahlen.»
«Versehentlich?», fragte Sonderegger, jede Silbe des Wortes betonend.
«Ja, genau. Ich fasse es nicht.» Er habe den Kerl gleich heute Morgen vor Arbeitsantritt an die frische Luft gesetzt. Das Dumme sei nur, er müsse ihm noch zwei Monate lang den vollen Lohn zahlen. Doch die Geschäfte liefen nicht schlecht, als Inhaber der Rösterei könne er sich diesen Verlust leisten. Er und seine Frau müssten für die nächsten Wochen vermehrt Hand anlegen. Das Problem sei derzeit, Arbeitskräfte zu finden.
Sonderegger erkundigte sich, ob die Anzeige aufrechterhalten werde.
Der Fabrikbesitzer sagte: «Nein, wenn er das Diebesgut zurückgibt, ist für mich die Sache in Ordnung.»
Sonderegger stiess das sauer auf.
4
Anfang Mai 2014
Die Arbeitsgruppe «Brugisser» war kaum weitergekommen. Man wusste immer noch nicht, ob Brugisser freiwillig aus dem Leben geschieden war oder ob jemand nachgeholfen hatte. Da schrillte am Donnerstagmorgen, den 1. Mai 2014, Kochs Telefon. Der Anrufer meldete, er habe zwischen den Gleisen auf dem Bahnhofareal einen interessanten Fund gemacht. Ein Karton, der mit einer Schnur an einem Knochen befestigt sei. Am Karton hänge ein Schlüssel, ein alter, so einer für Geldschränke. Auf dem Karton sei mit Kugelschreiber in Blockschrift geschrieben:
Meister Reineke, das ist das letzte Stück Fleisch von mir. Geniess es.
«Wo liegt der Fundgegenstand genau?», fragte Koch ein wenig erregt.
«Zwischen dem zweiten und dritten Gleis südseits, circa fünfzig Meter östlich der Unterführung Langstrasse. Als Markierung habe ich ein Schweizer Fähnchen in den Schotter gesteckt.»
«Darf ich Ihren Namen wissen?»
«Nein.»
«Sind Sie ein Penner?»
«Das geht Sie nichts an.»
Koch hörte den Summton.
Eine halbe Stunde später lag der Fund zwischen den Gleisen auf dem Schreibtisch von Koch. Er zog die Gummihandschuhe aus der Schublade hervor und befühlte den Karton, den Knochen und den Schlüssel.
Er wählte die Nummer des ältesten Polizisten in der Kriminalabteilung, Wachtmeister Früh, bat ihn, rasch bei ihm hereinzuschauen.
Koch hielt Früh den Schlüssel unter die Nase und fragte, von wo der stammen könnte.
Früh zuckte mit den Achseln.
«Als Sie als junger Polizist auf dieser Hauptwache angefangen haben, hat Ihnen vielleicht ein älterer Kollege erzählt, wo er hingegangen ist, um seinen Zahltag abzuholen.»
«Genau! Der Tresor, aus dem damals in diesem Hause ein grösserer Geldbetrag gestohlen worden ist. Als ich Mitte der 1970er Jahre hier Dienst tat, war das ein viel diskutiertes Thema in der Kantine. Sicher existieren irgendwo Fotos von diesem Schlüssel.» Einer sei vier Jahre vor dem Diebstahl verschwunden.
«Und seither nicht mehr aufgetaucht?»
«Nein. Das hat zu den wildesten Spekulationen geführt. Das kleinere Schloss war offen, das grössere verschlossen, der Schlüssel dazu sicher verwahrt. Wäre der Dieb im Besitz des grösseren Schlüssels gewesen, hätte er den Tresor öffnen können.»
Koch fand das sehr interessant. Er fragte, wo sich der Tresor jetzt befinde.
«Jetzt?» Früh blies seine Backen auf und liess die Luft mit einem leisen Pfiff hinaus. «Wenn ich das wüsste. Ich fürchte, er ist verschrottet worden.»
«Es wäre wunderbar, wenn wir den Tresor hätten. Passt der Schlüssel zum Schloss, sehe ich eine Chance, dass dieses Delikt aufgeklärt wird.»
Früh schüttelte den Kopf. «Was bringt denn das?» Der Fall sei längst verjährt. Niemand könne deswegen zur Verantwortung gezogen werden.
Koch war nicht einverstanden. Er sehe einen Unterschied zwischen «zur Verantwortung ziehen» und «bestraft werden». Komme an den Tag, wer der Täter sei, wäre das ein gelöster Kriminalfall mehr. Gleichgültig, ob der Delinquent bestraft werde, gleichgültig, ob er noch lebe. «Wachtmeister, finden Sie heraus, ob der Tresor noch existiert, und wenn ja, wo er ist.» Eine Frage habe er noch, sagte Koch. «Wo war der Tresor, als einer der Schlüssel verschwunden war?»
«Soweit ich informiert bin, war der Tresor ursprünglich im Büro von Brugisser, als er noch Stellvertreter des Kommissärs war.» Beim Umzug an den Ort, wo der Diebstahl begangen wurde, sei er verloren gegangen.
Der Fund zwischen den Gleisen wurde vom Wissenschaftlichen Dienst der Stadtpolizei Zürich aufs Genaueste untersucht. Spuren, ausgenommen Fingerabdrücke, die vom unbekannten Finder stammen mussten, wurden weder auf dem Karton noch auf dem Schlüssel gefunden.
***
Früh machte sich auf die Suche. Zuerst fragte er herum, das brachte aber nichts. Schliesslich erinnerte er sich an seine ersten Tage in der Polizeischule. Das Kriminalmuseum! Einen ganzen Morgen lang verbrachte er dort. Klar doch, im Kriminalmuseum der Kantonspolizei an der Kasernenstrasse war dieser Kassenschrank.
Der Schlüssel passte ins Schloss.
Triumphierend klopfte Früh an Kochs Bürotür, platzte ohne das «Herein» abzuwarten hinein. Die Nachricht war rasch erzählt.
Koch umarmte Früh. «Gute Arbeit.»
«Etwas muss ich noch loswerden, Hauptmann Koch. Im Kriminalmuseum befindet sich der berühmteste Tresor der Schweiz. Ein Foto davon wurde 1963 sogar in der ‹New York Times› verewigt. Die Zeitungsseite davon ist am Tresor angeklebt. Damals ging die Meldung über diesen Diebstahl rund um die Welt. ‹Jemand begeht einen Geldraub in den heiligsten Räumen der Kriminalpolizei.› Damals eine Sensation, heute sozusagen ein Normalfall. Gestern entnahm ich der Zeitung, dass allein im Berner Oberland seit der letzten Jahrhundertwende Beträge in der Grössenordnung von einer halben Million aus den Kassenschränken von Polizeistationen entwendet wurden. Als Täter kommen nur Polizisten in Frage. Es war ein kurzer Artikel, den wohl die wenigsten zur Kenntnis nahmen.»
Er werde trotzdem ein Mediencommuniqué vom Stapel lassen, sagte Koch. Er trommelte für Montag, den 5. Mai, vierzehn Uhr, die Arbeitsgruppe «Brugisser» zusammen.
***
«Nun liegt der Obduktionsbericht vor.» Mit diesen Worten eröffnete Koch die Sitzung. «Herausgekommen ist nichts Überraschendes. Der Schuss muss aus nächster Nähe abgefeuert worden sein. Der Einschusswinkel beträgt nahezu null Grad, ist also waagrecht in den Schädel eingedrungen.» Zwei Meter, einen Meter, zwanzig Zentimeter vom Einschussloch entfernt. Alles sei möglich. Nur beim Letzteren käme ein Suizid in Frage. «Es kann somit beides, ein Mord oder ein Suizid gewesen sein.» Danach kam er auf den Fund zwischen den Gleisen des Bahnhofareals zu sprechen, die Mitteilung des anonymen Anrufers, die Entdeckung des Wachtmeisters Früh. Nach Koch war das ein sensationeller Fahndungserfolg.
Die Fahnder teilten nur halbwegs Kochs Euphorie. Man könne wohl vermuten, dass Brugisser im Besitz des vermissten Schlüssels war. Dass er womöglich auch der Dieb von 1963 gewesen sei. Allerdings sei er erst 1968, also fünf Jahre nach dem Diebstahl, in Verdacht geraten, den Raub begangen zu haben.
Koch versuchte die ausufernde Diskussion wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Die Geschichte um den Raub im Kassenschrank und die Beschuldigung gegen Brugisser seien ihm wohl bekannt. «Der Fund vom 1. Mai auf dem Bahnhofareal könnte den Schluss zulassen, dass Brugisser tatsächlich im Besitz des seit 1959 vermissten Schlüssels gewesen war. Der Text beim gefundenen Schlüssel weist jedenfalls in diese Richtung. Ein Abschiedsgruss an ‹Meister Reineke›, seinem Freund, ein letztes Vermächtnis des Diebes von 1963, kryptisch, dem Zufall überlassend, dass es jemand findet.»
Ein Raunen ging durch die Reihen der Kommissionsmitglieder. Koch griff das Unbehagen auf. Er verstehe, dass das eine gewagte Vermutung sei. Brugissers Zuneigung Füchsen gegenüber sei den meisten Leuten, die mit ihm Umgang pflegten, bekannt gewesen. Gut möglich, dass sich das jemand zunutze gemacht habe, um eine irreführende Spur zu legen.
Koch klopfte dezidiert auf den Tisch. «Es geht mir nicht um eine Schuldzuweisung an Brugisser. Ist Brugisser tatsächlich umgebracht worden, wären der Text auf dem Karton und der gefundene Schlüssel hinterlegt worden, um ein Verbrechen zu vertuschen. Meine lieben Leute, jetzt seid ihr gefordert. Wir müssen mit Nachdruck den Bekanntenkreis Brugissers durchforsten. Den von heute und den von früher. Wobei die Betonung auf dem ‹von früher› liegt.»
5
April 1963
Der Diebstahl im Tresor der Kriporäume wurde auf eine Art und Weise bearbeitet, die Mathias Sonderegger sehr zu schaffen machte. Er dachte in schlaflosen Nächten darüber nach, was er tun könnte, um diesem Missstand zu begegnen. Er war ein Polizist in den unteren Rängen, doch nicht mehr ganz unten. Er hatte sein eigenes Büro, konnte selbstständig ermitteln und erfreute sich am Privileg, bei der Arbeit Zivilkleidung zu tragen. Die Arbeit gefiel ihm. Mehr noch: Er war Polizist aus Leidenschaft. Seine Bestimmung fasste er als Auftrag auf, gegen Ungerechtigkeiten anzukämpfen und die Gesetze anzuwenden.
Doch nun musste er zuschauen, wie seine Vorgesetzten diese Aufgabe nicht ernst nahmen, über die Gesetze hinwegsahen und vielleicht sogar selbst Delikte begingen. Sonderegger musste dagegen ankämpfen, nicht das Vertrauen in Polizei und Justiz zu verlieren.
Er fasste sich ein Herz und beschloss, dem Stadtrat Schläppi, der dem Departement Polizei und Justiz vorstand, einen Brief zu schreiben.
Zürich, Mittwoch, den 3. April 1963
Sehr geehrter Herr Stadtrat,
am Abend des 26. März 1963 wurden aus dem Kassenschrank der Polizeihauptwache Urania neunzigtausend Franken entwendet. Als Angehöriger der Kriminalpolizei war ich zum mutmasslichen Zeitpunkt des Diebstahls im obersten Stock des Gebäudes, dort wo sich der Tresor befindet. Es hielten sich zeitgleich neun weitere Personen dort auf, unter anderem Kriminalkommissär Brugisser.
Ich wurde von Major Brugisser in der Sache Gelddiebstahl verhört. Die Vernehmung fand in entspannter Atmosphäre statt, es wurden keinerlei Beschuldigungen gegen mich erhoben.
Weniger sanft umgesprungen ist man mit den beiden Putzfrauen. Sie wurden nicht nur stundenlang verhört, bei ihnen zu Hause fand auch eine Wohnungsdurchsuchung statt. Dabei konnten sie gar keinen Schlüssel zum Tresorraum haben. Sie durften dort nur in Anwesenheit des Kassenwarts Boden, Fenster und Wände reinigen.
An der ganzen Angelegenheit finde ich insofern problematisch, dass die Ermittlungen der Kriminalabteilung der Stadtpolizei übertragen worden sind. Wäre es nicht besser, damit eine aussenstehende Dienststelle zu betrauen? Die Kantonspolizei Zürich oder besser noch eine ausserkantonale Polizei.
sig. Detektivwachtmeister Mathias Sonderegger, Kriminalabteilung der Stadtpolizei Zürich
Bereits am nächsten Tag wurde Sonderegger zu Brugisser zitiert. Zugegen war auch Kommandant Huber der Stadtpolizei. Die beiden Herren sassen je auf einem Fauteuil am Besuchertisch. Sonderegger sah sich nach einer Sitzgelegenheit um.
«Wachtmeister, Sie bleiben stehen», schnauzte ihn Brugisser an.
Huber nahm den Brief, den Sonderegger an den städtischen Polizeidirektor Schläppi geschickt hatte, aus der Westentasche, entfaltete ihn, strich ihn glatt und sah den Wachtmeister längere Zeit wortlos an.
Dann begann er mit donnernder Stimme zu sprechen: «Sonderegger, was Sie sich da geleistet haben, ist in der langen Geschichte der Stadtpolizei Zürich noch nie vorgekommen. Sie haben nicht nur den Dienstweg übergangen, sondern auch Ihren Vorgesetzten dem Verdacht ausgesetzt, eine kriminelle Tat begangen zu haben. Wir sehen uns gezwungen, ein Disziplinarverfahren gegen Sie zu eröffnen. Abtreten!»
Sonderegger schlug die Hacken zusammen, entfernte sich gemessenen Schrittes aus dem Raum, ging zurück in sein Büro und versuchte weiterzuarbeiten. Das gelang ihm aber erst nach einer Stunde. Es ging um kleinere Sachen. Einen Ladendiebstahl, eine Messerstecherei mit einem Leichtverletzten und ein entwendetes Velo.
Während der Mittagspause machte er einen Spaziergang am Limmatquai, kaufte sich an einem Stand ein Sandwich. Auf das Essen in der Kantine verzichtete er.
Um halb zwei fühlte er sich wieder imstande zu arbeiten. Der erste Anruf kam von Brugisser. Er habe die Angelegenheit mit dem Brief ausführlich mit dem Polizeikommandanten besprochen. Sie beide seien übereingekommen, die Sache vorerst auf sich beruhen zu lassen. «Sollten Sie aber weiterhin als Querulant Schwierigkeiten machen, werden wir kein Auge mehr zudrücken … Ich hoffe, Sie haben diese Botschaft verstanden.» Brugisser hängte grusslos auf.
Sondereggers Seelenzustand pendelte zwischen Erleichterung und Resignation. Vor einem Jahr hatte er ein Haus gekauft. Er hatte eine Frau und zwei Kinder. War es vertretbar, sein Familienglück aufs Spiel zu setzen? Nein, das konnte er seinen Lieben nicht antun. Aber war dieses Glück nicht auf Sand gebaut? Durfte er untätig hinnehmen, dass von seinen Vorgesetzten Recht und Gesetz mit Füssen getreten wurden?
Am Morgen danach nahm Sonderegger kurz nach Arbeitsbeginn einen Anruf entgegen. Vom Polizeiposten an der Langstrasse. Auf einem Zebrastreifen sei ein Erstklässler von einem Personenwagen angefahren worden. Der Bub liege nun schwer verletzt im Triemlispital. Der Lenker habe nach kurzem Anhalten Fahrerflucht begangen.
Sonderegger machte sich sogleich auf den Weg an die Langstrasse und sichtete auf dem Posten dort die eingegangenen Zeugenaussagen.
Wie üblich in solchen Fällen hatte niemand die Nummer auf dem Kontrollschild notiert. Immerhin konnte sich eine Frau erinnern, dass sie mit «LU 25» begann. Den Fahrzeugtyp hatten sich mehrere Personen übereinstimmend gemerkt. Eine schilfgrüne Mercedeslimousine. Bei der Kollision mit dem Schüler sei die Glasabdeckung des linken Schweinwerfers in die Brüche gegangen. Auch sei anzunehmen, dass die Karosserie bei der Kühlerhaube eine Delle bekommen habe. Der Polizist, der wenige Minuten nach dem Zusammenstoss an der Unfallstelle war, habe mehrere Lacksplitter sicherstellen können. Diese seien bereits auf dem Weg ins Labor.
Für Sonderegger eine wichtige Spur. Damit war es möglich, die Marke des Fahrzeugs mit den Zeugenaussagen abzugleichen. Das allein genügte aber nicht. Es gab zahlreiche Mercedeslimousinen in derselben Farbe. Man musste das Fahrzeug finden, um den fehlbaren Lenker zur Verantwortung ziehen zu können.
Sonderegger rief gegen zehn Uhr sein Team zusammen. Er las vier Korporale mit Detektivausbildung aus und wies sie an, alle Zeugenaussagen zu überprüfen und allenfalls nochmals nachzufragen. Zwei Spezialisten, die längere Zeit in der Autobranche gearbeitet hatten, bekamen die Aufgabe, die Halter sämtlicher im Kanton Luzern immatrikulierter Mercedeslimousinen ausfindig zu machen. Natürlich diejenigen zuerst, die auf den Kontrollschildern mit «LU 25» begannen und grün waren.
Sonderegger wollte gleich noch einen Augenschein an der Unfallstelle nehmen. Auf dem Weg dorthin fiel ihm der Sportwagen Brugissers auf. Er stand auf dem Parkfeld eines Nachtclubs am einen Ende der Langstrasse. Das brachte Sonderegger zum Nachdenken, denn er hatte am frühen Vormittag, bevor er wegfuhr, den käsebleichen Kommissär im Polizeigebäude gesehen. Unwahrscheinlich, dass Brugisser vor Arbeitsbeginn an der Langstrasse frühstückte und die paar Kilometer zum Kripogebäude zu Fuss zurücklegte.
Sonderegger liess seinen Fahrer beim Nachtclub anhalten und begab sich ins Lokal, traf dort einen mangelhaft ausgeschlafenen Barmann und fragte nach dem Herrn mit dem Sportwagen.
Das gehe ihn nichts an, sagte der Mann an der Theke, worauf Sonderegger seinen Polizeiausweis zückte. Der Barmann gab darauf den Namen des Halters preis – es war wie erwartet Brugisser – und erzählte, wie dieser bis zum Morgen mit einem anderen Herrn, dessen Identität er nicht kenne, gezecht habe.
Für Sonderegger keine Überraschung. Denn Brugisser, der in der Kripo den Übernamen «Playboy» hatte, schlug häufig über die Stränge, kam gelegentlich unausgeschlafen und nicht ganz nüchtern zur Arbeit.
Am Unfallort eingetroffen, fielen Sonderegger die grell weissen Markierungen der Spuren des Fluchtfahrzeuges und das getrocknete Blut des Opfers auf. Ein Polizist stand noch dort und bewachte die Unfallstelle. Er wollte von Sonderegger wissen, ob der Fahrer alkoholisiert gewesen sei. Das lasse sich anhand der Markierungen kaum mehr feststellen, aber dass er die signalisierte Geschwindigkeit massiv überschritten habe, schon, stellte Sonderegger fest und fuhr gleich weiter: «Wir werden den Burschen ausfindig machen, das garantiere ich Ihnen.»
Auf drei Uhr nachmittags bestellte Sonderegger sein Team nochmals zum Rapport.
Da lagen bereits einige Hinweise vor. Es gebe im Kanton Luzern nur sechs Mercedeslimousinen, deren Kontrollnummern mit «LU 25» begännen, vier davon trügen eine schilfgrüne Farbe.
Mit drei Haltern habe man schon Kontakt aufgenommen. Sie würden als Täter ausscheiden, da alle drei über ein hieb- und stichfestes Alibi verfügten. Vom vierten habe man Namen und Adresse. Es handle sich um einen Nationalrat. Man sei daran, ihn aufzutreiben und zur Rede zu stellen.
Sonderegger wies zwei Polizisten an, nach Verbindungen zwischen Brugisser und dem Nationalrat zu suchen.
Ein Treffen zwischen Sonderegger und dem Nationalrat kam drei Tage später am frühen Vormittag zustande. In einem Restaurant am Berner Bärenplatz, einen Katzensprung vom Bundeshaus entfernt.
Der Nationalrat gab sich zugeknöpft. Immerhin verweigerte er das Gespräch mit Sonderegger nicht, was er kraft seiner parlamentarischen Immunität hätte tun können. Sonderegger hatte ihm auch in Aussicht gestellt, dass er das respektieren würde. Allerdings wäre das kein Hinderungsgrund, die Untersuchung weiterzuführen, was dann mit Sicherheit so weit käme, und dass das Parlament trotzdem seine Immunität aufheben könnte.
Der Nationalrat gab zu, dass er in besagter Nacht an der Langstrasse mit einem Zürcher Freund zechte. Doch er beteuerte, mit dem Unfall nichts zu tun zu haben. Sonderegger gab sich mit dieser Aussage nicht zufrieden. Er bohrte weiter, wollte wissen, wer der Zechbruder war. Der Nationalrat weigerte sich, dessen Namen zu verraten.
Sonderegger griff zu einem Trick. «Ich weiss, wie Ihr Kumpan heisst: Werner Brugisser.»
Die Verblüffung des Nationalrats war mit Händen zu greifen. Er war Realist genug, zu erkennen, dass ihn Sonderegger übertölpelt hatte. «Stimmt, ich hielt mich mit Brugisser in der Bar auf. Wir haben die ganze Nacht durchgesoffen.»
«Wo ist Ihr Wagen?»
«Der müsste noch in der Garage von Brugisser stehen. Wir sind dort hingefahren, weil ich mich nicht imstande fühlte, mit dem Auto nach Bern zu fahren.»
Sonderegger lächelte verständnisvoll. «Zumindest war das ein weiser Entschluss. Wir werden selbstverständlich nachprüfen, ob das mit dem Standort des Wagens zutrifft. Wenn nicht, werde ich mich wieder an Sie wenden. Ich kann die Überprüfung von Bern aus anordnen.»
Sonderegger verabschiedete sich vom Nationalrat. Er rief einen seiner Mannen an. Eine halbe Stunde später kam die Rückmeldung. Der Wagen war nicht in Brugissers Garage. Dem nun unausweichlichen Gespräch mit dem Nationalrat konnte Sonderegger an diesem Tag nicht mehr nachkommen. Er bestieg den nächsten Schnellzug nach Zürich.
Nach der Mittagspause klopfte Sonderegger an Brugissers Büro. Eigentlich hätte er erwartet, einen zerknirschten, kurz vor dem Zusammenbruch stehenden Mann anzutreffen. Doch Brugisser gab sich aufgeräumt. Als Sonderegger ihn auf die Zecherei mit dem Nationalrat ansprach, benahm er sich so, als ob er sich nichts zuschulden hätte kommen lassen. Der Nationalrat sei ein guter Freund von ihm und politisch zuverlässig. Nicht ein bescheuerter linker Weltverbesserer, der gegen die Polizei arbeite. Dass man zwischendurch zusammen etwas trinke, sei überhaupt nichts Verwerfliches. Für Sonderegger war klar, dass Brugisser und der Nationalrat sich ständig austauschten und auf dem Laufenden hielten.
Wo der Wagen des Nationalrats sei, wollte Sonderegger wissen.
«In einer Autowerkstatt in der Nähe meines Hauses», antwortete Brugisser salopp.
Dort war der Wagen tatsächlich. Ohne Dellen, ohne zersplitterte Scheinwerfer. Sonderegger liess ihn dennoch beschlagnahmen. Er wurde in einer Werkstatt der Stadtpolizei peinlich genau angeschaut. Proben vom Lack wurden genommen und diese im Labor des Wissenschaftlichen Dienstes untersucht. Das dauerte allerdings fünf Tage.
Nach den ersten Ergebnissen entsprach die Zusammensetzung des Lacks nicht den am Unfallort gefundenen Spuren.
Ein Hammerschlag gegen Sonderegger. Er konnte das kaum glauben. Aber er gab nicht auf. Bevor er auf die Polizeischule ging, hatte er eine Lehre als Automechaniker erfolgreich abgeschlossen. So wusste er, dass Autos vollständig neu lackiert werden konnten. Dazu musste die ursprüngliche Farbe entfernt und danach die neue aufgetragen werden. In der Zwischenzeit – seit dem Unfall waren mehrere Tage vergangen – lag ein solches Prozedere durchaus drin. Aber das konnte nachgewiesen werden.
Nun ging es darum, unter dem neuen Lack Reste der alten Farbe zu finden. Ein mühsamer Prozess, den Sonderegger auf sich nahm, denn er war überzeugt, dass es sich beim Wagen um das Unfallfahrzeug handelte. Die Hartnäckigkeit Sondereggers zahlte sich aus. Eine Woche später war eindeutig bewiesen, dass der Wagen des Nationalrats den Schüler auf dem Zebrastreifen angefahren hatte.
Dem Jungen ging es wieder besser. Die Verletzungen waren nicht so schwerwiegend, wie zunächst befürchtet wurde.
Nun musste Sonderegger die Unterlagen der Staatsanwaltschaft weiterreichen. Dabei wusste er, dass dem Staatsanwalt nicht zu trauen war. Er intervenierte bei Stadtrat Schläppi und regte an, die Untersuchungen von einem aussenstehenden Staatsanwalt durchführen zu lassen. Dem wurde nicht entsprochen. Sonderegger blieb nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren. Allerdings legte er privat Kopien der Befunde der Werkstatt und des Labors an, was eigentlich nicht erlaubt war.
Nach dem abschlägigen Bescheid des Stadtrats war Sonderegger am Boden zerstört. Als er am Abend nach Hause kam, fiel das seinen beiden halbwüchsigen Kindern auf. Auch seiner Frau Klara, die tat aber so, als ob nichts geschehen wäre.
«Papa, ist dir etwas über die Leber gekrochen?», sprach ihn Helene an.
«Ja, das kann man wohl sagen. Es geschehen schlimme Dinge, und die Gerichtsbehörden schauen einfach weg, ebenso die verantwortlichen Polizeioffiziere.»
Nun reagierte seine Frau Klara. «Mathias, mach mal einen Punkt. Du bist und bleibst ein Weltverbesserer. Warum musst du dich immer mit deinen Vorgesetzten anlegen? Denk doch auch an deine Familie. Du bist auf dem besten Weg, deine Karriere zu versauen. – Auf dem Polizeiball vor ein paar Wochen habe ich mich mit deinem Chef, dem Herrn Dr. Brugisser, darüber unterhalten. Du hättest das Zeug zum Polizeioffizier, sagte er. Schade, dass du von deinen aufmüpfigen Hirngespinsten nicht lassen könnest.»
«Was sind Hirngespinste?», fragte Thomas.
Sonderegger warf seiner Frau einen Blick zu. «Das musst du jetzt erklären.»
«Frag nicht so dumm, Bub. Das verstehst du sowieso nicht», sagte Klara forsch.
«Ich versuche es dir begreiflich zu machen, mein Junge», funkte Sonderegger dazwischen. «Man meint damit etwas, das andere nicht verstehen oder nicht glauben können oder vielleicht nicht verstehen oder nicht glauben wollen. Genau das ist mir schon oft passiert. Wichtig ist, dass man selber überzeugt davon ist. Das ist aber nur möglich, wenn man weiss, dass es wahr ist.» Sonderegger sah Thomas lange an. Dann fragte er nach: «Hast du verstanden, was ich gesagt habe?»
«Ich glaube schon, ja.»
«Nein, nichts hast du verstanden. Ich sehe es deinen Augen an. Ich versuche es dir nochmals zu erklären. Ist ja auch nicht ganz einfach. – Erinnerst du dich noch an Onkel Walter?»
«Ja, er lebt nicht mehr.»
«Stimmt. Leider ist er vor drei Jahren am Sustenpass mit dem Motorrad tödlich verunglückt. Kurz zuvor war er noch bei uns zu Besuch. Er hat – was er meistens machte – von seiner Zeit in der französischen Fremdenlegion erzählt.»
«Die Fremdenlegion! Das war ungemein spannend.»
Onkel Walter, sein Bruder, sei ein guter Erzähler gewesen, sagte Sonderegger. «Er konnte das, weil er diese Geschichten selbst erlebt hatte. Beim letzten Mal, als er uns besuchte, berichtete er über eine Fata Morgana in der Wüste.»
Das komme ihm bekannt vor, bemerkte Thomas. Es habe sich um eine Art Spiegelbilder gehandelt.
So sei es, bestätigte Sonderegger. Er erzählte Thomas die Geschichte: