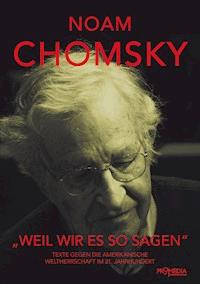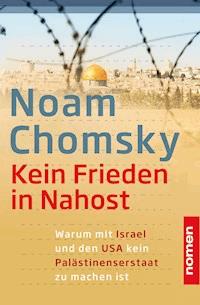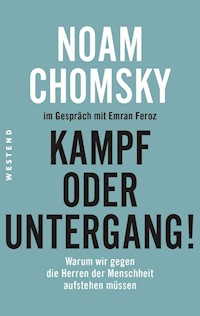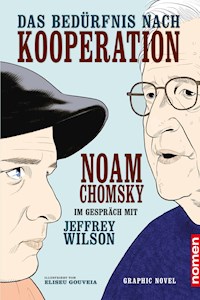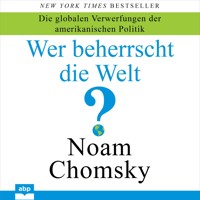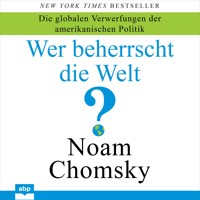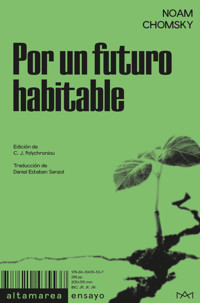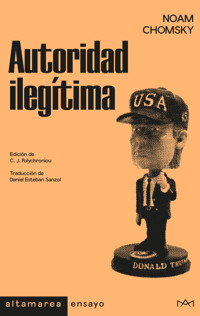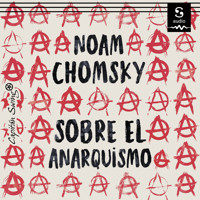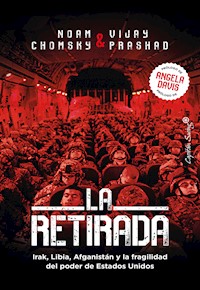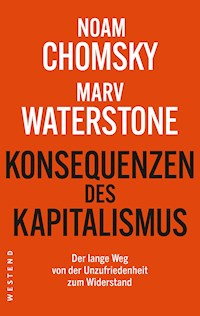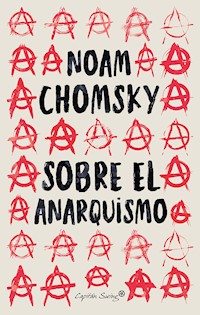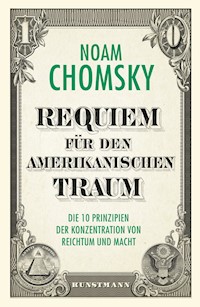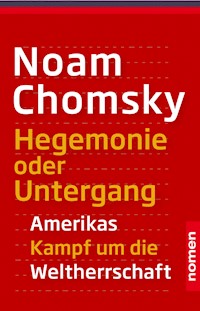
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Nomen Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
2/3 der Satelliten im All sind amerikanisch und tragen zur Stabilisierung der US-Dominanz bei. Um ihre strategischen Interessen und ihre Vormachtstellung im Weltraum auszubauen, beschlossenen die USA 2019, eine Armee – das Strategic Space Command – speziell fürs All zu gründen. Diese schon seit Präsident Clinton laufende Planung unter dem Titel »Vision for 2020« formulierte als Hauptziel: »Beherrschung der Weltraumdimension militärischer Operationen zum Schutz US-amerikanischer Interessen und Investitionen«. Noam Chomskys Klassiker von 2003, der nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat und lt. Penguin Books »Chomskys wichtigste Streitschrift gegen die amerikanische Außenpolitik« ist, beschreibt die Entwicklung der Außenpolitik der USA nach dem 2. Weltkrieg bis zum in den letzten Jahren in Osteuropa stationierten Raketenabwehrsystem BMD und der US-amerikanischen Beherrschung des Weltraums. Die Kosten dieser Strategie sind gigantisch und verschleudern finanzielle Ressourcen, die anderweitig sinnvoller eingesetzt werden könnten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
nomen
Noam Chomsky
HegemonieoderUntergang
Amerikas Kampf um dieWeltherrschaft
Aus dem Amerikanischen übersetzt von Michael Haupt
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe: Nomen Verlag,Frankfurt am Main 2017
www.nomen-verlag.de
4. Auflage 2022
Titel der amerikanischen Originalausgabe:»Hegemony or Survival«
Copyright © Aviva Chomsky, Diane Chomskyand Harry Chomsky, 2003
First published in the United States by: Metropolitan Books,a division of Henry Holt and Company L.L.C.
Umschlaggestaltung: Petra Dorkenwald, MünchenAutorenfoto: © Don Usner
Druck und Bindung: CPI Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-939816-86-7eISBN 978-3-939816-87-4
Inhalt
I. Hegemonie oder Überleben
II. Die imperiale Strategie
III. Die neue Epoche der Aufklärung
IV. Gefährliche Zeiten
V. Die Irak-Connection
VI. Weltmachtprobleme
VII. »Ein Hexenkessel von Feindseligkeiten«
VIII. Terrorismus und Gerechtigkeit
IX. Ein Alptraum, der vorübergeht?
Anmerkungen
Personenregister
I. Hegemonie oder Überleben
Vor einigen Jahren hat einer der großen zeitgenössischen Biologen, Ernst Mayr, einen Aufsatz veröffentlicht, in dem er sich mit den Erfolgsmöglichkeiten der Suche nach außerirdischer Intelligenz beschäftigt.1 Er hält die Aussichten für sehr gering und sieht die Gründe in dem mangelhaften Anpassungsvermögen der spezifisch menschlichen Form geistiger Organisation. Seit der Entstehung des Lebens hat es, Mayr zufolge, an die 50 Milliarden Arten auf der Erde gegeben, von denen nur eine einzige »jene Intelligenz ausbildete, die zur Errichtung einer Zivilisation notwendig ist«. Das geschah vor etwa 100 000 Jahren, als eine kleine Gruppe höherer Lebewesen überlebte, von der wir alle abstammen.
Es könnte sein, spekuliert Mayr, daß die menschliche Gattung gerade aufgrund ihrer Intelligenz von der natürlichen Auslese nicht begünstigt wird. Zumindest biologisch widerlege die Geschichte des Lebens auf der Erde die Behauptung, daß »Klugheit besser ist als Dummheit«: Käfer und Bakterien z. B. seien überlebensfähiger als Menschen. Überdies betrage, bemerkt Mayr düster, »die durchschnittliche Lebenserwartung einer Art ungefähr 100 000 Jahre«.
Vielleicht bietet die Epoche, deren Beginn wir jetzt gerade erleben, eine Antwort auf die Frage, ob Klugheit besser ist als Dummheit, wobei die hoffnungsvollste Antwort allerdings keinewäre, weil sich sonst herausstellen könnte, daß der Mensch ein »biologischer Irrtum« ist, der die ihm von der Evolution eingeräumten einhundert Jahrtausende dazu genutzt hat, sich selbst und dabei noch vieles andere zu zerstören.
Ganz sicher hat unsere Gattung die entsprechenden destruktiven Fähigkeiten entwickelt und, wie ein außerirdischer Beobachter bemerken könnte, im Verlauf ihrer Geschichte auch in die Tat umgesetzt; am augenfälligsten während der letzten Jahrhunderte mit Angriffen auf die lebenserhaltende Umwelt, die Artenvielfalt komplexerer Organismen sowie mit kalter und berechnender Brutalität gegen die Angehörigen der menschlichen Spezies selbst.
»Zwei Supermächte«
Schon zu Beginn des Jahres 2003 gab es zahlreiche Hinweise darauf, daß die Sorgen um das Uberleben unserer Gattung keineswegs übertrieben sind. Um nur ein paar Beispiele zu nennen: Im Herbst 2002 wurde bekannt, daß vierzig Jahre zuvor ein alles vernichtender Atomkrieg nur um Haaresbreite vermieden werden konnte. Kurz nach dieser alarmierenden Entdeckung blokkierte die Regierung Bush Bemühungen der Vereinten Nationen, die Militarisierung des Weltraums zu verhindern, brach internationale Verhandlungen über ein Verbot biologischer Kriegführung ab und marschierte, allen nationalen und internationalen Protesten zum Trotz, entschlossen auf einen Angriff gegen den Irak zu.
Irakerfahrene Hilfsorganisationen und Untersuchungen medizinischer Institutionen wiesen darauf hin, daß die Invasion in eine humanitäre Katastrophe münden könnte. Washington ignorierte diese Warnungen, und die Medien interessierten sich nur mäßig dafür. Eine hochrangige US-amerikanische Projektgruppe kam zu dem Schluß, daß Angriffe mit Massenvernichtungswaffen innerhalb der Vereinigten Staaten »wahrscheinlich« seien und durch einen Angriff auf den Irak noch wahrscheinlicher würden. Ahnlich äußerten sich zahlreiche Spezialisten und Geheimdienste, die hinzufügten, daß Washingtons kriegerische Haltung, die sich nicht auf den Irak beschränkte, langfristig den internationalen Terrorismus stärken und die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen begünstigen werde. Auch diese Warnungen wurden in den Wind geschlagen.
Im September 2002 verkündete die Regierung Bush ihre Nationale Sicherheitsstrategie: Fortan werde man sich das Recht vorbehalten, jeder Bedrohung der auf Dauer gestellten globalen Hegemonie der Vereinigten Staaten mit Gewalt zu begegnen. Diese neue Großstrategie erregte weltweit Besorgnis und führte auch bei außenpolitischen Spezialisten im eigenen Land zu kritischen Fragen. Ebenfalls im September wurde, rechtzeitig zum Beginn der Kongreßwahlen, eine Propagandakampagne lanciert, um Saddam Hussein als unmittelbare Bedrohung für die USA darzustellen und den Anschein zu erwecken, er sei für die Anschläge vom 11. September 2001 verantwortlich und plane weitere Attentate. Diese Kampagne war äußerst erfolgreich: Schon bald befürwortete die amerikanische Öffentlichkeit (im Gegensatz zur Weltmeinung) einen Krieg gegen Hussein, und die Regierung konnte den Irak zum geeigneten Testfall für die neue Strategie willkürlicher Gewaltanwendung machen.
Ebenso torpedierte die Regierung Bush internationale Bemühungen um eine umweltfreundlichere Politik mit Vorwänden, die kaum zu verhüllen mochten, daß es einzig um privatwirtschaftliche Interessen ging. Der Climate Change Science Plan (CCSP) der Regierung enthalte, schrieb Donald Kennedy, Herausgeber des Wissenschaftsmagazins Science, »keine Empfehlung für die Begrenzung von Emissionen oder andere Formen der Umweltentlastung«, sondern beschränke sich auf »freiwillige Maßnahmen, die, selbst wenn sie befolgt würden, eine Steigerung der Emissionsraten um 14 Prozent pro Dekade erlaubten«. Unberücksichtigt bleibe auch die wachsende Wahrscheinlichkeit, daß die kurzfristige Erwärmung der Erdatmosphäre einen »plötzlichen, nicht-linearen Prozeß« mit tiefgreifenden Temperaturveränderungen in Gang setzen könnte, der für die USA, Europa und andere gemäßigte Zonen erhebliche Risiken berge. Washingtons »verächtlicher Umgang mit den multilateralen Bemühungen um das Problem der Erderwärmung« führe, so Kennedy, »zur weiteren Aushöhlung der guten Beziehungen zu den europäischen Freunden« und zu »schwelendem Unmut«.2
Im Oktober war kaum noch zu übersehen, daß die Welt »den ungezügelten Einsatz amerikanischer Macht mit größerer Sorge betrachtete … als die von Saddam Hussein ausgehende Bedrohung« und »den Einfluß des Giganten ebenso gern beschränkt … wie die Arsenale des Despoten leergeräumt sähe«.3 Die Sorge wuchs noch in den folgenden Monaten, als der Gigant seine Absicht bekundete, den Irak auch dann anzugreifen, wenn es den von ihm widerwillig geduldeten UN-Inspektoren nicht gelingen sollte, die erforderlichen Massenvernichtungswaffen aufzutreiben. Im Dezember waren, internationalen Umfragen zufolge, außerhalb der USA gerade einmal zehn Prozent der Öffentlichkeit für einen Krieg, und zwei Monate später hieß es angesichts weltweiter Proteste, daß es »vielleicht immer noch zwei Supermächte auf diesem Planeten gibt: die Vereinigten Staaten und die öffentliche Weltmeinung« (wobei mit den »Vereinigten Staaten« hier die Regierung gemeint ist, nicht die Bevölkerung oder die Eliteschichten).4
Zu Beginn des Jahres 2003 hatte die globale Angst vor den USA beträchtliche Höhen erreicht, während das Vertrauen in ihre politische Führung nahezu auf den Nullpunkt gesunken war. Allzusehr hatte die Regierung Bush, ihren Lippenbekenntnissen zum Trotz, elementare Menschenrechte mißachtet und die Demokratie auf zuvor nie gekannte Weise mit Füßen getreten. Die folgenden Ereignisse sollten jeden mit Besorgnis erfüllen, der sich Gedanken über die Welt macht, die er seinen Kindern und Enkeln hinterläßt.
Obwohl die Bush-Krieger im traditionellen politischen Spektrum der USA die Position der extremen Falken besetzen, haben ihre Programme und Doktrinen viele Vorläufer, nicht nur in der amerikanischen Geschichte selbst, sondern auch in vielen früheren Weltmacht-Aspiranten. Noch bedrückender ist, daß die Entscheidungen der jetzigen US-Strategen im Rahmen der vorherrschenden Ideologie und der sie verkörpernden Institutionen keineswegs irrational sein müssen. Für die Bereitschaft politischer Führer, ungeachtet möglicher Katastrophen auf die Androhung oder Anwendung von Gewalt zu setzen, gibt es genügend historische Beispiele. Heute jedoch sind die Risiken höher als je zuvor, denn die Alternative lautet: Hegemonie oder Uberleben.
Im folgenden möchte ich einige der vielen Fäden, die dieses vielschichtige Gewebe durchziehen, entwirren und mich dabei auf die Weltmacht, die gegenwärtig globale Hegemonie beansprucht, konzentrieren. Ihre Handlungen und Prinzipien sind für alle Bewohner dieses Planeten von größter Bedeutung, insbesondere natürlich für die Amerikaner selbst, von denen viele außergewöhnliche Freiheiten und Privilegien genießen, die es ihnen ermöglichen, an der Gestaltung der Zukunft mitzuwirken. Sie sollten daher die Verantwortung, die mit solchen Privilegien unmittelbar verbunden ist, nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Der Feind im Innern
Wer seiner Verantwortung gerecht werden möchte, indem er für wahrhafte Demokratie und Freiheit – und eine Politik des Überlebens – eintritt, sollte wissen, welche Hindernisse dem entgegenstehen. In gewalttätigen Staaten liegen diese offen zutage, in demokratischeren Gesellschaften sind sie eher verborgen. So unterschiedlich die Methoden der Behinderung von Demokratie und Freiheit auch sein mögen, so ähnlich sind die Ziele: Immer geht es darum, die »große Bestie«, wie Alexander Hamilton das Volk nannte, innerhalb eng gezogener Schranken zu halten.
Seit der ersten demokratischen Revolution der Moderne im England des 17. Jahrhunderts war den Mächtigen und Privilegierten vor allem daran gelegen, die Volksmassen im Zaum zu halten. Angewidert reagierten die »wahrlich tugendhaften Männer«, wie sie sich selbst nannten, als eine »wankelmütige Menge von Bestien in Menschengestalt« jenseits des Bürgerkriegs zwischen Krone und Parlament eine Regierung forderte, die »aus Landsleuten wie wir selbst, die unsere Bedürfnisse kennen« bestehen müsse, nicht aber aus »Rittern und Adligen, deren Gesetze uns Furcht einflößen und unterdrücken sollen«. Wenn aber, so erkannten die wahrlich Tugendhaften, das Volk derart »verkommen und korrumpiert« ist, daß es »Macht und Verantwortung in die Hände schlechter und unwürdiger Männer legt, hat es damit seine Macht an diejenigen verloren, die gut sind, seien es ihrer auch nur wenige«. Fast drei Jahrhunderte später nahm der »Wilsonsche Idealismus« eine ähnliche Haltung ein. Im Ausland muß die US-Regierung dafür sorgen, daß die jeweilige Herrschaft von den »wenigen Guten« ausgeübt wird, während es im eigenen Land darum geht, die von Eliten getroffenen Entscheidungen von der Bevölkerung ratifizieren zu lassen, also ein System aufrechtzuerhalten, das die Politikwissenschaft »Polyarchie« nennt und das mit Demokratie wenig zu tun hat.5
Als Präsident schreckte Woodrow Wilson auch vor innerstaatlicher Repressionspolitik nicht zurück, aber solche Maßnahmen sind, wie man bereits damals in den Herrschaftsetagen der USA und Großbritanniens erkannte, kaum noch durchzusetzen, sobald die Bürger sich ein substantielles Maß an Freiheiten und Rechten erkämpft haben. Um die Bestie zu zähmen, bedurfte es anderer Mittel, die vor allem auf die Beeinflussung der öffentlichen Meinung hinausliefen. Zu diesem Zweck wurde eine umfangreiche Industrie ins Leben gerufen.
Wilson selbst war der Ansicht, daß eine gebildete Elite mit »erhabenen Idealen« dazu berufen sei und ermächtigt werden müsse, »Stabilität und Rechtschaffenheit« zu bewahren.6 Führende Intellektuelle wie Walter Lippmann schlossen sich dem an. In seinen Essays zur Funktion der Demokratie schlug Lippmann die »Herstellung von Konsens« vor; eine »Revolution« der demokratischen Verfahrensweise, mittels derer es einer »Klasse von Spezialisten« möglich wird, die »Interessen des Gemeinwesens« zu vertreten, die der Öffentlichkeit zumeist entgehen. Das ist im wesentlichen das leninsche Konzept einer »Avantgarde-Partei«. Wie eine solche Revolution möglich ist, konnte Lippmann schon als Mitglied von Wilsons Committee on Public Information erfahren, dem es mit gezielter Propaganda gelang, die amerikanische Öffentlichkeit für den Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg zu begeistern.
Die »verantwortlichen Männer« müssen, so Lippmann, ihre Entscheidungen treffen können, ohne sich vom »Getrampel und Gebrüll einer verwirrten Herde« beeindrucken zu lassen, deren Mitglieder bestenfalls »Zuschauer«, nicht aber »Teilnehmer« sein können. Der Herde kommt die Funktion zu, bei den periodisch abgehaltenenen Wahlen für den einen oder anderen Vertreter der politischen Führungsschicht zu trampeln und zu brüllen. Unerwähnt bleibt, daß die »verantwortlichen Männer« ihren Status nicht aufgrund bestimmter Talente oder Kenntnisse erlangen, sondern durch willige Unterordnung unter das jeweilige Machtsystem und die Treue zu dessen Prinzipien, deren wichtigstes lautet, daß die Entscheidungen über die sozialen und wirtschaftlichen Strukturen den autoritär verfaßten Institutionen überlassen bleiben, während die Mitwirkung der Bevölkerung auf einen eng begrenzten öffentlichen Bereich beschränkt bleibt.
Wie begrenzt dieser Bereich sein sollte, ist umstritten. In den letzten dreißig Jahren haben neoliberale Initiativen immer wieder den Versuch unternommen, ihn weiter zu reduzieren und die Entscheidungsebene einigen rechtlich unangreifbaren Privattyranneien zu überlassen, die miteinander und mit ein paar mächtigen Staaten eng verwoben sind. Die Demokratie kann dann nur in äußerst eingeschränkter Form überleben. In dieser Hinsicht besonders extrem waren die Regierungen Reagan und Bush, aber das politische Spektrum in den USA ist ohnehin nicht besonders breit. Manche bezweifeln, daß es überhaupt existiert und machen sich über jene Experten lustig, die »ihren Lebensunterhalt dadurch verdienen, daß sie [bei Wahlkämpfen] die feineren Pointen der von der NBC ausgestrahlten Sitcoms mit denen vergleichen, die bei CBS laufen«: »In stillschweigendem Einvernehmen führen die beiden großen Parteien den Wettbewerb um die Präsidentschaft als politisches Kabuki-Theater durch, bei dem alle Spieler ihre Rollen gelernt haben und nicht vom Drehbuch abweichen« – eine Veranstaltung, »die in keiner Weise ernstgenommen werden kann«.7
Wenn die Öffentlichkeit ihre Marginalisierung und Passivität überwindet, sprechen liberale Intellektuelle von einer »Krise der Demokratie«, die auch durch die Disziplinierung jener Institutionen überwunden werden muß, welche für die »Indoktrinierung der Jugend« verantwortlich sind, also Schulen, Universitäten, Kirchen und dergleichen. Und falls die Selbstzensur der Medien nicht mehr ausreicht, müssen sie von der Regierung direkt kontrolliert werden.8
Insofern sie solche Ansichten unterstützen, können die zeitgenössischen Intellektuellen sich auf verfassungsnahe Quellen berufen. Schon James Madison meinte, die Macht müsse an den »Reichtum der Nation« delegiert werden, d. h. an jene »fähigeren Männer«, die begreifen, daß die Regierung die Aufgabe hat, »die Minderheit der Wohlhabenden vor der Mehrheit zu schützen«. Madison, dessen Weltbild noch aus der vorkapitalistischen Ara stammte, war davon überzeugt, daß die »aufgeklärten Staatsmänner« und »wohlmeinenden Philosophen« ihre Macht »im wahren Interesse ihres Landes« ausüben und die Allgemeinheit vor dem »Mutwillen« demokratischer Mehrheiten bewahren würden. Als er älter wurde, befiel ihn die Furcht, daß die wachsende Zahl derer, die »unter der Mühsal des Lebens leiden und heimlich eine gerechtere Verteilung seiner Früchte ersehnen«, zu gravierenden Problemen führen könnte. Die moderne Geschichte ist nicht zuletzt von den Auseinandersetzungen darüber geprägt, wer auf welche Weise Entscheidungen trifft.
Daß keine Regierung, sei sie despotisch oder frei, auf die Kontrolle der öffentlichen Meinung verzichten kann, wußte bereits David Hume. Dem ist bestenfalls hinzuzufügen, daß dies in den freieren Gesellschaften, in denen Gehorsam nicht durch die Knute zu erzwingen ist, sehr viel größere Bedeutung besitzt. Daher kann nicht verwundern, daß die modernen Institutionen für die Gedankenkontrolle – die ganz offen als Propaganda bezeichnet wurde, bevor der Begriff in den Ruch des Totalitären kam – in den freiesten Gesellschaften entstanden. Pionierarbeit leistete Großbritannien mit seinem Informationsministerium, das im Ersten Weltkrieg sich vornahm, »weltweit die Gedanken zu kontrollieren«. Bald darauf folgte Wilsons bereits erwähntes Committee on Public Information, dessen Erfolge die fortschrittlichen Theoretiker der Demokratie ebenso inspirierten wie die moderne PR-Industrie. Führende Mitarbeiter dieses Komitees wie Walter Lippmann und Edward Bernays machten sich die Errungenschaften der Kriegspropaganda zunutze; Bernays erblickte in der »Herstellung von Konsens … das wesentliche Merkmal des demokratisches Prozesses«. 1922 fand der Terminus »Propaganda« Eingang in die Encyclopaedia Britannica, ein Jahrzehnt später tauchte er in der Encyclopedia of the Social Sciences auf, als Harold Lasswell den neuen Techniken zur Kontrolle des öffentlichen Bewußtseins seinen akademischen Segen erteilte. Bedeutsam waren die Methoden der Pioniere auch deshalb, schreibt Randall Martin in seiner Geschichte der Propaganda, weil sie »vom nationalsozialistischen Deutschland, von Südafrika, der Sowjetunion und dem Pentagon nachgeahmt wurden«, ohne daß die Erfolge der PR-Industrie jemals erreicht worden wären.9
Die eigene Bevölkerung unter Kontrolle zu halten, wird vor allem dann problematisch, wenn die Regierungspolitik auf heftige Opposition stößt. In diesem Fall mag die politische Führung versucht sein, den Weg Reagans einzuschlagen, der ein »Büro für öffentliche Diplomatie« (Office of Public Diplomacy) einrichtete, um seine mörderische Vorgehensweise in Mittelamerika besser zu verkaufen. Ein hoher Regierungsbeamter beschrieb die vom Büro lancierte »Operation Wahrheit« als »umfangreiche psychologische Operation der Art, wie sie das Militär durchführt, um eine auf feindlichem Territorium lebende Bevölkerung zu beeinflussen« – was besagt, daß die Regierung auch die eigene Bevölkerung durchaus als »auf feindlichem Territorium lebend« begreifen kann.10
Der Feind jenseits der Grenzen
Während man im eigenen Land die Leute oft mit intensiver Propaganda im Zaum halten muß, stehen für Aktionen jenseits der Grenzen weniger umständliche Mittel zur Verfügung. Führende Mitglieder der jetzigen Regierung Bush haben, als sie noch unter Reagan und Bush sr. dienten, bereitwillig gezeigt, daß und wie sie diese Mittel zu nutzen imstande sind. Als die traditionelle Herrschaft von Gewalt und Unterdrückung in den mittelamerikanischen US-Domänen von kirchlichen und anderen oppositionellen Kräften in Frage gestellt wurde, reagierte Reagan gleich nach seinem Amtsantritt 1981 mit einem »Krieg gegen den Terror«, der schon bald und wenig überraschenderweise zu einem Terrorkrieg, einer Folter- und Mordkampagne wurde, die auch andere Weltregionen nicht verschonte.
In Nicaragua hatte Washington die Kontrolle über die Streitkräfte verloren, denen es traditionellerweise (eine Erbschaft des Wilsonschen Idealismus) oblag, die Bevölkerung in den Staaten der Region zu unterdrücken. Die Sandinisten stürzten den Diktator Somoza, eine US-Marionette, und entwaffneten die mörderische Nationalgarde. Daraufhin wurde das Land Reagans Terrorismus unterworfen, der sich wirtschaftlich, politisch und auch psychologisch katastrophal auswirkte. Der Sturz der Diktatur hatte für eine Welle von Begeisterung, Vitalität und Optimismus gesorgt und die Hoffnung hervorgerufen, daß die düstere Geschichte Nicaraguas vielleicht doch einen anderen Verlauf nehmen könnte. Das durfte die Supermacht in ihrem Hinterhof nicht zulassen.
In den anderen Ländern Mittelamerikas, die Zielscheiben von Reagans »Krieg gegen den Terror« wurden, behielt das von den USA ausgebildete und mit Waffen versehene Militär die Oberhand. Die Bevölkerung war diesen Terroristen schutzlos ausgeliefert und wurde das Opfer zahlloser Greueltaten, die von Menschenrechtsorganisationen, Kirchengruppen und Lateinamerikaexperten in allen Einzelheiten dokumentiert wurden, ohne daß die Bürger jenes Staats, der für die Folterungen und Massaker in erster Linie verantwortlich war, davon besonders viel erfuhren.11
Mitte der achtziger Jahre hatten, so eine kirchliche Menschenrechtsorganisation aus El Salvador, die staatsterroristischen Kampagnen in den betroffenen Gesellschaften ein Klima »von Schrecken und Panik … kollektiver Einschüchterung und Furcht« geschaffen; die Bevölkerung hatte sich an den »täglichen und häufigen Einsatz von Gewalt« und den »Anblick von Folteropfern« gewöhnt. Nach der Rückkehr von einem kurzen Besuch seiner Heimat Guatemala schrieb der Journalist Julio Godoy: »Man ist versucht zu glauben, daß einige Leute im Weißen Haus die aztekischen Götter anbeten und ihnen das Blut der Mittelamerikaner opfern.« Godoy war geflohen, nachdem das Büro seiner Zeitung, La Epoca, von Staatsterroristen in die Luft gesprengt worden war, was in den Vereinigten Staaten keinerlei Aufmerksamkeit erregte. Das Weiße Haus habe, so Godoy, in Mittelamerika Kräfte installiert, die es »an Grausamkeit durchaus mit Nicolae Ceausescus Securitate aufnehmen können«.12
Nachdem die Terroristen ihre Ziele erreicht hatten, erörterte eine Konferenz von Jesuiten und Laienbrüdern in San Salvador die Folgen. Die Teilnehmer hatten in den düsteren achtziger Jahren genügend persönliche Erfahrungen gesammelt, um ein Urteil abgeben zu können, und kamen zu dem Schluß, daß es nicht ausreiche, sich allein auf den Terror zu konzentrieren. Ebenso müsse man erforschen, »welches Gewicht der Kultur der Terrors zukommt, wenn es darum geht, die Erwartungen der Bevölkerungsmehrheit herabzusetzen« und sie daran zu hindern, »Alternativen zu den Forderungen der Mächtigen« in Betracht zu ziehen.13 Das gilt nicht nur für Mittelamerika.
Hoffnungen zu zerstören, ist ein wichtiges Unterfangen. Gelingt es, können die Mächtigen formelle Demokratie zulassen oder gar, wenn auch nur aus PR-Motiven, für wünschenswert halten. In Kreisen, wo halbwegs ehrlich gesprochen wird, räumt man dies auch ein. Am besten aber verstehen es jene »Bestien in Menschengestalt«, die den Imperativen von Stabilität und Ordnung Widerstand leisten und dann die Folgen zu tragen haben.
Diese Dinge sollte die zweite Supermacht, die öffentliche Weltmeinung, zu begreifen sich alle Mühe geben, damit sie die ihr auferlegten Zügel abwerfen und die Ideale von Gerechtigkeit und Freiheit auf die Tagesordnung setzen kann. Denn leicht ist es, diese Begriffe im Munde zu führen, schwer jedoch, sie zu verteidigen und in die Tat umzusetzen.
II. Die imperiale Strategie
Im Herbst 2002 hatte der mächtigste Staat in der Geschichte ein Ziel ganz oben auf seine weltpolitische Tagesordnung gesetzt: Er wollte seine Hegemonie durch die Androhung oder Anwendung militärischer Gewalt, also jener Dimension, in der er die uneingeschränkte Vorherrschaft besitzt, aufrechterhalten. In der offiziellen Rhetorik der Nationalen Sicherheitsstrategie hieß das: »Unsere Streitkräfte werden stark genug sein, potentielle Gegner davon abzuhalten, eine militärische Aufrüstung zu betreiben, die darauf ausgerichtet ist, die Macht der Vereinigten Staaten zu übertreffen oder mit ihr gleichzuziehen.«1
Ein bekannter Spezialist für internationale Politik, John Ikenberry, beschreibt die Erklärung als »umfassende Strategie, die sich von ihrem Ansatz her dazu verpflichtet, eine unipolare Welt zu garantieren, in der die Vereinigten Staaten keinen gleichrangigen Konkurrenten haben«, so daß auch langfristig »kein Staat oder Staatenbündnis die USA als globale Führungs-, Schutz- und Erzwingungsmacht in Frage stellen kann«. Damit werden »internationale Normen der Selbstverteidigung, wie sie im Artikel 51 der UN-Charta festgelegt sind, nahezu bedeutungslos«. Darüber hinaus mißt die Doktrin der internationalen Rechtsprechung und ihren Institutionen nur noch »geringen Wert« bei. Ikenberry fährt fort: »Die neue imperiale Strategie läßt die USA als einen revisionistischen Staat erscheinen, der seine momentanen Vorteile in eine Weltordnung umzumünzen sucht, deren Strukturen von ihm bestimmt werden.« Dadurch aber werden andere Staaten veranlaßt, nach Wegen zu suchen, um »die US-amerikanische Macht zu unterminieren, einzudämmen und Vergeltungsschläge gegen sie auszuüben«. Die Strategie läuft darauf hinaus, »die Welt gefährlicher und in sich gespaltener zu machen, während die Vereinigten Staaten weniger Sicherheit genießen«. Viele außenpolitische Spezialisten teilen diese Ansicht.2
Die Hegemonie erzwingen
Mit der imperialen Strategie räumen die Vereinigten Staaten sich das Recht ein, nach Gutdünken einen »Präventivkrieg« zu führen: präventiv3, nicht etwa präemptiv? Ein präemptiver Krieg kann im Rahmen des internationalen Rechts geführt werden. Hätte die Regierung Reagan 1983 auf dem von ihr hervorgezauberten Militärstützpunkt auf Grenada tatsächlich russische Bomber entdeckt, die bereitstanden, um die USA zu bombardieren, wäre ein präemptiver Angriff, der die Flugzeuge und eventuell auch den Stützpunkt zerstören würde, mit der UN-Charta zu rechtfertigen gewesen. Ebenso hätten sich Kuba, Nicaragua und andere Länder, als sie von den USA angegriffen wurden, auf dieses Recht berufen können, wenngleich es aufgrund ihrer militärischen Schwäche verrückt gewesen wäre, präemptive Maßnahmen gegen die Supermacht zu ergreifen. Aber solche Rechtfertigungen gelten nicht für den Präventivkrieg, und schon gar nicht in der Bedeutung, die seine gegenwärtigen Befürworter dem Begriff verleihen, wenn sie darunter die Anwendung von Gewalt gegen eine angebliche oder erfundene Bedrohung verstehen, weil dafür selbst der Terminus »präventiv« noch zu milde ist.
Der Präventivkrieg fällt unter die Kategorie der Kriegsverbrechen. Wenn es sich tatsächlich um eine Idee handeln sollte, »deren Zeit gekommen ist«, hat die Welt berechtigten Anlaß zur Sorge.4
Als die Invasion des Irak begann, schrieb der prominente Historiker und Kennedy-Berater Arthur Schlesinger:
»Der Präsident betreibt eine Politik ›antizipatorischer Selbstverteidigung‹, die auf alarmierende Weise der Politik des imperialen Japan beim Angriff auf Pearl Harbor ähnelt, dessen Datum, wie ein früherer amerikanischer Präsident bemerkte, einen Tag der Schande bezeichnet. Franklin D. Roosevelt hatte recht, aber heute sind wir Amerikaner dabei, die Schande zu begehen.«5
Er fügte hinzu, daß »die weltweite Woge des Mitgefühls für die Vereinigten Staaten nach dem 9. September einer weltweiten Woge des Hasses auf amerikanischen Hochmut und Militarismus gewichen ist« und sogar in befreundeten Ländern Bush nach Ansicht der Bevölkerung »eine größere Bedrohung des Friedens darstellt als Saddam Hussein«.
Der Spezialist für internationales Recht, Richard Falk, findet die Folgerung »unausweichlich«, daß der Irakkrieg ein »Verbrechen jener Art war, für das deutsche Führer in Nürnberg angeklagt, verurteilt und bestraft wurden«.6
Einige Verteidiger der Strategie räumen ein, daß sie sich über internationales Recht hinwegsetzt, sehen darin aber kein Problem, weil dieses Recht nur »heiße Luft« sei. »Der großangelegte Versuch, die Herrschaft der Gewalt der Herrschaft des Gesetzes zu unterwerfen« gehöre, schreibt der Rechtswissenschaftler Michael Glennon, auf den Müllhaufen der Geschichte. Das ist die angemessene Einstellung für den einen Staat, der die neuen Nicht-Regeln seinen Zwecken dienstbar machen kann, weil er fast ebensoviel wie die gesamte übrige Welt in Gewaltmittel investiert und bei der Entwicklung von Vernichtungswaffen, ungeachtet aller globalen Opposition, neue und gefährliche Pfade beschreitet. Im übrigen wird der Beweis dafür, daß das internationale Rechtssystem »heiße Luft« sei, recht umstandslos geführt: Washington »machte deutlich, daß es alles tun werde, um seine Vorherrschaft aufrechtzuerhalten«, verkündete dann, es werde die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats zum Irak »ignorieren« und erklärte schließlich, es sei »nicht länger an die Regeln der UN-Charta zur Anwendung von Gewalt gebunden«. Quod erat demonstrandum. Dementsprechend seien die Regeln »zusammengebrochen« und »das ganze Gebäude eingestürzt«. Das ist, meint Glennon, eine gute Sache, weil die USA die Führungsmacht der »aufgeklärten Staaten« sind und daher jedem Versuch, »die von ihnen [den Vereinigten Staaten] ausgeübte Gewalt zu beschneiden, widerstehen müssen«.7
Die aufgeklärte Führungsmacht hat auch die Freiheit, die Regeln nach ihrem Willen zu verändern. Als die Militärkräfte bei der Besetzung des Irak die Massenvernichtungswaffen, deren bedrohliche Existenz doch den Einmarsch hatte rechtfertigen sollen, nicht fanden, sprach die US-Regierung auf einmal nicht mehr von »absoluter Gewißheit«, sondern versicherte nun, daß die Beschuldigungen »durch die Entdeckung von Ausrüstungsgegenständen, die zur Herstellung von Waffen geeignet sind, gerechtfertigt waren«. Hochrangige Regierungsbeamte schlugen vor, den »umstrittenen Begriff ›Präventivkrieg‹«, der bislang Washington dazu berechtigte, Militäraktionen »gegen ein Land, das tödliche Waffen in großer Quantität besitzt« zu unternehmen, dahingehend zu »verfeinern«, »daß die Regierung gegen ein feindliches Regime auch dann vorgehen kann, wenn dieses nur die Absicht und Fähigkeit hat«, Massenvernichtungswaffen zu entwickeln.8
Allerdings hat fast jedes Land die Fähigkeit, solche Waffen zu entwickeln und herzustellen, und die Absicht liegt im Auge des Betrachters. Mithin garantiert diese verfeinerte Version Washington das Recht auf willkürliche Aggression. Nachdem das ursprüngliche Argument für die Invasion des Irak in sich zusammengefallen war, senkte man also einfach die Hemmschwelle für die Anwendung von Gewalt.
Die imperiale Strategie verfolgt das Ziel, alles zu verhindern, was »die Macht, die Position und das Prestige der Vereinigten Staaten« in Frage stellen könnte. Das sind nicht die Worte von Dick Cheyney oder Donald Rumsfeld oder einem der anderen etatistischen Reaktionäre, die im September 2002 die Nationale Sicherheitsstrategie formulierten. Vielmehr stammen sie von 1963 und wurden von dem geachteten liberalen Elder Statesman Dean Acheson geäußert, der damit die amerikanischen Aktionen gegen Kuba rechtfertigte. Er wußte natürlich, daß Washingtons terroristischer Feldzug, der auf der Insel einen »Regimewechsel« bewirken sollte, nur einige Monate zuvor dazu beigetragen hatte, die Welt an den Rand eines Atomkriegs zu bringen. Nachdem die Raketenkrise behoben worden war, wurde der Feldzug fortgesetzt, als sei nichts geschehen, und Acheson teilte der American Society of International Law mit, daß kein »Rechtsproblem« entstehe, wenn die USA auf eine Bedrohung ihrer Macht, ihrer Position, ihres Prestiges reagierten.
Achesons Doktrin war auch maßgebend für die konservative Regierung Reagan, als der Angriff auf Nicaragua vor dem Weltgerichtshof verhandelt wurde. Dessen Aufforderung, die verbrecherischen Aktionen zu beenden, wurde ignoriert, Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, die alle Staaten aufriefen, das internationale Recht zu respektieren, wurden mit einem Veto belegt. Abraham Sofaer, Rechtsberater des Außenministeriums, erklärte, daß die meisten Staaten »unsere Ansicht nicht teilen«, wobei »diese Mehrheit bei wichtigen internationalen Fragen oftmals in Opposition zu den Vereinigten Staaten steht«. Folglich müssen wir uns die Entscheidung darüber, welche Angelegenheiten »unter die nationale Rechtsprechung der Vereinigten Staaten fallen« vorbehalten – und dazu gehörten in diesem Fall eben auch Aktionen, die der Weltgerichtshof als »unrechtmäßige Anwendung von Gewalt«, d. h. letztlich als internationalen Terrorismus, gegen Nicaragua verurteilt hatte.9
Besonders die Regierungen Reagan und Bush sr. zeigten eine flagrante Verachtung für das internationale Recht und seine Institutionen, doch ihre Nachfolger machten ebenfalls deutlich, daß sich die USA vorbehielten, »wenn notwendig, unilateral zu handeln«, wozu auch der »unilaterale Einsatz militärischer Macht« gehörte, mit dem vitale Interessen wie der »ungehinderte Zugang zu Schlüsselmärkten, Energievorräten und strategischen Ressourcen« verteidigt werden sollte.10 Neu war diese Haltung allerdings nicht.
Die Fundamente der imperialen Strategie vom September 2002 wurden bereits in der Anfangsphase des Zweiten Weltkriegs gelegt. Noch vor dem Kriegseintritt der USA gingen hochrangige Strategen davon aus, daß die Vereinigten Staaten in der Nachkriegsära eine »unhinterfragbare Machtposition« einnehmen und »jedwede Ausübung von Souveränität« durch Staaten, die Washingtons globale Pläne gefährden könnten, beschränken müßten. Um diese Ziele zu erreichen, war es unbedingt notwendig, »so schnell wie möglich das Programm einer vollständigen Wiederbewaffnung in die Tat umzusetzen«. Hochrüstung war damals wie heute die zentrale Komponente »einer Politik, die den USA gleichermaßen die ökonomische wie militärische Vorherrschaft sichern wird«. Zunächst richteten sich diese Ambitionen noch auf die »nicht-deutsche Welt«, die unter der Suprematie der USA alsGrand Area entstehen sollte. Zu diesem geopolitischen Großraum gehörten die westliche Hemisphäre, das ehemalige britische Empire und der Ferne Osten. Als die Niederlage Deutschlands sich abzuzeichnen begann, wurden diese Pläne auch auf Eurasien ausgedehnt.11
Das sind nur einige Präzedenzfälle, die indes das enge Spektrum politischer Planungsstrategien verdeutlichen. Sie werden im Rahmen eines institutionellen Machtgefüges entwickelt, das relativ stabil bleibt. Auch die ökonomischen Entscheidungsbefugnisse sind hoch zentralisiert, und John Dewey dürfte kaum übertrieben haben, als er die Politik den »Schatten, den das Big Business auf die Gesellschaft wirft«, nannte. Es ist nur natürlich, daß Washington die Errichtung eines globalen Systems intendiert, das der amerikanischen Wirtschaft offensteht und sich politisch kontrollieren läßt, ohne daß Konkurrenten oder andere Bedrohungen zu befürchten wären.12 Dazu gehört auch die wachsame Abwehr aller Bestrebungen zu einer unabhängigen Entwicklung, die, wie Strategen es ausdrückten, zum »Virus« werden könnte, der »andere infiziert«. Der Kampf gegen diese Bestrebungen bildet eines der Leitmotive der Nachkriegsgeschichte und wurde, auch von der zweiten Supermacht, oft unter dem Vorwand des Kalten Kriegs geführt.
Die wesentlichen Aufgaben des US-amerikanischen globalpolitischen Managements sind seit 1945 dieselben geblieben: Im von den USA geschaffenen »weltweiten Ordnungsrahmen« müssen andere Zentren globaler Macht an der Entfaltung gehindert werden; zugleich gilt es, die Kontrolle über die Energiereserven zu bewahren, unannehmbare Formen eines unabhängigen Nationalismus zu bekämpfen und im eigenen Land den inneren Feind namens »Krise der Demokratie« zu bewältigen. Vor allem in Perioden tiefgreifenden Wandels können diese Aufgaben in unterschiedlicher Gestalt auftreten: Ab 1970 ging es um die Entwicklungen in der Weltwirtschaftsordnung; zwanzig Jahre später um die Rückstufung des ehemaligen Hauptfeindes auf einen quasi-kolonialen Status; kurz darauf um jenen internationalen Terrorismus, der diesmal die Vereinigten Staaten selbst bedrohte, was schockhaft am 11. September 2001 erfahren werden mußte. Immer wieder wurden die Taktiken, mit denen diese Entwicklungen bewältigt werden konnten, verändert und neue Gewaltmittel ersonnen, die unsere gefährdete Spezies näher an den Rand der Katastrophe treiben.
Allerdings löste die Verkündung der imperialen Strategie im September 2002 berechtigterweise weltweit Alarmsignale aus. Acheson und Sofaer hatten politische Leitlinienbeschrieben, und dies nur für Eingeweihte. Ihre Standpunkte waren bestenfalls Spezialisten oder Lesern kritischer Literatur bekannt. Andere Fälle können als lebenskluge Wiederholung der Maxime des Thukydides betrachtet werden, der zufolge »große Nationen tun, was ihnen beliebt, während kleine Nationen die Kröten schlucken, die sie schlucken müssen«. Im Gegensatz dazuverkünden Cheyney, Rumsfeld und Konsorten ganz offiziell eine sogar noch extremere, auf permanente globale Hegemonie ausgerichtete Politik, die, wenn notwendig, durch Gewalt abgesichert wird. Sie wollten gehört werden und zeigten der Welt sehr schnell, daß sie, was sie sagen, auch meinen. Das ist ein bedeutsamer Unterschied.
Neue Normen des internationalen Rechts
Die Verkündung der imperialen Strategie galt mit Recht als unheildrohende Veränderung in den internationalen Beziehungen. Doch darf eine Großmacht die Neuausrichtung ihrer offiziellen Politik nicht einfach nur verbal deklarieren, sondern muß sie durch beispielhafte Aktionen als neue Norm des internationalen Rechts geltend machen. Danach können hervorragende Spezialisten und medienwirksame Intellektuelle nüchtern erklären, Recht und Gesetz seien flexible Instrumente, so daß die neue Norm als Anleitung zum Handeln gelten dürfe. Dementsprechend wurden im September 2002 die Kriegstrommeln gerührt und die Bevölkerung für die Invasion des Irak in den fälligen Begeisterungstaumel versetzt. Zur gleichen Zeit wurde die Kampagne für die Kongreßwahlen eröffnet. Diese Konstellation, auf die bereits hingewiesen wurde, sollte nicht in Vergessenheit geraten.
Das Angriffsziel eines Präventivkriegs à la USA muß bestimmte Eigenschaften aufweisen:
1. Es muß praktisch verteidigungsunfähig sein.
2. Es muß wichtig genug sein, damit der Aufwand sich lohnt.
3. Es muß sich als das Böse schlechthin und unmittelbare Gefahr für unser Überleben darstellen lassen.
Der Irak erfüllte alle drei Punkte. Die ersten beiden Bedingungen waren offensichtlich, die dritte ließ sich leicht herstellen. Man mußte nur die leidenschaftlichen Beschwörungen von Bush und Blair oft genug wiederholen: Der irakische Diktator »legt sich die gefährlichsten Waffen der Welt zu, um herrschen, einschüchtern oder angreifen zu können«, und er hat diese Waffen »bereits gegen ganze Dörfer eingesetzt, wobei Tausende seiner eigenen Bürger erblindeten, entstellt wurden oder zu Tode kamen … Wenn das nicht das Böse ist, dann hat das Wort keine Bedeutung.«13
Die beredte Anklage von Präsident Bush, die er im Januar 2003 in seiner Rede zur Lage der Nation formulierte, klingt zweifellos wahrhaftig. Und sicherlich sollte nicht ungestraft davonkommen, wer zur Steigerung des Bösen beiträgt – und dazu gehören auch der beredsame Redner und seine Spießgesellen, die den schlechthin Bösen und seine Verbrechen lange Zeit offenen Auges unterstützten. Beeindruckend, wie mühelos George W. Bush die Untaten des Monsters aufzählt, ohne zu erwähnen, daß sie mit unserer fortgesetzten Hilfe verübt werden konnten, weil wir uns nicht darum scherten. Allerdings fiel Saddam Hussein sofort aus der Gnade, als er 1990 sein erstes wirkliches Verbrechen beging, indem er Befehlen nicht gehorchte (oder sie vielleicht mißverstand) und in Kuweit einmarschierte. Die Strafe folgte auf dem Fuß – für seine Untertanen. Der Tyrann aber kam ungeschoren davon und wurde durch die von seinen Ex-Freunden verhängten Sanktionen noch gestärkt.
Als im September 2002 die Zeit näherrückte, um der Welt die neue Form des Präventivkriegs zu demonstrieren, sprach Bushs Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice mit warnender Stimme von dem möglichen nächsten Beweis für Husseins Absichten – einem Atompilz über New York. Die Nachbarländer des Irak wiesen diese Behauptungen ebenso zurück wie der israelische Geheimdienst, und später fanden die UN-Inspektoren auch nicht den Hauch eines Beweises, aber Washington beharrte auf der Existenz von Massenvernichtungswaffen, obwohl der Propagandaoffensive von Anfang an die Glaubwürdigkeit fehlte. »›Diese Regierung ist zu jeder Lüge fähig … um ihre Kriegsziele im Irak voranzutreiben‹, ließ ein Regierungsbeamter mit zwanzigjähriger Geheimdiensterfahrung durchblicken.« Die Regierung sei gegen Inspektionen, weil sie fürchte, daß nicht viel gefunden werde. Die Behauptungen über irakische Drohpotentiale, fügten zwei führende Politikwissenschaftler hinzu, sollten »als durchsichtige Versuche gewertet werden, den Amerikanern Angst einzujagen, damit sie den Krieg unterstützen«. Das ist die übliche Verfahrensweise. Washington weigert sich immer noch, Beweise für die Behauptung von 1990 beizubringen, der Irak habe an der Grenze zu Saudi-Arabien einen gewaltigen Militäraufbau betrieben, womit der erste Golfkrieg zunächst gerechtfertigt wurde. Die einzige Zeitung, die Recherchen in dieser Richtung anstellte, fand keine Anzeichen für einen solchen Aufbau, doch blieben ihre Enthüllungen wirkungslos.14
Indes setzten Bush und seine Helfershelfer, Beweise hin oder her, ihre Warnrufe über die Bedrohung, die der Irak für die USA und seine Nachbarn darstelle, munter fort und deuteten an, Saddam Hussein habe Verbindungen zu internationalen Terroristen, ja, sei gar in die Angriffe vom 11. September verwickelt. Die von Regierung und Medien unisono vorgetragenen Propagandalügen blieben nicht ohne Erfolg: Schon nach wenigen Wochen glaubten knapp 60 Prozent der Amerikaner, Hussein sei »eine unmittelbare Bedrohung für die Vereinigten Staaten« und müsse aus Gründen der Selbstverteidigung eilends beseitigt werden. Im März war die US-Bevölkerung fast zur Hälfte der Ansicht, der Diktator sei in die Anschläge vom 9. September verstrickt und unter den Flugzeugentführern hätten sich Irakis befunden. Konsequenterweise stieg damit auch die Akzeptanz eines kriegerischen Angriffs.15
Im Ausland, so berichtete die internationale Presse, habe die US-Diplomatie »kläglich versagt«, jedoch im eigenen Land triumphiert, »weil es ihr gelungen war, den Irakkrieg mit dem Trauma vom 11. September in Verbindung zu bringen … Fast 90 Prozent der Amerikaner glauben, daß Saddam Husseins Regime Terroristen stützt und schützt, die weitere Anschläge gegen die Vereinigten Staaten vorbereiten.« Der politische Kommentator Anatol Lieven meinte, die meisten Amerikaner hätten sich »von einem Propagandaprogramm täuschen lassen, dessen systematische Verlogenheit in Demokratien zu Friedenszeiten kaum eine Parallele findet«.16 Der Propagandafeldzug verschaffte den Republikanern zudem eine knappe Mehrheit im Kongreß, weil die Wähler ihre Alltagssorgen hintanstellten und sich aus Furcht vor dem dämonischen Feind unter dem Schirm der Macht zusammenkauerten.
Auch der Kongreß erlag dem Zauber der Regierungsdiplomatie. Im Oktober 2002 gab er dem Präsidenten grünes Licht für den Krieg, »um die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten gegen die fortwährende Bedrohung, die der Irak darstellt, zu verteidigen«. Das ist ein vertrautes Drehbuch: 1985 rief Ronald Reagan den nationalen Notstand aus, der dann jährlich erneuert wurde, weil »die Politik und die Handlungen der Regierung von Nicaragua für die nationale Sicherheit und die Außenpolitik der Vereinigten Staaten eine unübliche und außergewöhnliche Bedrohung darstellen«. Siebzehn Jahre später mußten die Amerikaner erneut erzittern, diesmal aus Furcht vor dem Irak.
Einen weiteren Heimerfolg feierte die US-Diplomatie, als der Präsident am 1. Mai 2003 auf dem Deck des Flugzeugträgers Abraham Lincoln »einem sechswöchigen Krieg ein kraftvolles Finale à la Reagan verlieh«. Ohne skeptische Kommentare aus der Heimat befürchten zu müssen, konnte er erklären, daß er »im Krieg gegen den Terror einen Sieg« errungen habe, indem »ein Verbündeter von al-Qaida« beseitigt worden sei.17 Es spielt dabei keine Rolle, daß die angebliche Verbindung zwischen Saddam Hussein und Osama bin Laden, der in Wirklichkeit ein erbitterter Feind des Diktators ist, aller Beweise entbehrte und von kompetenten Beobachtern für unwahrscheinlich gehalten wurde. Ebenso unwichtig ist die bislang einzig bekannte Verbindung zwischen der Invasion des Irak und dem Terrorismus, die allem Anschein nach darauf hinausläuft, die Reihen von al-Qaida massiv zu stärken, so daß die Invasion eher als »großer Rückschlag im ›Kampf gegen den Terror‹« zu werten wäre.18
Aber der Einfluß der Propaganda wirkte auch nach dem Krieg weiter. Obwohl trotz intensivster Anstrengungen keine Massenvernichtungswaffen gefunden werden konnten, glaubte ein Drittel der US-Bevölkerung, die Streitkräfte hätten solche Waffen entdeckt, und mehr als zwanzig Prozent meinten, der Irak habe sie während des Kriegs eingesetzt.19 Das ist eine vielleichtverständliche Reaktion von Menschen, die sich nach Jahren umfassender Propaganda mittlerweile vor allem und jedem fürchten.
Die Redewendung vom »kraftvollen Finale à la Reagan« bezieht sich vermutlich auf dessen stolze Verkündung, daß die USA wieder »groß dastehen«, nachdem sie die schreckliche Bedrohung, die von Grenada ausging, niedergerungen hatten. Scharfsinnige Kommentatoren fügten hinzu, daß Bushs sorgfältig inszenierter Auftritt auf dem Flugzeugträger »den Beginn seiner Kampagne für die Wiederwahl 2004« markierte. Diese Kampagne, so hofft man im Weißen Haus, »wird sich so ausführlich wie möglich um Themen der nationalen Sicherheit drehen und dabei hauptsächlich die Beseitigung des irakischen Führers Saddam Hussein in den Vordergrund rücken«. Um die Botschaft noch deutlicher zu vermitteln, wurde der Beginn der offiziellen Bush-Kampagne auf Mitte September 2004 verschoben, damit der in New York stattfindenden Konvent der Republikaner jenen Kriegsherrn, der als einziger in der Lage ist, die Amerikaner vor einem neuen 11. September zu bewahren, gebührend feiern kann. Die Wahlkampagne werde sich, so erklärte der Chefstratege der Republikaner, Karl Rove, »auf die Schlacht gegen den Irak« konzentrieren, nicht aber auf den Krieg selbst. Die Invasion des Irak war lediglich Bestandteil eines »sehr viel längeren und umfassenderen Kriegs gegen den Terrorismus, der sich, wie Rove bemerkt, mit etwas Glück auf jeden Fall bis zum Wahltag 2004 erstrecken wird«.20 Und sicherlich darüber hinaus.
Im September 2002 standen alle drei Faktoren, die man zur Inauguration der neuen internationalen Rechtsnorm benötigte, Gewehr bei Fuß: Der Irak war militärisch schwach, strategisch wichtig und eine unmittelbare Bedrohung für unsere Existenz. Natürlich gab es immer noch die Möglichkeit, daß etwas schiefgehen könnte, aber das war, zumindest für die Invasoren, wenig wahrscheinlich. Das außergewöhnliche Ungleichgewicht der Kräfte garantierte einen überlegenen Sieg, und eventuelle humanitäre Kollateralschäden konnten Saddam Hussein angelastet werden. Waren sie allzu unerfreulich, würde man sie nicht weiter untersuchen und, wie in der Vergangenheit, die Spuren tilgen. Sieger machen sich nicht die Mühe, ihre eigenen Verbrechen zu erforschen, so daß die Nachwelt nur wenig von ihnen weiß; ein Prinzip, das fast ausnahmslos gültig ist. Bis heute wissen wir nicht, wieviele Millionen Opfer die US-Kriege in Indochina gekostet haben. Ahnlich verfuhren die Sieger mit den Kriegsverbrecherprozessen nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Definition vonKriegsverbrechen undVerbrechen gegen die Menschlichkeit folgte rein operationalen Erwägungen: Um Verbrechen handelte es sich bei Aktionen des Feindes, nicht der Alliierten. Folglich war die Bombardierung städtischer Wohngebiete kein Verbrechen. Auch bei weiteren Tribunalen fand dieses Prinzip Anwendung, jedoch nur gegenüber besiegten Feinden oder anderen Gegnern, die man gefahrlos mit Füßen treten kann.
Nachdem die Invasion des Irak zum Erfolg erklärt worden war, wurde öffentlich anerkannt, daß ein Motiv des Kriegs darin bestanden hatte, die imperiale Strategie als neue Norm durchzusetzen: »Die Veröffentlichung der Nationalen Sicherheitsstrategie war das Signal, daß der Irak dafür der erste, nicht jedoch der letzte Testfall sein würde«, hieß es in derNew York Times. »Der Irak war die Petrischale, in der dieses Experiment einer präemptiven[preemptive] Politik heranwuchs.« Ein hochrangiger Regierungsbeamter fügte hinzu: »Wir werden nicht zögern, allein zu handeln, wenn es notwendig ist, um unser Recht auf Selbstverteidigung durch präemptives Handeln auszuüben.« Was jetzt, da die Norm durchgesetzt wurde, natürlich möglich ist. »Das Beispielhafte dieses Vorgehens [gegen den Irak] wird von der übrigen Welt durchaus erkannt«, bemerkte der Nahost-Historiker Roger Owen von der Harvard-Universität. Völker und Regierungen werden ihre Sicht auf die Welt ändern und »von einer Perspektive, die sich auf die Vereinten Nationen und das internationale Recht beruft, zu einer anderen übergehen müssen, die auf der Identifikation« mit Washingtons Tagesordnung beruht. Die Macht läßt ihre Muskeln spielen, um den Staaten der Welt zu zeigen, daß sie »ernsthafte Erwägungen nationalen Eigeninteresses« hintanzustellen und die »Zielvorstellungen Amerikas« in den Vordergrund zu rücken haben.21
Möglicherweise hat das Bedürfnis, Stärke zu demonstrieren, um vor aller Welt die »Glaubwürdigkeit zu bewahren«, bei der Entscheidung für den Krieg den Ausschlag gegeben. In einem Rückblick lokalisierte dieFinancial Times den endgültigen Zeitpunkt auf Mitte Dezember 2002, nachdem der Irak das Dossier über die in seinem Besitz befindlichen Waffen den Vereinten Nationen übergeben hatte. »›Im Weißen Haus hatte man das Gefühl, verspottet worden zu sein‹, bemerkt eine Person, die in jenen Tagen nach dem 8. Dezember, dem Tag, an dem das Dossier übermittelt worden war, eng mit dem Nationalen Sicherheitsrat zusammengearbeitet hatte. ›Ein Operettentyrann machte sich über den Präsidenten lustig. Das rief im Weißen Haus eine Art von Zorn hervor. Danach gab es keine Aussichten mehr für eine diplomatische Lösung.«‹22 Es folgten nur noch diplomatische Vernebelungsaktionen, während die Truppen in Marsch gesetzt wurden.
Nachdem die imperiale Strategie nicht nur offiziell verkündet, sondern auch in die Tat umgesetzt worden ist, kann die neue Norm des Präventivkriegs ihren Platz im Kanon finden, und die USA sind in der Lage, sich schwierigeren Fällen zuzuwenden. Möglichkeiten gibt es genug: den Iran, Syrien, die Andenregion und weitere Gebiete. Was geschehen wird, hängt großenteils davon ab, ob die »zweite Supermacht« eingeschüchtert und in Schranken gehalten werden kann.
Es ist interessant, sich die Bedingungen, unter denen neue Normen implementiert werden, näher anzusehen. Daß nur die wirtschaftlich und militärisch Mächtigen dazu berechtigt sind, verdeutlicht die weithin gefeierte »normative Revolution«, mit der das 20. Jahrhundert zu Ende ging. Nach einigen Fehlschlägen wurden die neunziger Jahre zum »Jahrzehnt der humanitären Intervention«. Das neue Recht, aus »humanitären Gründen« zu intervenieren, verdankte sich dem Mut und Altruismus der USA und ihrer Verbündeten, wobei vor allem das Kosovo und Ost-Timor, die zwei Juwelen im Diadem, eine herausragende Rolle spielen. Vor allem die Bombardierung des Kosovo gilt bei angesehenen Experten als bahnbrechend, weil hier von der NATO zum ersten Mal Gewaltaktionen ohne die Autorisierung des UN-Sicherheitsrats durchgeführt wurden.
Man könnte die Frage stellen, warum die neunziger Jahre als »Jahrzehnt der humanitären Intervention« galten, nicht aber die siebziger? Seit dem Zweiten Weltkrieg hat es zwei herausragende Beispiele für Gewaltanwendung gegeben, die schrecklichen Verbrechen ein Ende bereiteten und offensichtlich der Selbstverteidigung dienten: Indiens Invasion in Ost-Pakistan 1971, und Vietnams Invasion von Kambodscha im Dezember 1978, die Pol Pots Greueltaten stoppte. Nichts auch nur annähernd Vergleichbares geschah unter westlicher Ägide in den neunziger Jahren. Man muß schon die Konventionen kennen, um zu verstehen, warum das letzte Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts dennoch den Vorzug erhielt.
Allerdings sind die Gründe nicht schwer zu durchschauen: Die wirklich humanitären Interventionen – die der siebziger Jahre – wurden von den falschen Staaten durchgeführt. Zudem waren die USA in beiden Fällen strikt gegen diese Aktionen und zögerten nicht, die Übeltäter abzustrafen, worunter insbesondere Vietnam zu leiden hatte, das von den USA unterstützte Ubergriffe der Chinesen und danach noch härtere Sanktionen erdulden mußte, während die Vereinigten Staaten und Großbritannien den vertriebenen Roten Khmer ihre Hilfe anboten. Mithin gab es in den siebziger Jahren keine humanitären Interventionen und keine neuen Normen.
Die wesentliche Einsicht in diese Dinge wurde bereits 1949 in einer einstimmig gefaßten Entschließung des Internationalen Gerichtshofs formuliert:
»Der Gerichtshof kann das angebliche Recht auf Intervention lediglich als die Manifestation einer Politik der Gewalt betrachten, die in der Vergangenheit zu höchst mißbräuchlicher Anwendung geführt hat und der, aller Mängel in den internationalen Beziehungen ungeachtet, kein Platz im internationalen Recht eingeräumt werden kann … Es liegt in der Natur der Dinge, daß eine Intervention nur den mächtigsten Staaten vorbehalten bliebe und leicht zu einer Pervertierung der Durchsetzung des Gerechtigkeitsprinzips selbst führen könnte.«23
Während man sich im Westen dazu beglückwünschte, die neue Norm der humanitären Intervention durchgesetzt zu haben, reagierte der Rest der Welt alles andere als begeistert. So gab es auf Tony Blairs Wiederholung der offiziellen Begründung für die Bombardierung Serbiens sehr erhellende Reaktionen. Blair hatte verkündet, daß ein Gewaltverzicht »der Glaubwürdigkeit der NATO einen entscheidenden Schlag versetzt hätte« und »die Welt im Endeffekt weniger sicher gewesen wäre«. Viele, die ihre eigenen Erfahrungen mit amerikanischer und britischer Politik gemacht hatten, zeigten sich davon wenig beeindruckt. Nelson Mandela z. B. verurteilte Großbritannien und die USA wegen ihrer Angriffe auf den Irak 1998 und der Intervention in Serbien und meinte, sie hätten »das internationale Chaos verstärkt … indem sie andere Nationen ignorierten und den ›Weltpolizisten‹ spielten«. Auch in der größten Demokratie der Welt, in der die Erinnerung an die britische Kolonialherrschaft noch lebendig ist, reagierten Presse und Regierung auf Clintons und Blairs Einlassungen mit heftiger Kritik, die jedoch im Westen nicht zur Kenntnis genommen wurde. Und sogar in Israel, dem Satellitenstaat par excellence, bezeichneten führende Experten aus Militär und Politik das Vorgehen der NATO als Rückkehr zur traditionellen »Kanonenboot-Diplomatie«, die sich unter dem bekannten »Mantel moralischer Rechtschaffenheit« verberge, tatsächlich jedoch eine »Gefahr für die Welt« darstelle.24
Man hätte auch auf die Stimmen der blockfreien Länder hören können, deren Regierungen auf dem Südgipfel im April 2000 etwa 80 Prozent der Weltbevölkerung vertraten. Das Treffen war das wichtigste in ihrer Geschichte, weil es zum ersten Mal auf höchster Ebene stattfand. Die Teilnehmer leisteten nicht nur eine detaillierte, kritische Analyse jener neoliberalen sozioökonomischen Programme, die von westlichen Ideologen »Globalisierung« genannt werden, sondern verwarfen auch »das sogenannte Recht auf humanitäre Intervention«. Diese Haltung wurde auf dem Gipfel in Malaysia drei Jahre später mit den gleichen Worten bekräftigt.25 Vielleicht wissen diese Länder zuviel von der dunklen Seite der Geschichte, um sich mit exaltierter Rhetorik über »humanitäre Intervention« abspeisen zu lassen.
Im Prinzip besitzen, wie gesagt, nur die mächtigsten Staaten die Autorität, Normen angemessenen politischen Verhaltens durchzusetzen, die dann auch nur für sie gelten. In Ausnahmefällen jedoch kann diese Autorität auf verläßliche Satellitenstaaten übertragen werden. Dergestalt dürfen Israels Verbrechen zum Normen- und Normalfall werden, wie etwa das regelmäßige »zielgerichtete Töten« von Verdächtigen, das für gewöhnlich unter die Kategorie »terroristische Greueltaten« fallen würde. Im Mai 2003 stellten zwei israelische Anwälte und Menschenrechtsaktivisten eine detaillierte Liste »aller Liquidierungen und Attentatsversuche« vor, die israelische Sicherheitskräfte während der Al-Aqsa-Intifada vom November 2000 bis zum April 2003 verübt hatten. Aufgrund der Auswertung offizieller und halboffizieller Dokumente fanden sie heraus, daß bei »nicht weniger als 175 Attentatsversuchen« 235 Personen ums Leben kamen, von denen 156 verdächtigt wurden, Verbrechen begangen zu haben. »Es schmerzt uns sehr, dies zu sagen«, bemerkten die Anwälte, aber »die weitverbreitete Politik zielgerichteter Liquidierungen läuft auf ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit hinaus.«26
Das ist natürlich ein sehr einseitiges Urteil. Liquidierung ist nur dann ein Verbrechen, wenn es von den falschen Leuten verübt wird, anderenfalls aber ein gerechtfertigter, wenngleich bedauerlicher Akt der Selbstverteidigung, der sogar für den ›»Partner‹ genannten Boß«, der das Ganze genehmigt, normenbildend wirken kann.27 Der nämlich machte sich das israelische Beispiel zunutze, als er mittels einer Rakete im Jemen eine verdächtige Person tötete, wobei fünf weitere, die zufällig in der Nähe waren, ebenfalls ums Leben kamen. Der Schlag war zeitlich so berechnet, daß er »als Oktober-Überraschung … für die Kongreßwahlen« diente und einen »Vorgeschmack auf kommende Ereignisse« bot.28
Ganz andere Maßstäbe für Normen hatte Israel im Juni 1981 mit der Bombardierung des irakischen Atomreaktors in Osirak gesetzt. Zunächst wurde der Angriff als Verletzung internationalen Rechts kritisiert; eine Bewertung, die sich änderte, als Saddam Hussein im August 1990 vom Freund zum Feind mutiert war. Nunmehr war die Aktion gegen den Reaktor eine aller Ehren werte Tat, weil sie Husseins Programm zur Herstellung von Atomwaffen erheblich beeinträchtigt hatte.
Die Wirklichkeit sah leider etwas anders aus. Kurz nach der Bombardierung inspizierte ein prominenter Atomphysiker, Richard Wilson, der damals die Abteilung für Physik an der Harvard-Universität leitete, den Schauplatz. Er kam zu dem Schluß, daß der Reaktor für die Produktion von Plutonium nicht geeignet gewesen sei (wobei wir nur am Rande darauf hinweisen, daß Israels Atomreaktor in Dimona bereits Material für die Herstellung von 700 nuklearen Waffen produziert haben soll). Wilsons Auffassung wurde von dem irakischen Atomphysiker Imad Khadduri bekräftigt. Khadduri war am Reaktor vor der Bombardierung mit Experimenten beschäftigt gewesen und später aus dem Irak geflohen. Er merkte an, daß der Irak nach der Zerstörung »den Entschluß faßte, die atomare Bewaffnung mit aller Macht voranzutreiben«. Die israelische Aktion habe, bestätigt Kenneth Waltz, »die Araber noch stärker dazu motiviert, Nuklearwaffen zu produzieren« und dem Irak »die Unterstützung anderer arabischer Staaten zur Fortsetzung seines Atomprogramms verschafft«.29
Wie immer die Tatsachen beschaffen sein mögen, ist die von Israel 1981 etablierte Norm dank der irakischen Invasion in Kuweit jetzt zum festen Bestandteil politischen Handelns geworden. Und selbst wenn die Bombardierung die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen beschleunigt haben sollte, ziehen wir daraus noch lange keine Schlüsse über die Folgen einer Gewaltanwendung, mit der altmodische Konzeptionen des internationalen Rechts verletzt werden, weil diese Konzeptionen jetzt der Verachtung durch die Supermacht anheimgefallen sind. Zukünftig werden die USA, Israel und vielleicht noch ein paar andere Favoriten je nach Gusto auf diese Norm zurückgreifen können.
Die Herrschaft des Gesetzes
Die imperiale Strategie erstreckt sich auch auf die Gesetzgebung in den Vereinigten Staaten, wo, wie in vielen anderen Ländern, die Regierung die Gelegenheit nutzte, im Gefolge der Terrorangriffe vom 11. September die Bevölkerung zu disziplinieren. Das Justizministerium behauptet, es sei rechtens, Personen – auch US-Bürger – zu »feindlichen Kombattanten« oder »des Terrorismus Verdächtigen« zu erklären und sie ohne konkrete Beschuldigung und ohne ihnen den Kontakt zu einem Anwalt oder zur Familie zu gestatten, so lange ins Gefängnis zu sperren, bis das Weiße Haus den »Krieg gegen den Terror« für erfolgreich beendet erklärt, also bis zum St. Nimmerleinstag. Die Gerichte haben Justizminister Ashcroft teilweise recht gegeben und verfügt, »daß ein Präsident in Kriegszeiten einen Bürger der Vereinigten Staaten, der auf dem Schlachtfeld als feindlicher Kombattant gefangengenommen wird, auf unbestimmte Zeit gefangenhalten und ihm den Kontakt mit einem Anwalt verweigern kann«.30
Gegen die Behandlung von »feindlichen Kombattanten« im US-Gefangenenlager Guantánamo auf Kuba haben Menschenrechts- und andere Organisationen protestiert, und sogar der Generalinspekteur des Justizministeriums sah sich zu einem höchst kritischen Bericht veranlaßt, den sein Dienstherr jedoch unbeachtet ließ. Nach der Eroberung des Irak stellte sich schon bald heraus, daß mit irakischen Gefangenen ähnlich umgegangen wurde: Knebelungen, Fesselungen, Augenbinden und Schläge waren an der Tagesordnung. Das Rote Kreuz wandte sich empört gegen die Weigerung des US-Kommandos, Vertretern dieser Organisation Zutritt zu gefangenen Zivilisten und – in Verletzung der Genfer Konvention – zu Kriegsgefangenen zu gewähren.31 Überdies ist höchst unklar, wer als »feindlicher Kombattant« eingestuft werden kann – im Augenblick gehört dazu jeder, den die USA angreifen, auch wenn es, wie Washington einräumt, für seinen Status keine glaubwürdigen Beweise gibt.32