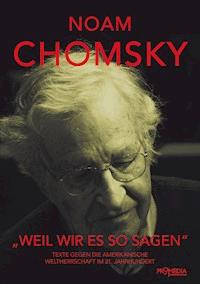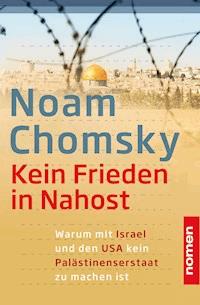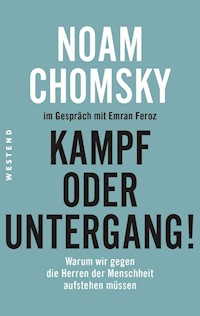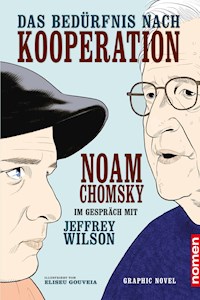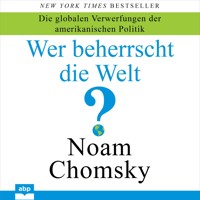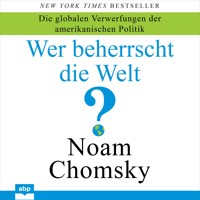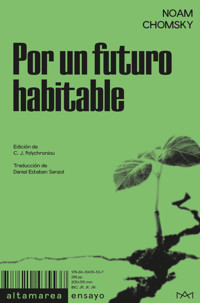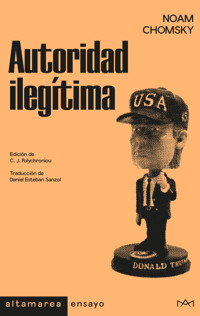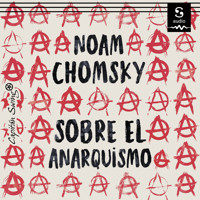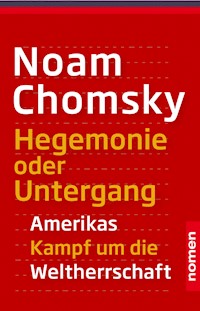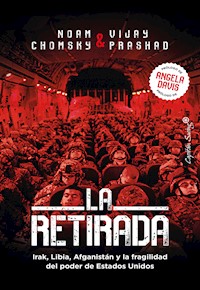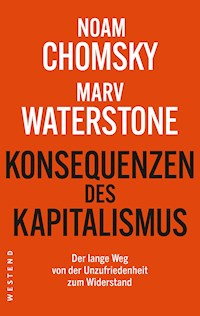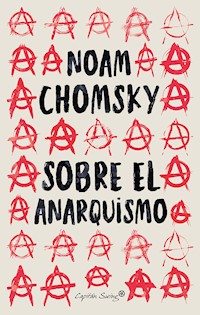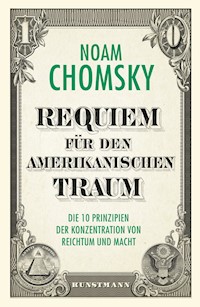
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Noam Chomsky ist der einflussreichste Intellektuelle der Vereinigten Staaten und in seinem neuen Buch befasst er sich erstmals umfassend mit dem großen Thema unserer Zeit: der sozialen Ungleichheit. Anhand von zehn Prinzipien zur Konzentration von Reichtum und Macht und mithilfe zahlreicher historischer Texte der amerikanischen Geschichte erklärt Noam Chomsky, wie der amerikanische Traum – dass jeder es mit harter Arbeit zu etwas bringen kann – in den letzten Jahrzehnten beerdigt und ein System nie da gewesener sozialer Ungleichheit errichtet wurde, von dem letztlich nur einige wenige profitieren. Requiem für den amerikanischen Traum macht die Breite und Tiefe von Noam Chomskys Denken zugänglich wie kein anderes seiner Bücher und verdeutlicht seine politischen Ideen mit einer beispiellosen Direktheit. Die Pflichtlektüre für alle, die noch Hoffnung auf eine gemeinsame, demokratische Gestaltung unserer Zukunft haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Zum Buch
Luzid, direkt, stringent: Noam Chomsky über das Ende des amerikanischen Traums.
Noam Chomsky gilt als der einflussreichste Intellektuelle der Vereinigten Staaten. In seinem neuen Buch befasst er sich erstmals umfassend mit dem großen Thema unserer Zeit: der sozialen Ungleichheit.
Anhand von zehn Prinzipien der Konzentration von Reichtum und Macht und mithilfe zahlreicher historischer Texte der amerikanischen Geschichte erklärt Noam Chomsky, wie der amerikanische Traum – dass jeder es mit harter Arbeit zu etwas bringen kann – in den letzten Jahrzehnten systematisch beerdigt und ein System nie da gewesener sozialer Ungleichheit errichtet wurde, von dem letztlich nur einige wenige profitieren.
Requiem für den amerikanischen Traum macht die Breite und Tiefe von Noam Chomskys Denken zugänglich wie kein anderes Buch und verdeutlicht seine überzeugenden politischen Ideen mit einer beispiellosen Direktheit. Eine Pflichtlektüre für alle, die noch Hoffnung auf eine gemeinsame, demokratische Gestaltung unserer Zukunft haben.
Noam Chomsky
REQUIEM FÜR DENAMERIKANISCHENTRAUM
Die 10 Prinzipien der Konzentrationvon Reichtum und Macht
Herausgegeben von Peter Hutchison, Kelly Nyks und Jared P. Scott
Basierend auf dem Film Requiem für den amerikanischen Traum
Aus dem Englischen von Gabriele Gockel undThomas Wollermann
Verlag Antje Kunstmann
Inhalt
Der amerikanische Traum – eine kurze Vorbemerkung
Einleitung
ERSTES PRINZIPDemokratie einschränken
Geheime Verhandlungen … im Jahr 1787und andere Quellen
ZWEITES PRINZIPIdeologie bestimmen
Powell Memorandum und andere Quellen
DRITTES PRINZIPWirtschaft umgestalten
Schluss mit der Konzentration auf kurzfristige Gewinneund andere Quellen
VIERTES PRINZIPAndere die Last tragen lassen
Henry Ford zur Verdoppelung des Mindestlohnsund andere Quellen
FÜNFTES PRINZIPSolidarität bekämpfen
Die Theorie der ethischen Gefühleund andere Quellen
SECHSTES PRINZIPRegulierungsbehörden regulieren
Wohlstandsökonomie und andere Quellen
SIEBTES PRINZIPWahlen manipulieren
Citizens United vs. Federal Election Commissionund andere Quellen
ACHTES PRINZIPDen Pöbel im Zaum halten
Ford-Leute verprügeln und vertreiben …und andere Quellen
NEUNTES PRINZIPZustimmung konstruieren
Über die ursprünglichen Prinzipien der Regierungund andere Quellen
ZEHNTES PRINZIPDie Bevölkerung an den Rand drängen
Theorien amerikanischer Politik auf dem Prüfstandund andere Quellen
Über den Autor
Über die Herausgeber
Quellenverzeichnis
Der amerikanische Traum – eine kurze Vorbemerkung
Die Great Depression, die schwere Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre in den USA, die ich noch selbst miterlebt habe, war eine harte Zeit – subjektiv gesehen viel härter als die heutige. Aber es herrschte das Gefühl vor, irgendwie auch wieder da rauszukommen, die Erwartung, es werde irgendwann schon wieder besser: »Heute haben wir vielleicht keine Arbeit, aber morgen ganz bestimmt, und gemeinsam können wir an einer besseren Zukunft arbeiten.« Politischer Radikalismus hatte Hochkonjunktur und nährte die Hoffnung auf eine bessere Zukunft – eine, in der mehr Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit die repressiven Klassenstrukturen aufbrechen würden. »Irgendwie wird es vorangehen«, dachten alle.
Auch in meiner Familie gehörten viele zur Arbeiterklasse und hatten keinen Job. Aber die Gewerkschaftsbewegung war im Aufschwung, Ausdruck und Quelle von Optimismus und Hoffnung zugleich. Und das fehlt heute. »Nichts wird mehr, wie es mal war«, das ist heute die Stimmung – es ist aus und vorbei.
Wie viele Träume ist auch der amerikanische Traum zu einem nicht unerheblichen Teil ein Mythos. Im 19. Jahrhundert gehörte dazu auch der Traum vom Aufstieg, wie ihn Horatio Alger in populären Groschenromanen schilderte – »wir mögen
Einleitung
Schauen wir uns die amerikanische Gesellschaft einmal an. Stellen Sie sich vor, Sie würden sie vom Mars aus betrachten. Was sehen Sie?
In den Vereinigten Staaten werden Werte wie Demokratie hochgehalten. In einer Demokratie hat die öffentliche Meinung einen gewissen Einfluss auf die Politik, und die Regierung richtet ihr Handeln am Willen der Bevölkerung aus. Das ist das Wesen von Demokratie.
Man muss allerdings wissen, dass die Demokratie in den Reihen der Privilegierten und Mächtigen nicht besonders geschätzt wird, und das aus gutem Grund. Demokratie legt die Macht in die Hände der gesamten Bevölkerung und nimmt sie den Privilegierten und Mächtigen weg. Diese aber folgen dem Prinzip der Konzentration von Reichtum und Macht.
Ein Teufelskreis
Die Konzentration von Reichtum führt zur Konzentration von Macht, insbesondere wenn die Kosten für Wahlen immer mehr in die Höhe schießen, was die politischen Parteien zunehmend in die finanzielle Abhängigkeit von Großunternehmen treibt. Deren so gewonnene politische Macht schlägt sich alsbald in Gesetzen nieder, die die Konzentration von Reichtum unterstützen. Die Finanzpolitik – etwa in Form von Steuergesetzen, Deregulierung, Bestimmungen zur Unternehmensführung und vielen weiteren Maßnahmen – hat die Konzentration von Reichtum und Macht zur Folge und unterstützt die Kräfte, die diese Tendenz fördern. Wir befinden uns in einem Teufelskreis.
Die elende Maxime
Die Reichen hatten schon immer ein übergroßes Maß an Kontrolle über die Politik. Das hat eine lange Tradition und wurde bereits 1776 von Adam Smith beschrieben. In seinem einflussreichen Werk Der Wohlstand der Nationen lesen wir, dass die »Hauptkünstler des Merkantilsystems« die Menschen sind, denen die Gesellschaft gehört – in seiner Zeit waren das die »Kaufleute und Fabrikanten«. Und sie sorgten dafür, dass für ihre Interessen gesorgt wurde, ganz gleich wie »verderblich« die Folgen für das Volk von England und andere waren. Heute geht es nicht um Kaufleute und Fabrikanten, sondern um Finanzinstitute und multinationale Konzerne. »Alles für uns und nichts für andere«, so lautet nach Adam Smith schon seit jeher »die elende Maxime« der »Herren der Welt«. Die von ihnen verfolgte Politik wirkt sich stets zu ihrem Nutzen und zum Schaden für alle anderen aus.
Nun, diese Maxime der Politik gilt ganz allgemein und ist in den USA gut untersucht. Sie hat immer mehr Raum gegriffen, wie auch beim Ausbleiben einer Reaktion der Bevölkerung nicht anders zu erwarten ist.
ERSTES PRINZIP
DEMOKRATIE EINSCHRÄNKEN
Wie ein roter Faden zieht sich der Gegensatz zwischen der Forderung nach mehr Freiheit und Demokratie von unten und dem Bemühen der Elite um Macht und Herrschaft durch die amerikanische Geschichte. Er prägte bereits die Staatsgründung.
Die Minderheit der Reichen
James Madison, der maßgebliche Autor der amerikanischen Verfassung, war zwar einer der entschiedensten Verfechter der Demokratie in seiner Zeit, meinte aber, das Staatssystem der USA müsse gewährleisten, dass sich die Macht in den Händen der Wohlhabenden befinde – was er auch tatsächlich durchsetzte. Schließlich, so seine Überzeugung, seien die Reichen verantwortungsvoller, denn ihnen läge das öffentliche Interesse und nicht nur ihr eigener Vorteil am Herzen.
Deshalb verlieh die Verfassung dem Senat die größte Macht. Dies ist umso mehr von Bedeutung, als die Mitglieder dieser Kammer bis vor etwa einem Jahrhundert nicht direkt gewählt, sondern von den Parlamenten der Bundesstaaten bestimmt wurden – für eine lange Amtszeit. Außerdem wurden sie aus den Reihen der Wohlhabenden des Landes rekrutiert, aus dem Kreis der Männer, die, wie sich Madison ausdrückte, Sympathien für Besitzende und ihre Rechte hegten. Und beides sollte geschützt werden.
Der Senat hatte also die größte Macht, war jedoch am weitesten von der Bevölkerung entfernt. Das Repräsentantenhaus hatte eine größere Nähe zum Volk, verfügte aber über weitaus weniger Einfluss. Die Exekutive – der Präsident – hatte eher eine verwaltende Funktion, wenngleich auch eine gewisse Verantwortung für die Außenpolitik und andere Angelegenheiten. Ganz anders als heute.
Siehe: Geheime Verhandlungen und Debatten des 1787 in Philadelphia versammelten Verfassungskonvents; S. 24.
Eine zentrale Frage war, in welchem Maß unser Land echte Demokratie zulassen sollte. Madison diskutierte dieses Problem sehr eingehend, weniger in den sogenannten Federalist Papers, einer Serie von Artikeln in Tageszeitungen, in denen Madison, John Jay und Alexander Hamilton für ihr Verfassungskonzept warben, als in den höchst interessanten Debatten der verfassungsgebenden Versammlung. Aus den Protokollen geht hervor, dass Madison es als die wichtigste Aufgabe einer Gesellschaft – jeder vernünftigen Gesellschaft – ansah, »die Minderheit der Reichen gegen die Mehrheit zu schützen«. So seine eigenen Worte. Und er hatte auch Argumente dafür.
Er dachte dabei natürlich an England, seiner Ansicht nach die fortschrittlichste und in politischer Hinsicht modernste Gesellschaft seiner Zeit. Aber man nehme einmal an, argumentierte er, in England könne jeder frei wählen. Die Armen, die die Mehrheit bildeten, würden sich zusammenschließen und sich organisieren, um den Reichen ihren Besitz zu nehmen. Sie würden beschließen, was man heute eine »Landreform« nennt, mit anderen Worten, die großen Ländereien, die weitläufigen landwirtschaftlichen Güter auflösen und sie unter den Menschen verteilen, also sich das Land zurückholen, von dem sie erst kurz zuvor durch die Einhegung vertrieben worden seien. Die Armen würden so abstimmen, dass an sie zurückfiele, was einmal die Allmende war.
Das aber, so Madison, wäre offensichtlich ungerecht und somit nicht zu befürworten. Also müsse die Verfassung die Demokratie – die »Tyrannei der Mehrheit«, wie es gelegentlich hieß – verhindern, um zu gewährleisten, dass das Eigentum der Reichen unangetastet bleibe.
Das ist die Grundstruktur des Systems: Es ist darauf ausgelegt, die Gefahr der Demokratie abzuwenden. Natürlich kann man zu Madisons Verteidigung sagen, dass er Präkapitalist war. Er ging davon aus, dass die Reichen der Nation eine Art römischer Adel waren, wie man ihn sich damals vorstellte – aufgeklärte Aristokraten, gütige Menschen, die sich dem Wohl aller widmeten und dafür arbeiteten. Das war eine ziemlich verbreitete Sichtweise, was schon daran ablesbar ist, dass sich Madisons Verfassungssystem tatsächlich durchsetzte.
Und ich muss auch sagen, dass Madison schon in den 1790er-Jahren bitter enttäuscht war über die Abwege, auf die das von ihm selbst geschaffene System geraten war. Börsenhändler und andere Spekulanten hatten die Regie übernommen und es zugunsten eigener Interessen zerstört.
Aristokraten und Demokraten
Es gab jedoch noch eine andere Vorstellung von Demokratie, die Jefferson, ihr führender Theoretiker, anhand der Unterscheidung zwischen »Aristokraten« und »Demokraten« ziemlich eloquent darlegte.
Siehe: Thomas Jefferson in einem Brief an William Short am 8. Januar 1825; S. 25.
Die Grundidee der Aristokratie als Staatsform sei, dass die Macht in Händen einer eigenen Klasse besonders herausragender und privilegierter Personen liegen sollte, die vernünftige Entscheidungen treffen. Die Demokraten hingegen glaubten, die Macht solle beim Volk liegen. Schließlich sei es der sicherste Träger der Macht und des vernünftigen Handelns, und ob uns seine Beschlüsse gefielen oder nicht, sollten wir dieses Modell unterstützen. Jefferson unterstützte also das demokratische Modell und nicht das aristokratische, das Madison propagiert hatte, bevor er sah, wohin sich das System entwickelte. Dieser Riss durchzieht die amerikanische Geschichte bis heute.
Weniger Ungleichheit
Siehe: Aristoteles, Politik, Buch III, Kapitel 8, Buch IV, Kapitel 4; S. 26.
Interessant dabei ist, dass diese Debatte eine lange Tradition hat und bis auf das erste Werk über politische Demokratie im klassischen Griechenland zurückgeht, die Politik von Aristoteles, die erste umfassende Untersuchung verschiedener politischer Systeme. Aristoteles kommt darin zu dem Schluss, dass die Demokratie die beste Regierungsform sei. Doch dann weist er genau auf das Problem hin, das auch Madison bemerkte. Aristoteles betrachtete nicht ein Land, sondern den Stadtstaat Athen, und man darf nicht vergessen, dass sich seine Demokratie auf freie Männer beschränkte. Doch das war auch bei Madison so – seine Überlegungen galten freien Männern, nicht Frauen, und natürlich erst recht nicht Sklaven.
Siehe: Aristoteles, Politik, Buch VI, Kapitel 5; S. 27.
Aristoteles stellte dasselbe fest wie Madison viel später. Wenn Athen eine Demokratie für freie Männer wäre, würden sich die Armen zusammenschließen und den Reichen ihren Besitz nehmen. Doch die beiden fanden entgegengesetzte Lösungen für dasselbe Dilemma. Madison kam zu dem Schluss, man müsse die Demokratie einschränken – mit anderen Worten, das System so gestalten, dass die Macht in den Händen der Reichen liege, und die Bevölkerung auf vielerlei Weise spalten, damit sie sich nicht zusammenschließen könne, um den Reichen die Macht zu entreißen. Aristoteles sah die Lösung im Gegenteil: Er schlug eine Staatsform vor, die wir heute als »Wohlfahrtsstaat« bezeichnen würden. Man müsse, so meinte er, die Ungleichheit vermindern – durch öffentliche Speisungen und andere dem Stadtstaat angemessene Maßnahmen. Kurz, ein Problem, zwei Lösungen: die Ungleichheit vermindern oder die Demokratie einschränken. Und diese beiden gegensätzlichen Bestrebungen konstituieren unser Land.
Ungleichheit hat viele Konsequenzen. Sie ist nicht nur an sich ungerecht, sondern hat ausgesprochen negative Auswirkungen auf die Gesellschaft insgesamt, selbst auf Dinge wie die Gesundheit. Es gibt fundierte Studien – etwa von Richard Wilkinson –, die zeigen, dass es um die Gesundheit einer Gesellschaft umso schlechter bestellt ist, je mehr sie von Ungleichheit geprägt ist, egal ob diese Gesellschaft arm oder reich ist. Denn die Ungleichheit an sich hat bereits zerstörerische, schädliche Auswirkungen auf die sozialen Beziehungen, das Bewusstsein, das Leben der Menschen und zieht weitere negative Folgen nach sich. All das sollte aber überwunden werden. Aristoteles hatte recht – um das Paradox der Demokratie zu überwinden, muss die Ungleichheit vermindert und nicht die Demokratie eingeschränkt werden.
Die Sünden der amerikanischen Gesellschaft
In den ersten Jahren ihres Bestehens blickten die Vereinigten Staaten in eine endlose Zukunft steigenden Wohlstands, zunehmender Freiheit, zahlloser neuer Errungenschaften und wachsender Macht – sofern man die Opfer dieser Entwicklung ausblendete. Die USA waren eine koloniale Siedlergesellschaft – die brutalste Form des Imperialismus. Man muss schon darüber hinwegsehen, dass man deshalb reicher wurde und ein immer freieres Leben führte, weil die indigene Bevölkerung dezimiert wurde – die erste schwere »Ursünde« der amerikanischen Gesellschaft; und weil ein anderer Teil der Bevölkerung aus herbeigeschafften Sklaven bestand – die zweite schwere Sünde. Wir leben bis heute mit den Folgen beider. Man muss schon die schändliche Ausbeutung der Arbeitskräfte ignorieren, die Eroberung anderer Länder und vieles mehr. Nur wenn man diese »unbedeutenden« Details außer Acht lässt, kann man sagen, dass wir unseren Idealen einigermaßen gerecht werden. Eine der wichtigsten Fragen lautet eben seit jeher: In welchem Maß sollten wir echte Demokratie zulassen?
Siehe: Somerset vs. Stewart, Court of King’s Beach, England, 14. Mai 1772, Urteilsbegründung von Lord Mansfield; S. 27.
Am Ende des 18. Jahrhunderts, kurz vor der Unterzeichnung der Verfassung der Vereinigten Staaten, gab es, wie gesagt, widersprüchliche Ansichten darüber, wie die neue Gesellschaft organisiert und aufgebaut sein sollte. Ein entscheidendes Element, das man dabei nicht vergessen darf, ist der überwältigende Einfluss der Sklavenhalterstaaten. Die Sklaverei spielte in der amerikanischen Revolution sogar eine entscheidende Rolle. Schon 1770 bewerteten britische Richter – wie Lord Mansfield im berühmten Fall des James Somerset – die Sklaverei als eine schändliche Einrichtung, die nicht toleriert werden könne. Damit waren amerikanische Sklavenbesitzer gewarnt. Sollten die Kolonien der britischen Herrschaft unterstellt bleiben, wäre die Sklaverei bald geächtet – es gibt ziemlich eindeutige Hinweise darauf, dass dies ein wichtiger Faktor für die Erhebung gegen England war, die stark von den Sklavenhalterstaaten, allen voran Virginia, geprägt wurde. Im Nordosten zeigte sich bereits Widerstand gegen die Sklaverei, aber er war gering, und die Verfassung spiegelt dies wider.
Gegensätzliche Kräfte
Die Geschichte der Vereinigten Staaten ist ein ständiger Kampf zwischen diesen beiden Tendenzen: ein demokratischer, vor allem von der Bevölkerung ausgehender Druck von unten, erwies sich dabei oft als erfolgreich. So erhielten beispielsweise Frauen – die Hälfte der Bevölkerung – in den 1920er-Jahren das Wahlrecht. Ehe wir uns allzu viel darauf einbilden: Etwa zur selben Zeit wurden in Afghanistan die Frauenrechte erheblich ausgeweitet.
Die Sklaven wurden zwar nach dem amerikanischen Bürgerkrieg formell befreit, nicht jedoch wirklich. In der Praxis erkämpfte erst die Bürgerrechtsbewegung in den 1960er-Jahren alle formalen Rechte und Freiheiten, und auch dann noch mit erheblichen Einschränkungen. In unserem gegenwärtigen politischen System gibt es immer noch zahlreiche Relikte der Sklaverei, aber die Koppelung des Wahlrechts und der Mitbestimmung an Grundbesitz wurde im 19. Jahrhundert immerhin gelockert. Damals bildeten sich auch die ersten ernst zu nehmenden Arbeiterorganisationen, die viele Siege errangen.
Der Kampf setzte sich also fort – Zeiten des Rückschritts wechselten mit solchen des Fortschritts. Die 1960er-Jahre beispielsweise waren eine Epoche weitgehender Demokratisierung. Teile der Bevölkerung, die zuvor passiv und geradezu apathisch gewesen waren, organisierten sich jetzt, wurden aktiv und drängten auf die Durchsetzung ihrer Forderungen, sie beteiligten sich zunehmend an der Entscheidungsfindung, gründeten Bürgerinitiativen und so fort. Es war eine Zeit zivilgesellschaftlichen Engagements – und sie wurde meines Erachtens gerade deshalb als »Zeit der Unruhen« bezeichnet. Sie veränderte in vielerlei Hinsicht das Bewusstsein der Menschen: in Sachen Minderheitenrechte, Frauenrechte, Umweltschutz, staatlicher Aggression, Solidarität mit anderen.
Siehe: Malcolm X, Demokratie ist Heuchelei, Rede im Jahr 1960; S. 28. Martin Luther King, Wo wollen wir hin?, Rede am 16. August 1967; S. 29; Gaylord Nelson, Rede zum Tag der Erde am, 22. April 1970; S. 30.
All dies sind Effekte der Zivilgesellschaft, und gerade das löste große Angst aus …
Die Heftigkeit der Gegenreaktion auf diese Gesellschaftsbewegung der 1960er-Jahre habe ich damals nicht vorausgesehen, obwohl ich es eigentlich hätte ahnen können – weder die ökonomischen Kräfte, die eingesetzt wurden, noch die Disziplinierungstechniken.
GEHEIME VERHANDLUNGEN … IM JAHR 1787 UND ANDERE QUELLEN
Geheime Verhandlungen und Debatten des 1787 in Philadelphia versammelten Verfassungskonvents
MR. MADISON: So vielfältig sind die Lebenswege unserer Zeit, dass in allen zivilisierten Ländern die Interessen einer Gemeinschaft geteilt sind. Es gibt Schuldner und Gläubiger und ungleichen Grundbesitz, und daraus erwachsen verschiedene Sichtweisen und verschiedene Ziele im Staat. Dies ist die Grundlage der Aristokratie, die Bestandteil jeder Regierung ist, sei es einer der Antike oder einer modernen. Selbst dort, wo Titel länger bestehen bleiben als Eigentum, stoßen wir bisweilen auf den edlen Bettelmann, hochmütig und anmaßend.
Der Mann, der über Reichtum verfügt, der sich auf seinem Sofa rekelt oder in seiner Kutsche dahinrollt, kann die Wünsche und Gefühle des Tagelöhners nicht beurteilen. Der Staat, den wir errichten wollen, soll immerdar Bestand haben. Gegenwärtig haben die Grundbesitzer Vorrang, doch im Verlauf der Zeit, wenn wir uns den Staaten und Königreichen Europas annähern; wenn die Zahl der Grundbesitzer aufgrund der Vielgestalt des Handels und der Fabrikation verhältnismäßig klein sein wird, werden dann nicht bei zukünftigen Wahlen die Grundbesitzer überstimmt, und was wird dann, wenn nicht kluge Vorsorge dagegen getroffen wird, aus dem Staat werden? Stünden in England heute die Wahlen allen Klassen offen, wäre das Eigentum der Landbesitzer gefährdet. Bald würde es zu einem Agrargesetz kommen. Wenn diese Beobachtungen richtig sind, sollte unser Staat die langfristigen Interessen des Landes vor Neuerungen schützen. Landbesitzer sollten einen Teil der Regierung stellen, um diese unverzichtbaren Interessen zu unterstützen und ein Gegengewicht zu den anderen zu bilden. Sie sollten in die Lage versetzt werden, die Minderheit der Reichen vor der Mehrheit zu schützen. Das Instrument hierzu sollte der Senat sein; und er sollte Dauerhaftigkeit und Stabilität besitzen. Es wurden die verschiedensten Vorschläge unterbreitet, meiner Meinung nach aber wird man diesen Ansprüchen umso mehr gerecht, je länger die Senatoren im Amt bleiben.
Thomas Jefferson in einem Brief an William Short am 8. Januar 1825
Je nach ihrer Konstitution und den Umständen, in denen sie sich befinden, vertreten die Menschen unterschiedliche Meinungen. Manche sind Whigs, andere Torys, Sklaven, Aristokraten und so weiter. Letztere fürchten das Volk und möchten die Macht in die Hand der höheren Gesellschaftsklassen geben. Erstere betrachten das Volk letztlich als den sichersten Hort der Macht, sie schätzen es deswegen und möchten ihm alle Befugnisse überlassen, zu deren Ausübung es befähigt ist. So sind die Ansichten heute in den Vereinigten Staaten geteilt.