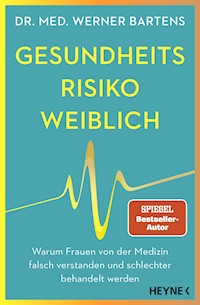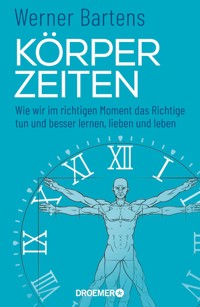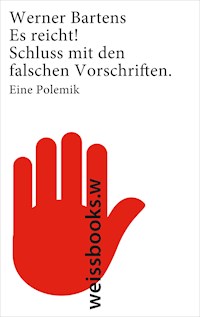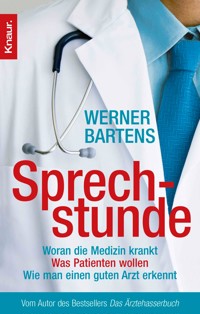7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eigentlich ist Wachstum gut. Wenn es uns allen bessergehen soll, muss die Wirtschaft wachsen. Wenn aber die Gesundheitsindustrie wachsen soll, müssen mehr Menschen kränker sein. Seit Jahren boomt diese Branche. Warum das so ist und was dies für uns bedeutet, beleuchtet Deutschlands profiliertester Medizinjournalist Werner Bartens. Er zeigt, dass Krankheiten geradezu erfunden, unnötige Medikamente verschrieben werden, dass die Anzahl intensiver Untersuchungen nicht vom Verlauf der Krankheit abhängt, sondern von der Verfügbarkeit und vom Abschreibebedarf teurer Geräte. Er legt dar, dass die wirkungsvollste Therapie für viele Krankheiten in einem ruhigen Arzt-Patienten-Gespräch liegt und weshalb dafür kein Geld vorhanden ist, obwohl die Gesundheitsausgaben jährlich wachsen. "Heillose Zustände" ist die überfällige Abrechnung eines Insiders mit einem System, das die Menschen kränker, nicht gesünder macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Werner Bartens
Heillose Zustände
Warum die Medizin die Menschen krank und das Land arm macht
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
In einem scharfen Debattenbuch rechnet Werner Bartens ab mit geldgieriger Medizintechnik- und Pharmaindustrie, unfähigen oder gekauften Gesundheitspolitikern und getriebenen Ärzten, die sich zu einem unseligen Komplott auf Kosten der Volksgesundheit zusammengetan haben. Denn das äußerst kapitalintensive Gesundheitssystem kann nur wachsen, und das tut es, wenn bei immer mehr Menschen immer mehr Leiden diagnostiziert werden, gegen die sie immer intensiver behandelt werden müssen. Die Folge: unnötige Operationen und Therapien, Folgeschäden der OPs, Nebenwirkungen der Medikamente. Und die Menschen leiden, weil sie sich kränker wähnen als sie sind.
Inhaltsübersicht
Vorwort: Das kranke System
Die Medizinindustrie
Wahnsinn mit Methode: Zement-Wirbel, Tumormarker, Tinnitustherapie
Teurer heißt nicht besser – Herumdoktern an Symptomen
Beispiel Krebs – hoher Preis für fragwürdigen Nutzen
Medizin mit dem Preisschild
Die Illusion vom medizinischen Fortschritt
Rettet die Medizin vor der Ökonomie!
Halsweh, Schnupfen, Husten: Warum gibt es kein Medikament dagegen?
Nur zur Sicherheit – der alte Mann und das Mehr
Weniger ist mehr
Aufhören! Ärzte warnen vor zu viel Medizin
Brustkrebs abgesetzt: Weniger Hormone – weniger Tumore
Vorbeugung gegen Lungenkrebs? Durchleuchtet ohne Nutzen
Wie viel Mammographie?
Risiko Stent – Gefahren der Gefäßstütze
Unnötige OP, unnützes Röntgen – hoffentlich nicht privatversichert
Abwarten und Tee trinken – keine Antibiotika bei Nebenhöhlenentzündung
Cholesterinsenker für Millionen – fette Gewinne
Blutzuckereinstellung – zu viel des Guten
30 Prozent nutzlos – des Schlechten zu viel
Mehr Qualität, bitte
Die Praxis als Basar – Propaganda für Patienten
IGeL – ich hab’ da noch was für Sie
Individualisierte Medizin? Etikettenschwindel und Science-Fiction!
Blutwerte ohne Wert
Die Krankheitserfinder
Krank zu sein bedarf es wenig
Jahrmarkt der Krankheiten
Ein ganzes Land krankgeschrieben
Multivitamine? Multi-Risiko-Tabletten
ADHS – gedämpft und ruhiggestellt?
Die Pille für alle gegen alles
Überleben mit Brustkrebs: Die Therapie macht es – nicht das Screening
Übergewichtige Kinder in Deutschland? Ihr Anteil sinkt
Die Wechseljahre des Mannes sind ein Mythos
Schnarchen unter Aufsicht
Die Folgen der Schweinegrippe – wer wird Millionär?
Die Tamiflu-Lüge – das Fieber der Gutgläubigkeit
Schweinegrippe-Impfung – eine Konjunkturspritze für die Pharmaindustrie
Widersprüche, Widerstände, widerliche Übertreibungen
Industriefreundliche Symbolpolitik
Ärzte – denn sie wissen nicht, was sie tun
Die Fakten und die Toten
Der Arzt als Pharmareferent
Schlechtes Vorbild Arzt
Medizin von gestern
Müllvermeidung in Medizin-Journalen
Die Macht der Mietmäuler
Antidepressiva – die halbe Wahrheit
Patienten in Gefahr
Im Tollhaus der Medizin
Das Laster des Weglassens
Giftige Gelenke
Knirschen im Knie
Neue Medikamente – der Vergleich fehlt
Die größte Gefahr für Patienten
Alt, krank und falsch behandelt
Kittel des Schweigens
Nutzlose Tests für Todkranke
Grüne Giraffen und andere Beweise
Was tun? Aufruf für eine bessere Medizin
Literaturverzeichnis
Vorwort: Das kranke System
Was ist los mit der Medizin?
Joachim Jähne, Chefarzt der Chirurgie am Henriettenstift in Hannover, beklagt im »Deutschen Ärzteblatt«, dass Ärzte »aufgrund des starken finanziellen Drucks auf die Krankenhäuser« immer mehr operieren und so ihre Patientenzahl steigern – und zwar nicht aus medizinischen, sondern aus ökonomischen Gründen.1 Der Mann ist Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Markus Büchler, Chefarzt an der Universitätsklinik Heidelberg, erinnert daran, dass der Entscheidung zur Operation wie auch der Wahl des OP-Verfahrens »ausschließlich medizinische Gründe, keinesfalls aber finanzielle Intentionen zugrunde liegen« sollten.2 Der Mann, der betont, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, ist Präsident der Chirurgenvereinigung.
Was ist da los?
Tausende Frauen laufen mit »Schrott in den Brüsten« herum, wie ein Insider die aus minderwertigem Material hergestellten, oft schadhaften Brustimplantate nennt. Ärzte beschweren sich über gefährliche Hüftprothesen mit Metallabrieb – aber wenig später erklärt Susanne Conze, Referatsleiterin Medizinprodukte im Gesundheitsministerium, dass ihr Dienstherr Daniel Bahr deshalb noch lange »keinen Systemwechsel« plane und am laschen Zulassungsverfahren »nichts ändern wolle«.3
Was ist da los?
In der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« erklärt Matthias Rothmund, Chef der Gefäßchirurgie und Medizin-Dekan der Universität Marburg: »Das Großexperiment Fusion und Privatisierung zweier Universitätsklinika ist misslungen. Land und Rhön Klinikum AG sind aufgefordert, diese Wahrheit zu erkennen und zu reagieren.«4 Die Versorgung der Patienten in Mittelhessen dürfe nicht durch weiteren Personalabbau und Einsparungen in Gefahr geraten, weil die Privatisierung der Uniklinika Gießen und Marburg bisher zu wenig Rendite für die Rhön-Aktionäre erbracht habe.
Drei Nachrichten über den Zustand der Medizin – alle drei sind innerhalb von nur einer Woche im April 2012 im offiziellen Standesorgan der Ärzteschaft und dem inoffiziellen Organ des konservativen Bürgertums erschienen – lassen erahnen, wie schlecht es um die Medizin in Deutschland steht. Zwar gibt es Patienten, die mit ihrem Arzt zufrieden sind und ihn loben. Doch die Wut auf die Medizin ist groß. Und fast alle sind wütend: niedergelassene Ärzte, die um die Existenz ihrer Praxis fürchten; Patienten, die beim Arzt zu schnell abgefertigt werden; Klinikärzte, die nicht mehr wissen, wie sie vor lauter Sparzwang gute Medizin machen sollen. Trotzdem sprechen Politiker, wenn Kritik am Gesundheitswesen aufkommt, nur davon, dass sie Details der Gesundheitsreform »nachjustieren« müssen. Doch wer meint, mit ein paar kleinen Veränderungen sei es getan, irrt sich.
Der Fehler liegt im System.
Im Gesundheitswesen sollte es in erster Linie um die Patienten gehen. Hinter beschönigenden Begriffen wie Gesundheitsreform oder Gesundheitsfonds verbirgt sich hingegen ein bürokratisches Ungetüm, das die Bezahlung der Ärzte und die Verteilung der Kassenbeiträge verkompliziert und kaum die Patienten im Blick hat. Ein Konzept, das sinnvolle Medizin fördert, ist nicht zu erkennen. Die aktuelle Form der Honorierung bietet Ärzten erst recht keine Anreize für eine Heilkunde, die den Kranken zugutekommt.
Wird beispielsweise eine Kassenpatientin mit Brustkrebs behandelt, muss der Frauenarzt viel Idealismus und wenig betriebswirtschaftliches Kalkül mitbringen, wenn er gute Medizin betreiben will. Zur Betreuung gehört es, Ängste und Erwartungen zu besprechen, die Abfolge der Chemotherapie zu erläutern und Perspektiven für den oft günstigen Krankheitsverlauf zu eröffnen. Hinzu kommt die medizinische wie die psychologische Begleitung während der Behandlung. Pro Quartal bekommt ein Frauenarzt – je nach Bundesland – pauschal zwischen 15 und 35 Euro dafür. Dass sie für diese zeitintensive und menschlich anspruchsvolle Tätigkeit schlechter bezahlt werden als eine Tankstelle für einen Reifenwechsel, verbittert viele Ärzte zu Recht.
Die Patienten haben unter dem falschen Honorarsystem ebenfalls zu leiden. Wenn ein Mensch mit Schwindel zum Arzt kommt, müssten Herz, Hirn, Ohren und Psyche angeschaut werden. Das ist aufwendig. Der Hausarzt begnügt sich womöglich mit einem EKG, der Neurologe mit den Hirnströmen, das irritierte Seelenleben – die häufigste Ursache für Schwindel – kommt in der Regel zu kurz. Der Patient wird von Arzt zu Arzt geschickt, weil keiner die umfangreiche Diagnostik oder ausführliche Gespräche für eine Pauschale von 15 oder 35 Euro auf sich nehmen will, selbst wenn er noch einen kleinen Zuschlag für die Gerätenutzung bekommt. Weil es sich für den niedergelassenen Arzt nicht lohnt, werden immer wieder Patienten mit banalen Beschwerden ins Krankenhaus geschickt. Denn finanziell attraktiv für Ärzte sind nur gesunde Patienten. Diejenigen mit einem Zipperlein, das schnell zu erkennen und zu behandeln ist. Kranke mit verschiedenen oder komplizierten Leiden werden hingegen zum finanziellen Risiko. Die Pauschale deckt nämlich nur eine Behandlung ab. Wer mehrmals kommt, den muss der Arzt zum Nulltarif behandeln.
Vor allem geht in dem ständig steigenden Arbeitsdruck etwas verloren, was wesentlich wäre für eine gute Medizin: Zeit für Zuwendung, Zuhören, Trost. Der Patient wird zum Störfaktor. Die ökonomisierte Medizin gleicht diesen Mangel mit Technik aus: »Kann ein Patient im Krankenhaus nicht mehr genug trinken, bekommt er einen Tropf. Isst er zu wenig oder zu langsam, wird eine Magensonde gelegt. Nässt er ein, wird ein Dauerkatheter gelegt. Verhält er sich unruhig, werden Bettgestelle oder Fixierungen angebracht.« So beschreibt der Marburger Oberarzt Konrad Görg einen Krankenhausalltag, aus dem Fürsorge, Mitgefühl und Menschlichkeit wegrationalisiert wurden.
Das gegenwärtige System folgt einer blinden Fortschrittsrhetorik. Medizin ist aber kein Wirtschaftszweig wie jeder andere, in dem mehr Mittel auch mehr Erfolg nach sich ziehen. Mehr Medizin macht nicht zwangsläufig gesünder – sondern manchmal sogar kränker. Gesundheit ist ein Zustand der Selbstvergessenheit, ein »Schweigen der Organe«, das sich nicht immer auf Rezept herstellen lässt.5 Dennoch verfahren viele Ärzte nach dem zynischen Motto: Es gibt keine Gesunden – nur Menschen, die noch nicht ausreichend untersucht worden sind.
Technisch aufwendige Untersuchungen sind lukrativ – etwa mittels CT, Kernspin oder Herzkatheter. Entsprechende Diagnostik machen Ärzte vor allem, weil sie sich separat abrechnen lässt – oder bei Privatpatienten. Gigantische Summen werden so für unnötige Diagnostik und Therapie verschwendet, dabei leiden 40 bis 50 Prozent der Patienten in Arztpraxen unter psychosomatisch überlagerten Beschwerden, die keiner Labor- und Gerätediagnostik, sondern einer geschulten Gesprächsbegleitung bedürfen. Ein irrwitzig hoher Anteil, der die gigantische Verschwendung umso deutlicher macht.
Dennoch bestellen Ärzte ihre Patienten nach überstandener Krankheit zu oft unnötigen Nachkontrollen ein. Krebsmediziner stellen Überdiagnosen und verordnen Übertherapien, da Bildgebung und andere Tests inzwischen so genau sind, dass auch Tumore entdeckt und behandelt werden, die nie Beschwerden verursacht hätten. In Fachzeitschriften wird unter dem Motto »Less is more« bereits diskutiert, wie schädlich zu viel Medizin ist. Dabei besteht eine ärztliche Kernkompetenz darin, unnötige Diagnostik zu unterlassen und stattdessen die Ressourcen der Patienten zu aktivieren.
Kein Land steckt – neben der Schweiz, den USA und Frankreich – so viel Geld in sein Gesundheitswesen wie Deutschland: mehr als zehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Von dem Geld kommt jedoch zu wenig dort an, wo es gebraucht wird. Die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV), die das Honorar der Ärzte berechnen und verteilen, sind bürokratisch so aufgebläht, dass viele Ärzte mehr Zeit mit der Abrechnung verbringen als mit ihren Patienten.
Ein System, das die Medizin dem freien Spiel des Marktes opfert, ist krank. Eine Option wären Anleihen am Modell Norwegen. Dort ist nicht alles besser, aber einiges kann man sich abschauen: Ärzte bekommen für jeden Patienten, der sich in ihre Liste einschreibt, eine jährliche Pauschale – egal, ob er gar nicht, einmal oder zehnmal kommt. Hinsichtlich der Lebenserwartung und anderer Kriterien für gute Gesundheit steht Norwegen besser da als Deutschland. Vielleicht auch deshalb, weil weniger oft mehr bringt: Norweger gehen im Durchschnitt drei- bis viermal im Jahr zum Arzt, Deutsche hingegen 17- bis 18-mal. Davon haben die Deutschen nicht viel. Im Gegenteil: »Patienten droht ein Desaster.« »Arzneimittel sind nicht mehr sicher.« »Die Gesundheit von Millionen Menschen wird für Wirtschaftsinteressen geopfert.« Was klingt wie eine abstruse Verschwörungstheorie, sind Reaktionen von Ärzten, Patienten und Arzneimittelexperten auf die »Änderungsanträge zum Gesetzentwurf zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes«. FDP und CDU/CSU haben das Gesetz im Sommer 2010 auf den Weg gebracht. 2011 trat es in Kraft.
Die Hintergründe sind ähnlich vertrackt wie der Versuch, eine Packungsbeilage zusammenzufalten.
Das ist perfide an der gegenwärtigen Medizin: Viele Ärzte und Pflegekräfte geben ihr Bestes für die Patienten, opfern sich in Klinik oder Praxis auf und tragen dazu bei, dass sich die meisten Menschen bei ihrem Arzt gut aufgehoben fühlen. Doch eine Medizinindustrie, die von »Gesundheitspolitikern« unterstützt wird, trägt leider dazu bei, dass Patienten in Gefahr geraten und zu wenig geprüfte Medikamente, zu viele unnötige Untersuchungen und nicht getestete Implantate bekommen. Ein Konzept, das auf mehr Wachstum setzt, ist im Gesundheitswesen fehl am Platz. In der Medizin bedeuten mehr Leistungen nicht automatisch, dass Kranke besser versorgt werden.
Von den etwa 2000 beim Deutschen Bundestag registrierten Lobbyverbänden bearbeiten mehr als 400 das Bundesgesundheitsministerium. In der Gesundheitspolitik scheint es gewollt zu sein, dass die Strukturen kompliziert und wenig transparent sind. Nur so kann weiterhin jede Interessengruppe von dem Milliardenmarkt profitieren. Eine Gesundheitsreform, die diesen Namen verdient, gab es schon lange nicht mehr. Nach medizinischen Kriterien und nach den Bedürfnissen der Kranken wird nicht entschieden. In den Ministerien haben Betriebswirtschaftler das Sagen, in den Kliniken die Kaufleute und Controller. Gute Medizin kommt dabei nicht heraus, sondern nur Interessenpolitik auf Kosten der Patienten.
Die Medizinindustrie
Wahnsinn mit Methode: Zement-Wirbel, Tumormarker, Tinnitustherapie
Für die einen sind sie Spielverderber. Den anderen gelten sie als aufrechte Streiter für eine sinnvolle Medizin, die sich am Nutzen für den Patienten und nicht am Profit der Pharmafirmen, Medizintechnikunternehmen und Ärzte orientieren. Die Waffen im Kampf gegen eine dem ökonomischen Diktat unterworfene Medizin, gegen die Marketingabteilungen der Firmen und Krankenhäuser sind jedoch vergleichsweise stumpf. Lediglich ihre kritische Urteilskraft steht jenen zur Verfügung, die eine bessere Medizin wollen und die in unabhängigen Instituten untersuchen, ob neue Therapien Patienten tatsächlich nutzen oder wie gut die wissenschaftlichen Beweise wirklich sind, wenn in Fachartikeln eine neue Behandlung oder umfangreichere Diagnostik angepriesen wird.
»Manchmal hat man den Eindruck, das ist Wahnsinn mit Methode«, sagt Jürgen Windeler. Seit mehr als zwei Jahrzehnten tritt er für eine wissenschaftlich fundierte Medizin ein. In den 1990ern war er daran beteiligt, die immer wieder am politischen und ökonomischen Widerstand gescheiterte Positivliste zu erstellen, in der statt der mittlerweile 60000 Medikamente auf dem Markt nur 1500 sichere, nützliche und zuverlässige Präparate aufgeführt sind, die Ärzte in der Klinik wirklich brauchen – einer Internistenpraxis würden sogar 500 Arzneien reichen, dem Hausarzt 150.
Seit September 2010 bekommt Windeler den Wahnsinn in der Medizin aus nächster Nähe mit. Er leitet seither das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) in Köln, das jährlich bis zu 50 diagnostische und therapeutische Verfahren bewertet. Windeler hat Dutzende Beispiele untersucht, in denen der Nutzen einer Behandlung steif und fest behauptet, aber nie belegt wurde. »Die Dreistigkeit, mit der angebliche Vorteile angegeben werden, ist manchmal schon erstaunlich«, sagt der Arzt. »Natürlich ärgere ich mich über die Auswüchse des Systems – und dass es immer wieder ausgenutzt wird.«
Im Jahr 2009 berichtete beispielsweise der Bundesverband Medizintechnologie, ein Wirtschaftsverband, der 200 Unternehmen vertritt, von einer neuen Behandlung schmerzhafter Wirbelkörperbrüche. Für Millionen Deutsche mit Osteoporose sei mit einem Zement, mit dem die Wirbelkörper aufgefüllt werden, endlich »ein schonendes Verfahren zur dauerhaften Schmerzbeseitigung« gefunden worden. 2011 erschien im Deutschen »Ärzteblatt« eine Studie von Radiologen aus Recklinghausen, die 1188 Patienten behandelt hatten und schwärmten, dass die Zementspritze »die Schmerzen bei der Wirbelkörperfraktur unmittelbar gelindert«, »die Beweglichkeit verbessert« und »den Schmerzmittelbedarf verringert« habe.5
Schwer zu sagen, ob es Mut, Voreingenommenheit oder Dreistigkeit bedarf, um so etwas zu behaupten. Im weltweit angesehensten Fachblatt für Ärzte, dem »New England Journal of Medicine«, hatten australische Ärzte um Rachelle Buchbinder schließlich schon 2009 festgestellt, dass es keinen Nutzen der Wirbelzementierung gebe.6 Im Gegenteil. Die Australier hatten einem Teil ihrer Patienten Zement in lädierte Wirbel injiziert, die andere Hälfte bekam ebenfalls Spritze und Verband, allerdings ohne dass etwas injiziert wurde. Unmittelbar danach, wie auch drei Monate und ein halbes Jahr später, war der Nutzen gegenüber der Scheinbehandlung gleich null. Beide Gruppen klagten über ähnlich starke Schmerzen. Zudem hatte bei manchen Patienten der schwere Zement im Rücken dazu geführt, dass die intakten Wirbelkörper darunter häufiger unter der Last brachen.
Die Ärzte aus dem Ruhrgebiet konnten diese Befunde in ihrer Studie nicht nachvollziehen. Wie auch, sie hatten ja keine Vergleichsgruppe untersucht! Bei einem guten Fachartikel über eine neue Therapie wäre das selbstverständlich gewesen. Auf der letzten Seite ihres Beitrags gehen sie auf Buchbinders Studie kurz ein und beklagen, dass dadurch »die Anwendung einer Methode, die sich in den Jahren zuvor zunehmend etabliert hat, stark beeinflusst wurde und dies zu möglichen Missinterpretationen und Unsicherheiten bei Zuweisern und Behandlern geführt« hat. Das muss man übersetzen. Auf Deutsch heißt es: Wir lassen uns doch eine Behandlung nicht miesmachen, nur weil deren Nutzen nicht erwiesen ist.
»Wir müssen bessere Untersuchungen einfordern«, sagt Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. »Gerade für die derzeit so massiv beworbenen Tumormarker, die eine individualisierte Medizin versprechen, gibt es kaum vernünftige Daten.« Ludwig ist wenig euphorisch, was die immer wieder beschriebenen Vorteile für Patienten angeht, »sieht aber die Gefahr, dass alles, was sich Biomarker nennt, vorschnell eingeführt wird, ohne dass der Nutzen für Patienten überhaupt geprüft ist«.
Erstaunlich auch die Begründung, warum eine andere Methode, deren Vorteile nicht belegt sind, weiter erstattet werden soll. Der Gemeinsame Bundesausschuss, der entscheidet, welche medizinischen Maßnahmen sinnvoll sind und von der Solidargemeinschaft bezahlt werden, hatte im Oktober 2010 befunden, dass die Positronenemissionstomographie (PET) bei Patienten mit Lymphomen nur noch in Ausnahmen erstattet werden soll. Die Begründung: Es gebe keine zuverlässigen Beweise dafür, dass Patienten, die mit dieser Diagnosetechnik untersucht worden sind, im Anschluss besser behandelt werden oder andere Vorteile hätten.
Die mächtige Interessenvertretung der Kliniken, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, veröffentlichte daraufhin einen Beitrag, aus dem deutlich wurde, dass man doch nicht von einer Untersuchung lassen könne, nur weil sie keinen Vorteil bringt7: »Ist eine Methode wie zum Beispiel die PET bei der Lymphomdiagnostik schon seit längerer Zeit etabliert, in zahlreichen Studien publiziert und Bestandteil nationaler und internationaler Leitlinien, entspricht die Forderung nach Durchführung weiterer randomisiert-kontrollierter Studien zum Nachweis eines patientenrelevanten Nutzens nicht mehr der Versorgungsrealität.«
Auch hier braucht man einen Dolmetscher. Der Bandwurmsatz bedeutet: Wir nutzen die Methode schon lange, unsere Gremien finden das gut, und deshalb wollen wir nicht länger mit der lästigen Frage nach Vorteilen für Patienten behelligt werden. Es machen doch alle – daher soll das Verfahren bitte weiterhin erstattet werden, statt »überhöhte Forderungen an die Evidenz« zu stellen, wie die Überschrift des Artikels lautet. Wozu einen Nutzen beweisen, wenn Ärzte wie Patienten mit der Untersuchungsmethode zufrieden sind?
»Der wirtschaftliche Druck in der Medizin ist viel zu groß«, sagt Windeler. »Dabei ist für die Mehrzahl der Produkte, die neu in den Markt kommen, gar nicht belegt, dass der Nutzen größer ist als der Schaden.« Immer neue Angebote in der Medizin steigerten nicht unbedingt die Qualität. »Dass weniger oft mehr ist, wollen aber viele Patienten nicht wahrhaben. Sie fürchten, dass man ihnen etwas wegnimmt und sie weniger Wahlmöglichkeiten haben – unabhängig davon, ob ein Nutzen erwiesen ist oder nicht.«
Um den Nutzen zu erfassen, gibt es die Evidenzbasierte Medizin (EbM), vorangebracht von Cochrane-Zentren, die nach dem britischen Arzt und Epidemiologen Archie Cochrane benannt sind. Weltweit haben es sich Cochrane-Zentren zur Aufgabe gemacht, in großen Untersuchungen und Meta-Analysen zu zeigen, was methodisch hochwertige Studien ausmacht und wie daraus Empfehlungen für die medizinische Praxis zu gewinnen sind. Das Deutsche Cochrane-Zentrum in Freiburg, das 1997 eröffnet wurde, leitet Gerd Antes. »Wir können es uns nicht leisten, eine Medizin zu betreiben, von der Patienten keine Vorteile haben«, sagt er. »Leider werden gründliche Wirksamkeitsnachweise immer wieder bewusst ausgelassen oder unterlaufen, um Eigeninteressen zu schützen, die durch objektive Studienergebnisse bedroht wären.«
Ein anderes Beispiel betrifft die Vermarktung eines »Neurostimulators« gegen Tinnitus. Peter Tass, Direktor am renommierten Forschungszentrum Jülich, hat das Gerät mitentwickelt, die Firma ANM vertreibt es. Der quälende Ton im Ohr lasse sich bekämpfen, wenn ihm eine andere Form der Beschallung entgegengesetzt werde, so die Ankündigung. Klingt logisch, ist aber bisher nicht wissenschaftlich erwiesen und belegt. Obwohl die Initiatoren behaupten, seit eineinhalb Jahren eine entsprechende Studie beendet zu haben, ist diese bis zum Sommer 2012 und der Drucklegung dieses Buches noch nicht erschienen, sondern nur eine Untersuchung, in der entscheidende Belege für den Nutzen nicht erbracht werden konnten. Doch obwohl kein Nutzenbeweis vorliegt, bieten Dutzende Arztpraxen das Verfahren an.
Womöglich zeigt sich ja, dass die Töne gegen das Brummen tatsächlich helfen. Peter Tass wurde vorsorglich mit einem mit 100000 Euro dotierten Innovationspreis ausgezeichnet. Nach dem Motto: erst der Preis, später vielleicht der Beweis. Die Deutsche Tinnitusliga erklärt auf ihrer Homepage: »Die Daten reichen nicht aus, um eine gültige Aussage zur Wirksamkeit und zur Sicherheit dieser Behandlungsmethode zu treffen. Daher rät die Deutsche Tinnitusliga von dieser Therapie zum jetzigen Zeitpunkt ab.«
Patienten, die in Selbsthilfegruppen organisiert sind, werden ebenfalls ungeduldig und fragen sich, warum die angekündigte Studie so lange auf sich warten lässt. »Leider gibt es immer wieder Beispiele dafür, dass Patienten wie Ärzte auf massive Weise desinformiert oder im Unklaren gelassen werden«, sagt Gerd Antes. »Zwar hat die Nutzenbewertung in den vergangenen Jahren beeindruckend zugelegt, aber es gibt noch viele Schlupflöcher und mehr offene Fragen als Antworten.«
Wolf-Dieter Ludwig wüsste einen einfachen Weg, wie die Medizin besser und dem Wahnsinn Einhalt geboten werden kann. »Wir brauchen mehr gute Wissenschaft, aber daran mangelt es leider in etlichen Bereichen.«
Teurer heißt nicht besser – Herumdoktern an Symptomen
Bei jeder Gesundheitsreform stellt sich wieder die Frage: Das soll eine »Gesundheitsreform« sein? Diese Bezeichnung ist ein Witz, und zwar ein schlechter. Die Reformen, die von den Gesundheitsministern – auch dieser Begriff ist beschönigend – in den vergangenen Jahren vorgestellt wurden, sind halbgare Finanzierungsmodelle, um weiterhin die Lobbygruppen in der Medizin bedienen zu können. Das jeweilige Ansinnen, die chronischen Defizite im Gesundheitswesen zu beheben, hat sich allenfalls als kurzfristig lindernd erwiesen.
Daran wird sich auch nichts ändern. Denn solange die Medizin weiterhin nach Kriterien von Markt und Wachstum bemessen wird, steigen die Ausgaben unaufhörlich weiter. Das liegt in der Logik eines Wirtschaftssystems, das auf ständig neue Angebote und eine Stimulation der Nachfrage angewiesen ist. Und wer würde sich für diese merkantile Medizin besser eignen als die FDP-Gesundheitsminister wie Philipp Rösler und Daniel Bahr, die beide als Wirtschaftspolitiker sozialisiert wurden? Doch selbst wenn der gegenwärtige Minister mit seiner Partei untergehen sollte, werden es Politiker anderer Parteien wohl kaum schaffen, der Medizinindustrie Paroli zu bieten.
Die Medizin ist zwar einer der größten Wirtschaftsfaktoren in Deutschland, aber sie ist eben keine Wirtschaftsbranche wie jede andere. Stetiges Wachstum bedeutet in anderen Branchen Prosperität. Mehr Glück, mehr Liebe, aber auch mehr Umsatz und mehr Geld kann fast jeder gebrauchen. Ungezügeltes Wachstum in der Medizin ist hingegen ein Zeichen für Krebs. Da mit der Untersuchung und Behandlung Gesunder wie Kranker viel Geld zu verdienen ist, haben Kaufleute die Medizin zu einer Industrie gemacht und die Krankenbehandlung ökonomisiert. Weder Patienten noch Ärzten ist das gut bekommen.
Der Zusammenhang liegt auf der Hand: Für Kranke so wichtige Werte wie Zeit, Geborgenheit und – so altmodisch es klingt – Barmherzigkeit bleiben in der Medizinwirtschaft schnell auf der Strecke. Auch die ärztliche Kunst, abzuwarten und vorerst nichts zu tun8, lässt sich nicht betriebswirtschaftlich optimieren. Stattdessen werden neue Krankheiten erfunden, Grenzwerte gesenkt, oder es wird die Indikation zur Behandlung ausgedehnt. Gesunde werden zu kontrollbedürftigen Patienten erklärt. Es geht den Menschen aber nicht besser, wenn die Medizin zum Markt und immer teurer wird. Im Gegenteil: Nicht nur 80 bis 90 Prozent der Röntgenuntersuchungen bei Rückenschmerzen gelten als überflüssig, sondern auch ein ähnlich großer Anteil der Kniespiegelungen. Die Belastung durch die Arthroskopien ist groß, die Infektionsgefahr auch, der Nutzen nur in der Minderheit der Anwendungen belegt.
Und seit Jahren wehren sich Kliniken dagegen, dass nur jene Krankenhäuser die frühesten Frühgeborenen behandeln dürfen, die dies auch mindestens 75-mal im Jahr tun und damit den Kindern zu nachweislich besseren Überlebenschancen und weniger Behinderungen verhelfen. Da die Kliniken aber bis zu 130000 Euro für die Behandlung eines besonders kleinen Frühgeborenen bekommen, wollen sie nicht darauf verzichten – ökonomisch plausibel, medizinisch und vor allem menschlich ein Irrsinn.
Verkaufen lässt sich eine Gesundheitsreform, die keine ist, nur mit dem Mantra vom medizinischen Fortschritt. Und das geht so: Die Menschen werden immer älter, die Medizin wird immer besser – und beides kostet Geld. Will Deutschland weiter an den Segnungen der modernen Medizin teilhaben, wird die Medizin nun mal von Jahr zu Jahr teurer. Diese Logik klingt einleuchtend, ist aber falsch.9 Erstens verbrauchen die Menschen 80 bis 90 Prozent ihrer Gesundheitsausgaben im letzten Jahr vor ihrem Tod. Sterben sie im Alter von 90 Jahren, ist das – so zynisch es klingt – medizinisch sogar billiger, als wenn sie mit 50 Jahren sterben, denn bei jüngeren Menschen werden aufwendigere und invasivere Versuche unternommen, sie am Leben zu erhalten. Die jedes Jahr um drei Monate steigende Lebenserwartung erklärt also keineswegs die Kostenexplosion.
Zweitens ist der Fortschritt in der Medizin eine seltsame Angelegenheit. Neue Therapien und Arzneimittel sind oft nur teurer, weniger geprüft und daher weniger sicher, aber nicht besser als bewährte Möglichkeiten der Behandlung. Solche Zweifel passen allerdings nicht in ein Konzept, in dem die Heilkunde zu einer Medizinindustrie umgestaltet, sogar eine Universitätsklinik wie im Fall Gießen/Marburg privatisiert und damit das gesundheitliche Wohl einer ganzen Region zum Spielball von Aktionärsinteressen wird.
Wie sieht denn der Fortschritt aus, den Gesundheitspolitiker gern als Begründung für ihren desolaten Haushalt und die angeblich unaufhaltsam steigenden Kosten angeben? An verschiedenen Kliniken wurden Protonenzentren errichtet oder befinden sich als Prestigeprojekte mit Hilfe üppiger Subventionen im Bau. Dort sollen mit einer neuartigen Bestrahlungsmethode Krebspatienten behandelt werden. Diese Zentren kosten dreistellige Millionenbeträge, ein Nutzennachweis oder gar die Überlegenheit gegenüber konventionellen Verfahren zur Krebsbehandlung ist in den meisten Fällen aber noch gar nicht belegt.
Neue Arzneimittel? Die Art der Innovation im pharmazeutischen Bereich hat sich in den vergangenen Jahren massiv verändert. In den 1970er und 1980er Jahren wurden wichtige Medikamente entwickelt, zur Senkung des Blutdrucks, des Cholesterins und zur Krebsbehandlung. Neuerungen der letzten Dekade betreffen vor allem Nachahmerprodukte, oder es handelt sich um extrem teure Spezialmittel für einen eng begrenzten Patientenkreis. Bei neuen Medikamenten zur Behandlung großer Patientengruppen gab es in den vergangenen zehn Jahren auffallend viele Enttäuschungen. Bei Antidepressiva, Blutdrucksenkern, Psychopharmaka und Cholesterinsenkern sind neue Medikamente in den meisten Fällen zwar dreifach oder gar zehnfach so teuer wie ihre Vorgänger. Dafür wirken sie aber nicht besser, sondern gehen oft nur mit mehr Nebenwirkungen oder gefährlichen Komplikationen einher.
Die Pharmaindustrie in Deutschland hat das längst erkannt. Einst galt sie als »Apotheke der Welt«. Heute gibt sie den Großteil für Marketing aus und nicht für Forschung. Sie ist vollauf damit beschäftigt, Nachahmerprodukte als Neuigkeiten zu verkaufen oder Misserfolge schönzureden. Viele angebliche Innovationen sind Me-too-Präparate – Nachahmer, die nicht besser, sondern nur teurer sind als ihre Vorgänger. Auf den Markt kommen sie dennoch. Erst nachträglich kann ein Medikamenten-TÜV den Nutzen in Frage stellen.
Alle Gesundheitsminister der letzten 15 Jahre, von Horst Seehofer über Ulla Schmidt bis hin zu Daniel Bahr, knickten mit ihrer Forderung nach einer »Positivliste« ein, wenn Pharma-Lobbyisten drohten, dass Tausende Arbeitsplätze verlorengingen, wenn die internationalen Arzneimittelhersteller ihre Produktionsstätten ins Ausland verlagern. Deshalb gibt es hierzulande 60000 Präparate – und nicht, weil sie für die Gesundheit der Menschen wichtig wären. Dazu reichen weniger als drei Prozent davon aus. Dabei steht in keinem Gesetz und keiner Verfassung, dass die medizinische Versorgung der Bevölkerung den Profitinteressen einer Branche untergeordnet werden soll.
Das Land leistet sich einen weiteren, ebenso absurden wie teuren Luxus. Man muss einen sperrigen Begriff wie die »Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt« ansprechen, wenn es um die teure Medizin in Deutschland geht. Dieses Prinzip gilt im Krankenhaus und besagt Ungeheuerliches: Alle Untersuchungen und Behandlungen im Krankenhaus werden bezahlt, solange ihr Schaden nicht erwiesen ist – ein Nutzen muss nicht belegt sein! Diese Regel führt zu der seltsamen Situation, dass fragwürdige Interventionen in der Praxis nicht mehr erstattet werden – in der Klinik hingegen schon.
Den Preis kennen nicht die Patienten, nur die Ökonomen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass viele Kliniken nur existieren können, weil sie in großem Stil fragwürdige Untersuchungen und Therapien anwenden. Längst ist das Krankenhaus zum Warenhaus geworden, mit ständig wechselndem Sortiment. So wird die bis zu 8000 Euro teure Brachytherapie – eine besondere Form der Bestrahlung bei Prostatakrebs – im Krankenhaus erstattet, in der Arztpraxis nicht. Es gibt bisher keine überzeugenden Belege für den Nutzen. Gleiches gilt für die Vakuumtherapie bei Neurodermitis. Würden die Kassen nur bezahlen, was Patienten erwiesenermaßen nutzt, wären enorme Einsparungen die Folge – und die Kranken besser versorgt.
Wenn die Kassenbeiträge steigen, nehmen es die Versicherten mit viel Resignation und wenig Empörung hin. Gesundheitspolitiker schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Die Diskussion um Kopfpauschale, Bürgerversicherung und Zusatzbeiträge ist so ermüdend wie undurchsichtig. Der Bürger wendet sich ab und zahlt. Ihren Krankenversicherungen bleiben die meisten Menschen länger treu als dem Partner. Dabei gehen die Preissteigerungen der Gesundheitspolitik in mehrfacher Hinsicht auf Kosten der Versicherten.
In der rein ökonomischen Logik der Medizinwirtschaft ist es stimmig, weiter auf Wachstum und Neuerungen zu setzen. Jeder, der das Gesundheitswesen kennt, weiß, wie viel Geld im System steckt. Doch die Medizin ließe sich besser und trotzdem billiger machen in Deutschland. Das würde allerdings vielen Marktprinzipien der Medizinindustrie zuwiderlaufen, weswegen die nächste Gesundheitsreform absehbar ist – und wieder nur zu ein paar Umverteilungen in der Wachstumsbranche Medizin führen wird. Die Patienten, um die es eigentlich gehen sollte, haben nichts davon.
Beispiel Krebs – hoher Preis für fragwürdigen Nutzen
Die Patientin mit Brustkrebs bekam von ihrem Arzt Mut zugesprochen. »Wir haben da noch was für Sie«, sagte der Mediziner. »Das ist das Beste, was derzeit auf dem Markt ist.« Ein anderer Arzt, der die Betreuung übernahm, wunderte sich hingegen, dass der Patientin nicht eine Alternative angeboten wurde. Schließlich gebe es eine andere Behandlungsform, die nicht nur billiger, sondern auch schonender sei. Die Chancen, die nächsten fünf Jahre zu überleben, unterscheiden sich bei beiden Therapien nur um drei Prozent.
Der statistisch errechnete Vorteil einer neuen Behandlung kommt bei Patienten längst nicht immer als erlebter Gewinn an. »Es wird viel Geld für wenig klinischen Nutzen ausgegeben«, sagt Christoph Rochlitz, Chefarzt der Krebsmedizin am Universitätsspital Basel. »Das verschärft sich seit Jahren.« Längst haben sich Onkologen daran gewöhnen müssen, dass Erfolge in der Tumortherapie manchmal ziemlich bescheiden ausfallen. Aus dem »Krieg gegen den Krebs«, den US-Präsident Richard Nixon 1971 erklärte und für den er 100 Millionen Dollar zusätzlich für die Krebsforschung bewilligte, ist ein zermürbender Stellungskampf geworden, bei dem nicht immer klar ist, ob er für Patienten einen Vorteil bietet und wie teuer ein paar Tage mehr Leben erkauft werden.
Deutlich wurde dies auf dem weltgrößten Krebskongress, dem Treffen der American Society of Clinical Oncology (ASCO) in den USA, das jährlich 30000 Krebsexperten aus aller Welt anzieht. Ein Höhepunkt der Tagung war 2008 der Bericht europäischer Onkologen, die Patienten mit fortgeschrittenem Lungenkrebs mit einer neuen Medikamentenkombination behandelt hatten.10 Wurde die neue Antikörpertherapie mit Cetuximab (Erbitux) zusätzlich zu den Zytostatika Cisplatin and Vinorelbin gegeben, überlebten Patienten im Mittel 1,2 Monate länger, 36 Tage. Niemand sollte sich anmaßen, den Wert von fünf Wochen Leben für einen Todkranken zu bemessen. Doch die Krebskranken litten öfter an Fieber, das mit einem bedrohlichen Mangel an weißen Blutkörperchen einherging. Sie klagten häufiger über Hautrötungen, bekamen Durchfall und vertrugen die Infusion seltener. Die Lebensqualität der Patienten während der Therapie wurde für die Studie nicht erhoben. In dem »Lancet«-Beitrag – das Magazin gehört mit dem »New England Journal of Medicine« und dem »JAMA« zu den drei besten medizinischen Fachzeitschriften weltweit – ist von einem »neuen Standard« in der Therapie von Lungenkrebs die Rede. In der Ankündigung auf dem ASCO-Kongress hieß es, die Daten werden »wahrscheinlich entscheidenden Einfluss auf die Betreuung der Patienten« haben.
Haben sie das tatsächlich? »Die einzig vernünftige Schlussfolgerung lautet doch, dass eine vermeintliche neue Wunderwaffe gegen den Krebs gigantisch danebengetroffen hat«, so der Onkologe Tito Fojo und die Ethikerin Christine Grady von den Nationalen Gesundheitsinstituten der USA.11 »Solche Ergebnisse führen zu der viel dringlicheren Frage: Was zählt als Erfolg in der Krebstherapie?« Welchen Preis ist ein so geringer Nutzen wert?
»Statistisch signifikant heißt nicht immer, dass es wichtig für Patienten ist«, sagt Krebsarzt Herbert Kappauf aus Starnberg, der als Psychoonkologe Menschen mit Tumoren begleitet. »Es wird immer weniger mit Patienten besprochen, was ihnen bevorsteht – stattdessen sagen Ärzte: Wir haben da noch was.« Aus Sicht der Patienten ist die Frage hingegen eindeutig: »Krebskranke wollen wissen, wie viel Zeit sie durch eine Therapie gewinnen – und wie sehr sie dabei beeinträchtigt werden«, sagt Onkologe Rochlitz. »Das muss noch viel mehr Thema unter uns Ärzten werden.«
Fragwürdige Therapieerfolge sind kein Einzelfall in der Krebstherapie. Die amerikanische Medikamentenbehörde FDA ließ Cetuximab auch für die Behandlung von fortgeschrittenem Dickdarmkrebs zu – dadurch überleben Patienten im Mittel 1,7 Monate länger. Während der Therapie klagen aber 85 Prozent der Patienten über Hautschäden, 19 Prozent davon über Schäden dritten bis vierten Grades.
Die Liste lässt sich fortsetzen. Bevacizumab – als Avastin bekannt – wurde zum Standardzusatz in der Chemotherapie gegen eine Form von Lungenkrebs. Die FDA begründete dies mit einer verlängerten Überlebenszeit von zwei Monaten. Krebsexperten zweifelten den Nutzen an, denn andere Untersuchungen hatten ergeben, dass lediglich das Tumorwachstum um 0,6 bis 0,4 Monate gebremst, die Lebenszeit aber nicht verlängert wird.
Bei Pankreaskrebs führt der Zusatz von Erlotinib (Tarceva) zu einer verlängerten Überlebenszeit von ganzen zehn Tagen. Während der Therapie treten allerdings mehr Rötungen, Infektionen, häufiger Durchfall und Mundentzündungen auf. »Solche Beispiele sollten Onkologen aufrütteln«, fordern Fojo und Grady. »Es wäre erfreulich, Medikamentenwirkungen besser vorhersagen zu können«, wünscht sich Gerhard Ehninger, langjähriger Präsident der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie (DGHO