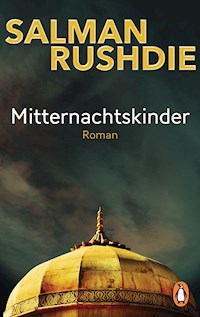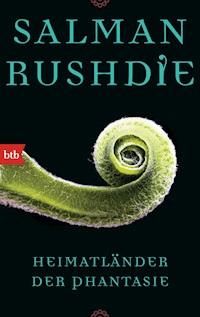
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Phantasie ist überall dort zu Hause, wo Geschichten erzählt werden.
»Heimatländer der Phantasie« ist eine Sammlung von Essays, Rezensionen und Glossen, die Salman Rushdie in den Jahren 1982 bis 1991 für bedeutende Zeitungen und Zeitschriften verfasst hat. Neben politischen und gesellschaftlichen Themen bilden Literaturkritiken einen Schwerpunkt. Rushdie setzt sich u.a. mit den Werken von Gabriel Garcia Manquez, Günter Grass oder Mario Vargas Llosa auseinander und reflektiert dabei auch seine eigene literarische Entwicklung. Denn die Phantasie ist überall dort zu Hause, wo jemand eine Geschichte erzählt – auf wen könnte das besser zutreffen, als auf Rushdie, der zwischen den Kulturen lebt und sich durch das Schreiben eine Heimat zurückerobert?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 688
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Heimatländer der Phantasie ist eine Sammlung von Essays, Rezensionen und Glossen, die Salman Rushdie in den Jahren 1981 bis 1991 für bedeutende Zeitungen und Zeitschriften verfasst hat. Neben politischen und gesellschaftlichen Themen bilden Literaturkritiken einen Schwerpunkt. Rushdie setzt sich u .a. mit den Werken von Gabriel García Márquez, Günter Grass oder Mario Vargas Llosa auseinander und reflektiert dabei auch seine eigene literarische Entwicklung. Denn die Phantasie ist überall dort zu Hause, wo jemand eine Geschichte erzählt - auf wen könnte das besser zutreffen als auf Rushdie, der zwischen den Kulturen lebt und sich durch das Schreiben eine Heimat zurückerobert?
SALMAN RUSHDIE, 1947 in Bombay geboren, studierte in Cambridge Geschichte. Mit seinem Roman Mitternachtskinder wurde er weltberühmt. Seine Bücher erhielten renommierte internationale Auszeichnungen, u.a. den Booker Prize, und sind in zahlreiche Sprachen übersetzt. 1996 wurde ihm der Aristeion-Literaturpreis der EU für sein Gesamtwerk zuerkannt. 2008 schlug ihn die Queen zum Ritter.
SALMAN RUSHDIE
HEIMATLÄNDER DER PHANTASIE
Essays und Kritiken 1981–1991
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel Imaginary Homelands bei Granta Books, London.
1. Auflage
Genehmigte Taschenbuchausgabe November 2014
Copyright © 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991 Salman Rushdie
All rights reserved.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2014 btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Alle Rechte an der Übertragung ins Deutsche bei Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg.
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagmotive: © Julian Winslow/ableimages/Gallery Stock
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
MI · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-14411-1www.btb-verlag.dewww.facebook.com/btbverlagBesuchen Sie unseren LiteraturBlog www.transatlantik.de!
Für meine Mutter Negin Rushdiein Liebe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Erster Teil
Heimatländer der Phantasie
»Errata« oder: Ein unzuverlässigerErzähler in den Mitternachtskindern
Das Rätsel der Mitternacht:Indien, August 1987
Zweiter Teil
Zensur
Das Attentat auf Indira Gandhi
Dynastie
Zia ul-Haq. 17. August 1988
Tochter der Macht
Dritter Teil
Es gibt keine »Commonwealth-Literatur«
Anita Desai
Kipling
Hobson-Jobson
Vierter Teil
Attenboroughs Gandhi
Außerhalb des Wals
Satyajit Ray
Handsworth Songs
Wo liegt Brazil?
Fünfter Teil
Das neue Empire in Großbritannien
Ein unbedeutender Brand
Home Front
V. S. Naipaul
Der Maler und die Pest
Sechster Teil
Allgemeine Wahlen
Charter 88
Über die Identität der Palästinenser:Ein Gespräch mit Edward Said
Siebter Teil
Nadine Gordimer
Rian Malan
Nuruddin Farah
Kapuscinskis Angola
Achter Teil
John Berger
Graham Greene
John Le Carré
Über das Abenteuer
Auf dem Festival von Adelaide
Reisen mit Chatwin
Chatwins Reisen
Julian Barnes
Kazuo Ishiguro
Neunter Teil
Michel Tournier
Italo Calvino
Stephen Hawking
Andrej Sacharow
Umberto Eco
Günter Grass
Heinrich Böll
Siegfried Lenz
Peter Schneider
Christoph Ransmayr
Maurice Sendak und Wilhelm Grimm
Zehnter Teil
Gabriel García Márquez
Mario Vargas Llosa
Elfter Teil
Die Sprache der Karten
Debrett Goes to Hollywood
E. L. Doctorow
Michael Herr: Ein Interview
Richard Ford
Raymond Carver
Isaac Bashevis Singer
Philip Roth
Saul Bellow
Thomas Pynchon
Kurt Vonnegut
Grace Paley
Der mit dem goldenen Esel reist
Der göttliche Supermarkt
Zwölfter Teil
Naipaul unter den Gläubigen
In God We Trust
In gutem Glauben
Ist gar nichts heilig?
1000 Tage im Ballon
Einleitung
Der Titel dieser Sammlung ist einem Essay entnommen, der mein Beitrag zu einem Seminar über indische Literatur in englischer Sprache auf dem Indien-Festival 1982 in London war. Damals regierte Indira Gandhi zum zweiten Mal als Premierministerin von Indien. In Pakistan war nach der Hinrichtung Zulfikar Ali Bhuttos das Zia-Regime damit beschäftigt, seine Macht zu festigen. Großbritannien lag in den ersten Wehen der Thatcher-Revolution, und in den Vereinigten Staaten gab sich Ronald Reagan immer noch als unverbesserlicher Kalter Krieger. Die Weltordnung hatte sich ihre wenig aufregende, altvertraute Form bewahrt.
Die Umwälzungen von 1989 und 1990 haben das alles drastisch verändert. Wenn wir heute die gewandelte Struktur der internationalen Szene betrachten mit ihren neuen Möglichkeiten, Ungewissheiten, Unversöhnlichkeiten und Gefahren, erscheint es uns angebracht, ein paar Gedanken über jenes rasch hinter uns versinkende Jahrzehnt zusammenzufassen, in dem, wie Gramsci es ausgedrückt hätte, das Alte starb, das Neue aber noch nicht geboren werden konnte. »In diesem Interregnum entstehen die unterschiedlichsten morbiden Symptome«, schrieb Gramsci. Das vorliegende Buch ist eine unvollständige, sehr persönliche Übersicht über das Interregnum der 80er-Jahre, deren Symptome, es muss gesagt sein, durchaus nicht alle morbid waren.
Im Jahre 1981 hatte ich gerade meinen ersten Roman veröffentlicht und genoss das einzigartige Gefühl, zum ersten Mal ein Buch geschrieben zu haben, das den Menschen gefiel. Vor den Mitternachtskindern1hatte ich einen Roman eingereicht, der abgelehnt wurde, zwei weitere Projekte von selbst abgebrochen und einen Roman, Grimus, veröffentlicht, der jedoch, vorsichtig ausgedrückt, ein Reinfall wurde. Nun jedoch, nach zehn Jahren Misserfolg, Unzulänglichkeit und Commercials für Sahnetorten, Haarfärbemittel und den Daily Mirror, konnte ich endlich von meiner Schreiberei leben. Ein schönes Gefühl.
An jenem Londoner Seminar nahmen fast alle wichtigen »angloindischen« Schriftsteller teil, darunter Nirad C. Chaudhuri, Anita Desai, Raja Rao, Mulk Raj Anand. Von den Großen fehlte nur R. K. Narayan, obwohl man mir zuvor mitgeteilt hatte, er habe die Einladung angenommen. »Narayan ist so höflich, dass er alle Einladungen akzeptiert«, erklärte mir jemand, »aber erscheint niemals wirklich.« Es war aufregend für mich, diese Schriftsteller kennenzulernen und ihnen zuzuhören. Aber es gab auch ärgerliche Vorkommnisse: So deutete einiges darauf hin, dass manche Teilnehmer die Absicht hatten, die indische Kultur – die ich immer als reiche Melange von Traditionen gesehen hatte – allein und ausschließlich im Hinblick auf die Hindus zu schildern.
Ein anerkannter Romancier begann seinen Auftritt mit dem Vortrag einer Sanskrit-sloka und erklärte anschließend, statt seine Dichtung zu übersetzen: »Jeder gebildete Inder wird verstehen, was ich soeben gesagt habe.« Das war nicht etwa nur intellektueller Größenwahn. In diesem Saal waren indische Schriftsteller und Gelehrte jeder nur vorstellbaren Herkunft versammelt: Christen, Parsen, Moslems, Sikhs. Keiner von uns war in der Sanskrittradition erzogen worden. Aber wir waren alle relativ »gebildet«. Was also wollte er uns damit sagen? Etwa, dass wir gar keine richtigen »Inder« seien?
Später am selben Tag hielt ein hervorragender indischer Akademiker einen Vortrag über die indische Kultur, in dem er sämtliche Minderheiten schlicht ignorierte. Als ihm einer der Zuhörer eine entsprechende Frage stellte, lächelte der Professor gütig und gab zu, dass es in Indien in der Tat zahlreiche verschiedene Traditionen gebe – darunter die der Buddhisten, der Christen und der mughals. Die Moslemkultur mit diesem Wort zu charakterisieren war mehr als absonderlich. Es handelte sich um eine Ausgrenzungstaktik. Denn wenn die Moslems mughals sind, wären sie ausländische Eindringlinge, und die indische Moslemkultur wäre imperialistisch und nicht authentisch. Damals nahmen wir diese Verhöhnung auf die leichte Schulter, aber sie verfolgte und quälte mich noch lange wie ein Dorn, der tief im Fleisch sitzt.
Jetzt, ein Jahrzehnt später, befindet sich Indien in einer massiven Identitätskrise. Religiöse Militanz bedroht die Grundfesten des Säkularstaates. Zahlreiche indische Intellektuelle scheinen heutzutage die nationalistische Staatsdefinition der Hindus zu übernehmen; Minderheitsgruppen reagieren darauf zunehmend mit einem eigenen Extremismus. Bezeichnend ist wohl, dass es im Hindustani kein allgemein gebräuchliches Wort für »Säkularismus« gibt; die große Bedeutung des säkularen Ideals wurde in Indien auf eine eher unkritische Art und Weise ganz einfach vorausgesetzt. Nun, da die kommunalistischen Kräfte die Energie gepachtet zu haben scheinen, geraten die Verteidiger des Säkularismus in helle Aufregung. Gäbe man jedoch das säkularistische Prinzip auf – Indien würde schlicht explodieren. Es ist ein Paradoxon, dass der Säkularismus, der sowohl außerhalb Indiens als auch im Land selbst in jüngster Zeit häufig angegriffen wurde, die einzige Möglichkeit ist, die Verfassungs-, Bürger- und, jawohl, Glaubensrechte der Minderheiten zu schützen. Besitzt Indien noch genug politische Willenskraft, sich diesen Schutz weiterhin zu erhalten? Ich hoffe es sehr. Wir alle müssen es sehr hoffen. Und abwarten.
Die ersten drei Teile dieses Buches behandeln Themen des Subkontinents. Teil eins enthält Arbeiten, die sich mehr oder weniger mit den Mitternachtskindern beschäftigen; Teil zwei befasst sich mit der Politik in Indien und Pakistan, Teil drei mit Literatur. Die angloindische Literatur ist augenblicklich in erstklassigem Zustand. Viele neue Schriftsteller haben sich in den 80er-Jahren einen guten Ruf erworben – Vikram Seth, Allan Sealy, Amitav Ghosh, Rohinton Mistry, Upamanyu Chatterjee, Shashi Tharoor und andere – und liefern Arbeiten von immer größerer Selbstsicherheit und Originalität. Wenn nur die politische Szene ebenso gesund wäre! Aber ach, der Schaden, der dem Leben Indiens durch die sogenannte Emergency – den Ausnahmezustand – zugefügt wurde, das heißt Mrs Gandhis autoritäre Herrschaft von 1974 bis 1977, ist auch heute noch nur allzu eklatant. Der Grund, warum viele von uns so empört waren über die Emergency, ging weit über die diktatorische Atmosphäre jener Tage, über die Festnahme politischer Gegner und die Zwangssterilisierungen hinaus. Der Grund war – wie ich vor sechs Jahren schon in dem Essay erwähnt habe, der hier den Titel »Dynastie« trägt –, dass während der Emergency der Deckel von der Pandorabüchse der Uneinigkeit im Volke gesprengt wurde. Die Büchse mag inzwischen wieder geschlossen sein, die bösen Geister des fanatischen Sektierertums sind aber noch immer am Werk. Indische Maler wie Vivan Sundaram zeigten sich der Herausforderung der Emergency mit Würde gewachsen. Und diese neue Krise werden die indischen Schriftsteller und Künstler zweifellos genauso geschickt bewältigen. Schlechte Zeiten haben schließlich immer schon gute Bücher hervorgebracht.
Der vierte Teil beschäftigt sich hauptsächlich mit Film und Fernsehen. Ich habe an der ursprünglichen Form dieser Arbeiten nur sehr wenig herumgebastelt, muss aber jetzt, nach sieben Jahren, doch sagen, dass ich in »Außerhalb des Wals« George Orwell wie auch Henry Miller gegenüber ein bisschen unfair gewesen bin. Meine Meinung über Richard Attenboroughs Film Gandhi habe ich nicht geändert, man muss jedoch wohl akzeptieren, dass der Film außerhalb von Indien einen vielfach positiven Einfluss ausgeübt hat; radikale und progressive Gruppen und Bewegungen in Südamerika, Osteuropa und auch Südafrika fanden ihn ermutigend. Der Beitrag über die Handsworth Songs löste eine lebhafte Debatte unter den schwarzen Filmemachern in England aus, von denen einige meine Ansichten unterstützten, andere sie kritisierten, alle sie aber faszinierend und, glaube ich, recht hilfreich fanden. Eine Anmerkung noch zu meiner Arbeit über Satyajit Ray. Als ich ihn kennenlernte, drehte er in einer alten Zamindar-Villa mitten im tiefsten ländlichen Bengalen Szenen für The Home and the World. In diesem Herrenhaus sah er zu Recht einen perfekten Schauplatz für seinen Film. Und da auch ich fand, dass ich es recht gut verwenden könne, wurde es zum Vorbild für die Traumvilla »Perownistan«, bewohnt von Mirza Saeed Akhtar und seiner Frau in den Titlipur-Kapiteln der Satanischen Verse. (Den mit Schmetterlingen besetzten Riesenbanyan gab es dort allerdings nicht. Den hatte ich in Südindien gesehen, in der Nähe von Mysore.)
Teil fünf enthält fünf Beiträge über die Erfahrungen von Auswanderern, vor allem indischen Auswanderern in Großbritannien. Von diesen erfordert »Das neue Empire in Großbritannien« wegen seines seltsamen Schicksals einige erklärende Worte. Der Beitrag wurde ursprünglich für die Sendung Options in den frühen Anfängen von Channel 4 verfasst. (Als zweiter Teil dieser Serie, unmittelbar gefolgt von E. P. Thompson.) Die vielen britischen Schwarzen und Asiaten, die daraufhin anriefen oder schrieben, bestätigten mir fast einstimmig, der Vortrag enthalte die reine Wahrheit. In ihren Augen war ich weit über das Einmaleins rassistischer Vorurteile in Großbritannien hinausgelangt. Davon abgesehen gab es jedoch, kaum überraschend, feindselige Reaktionen von einigen Angehörigen der weißen Bevölkerung, obwohl diejenigen weißen Briten, die meine Arbeit informativ und nützlich fanden, Ersteren zahlenmäßig weit überlegen waren. Meine Absicht war recht simpel gewesen: der weißen Mehrheit aufzuzeigen, wie die Angehörigen der Rassenminderheiten in Großbritannien nur allzu oft leben müssen. (Ich selbst habe mein Leben lang rassischen Minderheiten angehört: als Mitglied einer indischen Moslemfamilie in Bombay, dann einer mohajir, das heißt Einwandererfamilie, in Pakistan und jetzt als asiatischer Brite.) Indem ich einer Klage Ausdruck verlieh, vermochte ich Brücken des Verstehens zu bauen – das hoffte ich jedenfalls.
Ich hatte Fernsehprogramme immer für vergänglich gehalten, nur für den flüchtigen Moment gemacht. Aber wir standen am Anfang des Videobooms, und so kursierte eine Aufnahme von dieser Sendung in den verschiedensten Kreisen, so auch in der Commission for Racial Equality und ähnlichen Organisationen. Ich hatte in einem bestimmten Augenblick der Geschichte der britischen Rassenbeziehungen mündlich und schriftlich das Wort ergriffen. Diese Beziehungen machten Fortschritte, entwickelten und veränderten sich. Manches (mehr schwarze Gesichter in den Fernsehprogrammen und den Werbeblöcken) wurde ein bisschen besser, anderes (Rassenunruhen) wurde schlimmer. Aber das Videoband blieb immer dasselbe.
Was ich – möglicherweise allzu naiv – nicht vorausgesehen hatte, war die Tatsache, dass der Text des Beitrages von Menschen mit einer anderen politischen Meinung verdreht, verfälscht und gegen mich verwendet werden würde. Ich wurde sowohl von Geoffrey Howe als auch von Norman Tebbit beschuldigt, Großbritannien mit Nazi-Deutschland verglichen und dadurch mein Adoptivvaterland »verraten und beleidigt« zu haben. Nun stimmt es zwar, dass der Text dieses Essays bewusst polemisch ist, und das hat die Howes und Tebbits in diesem Land zweifellos verärgert. Ich entschuldige mich nicht für meinen Zorn über Rassenvorurteile. Aber in meiner Stellungnahme wird immer wieder darauf hingewiesen, dass das Leben unter dem Nationalsozialismus oder der Apartheid nicht mit der Lage in Großbritannien zu vergleichen ist. Das möchte ich an dieser Stelle betonen, weil Verdrehungen und Verfälschungen die Neigung haben, durch häufige Wiederholung mehr oder weniger wahr zu werden. Der »Nazi-England«-Vorwurf hat inzwischen lange genug überlebt. Die Wiederveröffentlichung meines Vortrags »Das neue Empire in Großbritannien« in diesem Buch ermöglicht es dem Leser, selbst zu entscheiden, ob er gerechtfertigt war oder nicht.
Ich bin natürlich keineswegs der einzige englische Schriftsteller, der in den vergangenen Jahren unter Beschuss geriet. Die letzte Dekade war gekennzeichnet von der regelmäßigen Schelte, mit der die Presse uns alle belegte, die wir gegen den Tenor des Thatcherismus schrieben. Ian McEwan wurde von einem leitenden Mitarbeiter der Sunday Times wegen seines Romans Ein Kind zur Zeit beschimpft, Harold Pinter wegen seiner Meinung über die amerikanische Politik in Nicaragua. Margaret Drabble wurde als ehrenwert, »hampsteadisch« und langweilig bezeichnet. Zwischendurch tat man diese und andere Schriftsteller dann wiederum als »Champagnersozialisten« ab. Und zwar nur, weil ihre Bücher, Stücke und Filme populär waren. Wären die Arbeiten unpopulär gewesen, hätte man sie zweifellos als Misserfolge angegriffen. Es war ein Jahrzehnt, in dem man es niemandem ganz recht machen konnte.
Teil sechs besteht aus drei Abschnitten – Reflexionen über die Thatcher/Foot-Wahl, über die Charter 88 und die Palästinafrage –, allesamt von der, wie ich vermute, Beschimpfung provozierender Art.
Die folgenden fünf Teile – über Schriftsteller aus Afrika, Großbritannien, Europa, Südamerika und den Vereinigten Staaten – bedürfen keiner Anmerkung. Der letzte Teil befasst sich dann mit einem Thema – nämlich der Krise, die mein Roman Die Satanischen Verse auslöste –, über das schon viel zu viele Kritiken veröffentlicht wurden. Dem habe ich wenig hinzuzusetzen. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Vernunft allmählich den Zorn aus dem Mittelpunkt der Debatte verdrängt, dass die Feuer des Hasses nach und nach von Verständnis gelöscht werden. Dieser Prozess muss gefördert werden, und ich werde natürlich weiterhin meinen Teil dazu beitragen.
Zuletzt noch ein paar wichtige Worte der Anerkennung. Mein Dank gilt den ursprünglichen Herausgebern all dieser Arbeiten, darunter London Review of Books, The Guardian, Index on Censorship, Observer, die Literaturzeitschrift Granta, The Times, American Film, New Society, New York Times, Washington Post, New Republic, Times Literary Supplement und Independent on Sunday, er gilt vor allem Bill Webb und Blake Morrison, den Besten aus zwei Generationen englischer Literaturherausgeber. Meinen Dank ebenfalls an Bill Buford, Bob Tashman und all jene von Granta Books, die mir geholfen haben, dieses Buch zusammenzustellen. Edward Said gestattete mir freundlicherweise den Nachdruck der Protokolle unserer öffentlichen Diskussion im Institute of Contemporary Arts. Und Susannah Clapp, die aus dem Text eines Essays den Satz herausgefischt hat, der zunächst sein und nun der Titel dieses Buches wurde, umarme ich in Dankbarkeit.
1991
1 Bücher und Filme werden im Folgenden mit dem deutschen Titel aufgeführt, sofern eine deutsche Fassung vorliegt; zwecks besseren Verständnisses werden ausländische Titel gegebenenfalls sinngemäß übersetzt (in Klammern). Anm. d. Red.
Erster Teil
Heimatländer der Phantasie
»Errata« oder:Ein unzuverlässiger Erzählerin den Mitternachtskindern
Das Rätsel der Mitternacht:Indien, August 1987
Heimatländer der Phantasie
In meinem Arbeitszimmer hängt in einem billigen Rahmen ein altes Foto an der Wand. Das Bild aus dem Jahre 1946 zeigt ein Haus, in dem ich zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht geboren war. Das Haus wirkt ein wenig sonderbar: dreistöckig, mit Giebel, Ziegeldach und runden Türmen rechts und links, die jeder einen spitzen Ziegelhut tragen. »Die Vergangenheit ist ein fremdes Land«, lautet der berühmte erste Satz von L. P. Hartleys Roman The Go-Between, »in dem alles anders gemacht wird.« Aber das Foto rät mir, diesen Gedanken umzukehren; es erinnert mich daran, dass für mich die Gegenwart fremdländisch ist und die Vergangenheit die Heimat, wenn auch eine verlorene Heimat in einer verlorenen Stadt in den Nebeln einer verlorenen Zeit.
Nachdem ich über die Hälfte meines Lebens fort gewesen war, besuchte ich vor ein paar Jahren noch einmal meine verlorene Stadt: Bombay. Kurz nach meiner Ankunft schlug ich spontan das Telefonbuch auf und suchte den Namen meines Vaters. Und oh Wunder, da standen sie tatsächlich: sein Name, unsere alte Adresse, die Telefonnummer – so unverändert, als wären wir nie in jenes unsägliche Land jenseits der Grenze gezogen. Eine unheimliche Entdeckung! Es kam mir vor, als würde ich irgendwie beansprucht, gefordert oder davon in Kenntnis gesetzt, dass alle Fakten meines fernen Lebens Illusionen seien, diese Kontinuität dagegen Wirklichkeit. Dann besuchte ich das Haus auf dem Foto und stand davor, wagte es aber nicht – und wünschte es mir auch nicht –, mich seinen neuen Bewohnern vorzustellen. (Ich wollte nicht sehen, wie sie die Innenräume verschandelt hatten.) Ich war überwältigt. Das Foto war natürlich ein Schwarzweißabzug; und in der Erinnerung, genährt von Bildern, ähnlich wie diesem, hatte ich allmählich begonnen, meine Kindheit genauso zu sehen: monochrom. Die Farben meiner Lebensgeschichte waren vor meinem inneren Auge verblasst; daher wurden meine beiden anderen Augen nun auf einmal von den Farben überfallen, von dem lebhaften Rot der Ziegel, dem gelb gerandeten Grün der Kaktusblätter, dem Glühen der Bougainvilleen. Es wäre vermutlich nicht übertrieben romantisch, zu sagen, dass das der Augenblick war, in dem mein Roman Mitternachtskinder wirklich geboren wurde: als mir klar wurde, wie sehr ich mir wünschte, die Vergangenheit für mich wiederaufleben zu lassen – nicht in den verblassten Grautönen der Schnappschüsse aus dem Familienalbum, sondern perfekt, in Cinemascope und leuchtendem Technicolor.
Bombay ist eine Stadt, die von Ausländern auf vom Meer zurückgewonnenem Boden erbaut wurde; und ich, der ich so lange fort gewesen war, dass diese Bezeichnung fast auch auf mich passte, kam zu der Überzeugung, dass auch ich eine Stadt und eine Lebensgeschichte zurückzugewinnen hatte.
Mag sein, dass Schriftsteller in meiner Lage, Exilanten, Emigranten oder Verbannte, von diesem selben Gefühl des Verlustes verfolgt werden: von dem Verlangen zurückzublicken, selbst wenn man Gefahr läuft, in eine Salzsäule verwandelt zu werden. Aber wenn wir dennoch zurückblicken, müssen wir es in dem – tiefe Unsicherheit auslösenden – Bewusstsein tun, dass unsere physische Entfremdung von Indien fast zwangsweise bedeutet, dass es uns nicht gelingen wird, haargenau das zurückzugewinnen, was wir verloren haben; dass wir, kurz gesagt, Fiktionen erschaffen, nicht tatsächliche Städte oder Dörfer, sondern unsichtbare, imaginäre Heimatländer, ein jeder sein ganz persönliches Indien der Phantasie.
Während ich in Nordlondon an meinem Buch schrieb und vor dem Fenster eine Großstadtszene sah, die so ganz anders war als jene, die ich auf dem Papier erfand, wurde ich so lange von diesem Problem verfolgt, bis ich mich genötigt sah, es auch im Text anzusprechen, deutlich zu machen, dass ich (trotz meiner ursprünglichen und, wie ich vermute, irgendwie proustschen Ambition, die Tore der verlorenen Zeit aufzuschließen, damit die Vergangenheit so zurückkehre, wie sie wirklich gewesen war, unberührt von den Verzerrungen der Erinnerung) im Grunde einen Roman der Erinnerung und über die Erinnerung schrieb, dass mein Indien also ebendieses war: »mein« Indien, eine Version und nicht mehr als eine Version all jener Hunderter von Millionen möglicher Versionen. Ich versuchte es so phantasievoll-echt zu machen, wie ich es vermochte, doch phantasievolle Echtheit ist zugleich ehrlich und verdächtig, und mir war klar, dass mein Indien möglicherweise nur eines war, zu dem zu gehören ich (der ich nicht mehr bin, was ich war, und der, indem er Bombay verließ, nicht das wurde, was zu werden ihm vielleicht bestimmt war), sagen wir mal, zuzugeben bereit bin.
Deswegen gestaltete ich Saleem, meinen Erzähler, in seiner Schilderung ein wenig fragwürdig; seine Irrtümer sind die Irrtümer eines fehlbaren Erinnerungsvermögens, ergänzt durch Winkelzüge des Charakters und der Umstände, und seine Vision ist bruchstückhaft. Vielleicht ist der indische Schriftsteller, der außerhalb seiner Heimat schreibt und versucht, jene Welt wiederzugeben, einfach gezwungen, zerbrochene Spiegel zu verwenden, von deren Scherben einige unwiederbringlich verloren sind.
Aber da gibt es ein Paradoxon. Der zerbrochene Spiegel könnte genauso wertvoll sein wie jener, der angeblich unbeschädigt ist. Ich will versuchen, dies anhand meiner eigenen Erfahrungen zu erklären. Bevor ich mit den Mitternachtskindern begann, verbrachte ich viele Monate nur mit dem Versuch, mich an möglichst vieles aus dem Bombay der Fünfziger- und Sechzigerjahre zu erinnern; und nicht nur aus Bombay, sondern genauso aus Kashmir, Delhi und Aligarh, das ich in meinem Buch nach Agra verlegt habe, um einem bestimmten Scherz über das Taj Mahal mehr Würze zu verleihen. Ich habe mich ehrlich gewundert, wie viele Dinge ich mir ins Gedächtnis zurückzurufen vermochte. Ich merkte, dass ich mich an die Kleidung erinnerte, die gewisse Personen an bestimmten Tagen getragen hatten, an Schulszenen und verbatim an ganze Passagen aus Gesprächen in Bombay. Das heißt, es schien mir jedenfalls so; sogar an Reklamen erinnerte ich mich, an Filmplakate, das Jeep-Neonschild am Marine Drive, Zahnpastawerbung für Binaca und Kolynos und an eine Fußgängerbrücke über das Gleis der Kleinbahn, an die auf einer Seite der Spruch »Esso packt den Tiger in den Tank« und auf der anderen die komisch widersprüchliche Warnung geschrieben war: »Fahr wie der Teufel, und du bist bald bei ihm.« Aus dem Nichts tauchten alte Songs in meiner Erinnerung auf: die Version eines Straßensängers von Good Night, Ladies, und aus dem Film Mr 420 (eine äußerst passende Quelle, aus der mein Erzähler schöpfte) der Hitsong Mera Joota Hai Japani,2der beinah Saleems Themasong sein könnte.
Ich wusste, dass ich eine reiche Ader angezapft hatte; aber der Punkt, auf den ich hinweisen will, ist natürlich der, dass ich nicht die Gabe absoluter Erinnerung besitze und dass es gerade die Unvollkommenheit dieser Erinnerungen ist, ihre fragmentarische Natur, die sie für mich so lebendig macht. Die Scherben meiner Erinnerung gewannen einen höheren Rang, eine größere Resonanz, weil sie eben Bruchstücke waren; ihre fragmentarische Natur ließ trivialste Dinge wie Symbole wirken, und das Weltliche nahm überirdische Eigenschaften an. Hierzu gibt es eine Parallele in der Archäologie. Die zerbrochenen Krüge der Antike, aus denen die Vergangenheit zuweilen zwar rekonstruiert werden kann, aber immer nur provisorisch, sind aufregend, wenn man sie entdeckt, obwohl sie Bruchstücke alltäglichster Gegenstände sind.
Man könnte einwenden, die Vergangenheit sei ein Land, aus dem wir alle emigriert sind, und ihr Verlust Bestandteil unserer gemeinsamen Menschlichkeit. Was ich natürlich für zutreffend halte; dennoch möchte ich behaupten, dass der Schriftsteller, der außerhalb seiner Heimat und sogar außerhalb seines Sprachgebiets lebt, diesen Verlust weitaus intensiver empfindet. Möglicherweise wird er für ihn durch die physische Tatsache der Diskontinuität konkreter, die Tatsache, dass seine Gegenwart an einem anderen Ort stattfindet als seine Vergangenheit, dass er »anderswo« ist. Und eben das befähigt ihn vielleicht dazu, sich treffend und konkret über ein Thema von weltweiter Bedeutung und Aufmerksamkeit zu äußern.
Aber ich möchte noch weitergehen. Der zerbrochene Spiegel ist nicht nur ein Spiegel der Nostalgie, sondern ebenso, glaube ich, ein nützliches Instrument für die Arbeit in der Gegenwart. John Fowles beginnt seinen Daniel Martin mit den Worten: »Das Ganze sehen: Alles andere ist Trostlosigkeit.« Aber menschliche Wesen nehmen die Dinge nicht in ihrer Ganzheit wahr; wir sind keine Götter, sondern verwundete Kreaturen, zersprungene Linsen, nur zu gebrochener Wahrnehmung fähig. Partielle Wesen, in jedem Sinne dieses Wortes. Bedeutung ist eine wacklige Konstruktion, die wir aus Bruchstücken errichten, aus Dogmen, Kindheitskränkungen, Zeitungsartikeln, zufälligen Bemerkungen, alten Filmen, kleinen Siegen, verhassten Menschen, geliebten Menschen; vielleicht verteidigen wir unser Gefühl für das, was real ist, nur deswegen so verzweifelt, selbst bis in den Tod, weil dieses Gefühl aus so unzulänglichen Materialien zusammengesetzt ist. Von Fowles’ Einstellung zu einer guruhaft-illusionären Weltsicht scheint es mir nur noch ein kleiner Schritt zu sein. Schriftsteller sind keine Weisen mehr, die die Wahrheit der Jahrhunderte verbreiten. Und jene von uns, die sich durch kulturelle Vertreibung gezwungen sehen, die provisorische Natur aller Wahrheiten, aller Gewissheiten zu akzeptieren, mögen sich den Modernismus haben aufzwingen lassen. Da wir den Olymp nicht für uns beanspruchen können, steht es uns frei, unsere Welten so zu schildern, wie wir alle sie, Schriftsteller oder nicht, Tag für Tag beobachten.
In den Mitternachtskindern benutzt Saleem, mein Erzähler, einmal die Metapher einer Filmleinwand, um das Thema Wahrnehmung zu behandeln: »Stell dir vor, du bist in einem großen Kino. Anfangs sitzt du in der hintersten Reihe, schiebst dich aber immer weiter nach vorn … bis du mit der Nase fast an die Leinwand stößt. Allmählich lösen sich die Gesichter der Stars in tanzende Körner auf; winzige Details nehmen groteske Proportionen an … wird klar, dass die Illusion selbst Realität ist.« Die Bewegung in Richtung Kinoleinwand ist eine Metapher für die Bewegung einer Erzählung durch die Zeit auf die Gegenwart zu, und das Buch selbst verliert, je mehr es sich gegenwärtigen Ereignissen nähert, bewusst die Tiefenperspektive und wird »partiell«. Ich habe nie versucht, über (zum Beispiel) die Emergency auf dieselbe Art und Weise zu schreiben wie über Geschehnisse, die ein halbes Jahrhundert früher stattfanden. Weil ich es nicht für ehrlich hielt vorzugeben, es sei möglich, das ganze Bild zu sehen, während man über den vorgestrigen Tag schreibt, zeigte ich nur gewisse Punkte und Abschnitte der Szene.
Einmal nahm ich an einer Konferenz über modernes Schreiben am New College von Oxford teil. Verschiedene Romanciers, darunter auch ich, diskutierten ernsthaft über Themen wie etwa die notwendige Suche nach neuen Möglichkeiten, die Welt zu beschreiben. Der Dramatiker Howard Brenton meinte, das sei ein eher begrenztes Ziel: Will denn die Literatur nicht mehr als nur beschreiben? Nervös geworden, wandten sich die Romanciers umgehend wieder ihren politischen Diskussionen zu.
Hier möchte ich Brentons Frage auf den speziellen Fall indischer Schriftsteller anwenden, die in England über Indien schreiben. Können sie wirklich nicht mehr tun, als aus der Ferne die Welt zu beschreiben, die sie verlassen haben? Oder öffnet eben diese Distanz ganz neue Türen?
Das sind natürlich politische Fragen, die wenigstens zum Teil mit politischen Begriffen beantwortet werden müssen. Zunächst muss ich vor allem sagen, dass die Beschreibung an sich eine politische Handlung ist. Der schwarzamerikanische Schriftsteller Richard Wright schrieb einmal, dass schwarze und weiße Amerikaner einen Kampf über das Wesen der Realität ausfechten. Ihre Beschreibungen seien unvereinbar. Somit steht fest, dass die Neubeschreibung einer Welt zwangsläufig der erste Schritt zu ihrer Veränderung ist. Und vor allem in Zeiten, da der Staat die Realität selbst in die Hände nimmt und sich daranmacht, sie zu verzerren, da er die Vergangenheit so lange verändert, bis sie seinen gegenwärtigen Bedürfnissen entspricht, wird die Schaffung alternativer Realitäten der Kunst, darunter des Romans der Erinnerung, politisiert. »Der Kampf des Menschen gegen die Macht«, schreibt Milan Kundera, »ist der Kampf der Erinnerung gegen das Vergessen.« Schriftsteller und Politiker sind natürliche Feinde. Beide Gruppen sind bestrebt, die Welt nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten; sie kämpfen um dasselbe Territorium. Und der Roman ist eine Möglichkeit, der offiziellen Version der Wahrheit, der Version der Politiker, zu widersprechen.
Die »Staatswahrheit« über den Krieg in Bangladesch zum Beispiel lautet, dass von der pakistanischen Armee in dem Teil, der damals der sogenannte Ostflügel war, keinerlei Gräueltaten begangen wurden. Diese Version wird von zahlreichen Personen bestätigt, die sich selbst als Intellektuelle bezeichnen würden. Und die offizielle Version der Emergency in Indien wurde kürzlich von Mrs Gandhi sehr schön in einem BBC-Interview ausgedrückt. Es gebe Menschen, sagte sie, die behaupteten, dass während der Emergency schreckliche Dinge geschehen seien, Zwangssterilisierungen und Ähnliches; aber, erklärt sie, das sei alles falsch. Nichts dergleichen sei je vorgekommen. Mr Robert Kee, der Interviewer, ging dieser Behauptung nicht nach, sondern erklärte Mrs Gandhi und den Zuhörern von Panorama stattdessen, sie habe immer wieder bewiesen, dass man sie mit Recht als Demokratin bezeichnen könne.
Also kann die Literatur – und muss es wohl sogar – die offiziellen Fakten Lügen strafen. Ist das aber eine angemessene Funktion für jene von uns, die außerhalb Indiens schreiben? Oder sind wir doch nichts als Dilettanten in derartigen Angelegenheiten, weil wir nichts mit ihrer tagtäglichen Weiterentwicklung zu tun haben, weil wir, wenn wir den Mund aufmachen, keinerlei Risiko eingehen, weil unsere persönliche Sicherheit nicht gefährdet ist? Welches Recht haben wir, überhaupt den Mund aufzumachen?
Meine Antwort ist einfach. Die Literatur rechtfertigt sich selbst. Das heißt, ein Buch ist nicht dadurch gerechtfertigt, dass sein Autor würdig ist, es zu schreiben, sondern durch die Qualität dessen, was er geschrieben hat. Es gibt schreckliche Bücher, die unmittelbar aus der Erfahrung entstehen, und außergewöhnlich phantasievolle Schriften über Themen, denen sich der Autor nur von außen zu nähern vermochte.
Es ist nicht Aufgabe der Literatur, bestimmten Gruppen das Copyright für bestimmte Themen zu erteilen. Und was das Risiko betrifft: Die eigentlichen Risiken geht jeder Künstler bei seiner Arbeit ein, wenn er in dem Versuch, die Summe dessen, was zu denken im Bereich des Möglichen liegt, die Arbeit bis an die Grenzen des Möglichen vorantreibt. Bücher werden gut, wenn sie bis zu diesem schmalen Grat gehen und das Risiko auf sich nehmen, auf der anderen Seite abzustürzen – wenn sie den Künstler durch das gefährden, was er künstlerisch gewagt oder nicht gewagt hat.
Wenn ich also für die indischen Schriftsteller in England spreche, würde ich in freier Wiedergabe von G. V. Desanis H. Hatterr sagen: Die Migrationen der Fünfziger- und Sechzigerjahre haben stattgefunden. »Wir sind. Wir sind hier.« Wir sind nicht bereit, uns von irgendeinem Teil unseres Erbes ausgrenzen zu lassen; und dieses Erbe schließt sowohl das Recht eines in Bradford geborenen Inderkindes ein, als volles Mitglied der britischen Gesellschaft behandelt zu werden, als auch das Recht eines jeden Mitglieds dieser Post-Diaspora-Gemeinschaft, für seine Kunst aus ihren Wurzeln zu schöpfen, wie es die weltweite Gesamtheit vertriebener Schriftsteller schon immer getan hat. (Ich denke da zum Beispiel an das zu Gdansk gewordene Danzig von Günter Grass, an das von Joyce verlassene Dublin, an Isaac Bashevis Singer, Maxine Hong Kingston, Milan Kundera und viele andere; die Liste ist lang.)
Dabei möchte ich zunächst den ein wenig trotzigen Ton zurücknehmen, der sich in diese letzte Bemerkung eingeschlichen hat. Wenn der indische Schriftsteller auf Indien zurückblickt, benutzt er dabei eine von Schuldbewusstsein getönte Brille. (Ich spreche natürlich wieder einmal von mir selbst.) Ich beziehe mich hier auf jene von uns, die ausgewandert sind … und vermute, dass es für uns alle Zeiten gibt, da uns diese Entscheidung falsch erscheint, da wir uns selbst wie Männer und Frauen nach dem Sündenfall fühlen. Wir sind Hindus, die das schwarze Wasser überquert haben; wir sind Moslems, die Schweinefleisch essen. Und gehören infolgedessen – wie die Tatsache andeutet, dass ich selbst den christlichen Begriff Sündenfall verwende – inzwischen teilweise zum Westen. Unsere Identität ist mehrfach und zugleich partiell. Manchmal haben wir das Gefühl, mit je einem Bein in zwei Kulturen gleichzeitig zu stehen; dann wiederum, zwischen zwei Stühlen zu sitzen. Aber so unsicher und veränderlich dieser Boden auch sein mag, er ist kein unfruchtbares Territorium für einen Schriftsteller. Wenn es in der Literatur zum Teil darum geht, neue Möglichkeiten für den Eintritt in die Realität zu finden, dann kann uns wieder einmal unsere Distanz, unsere lange geografische Perspektive derartige Möglichkeiten bieten. Vielleicht aber müssen wir ganz einfach daran glauben, um unsere Arbeit leisten zu können.
Die Mitternachtskinder gehen ihr Thema vom Standpunkt eines säkular eingestellten Menschen an. Ich gehöre zu jener Generation von Indern, denen das weltliche Ideal eingetrichtert wurde. Eines der Dinge, die mir an Indien gefielen und immer noch gefallen, ist die Tatsache, dass es sich auf eine nicht sektiererische Philosophie stützt. Ich bin nicht in einem engstirnigen Moslemmilieu aufgewachsen; für mich ist die Hindukultur weder fremdartig noch wichtiger als die islamische Religion. Ich glaube, das hat etwas mit dem Charakter der Stadt Bombay zu tun, einer Metropole, in der die Vielzahl durcheinandergewürfelter Glaubensrichtungen und Kulturen seltsamerweise ein bemerkenswert säkulares Ambiente ergeben. Saleem Sinai macht sich eklektisch jegliches Element aus jeglicher Quelle zunutze, das ihm gelegen kommt. Für seinen Autor war es vielleicht einfacher, das außerhalb des modernen Indien zu tun als innerhalb.
Ein letztes Wort noch über die Schilderung Indiens, die in den Mitternachtskindern angestrebt wird. Es handelt sich um den Pessimismus. Das Buch ist in Indien wegen seiner angeblich hoffnungslosen Atmosphäre kritisiert worden. Und die Verzweiflung des »Schriftstellers von außen« mag in der Tat ein wenig oberflächlich, ein wenig simpel wirken. Ich aber empfinde das Buch nicht als verzweifelt oder nihilistisch. Der Standpunkt des Erzählers ist nicht völlig identisch mit dem des Autors. Ich habe versucht, eine gewisse Spannung in den Text zu bringen, eine paradoxe Opposition zwischen Form und Inhalt der Erzählung. Saleems Geschichte stürzt ihn tatsächlich in Verzweiflung. Doch die Geschichte wird auf eine Art und Weise erzählt, die das indische Talent zur Regeneration so gut widerspiegeln soll, wie es mir bei meinen Fähigkeiten möglich war. Deswegen tauchen in der Erzählung immer wieder neue Geschichten auf, deswegen »schäumt sie über«. Die Form – mannigfaltig, ein Hinweis auf die unendlichen Möglichkeiten dieses Landes – ist das optimistische Gegengewicht zu Saleems persönlicher Tragödie. Ich glaube nicht, dass man ein so geschriebenes Buch wirklich als pessimistisch bezeichnen kann.
Englands indische Schriftsteller sind keineswegs alle vom selben Stamm. Manche von uns sind zum Beispiel Pakistani. Andere Bangladeschi. Wieder andere West-, Ost- oder sogar Südafrikaner. Und V. S. Naipaul ist inzwischen wieder etwas ganz anderes. »Indisch« wird allmählich zu einem ziemlich konfusen Begriff. Zu den indischen Schriftstellern in England gehören politische Exilanten, Einwanderer der ersten Generation, reiche Verbannte, die hier oft nur vorübergehend Wohnsitz nehmen, eingebürgerte Briten und Menschen, die hier geboren sind und den Subkontinent möglicherweise niemals gesehen haben. Daher kann ganz eindeutig nichts von dem, was ich sage, auf all diese Kategorien zutreffen. Interessant an dieser bunt gemischten Gemeinde ist jedoch, dass ihre Existenz, soweit es die angloindische Romanliteratur angeht, die Szene verändert, denn diese Literatur wird in Zukunft nicht weniger oft aus London, Birmingham und Yorkshire kommen als aus Delhi oder Bombay.
Eine der Veränderungen hat etwas mit der Einstellung zum Gebrauch des Englischen zu tun. Immer wieder wird die Frage gestellt, ob diese Sprache den rein indischen Themen angemessen sei. Und wie ich hoffe, sind wir alle gleichermaßen der Ansicht, dass wir das Englische keineswegs einfach genauso gebrauchen können wie die Briten, sondern dass man es für unsere Zwecke ganz neu gestalten muss. Jene von uns, die das Englische benutzen, tun das trotz ihrer zwiespältigen Einstellung zu dieser Sprache, vielleicht aber auch gerade deswegen, vielleicht, weil wir in diesem linguistischen Kampf die Spiegelung anderer Kämpfe sehen, die in der realen Welt stattfinden, die Kämpfe zwischen den Kulturen in uns selbst und den Einflüssen auf unsere Gesellschaften. Die englische Sprache zu bewältigen bedeutet vielleicht die Vollendung unseres Strebens nach Freiheit.
Aber der angloindische Schriftsteller hat überhaupt keine Möglichkeit, das Englische abzulehnen. Seine Kinder, ihre Kinder werden damit aufwachsen, es vermutlich als Erstsprache lernen; und bei der Schaffung einer angloindischen Identität ist die englische Sprache von zentraler Bedeutung. Man muss sie sich daher trotz allem zu eigen machen. (Das englische Wort translation für Übersetzung, Übertragung kommt etymologisch vom lateinischen Ausdruck für »übertragen«. Da wir quer über die Welt getragen wurden, sind auch wir selbst translated – übertragene Menschen. Normalerweise wird vorausgesetzt, dass bei der Übersetzung immer etwas verloren geht; ich halte hartnäckig an der Auffassung fest, dass genauso etwas gewonnen werden kann.)
Ein indischer Schriftsteller in dieser Gesellschaft zu sein bringt tagtäglich Definitionsprobleme. Was bedeutet es, außerhalb Indiens »indisch« zu sein? Wie kann man eine Kultur bewahren, ohne dass sie dabei verknöchert? Wie sollen wir die Notwendigkeit einer Veränderung in uns selbst und in unserer Gemeinschaft diskutieren, ohne unseren rassischen Feinden dabei scheinbar in die Hände zu spielen? Was sind die – geistigen und praktischen – Folgen einer Weigerung, irgendwelche Konzessionen an westliche Ideen und Praktiken zu machen? Was sind die Folgen der Übernahme jener Ideen und Praktiken und der Abwendung von denen, die wir hierher mitgebracht haben? Diese Fragen münden allesamt in eine einzige, existenzielle Frage: Wie sollen wir in dieser Welt leben?
Ich maße mir nicht an, eine verbindliche Antwort auf diese Fragen zu geben; es geht mir nur darum festzustellen, dass dies einige der Punkte sind, mit denen sich jeder Einzelne von uns arrangieren muss.
Nun möchte ich den Blick nach außen richten und ein paar Worte über das Verhältnis des indischen Schriftstellers zur Majorität der weißen Kultur äußern, in deren Mitte er lebt und mit der sich seine Arbeit früher oder später auseinandersetzen muss:
Genau wie zahlreiche in Bombay aufgewachsene Mittelschichtkinder meiner Generation wurde ich mit gründlichen Kenntnissen und sogar einem gewissen Freundschaftsgefühl für eine ganz bestimmte Art England aufgezogen: ein Traumengland, bestehend aus Kricketvergleichsspielen zwischen England und dem Commonwealth bei Lord’s, geleitet von John Arlotts Stimme, bei denen Freddie Truman unaufhörlich und erfolglos auf Polly Umrigar wirft; aus Enid Blyton und Billy Bunter, bei denen wir sogar bereit waren, nachsichtig über Porträts wie das des Hurree Jamset Ram Singh, »des dunkelhäutigen Nabobs von Bhanipur«, zu lächeln. Ich wollte unbedingt nach England. Konnte es kaum abwarten. Und ehrlich gesagt hat England mich gut behandelt; dennoch fällt es mir ein wenig schwer, angemessen dankbar zu sein. Denn ich komme nicht von dem Eindruck los, dass mein relativ leichter Weg nicht das Ergebnis des im Traumengland vorherrschenden, berühmten Sinnes für Toleranz und Fairplay ist, sondern meiner Gesellschaftsschicht, meiner außergewöhnlich hellen Haut und meines sehr »englischen« Akzents. Nimmt man einen dieser Faktoren fort, wäre die Story anders verlaufen. Denn das Traumengland ist natürlich eben nur das: ein Traum.
Leider jedoch ein Traum, aus dem zu viele weiße Briten einfach nicht erwachen wollen. Vor Kurzem fragte mich ein Profihumorist in einer Rundfunklivesendung allen Ernstes, was ich denn dagegen hätte, als wog bezeichnet zu werden. Er persönlich habe das immer für ein eher hübsches Wort gehalten, einen liebevollen Ausdruck. »Als ich neulich mal im Zoo war«, berichtete er, »erzählte mir ein Zoowärter, die wogs könnten am besten mit Tieren umgehen; sie steckten sich die Daumen in die Ohren, wackelten mit den Fingern, und die Tiere fühlten sich sofort zu Hause.« Der Geist von Hurree Jamset Ram Singh spukt also noch immer bei uns herum.
Wie Richard Wright vor langer Zeit in Amerika feststellte, sind die schwarzen und weißen Beschreibungen der Gesellschaft nicht mehr miteinander vereinbar. Eine Methode, mit diesen Problemen fertigzuwerden, ist die Phantasie oder das Vermischen von Phantasie und Naturalismus. Sie bietet die Möglichkeit, im Rahmen unserer Arbeit alle Fragen anzuschneiden, mit denen wir konfrontiert sind: wie man eine neue, »moderne« Welt aus einer alten, von Legenden verfolgten Zivilisation entstehen lassen kann, einer alten Kultur, die wir mitten ins Herz einer neueren getragen haben. Doch welche technischen Lösungen auch immer wir finden werden, die indischen Schriftsteller auf diesen Inseln sind, wie andere, die vom Süden in den Norden emigriert sind, in der Lage, aus einer Art Doppelperspektive heraus zu schreiben: weil sie – wir – in dieser Gesellschaft gleichzeitig Insider und Outsider sind. Und diese »Stereosicht« ist es vielleicht, was wir anstelle der »Ganzsicht« bieten können.
Noch einen letzten Gedanken gibt es, den ich näher untersuchen möchte, obwohl er beim ersten Hinhören einem großen Teil dessen widersprechen mag, was ich bisher gesagt habe. Er lautet: Von all den vielen Elefantenfallen, die auf uns warten, wäre die wohl größte und gefährlichste der Erwerb einer Ghettomentalität. Zu vergessen, dass es eine Welt außerhalb der Gemeinde gibt, zu der wir gehören, und sich in den engen kulturellen Grenzen einzuschließen hieße, wie ich meine, sich freiwillig in jene Form des inneren Exils zu begeben, das in Südafrika »Homelands« genannt wird. Wir müssen uns davor hüten, selbst aus den allerbesten Gründen literarische angloindische Äquivalente zu Bophuthatswana oder der Transkei zu bilden.
Damit erhebt sich sogleich die Frage, »für« wen man schreibt. Meine eigene kurze Antwort lautet, dass ich beim Schreiben nie an die Leser gedacht habe. Ich habe Ideen, Menschen, Ereignisse, Formen, und »für« diese Dinge schreibe ich, während ich hoffe, dass das vollendete Werk den anderen interessant erscheint. Doch welchen anderen? Im Fall der Mitternachtskinder hatte ich eindeutig das Gefühl, dass ich es, wenn seine subkontinentalen Leser das Werk ablehnten, als Misserfolg betrachtet hätte, und zwar ungeachtet der Reaktionen im Westen. Also würde ich sagen, dass ich »für« die Menschen schreibe, die sich als Teil der Dinge empfinden, »über« die ich schreibe, aber auch für jeden anderen, den ich irgendwie erreichen kann. In diesem Punkt bin ich derselben Meinung wie der schwarze amerikanische Schriftsteller Ralph Ellison, der in seiner Essaysammlung Shadow and Act sagt, er sehe etwas Kostbares darin, in der heutigen Zeit in Amerika schwarz zu sein, strebe aber nach weitaus mehr. »Ich wurde«, schreibt er, »schon sehr früh von der Leidenschaft ergriffen, alles, was ich innerhalb der Gemeinschaft der Schwarzen liebte, mit allen Dingen zu verbinden, die, wie ich spürte, in der Welt draußen existierten.«
Kunst ist eine Leidenschaft des Geistes. Und die Phantasie funktioniert am besten, wenn man ihr freien Lauf lässt. Die Schriftsteller des Westens haben sich bei der Wahl ihrer Themen, Schauplätze und Formen nie Zwang angetan; munter haben die visuellen Künstler des Westens in diesem Jahrhundert die visuellen Vorratslager Afrikas, Asiens, der Philippinen leer geräumt. Ich bin überzeugt, dass wir uns die gleiche Freiheit nehmen müssen.
Nach meiner Ansicht steht den indischen Schriftstellern in England, von ihrer eigenen Rassengeschichte abgesehen, noch eine zweite Tradition zur Verfügung: nämlich die Kultur und politische Geschichte des Phänomens der Migration, der Vertreibung, des Lebens in einer Minderheitsgruppe. Wir können völlig zu Recht die Hugenotten, die Iren, die Juden als unsere Vorfahren beanspruchen; die Vergangenheit, zu der wir gehören, ist eine englische Vergangenheit, die Geschichte der eingewanderten Briten. Swift, Conrad und Marx sind ebenso unsere literarischen Ahnen wie Tagore und Ram Mohan Roy. Amerika, eine ganze Nation von Einwanderern, hat aus dem Phänomen der kulturellen Transplantation, aus dem Studium der Methoden, durch die die Menschen mit einer neuen Welt fertigwerden, eine großartige Literatur geschaffen; mag sein, dass wir, indem wir entdecken, was wir mit jenen gemeinsam haben, die uns in dieses Land vorausgegangen sind, allmählich beginnen können, dasselbe zu tun.
Ich möchte betonen, dass dies nur eine von vielen möglichen Strategien ist. Aber wir sind unwiderruflich internationale Schriftsteller in einer Zeit, da der Roman eine so internationale Form angenommen hat wie nie zuvor (ein Schriftsteller wie Borges spricht von Robert Louis Stevensons Einfluss auf sein Werk, Heinrich Böll gibt zu, von der irischen Literatur beeinflusst worden zu sein: gegenseitige Befruchtung, wohin man sieht); und eine der erfreulicheren Freiheiten des literarischen Migranten ist wohl die Möglichkeit, seine Eltern zu wählen. Zu den meinen – halb bewusst, halb unbewusst ausgewählt – zählen Gogol, Cervantes, Kafka, Melville, Machado de Assis: ein polyglotter Stammbaum, an dem ich mich ständig messe und zu dem zu gehören mir eine Ehre sein würde.
In Saul Bellows jüngstem Roman Der Dezember des Dekans gibt es ein wunderschönes Bild. Die Hauptperson, Dekan Corde, hört irgendwo einen Hund wütend bellen. Er stellt sich vor, dass der Hund mit diesem Gebell seinem Protest gegen die begrenzten Erfahrungsmöglichkeiten eines Hundes Ausdruck verleiht. »Macht doch um Gottes willen das Universum ein bisschen weiter auf!«, verlangt der Hund. Und weil Bellow natürlich im Grunde nicht von Hunden redet oder nicht nur von Hunden, habe ich das Gefühl, dass die Wut des Hundes wie auch seine Sehnsucht ebenso meine, unsere, jedermanns Wut und Sehnsucht ist. »Macht doch um Gottes willen das Universum ein bisschen weiter auf!«
1982
2Mera joota hai Japani/Yé patloon Inglistani/Sar pé lal topi Rusi/Phir bhi dil hai Hindustani, was man in etwa übersetzen könnte mit: Aus Japan sind meine schönen Schuh/Die Hosen sind englisch, was meinst du dazu?/Auf dem Kopf ein russischer Hut/Aber indisch ist mein Blut.)
Das ist auch das Lied, das Gibril Farishta bei seinem Absturz vom Himmel zu Beginn der Satanischen Verse singt.
»Errata« oder: Ein unzuverlässigerErzähler in den Mitternachtskindern
Der Hinduüberlieferung zufolge liebt der elefantenköpfige Gott Ganesha die Literatur; liebt sie so sehr, dass er sich bereit erklärt, zu Füßen des Barden Vyasa zu sitzen und als einzigartigen Akt stenografischer Liebe den gesamten Text der Mahabharata von Anfang bis Ende niederzuschreiben.
In den Mitternachtskindern nimmt Saleem Sinai an einer Stelle Bezug auf diese alte Überlieferung. Nur lautet seine Version ein wenig anders. Bei Saleem sitzt Ganesha zu Füßen des Dichters Valmiki und schreibt die Ramayana nieder. Doch Saleem irrt sich.
Das ist allerdings nicht sein einziger Irrtum. In seinem Bericht über die Entwicklung der Großstadt Bombay erklärt er uns, Mumbadevi, die Schutzgöttin der Stadt, sei bei den damaligen Einwohnern von Bombay in Ungnade gefallen: »Der Festkalender bezeugt ihren Niedergang … Wo bleibt der Mumbadevi-Tag?« In Wirklichkeit enthält der Festkalender einen unverwechselbaren Mumbadevi-Tag, das heißt in allen indischen Versionen bis auf Saleems.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!