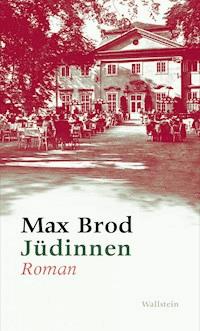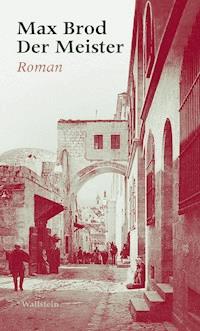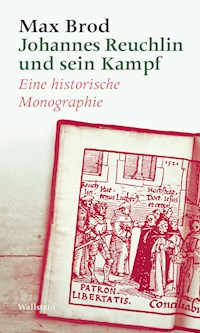Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Max Brod - Ausgewählte Werke
- Sprache: Deutsch
Diese sorgfältige und elegant geschriebene Biographie handelt nicht nur von Heine, sondern auch von Brod und vom Schicksal der deutschen Juden; als Brod den Text 1934 veröffentlichte, waren die Nazis schon ein Jahr an der Macht, das Publikum in Deutschland nicht mehr erreichbar. Das Buch kam im Exil-Verlag Allert de Lange in Amsterdam heraus und erlebte bereits 1935 eine zweite verbesserte Auflage. Dann gingen die schrecklichsten Ereignisse darüber hinweg. In einem kurzen Vorwort zur neuen Auflage 1956, die dieser Ausgabe zugrunde liegt, macht Brod darauf aufmerksam: Er musste einiges ändern nach der Vernichtung des deutschen Judentums.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 610
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ausgewählte Werke
Herausgegeben von Hans-Gerd Koch
und Hans Dieter Zimmermann
in Zusammenarbeit mit Barbora Šramková
und Norbert Miller
Max Brod
Heinrich Heine
Biographie
Mit einem Vorwort vonAnne Weber
Gefördert von der Fritz Thyssen Stiftung Köln undunterstützt vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfondssowie dem deutschen Auswärtigen Amt
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnetdiese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internetüber http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2015www.wallstein-verlag.deVom Verlag gesetzt aus Aldus RomanUmschlaggestaltung: Susanne Gerhards, DüsseldorfDruck und Verarbeitung: Hubert & Co, GöttingenISBN (Print) 978-3-8353-1340-8ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-2704-7ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-2705-4
Inhalt
Vorwort (Anne Weber)
Heinrich Heine. Biographie
Vorbemerkung
I.
Der »Morgenländer«
II.
Jugend • Düsseldorf
III.
Der »Fußtritt ins Herz« – Hamburg
IV.
Universitäten • Bonn, Göttingen
V.
Berlin • Erste VeröffentlichungenAllgemeine Zustände • Die Berliner JudenRahel Varnhagen
VI.
Der »Kulturverein«
VII.
Vers und Prosa bis zum »Buch der Lieder«
VIII.
Volkstümlichkeit, Romantik und romantischeIronie • Jüdisches Schicksal als Schicksal eines Dichters
IX.
Zwischen Deutschland und Paris
X.
Paris • Jahre des Glücks, Jahre des Kampfes
XI.
Un coin divin dans l’homme
Nachwort (Gerhard Kurz)
Editorische Notiz
Über den Autor
Max BrodAusgewählte Werke im Wallstein Verlag
Vorwort
Jedes Buch bringt beim Leser ein Bild des Autors hervor. Jede Biographie enthält eine Autobiographie; ein unbeabsichtigtes, nebenbei entstandenes Selbstporträt. Als Leser einer Biographie bekommt man es folglich mit zwei Menschen und ihren Besonderheiten zu tun, und mit dem oft schwierigen, zwischen Identifizierung und Distanzierung schwankenden Verhältnis des einen zum anderen.
Kaum ein Dichter zählt so viele Biographen wie Heinrich Heine. Allein zwischen den Jahren 1931 und 1934 sind drei Heine-Biographien entstanden. Antonina Vallentin veröffentlichte die ihre 1931 in französischer Sprache bei Gallimard; Ludwig Marcuses Heine-Buch erschien 1932 bei Rowohlt. Max Brods Heine-Biographie konnte 1934 schon nicht mehr in Deutschland publiziert werden, sie wurde von einem holländischen Verlag gedruckt.
Es kann kein Zufall sein, dass alle drei dieser Anfang der 30er Jahre entstandenen Biographien von jüdischen Autoren stammen. Angesichts eines immer offener und hemmungsloser judenfeindlichen Deutschlands muss der wegen seines Judentums verspottete und geschmähte Heine für sie eine wichtige Identifikationsfigur gewesen sein. Zwar wird die aktuelle politische Lage in den Erstausgaben dieser Bücher nicht berührt; sie ist aber aus dem Blick, den die Autoren auf Heine richten, herauszulesen. Nach dem Krieg hat Max Brod seine Heine-Biographie überarbeitet. Unter anderem sind alle Hinweise auf das Anfang der 30er Jahre noch bestehende osteuropäische Judentum, auf jüdische Bibliotheken und Kulturgüter, auf furchtbare Weise hinfällig geworden. Im Grunde haben ihn jedoch die »Ereignisse«, deren Ausmaße er nicht vorausahnen konnte, in seinem Zionismus, in der Ablehnung jeder Assimilation bestärkt. An den Prinzipien, auf denen sein Buch beruht, habe es, so schreibt er, nichts Wesentliches zu ändern gegeben.
Wer heute, mit dem Wissen um den Fortgang der Geschichte und – für den nicht-jüdischen deutschen Leser – mit der Bürde dieser Geschichte Max Brods Heine-Biographie liest, staunt über diese Kontinuität und über das Fehlen jeder Spur einer Empörung oder Wut. Er wundert sich über Brods Ruhe und Besonnenheit, über das Maßvolle seiner Beschreibung etwa der antisemitischen Atmosphäre in den Göttinger Studentenkreisen der 1820er Jahre, in der sich doch die späteren Judenverfolgungen schon ankündigten: »Im Bierkeller zu Göttingen mußte ich einst bewundern, mit welcher Gründlichkeit meine altdeutschen Freunde die Proskriptionslisten anfertigten für den Tag, wo sie zur Herrschaft gelangen würden. Wer nur im siebenten Grad von einem Franzosen, Juden oder Slawen abstammte, ward zum Exil verurteilt.« (Heinrich Heine, »Die Romantik«)
Brods gelassenes Zur-Kenntnis-Nehmen, fast schon Hinnehmen einer gegebenen politischen Situation ist es wohl, was sein Buch letztlich als ein der Nazi-Zeit vorausgehendes kennzeichnet. Doch diese scheinbare Gelassenheit hat noch eine andere Seite: das entschlossene Hinarbeiten auf eine außerhalb Deutschlands und Europas liegende Zukunft für das jüdische Volk. Um von einer solchen Zukunft zu träumen, war es für Heine noch zu früh; Theodor Herzl wird erst kurz nach seinem Tod geboren. Die Zukunft des jüdischen Volkes lag zu Heines Zeit noch innerhalb Europas, innerhalb seiner »Wirtsländer«, wie Brod, der in den Juden allerorts bloß gelittene Gäste sieht, sie nennt. Die Frage: Sollen wir uns von dem »Wirt« auffressen lassen, sollen wir in ihm untertauchen und schließlich ganz verschwinden oder sollen wir uns zu unserer jüdischen Herkunft und Tradition bekennen? hat er für sich längst beantwortet, und er sieht in Heine einen, wenn nicht gar den einzigen jüdischen Schriftsteller und Dichter seiner Zeit, der sie in seinem Sinne beantwortet und sein Judentum nie verleugnet hat.
Während Ludwig Marcuses Sicht auf Heines Werk und Leben vornehmlich eine politische ist und bei der an ein französisches Publikum sich wendenden Antonina Vallentin Heines französische Jahre im Vordergrund stehen, ist Max Brods Buch bei weitem dasjenige, das der Frage der Stellung Heines zum Judentum den größten Platz einräumt – zweifellos, weil ihn selbst diese Frage Anfang der 30er Jahre stark bewegt. Wer also in dieser Sache wie in allen anderen von einem Biographen eine möglichst neutrale, »objektive« Stellung erwartet, sollte besser zu einem anderen Buch greifen. Objektivität wird er nirgends finden, besser getarnte Subjektivität aber bestimmt. Doch ist das wirklich wünschenswert?
Max Brod geht in seiner Voreingenommenheit nicht so weit, Heines widersprüchliches Verhältnis zum Judentum zu leugnen. Aber einen Satz wie Marcuses »Wie Börne verfolgte er die Juden mit intimstem Haß« ist bei Brod nirgendwo zu finden. Unter seinen zum großen Teil dem Judentum gänzlich entfremdeten jüdischen Zeitgenossen – den »Erstlingen der Assimilation«, wie sie der jüdische Schriftsteller S. Schasar nennt – sieht er Heine als den einzigen, den es »zu klarer jüdischer Selbstbejahung« drängte – Heines Taufe zum Trotz, von der dieser sich, wie mancher andere, ein »Entreebillet zur europäischen Kultur« versprach, die er sich aber selbst am meisten übelnahm: »Ich stehe oft auf des Nachts und stelle mich vor den Spiegel und schimpfe mich aus.« Ob Brod mit dieser Sichtweise Recht hat, ist ungewiss. Auffallend ist jedenfalls, dass Heine, übrigens nicht nur in diesem Zusammenhang, mit Vorliebe eine Position annahm, in der er von mindestens zwei Seiten unter Beschuss geriet. So etwa, als er nach seiner Polen-Reise schrieb: »Denn trotz der barbarischen Pelzmütze, die seinen Kopf bedeckt, und der noch barbarischeren Ideen, die denselben füllen, schätze ich den polnischen Juden weit höher als so manchen deutschen Juden, der seinen Bolivar auf dem Kopf und seinen Jean Paul im Kopfe trägt.« Und: »Der polnische Jude mit seinem schmutzigen Pelze, mit seinem bevölkerten Barte und Knoblauchgeruch und Gemauschel ist mir noch immer lieber als mancher in all seiner staatspapiernen Herrlichkeit.« Mit einer solchen Einschätzung machte er sich sowohl bei den getauften Juden der Berliner Salons als auch bei den preußischen Beamten äußerst unbeliebt. Denn in ihrer Abscheu vor den in ihren Augen zurückgebliebenen, ungebildeten und schmutzigen Ostjuden trafen sich diese beiden Gruppen. Heines Widersprüchlichkeit oder Janusköpfigkeit ist es aber, die Max Brod erlaubt, ihn für die jüdische Sache zu vereinnahmen.
Die erste jüdische Generation nach der Emanzipation sah Max Brod vor eine schier unlösbare Aufgabe gestellt: einen Platz zu finden in der deutschen Gesellschaft, ohne sich selbst aufzugeben, ohne »ihr ureigenes Wesen zu negieren«. Mit wechselweise strengem und nachsichtigem Blick beurteilt Brod den Kreis um Rahel Varnhagen, das »Berliner Taufjudentum«, wie er es nennt. Es mag eher einem Wunschgedanken entsprechen, wenn er Heine als einen »Vorkämpfer« der jüdischen Selbstbehauptung ansieht, aber die Isolierung des Dichters »nach beiden Seiten hin«, seine Fremdheit in beiden Lagern, ist sicher nicht von Brod erfunden. Was Heine daran hinderte, wie die meisten anderen gebildeten deutschen Juden im deutschen Volk auf- oder vielmehr unterzugehen, war womöglich weniger die – von Brod übertriebene? – Anziehungskraft, die die urtümliche, tiefe Gläubigkeit der Ostjuden auf ihn ausübte, als ein sehr ausgeprägter Stolz. Denn er hatte durchaus zu den Deutschen, zum deutschen Kulturkreis ganz und gar dazugehören wollen, hatte den deutschen Patriotismus geteilt und in deutschem Volksliedton geschwelgt. Doch die Deutschen – die nicht-jüdischen Deutschen – haben ihn immer wieder als Juden gebrandmarkt, sie verwehrten ihm, wie Walter Benjamin hundert Jahre später, eine Professur und sahen in ihm zu keiner Zeit etwas anderes als: einen Juden. Dieser Zurückweisung zum Trotz immer weiter nach Zugehörigkeit zu streben, muss ihm als eine unerträgliche Selbstdemütigung erschienen sein, die zu verweigern der Stolz ihm gebot. Zwar ließ er sich taufen in einem schwachen Moment, doch verließ ihn zu keiner Zeit das Bewusstsein, dass seine Ahnen »nicht zu den Jagenden [gehörten], viel eher zu den Gejagten«. Anderen mag es gelungen sein, sich das Gegenteil einzureden: ihm blieben Taufe und Anbiederung immer ein Verrat. So sieht es Max Brod, und in dieser Einschätzung kann der Leser ihm folgen, nicht nur, weil viele Passagen in Heines Werk dafür sprechen, sondern noch etwas anderes legt das nahe, was sich nicht auf das Verhältnis von jüdischen und nicht-jüdischen Deutschen beschränkt, sondern eine universell-menschliche Reaktion ist: der Zurückgewiesene hört irgendwann auf, dazugehören zu wollen, er hört auf, an die Türe zu klopfen und um Einlass zu bitten. Die Gemeinschaft, die ihm lange Zeit so anziehend schien, sieht er fortan mit umso kritischerem Blick. Ihre Schwächen, die zu übersehen er bislang vorgezogen hatte, stechen ihm jetzt in die Augen. Und er fängt an, jene andere Zugehörigkeit, die er selbst nie recht verspürt noch ersehnt hat und die man ihm so hartnäckig zuweisen will, jene Identität, auf die er immer wieder zurückgeworfen wird, liebzugewinnen.
Doch sogar die Position des in seinem Zugehörigkeitsgefühl zum Judentum gefestigten Max Brod ist nicht bar von Widersprüchen oder jedenfalls Vorurteilen. So schreibt er über Heines berühmtestes Gedicht, »Die Loreley«, das die Nationalsozialisten kurz darauf seines Autors berauben werden, »die peinliche Inversion in der ersten Zeile« (»Ich weiß nicht, was soll es bedeuten«) stelle »vielleicht wirklich, wie die Gegner schadenfroh hervorheben, einen unbewussten Rückfall in den ›jiddischen‹ Jargon der Jugendjahre« dar – auch wenn ihm weniger das Jiddische selbst »peinlich« sein mag, das hier vielleicht nachklingt, als dessen Vermischung mit deutschem Volkstum. Dennoch: Uns später Geborene mutet es seltsam an, welch schüchternen, zaghaften Ausdruck die jüdische Selbstbehauptung in jenen vortotalitären Jahren annahm.
Von einer späten Bekehrung Heines ist weder bei Antonina Vallentin noch bei Ludwig Marcuse zu lesen. Wer aber, wie Max Brod, Zeichen für eine solche sehen will, kann sie auch finden: »Ja, ich bin zurückgekehrt zu Gott, wie der verlorene Sohn, nachdem ich lange Zeit bei den Hegelianern die Schweine gehütet.« Brod gelingt der tour de force, aus Heine einen Rückkehrer zum Glauben seiner Vorfahren, gleichzeitig aber einen Bekehrten ohne Kirche und Dogma zu machen. Noch die Ironie, mit der Heine die eigenen Glaubensbekenntnisse verulkt, ist Max Brod kein Beweis für deren Unernst oder gar Unaufrichtigkeit, sondern im Gegenteil: seine letzten Erkenntnisse seien ihm »zu ernst, um anders als ironisch vermittelt werden zu können«.
Vielleicht sollte es uns, den Lesern, weniger darum gehen, zu entscheiden, ob Max Brod Recht hat, wenn er in Heines Ironie einerseits ein Mittel zur Selbstverteidigung und andererseits die einzige, wenn auch verbrämte Möglichkeit einer Selbstoffenbarung sehen will – oder ob vielleicht Marcuse richtiger liegt, wenn er Heines Witz eine »Waffe im Klassenkampf« nennt –, als darum, der doppelten Verzweiflung gewahr zu werden, die uns in den Personen des Dichters und seines Biographen entgegentritt und die nicht ohne Einfluss bleiben konnte auf ihre Schriften: der Verzweiflung des beinahe gänzlich gelähmten, seit Jahren an sein Bett gefesselten Dichters, der gerade noch mit der einen Hand ein Augenlid lüpfen konnte, um einen Besucher zu erkennen, und der von einer anderen Art der Lähmung ausgelösten Verzweiflung Max Brods angesichts der Lage der Juden Europas und des Zuwachses und schließlich Sieges der nationalsozialistischen Partei in Deutschland. In Anbetracht dieser Not haben wir nicht vordringlich über wahr und falsch zu entscheiden. Wenigstens dürfte so manchem Leser dieser Biographie diese Frage sekundär erscheinen.
Was die Bedeutung des Judentums für Heine angeht, mag Brod – bedenkt man die Gründe seiner Voreingenommenheit – auf erschütternde Weise wenig objektiv sein. Er ist es womöglich nicht mehr, was das Leben und Dichten Heines insgesamt angeht. Seine Parteilichkeit ist indessen nicht von der Art, die man einem Biographen übelnehmen könnte. Zum einen, weil er sie nie zu verbergen versucht. Zum anderen ist sie offenkundig einer tiefen, aus jeder Zeile seiner biographischen Annäherung herauszulesenden Zuneigung entsprungen, die den Leser nach und nach für den Biographen nicht weniger als für den Biographierten einnimmt. Vielleicht ist es diese Zuneigung, die ihm gebietet, den größten Feind Heines im zwanzigsten Jahrhundert, Karl Kraus, und dessen 1910 veröffentlichte, von Vernichtungswillen getriebene Schrift »Heine und seine Folgen« stillschweigend zu übergehen, den Polemiker mit stiller Verachtung zu strafen. Nichts anderes scheinen dessen Hasstiraden in Brods Augen zu verdienen. Statt dagegenzuhalten und Heine gegen diese bösartigen Attacken zu verteidigen, erwähnt er den Namen Kraus nur ein einziges Mal im ganzen Buch, und zwar als den Mann, dem wir eine Jacques-Offenbach-Renaissance verdanken! Eine vornehmere Antwort, eine souveränere und feinere Rache lässt sich schwer denken.
Sicher ist: Der sich hier über die Schriften und Lebensphasen des Dichters beugt, tut dies eindeutig nicht wie ein Wissenschaftler über sein Studienobjekt; vielmehr mit einer Art brüderlicher Liebe, die ihn die Schwächen Heines nicht beschönigen, sondern mit schmerzlicher Deutlichkeit wahrnehmen lässt. Er unternimmt nichts, um diese Schwächen zu beschönigen, im Gegenteil; er ist streng wie es nur Hassende oder Liebende sind. Er sieht die Gefahren, in denen Heines Lyrik schwebt: das »süßnichtige Wortgeklingel«, zu dem er sich mitunter gehen lässt. Auch die leichtfertig-verletzende, manche seiner Widersacher zur Verzweiflung treibende Spottlust Heines unterschlägt Brod nicht. Doch führt er sie zurück auf Heines frühe Liebesenttäuschung; in ihr sieht er den Ursprung aller späteren Ressentiments. In keiner der drei um dieselbe Zeit entstandenen Biographien wird der ersten enttäuschten Liebe zu seiner Kusine, der Tochter seines wohlhabenden Onkels Salomon, eine derartige, das gesamte weitere Leben und Schaffen Heines überschattende Bedeutung eingeräumt. Aus der kalten Absage, die ihm das Mädchen erteilt, und der Demütigung durch ihren reichen Vater leitet Brod nicht nur alles Fragwürdige, »Unedle« in Heines Charakter, sondern auch so manchen missglückten Vers ab. Auch hier mag er durch seine unbedingte, brüderliche Liebe zu Heine befangen sein, doch wer will das letztlich entscheiden? Und vor allem: Wer will es ihm übelnehmen? Viel eher schulden wir ihm Dank für seine liebevolle und doch nicht blinde Parteinahme.
Anne Weber
Heinrich Heine
Biographie
Felix Weltsch,meinem Freund auf dem Lebenswege gewidmet
»Wer nicht so weit geht, als sein Herz ihn drängt und die Vernunft ihm erlaubt, ist eine Memme; wer weiter geht, als er gehen wollte, ist ein Sklave.«
HEINRICH HEINE
»Die Gipfel sehen einander.«
Vorbemerkung
1934 erschien diese Heine-Biographie im Verlag Allert de Lange (Amsterdam) und erlebte 1935 eine zweite verbesserte Auflage (4.-6. Tausend), die in Deutschland gleichfalls unbekannt blieb. Die zweite Auflage liegt der jetzigen Neuausgabe zugrunde, in der ich manches ändern mußte, da die ungeheuren Ereignisse, deren Zeugen wir seit jenen Jahren geworden sind, viel Tatsächliches und in manchen Fällen die ganze Blickrichtung, das Geschichtsbewußtsein nicht unberührt lassen konnten. Namentlich hat der Untergang eines großen Teils des jüdischen Volkes sowie die Neugründung des Staates Israel nach einer Unterbrechung von fast 2000 Jahren den Blick auf die geschichtliche Epoche, in der Heine gewirkt hat, die Beurteilung der Emanzipation und Assimilationsbestrebungen in mancher Hinsicht modifiziert. Mit einiger Genugtuung darf ich feststellen, daß ich in den Prinzipien, auf denen mein Heine-Buch ruht, nichts Wesentliches zu ändern hatte. Einige Fakten freilich sind mir gleichsam weggelaufen. Wenn ich (beispielsweise) in den Jahren 1934, 1935 auf den Standort einer bestimmten jüdischen Bibliothek oder auf die Fortdauer jüdischen Brauchtums in den Massen Osteuropas verwies, so ahnte ich nicht, daß all dies kurz nach Erscheinen des Buches der Zerstörung anheimfallen werde. – Derartige Hinweise habe ich also in der vorliegenden Neuausgabe korrigiert teils im Text selbst, teils in Fußnoten. In den Kreis meiner Betrachtungen miteinbezogen wurden ferner die Ergebnisse der jüngsten Heine-Forschung, die manchen Fortschritt zu verzeichnen hat (vgl. die Episode des »Chevalier von Geldern«, die kommentierte, beinahe komplette Gesamtausgabe der Briefe Heines durch Friedrich Hirth, dessen Grundeinstellung zu Heine allerdings der meinen diametral entgegengesetzt ist, Felix Stössingers ebenso wissensgesättigte wie erkenntnisreiche Heine-Darstellung »Mein wertvollstes Vermächtnis« u. s. f.).
I
Der »Morgenländer«
In Heines »Memoiren« findet sich bei Darstellung seiner Kinderjahre und seiner Erinnerungen an die Ahnenschaft mütterlicherseits, also an die Familie von Geldern, auch das Folgende vermerkt:
»Der beste und kostbarste Fund jedoch, den ich in den bestäubten Kisten machte, war ein Notizbuch von der Hand eines Bruders meines Großvaters, den man den Chevalier oder den Morgenländer nannte, und von welchem die alten Muhmen immer so viel zu singen und zu sagen wußten.
Dieser Großoheim, welcher ebenfalls Simon de Geldern hieß, muß ein sonderbarer Heiliger gewesen sein. Den Zunamen ›der Morgenländer‹ empfing er, weil er große Reisen im Orient gemacht und sich bei seiner Rückkehr immer in orientalische Tracht kleidete.
Am längsten scheint er in den Küstenstädten Nordafrikas, namentlich in den marokkanischen Staaten verweilt zu haben, wo er von einem Portugiesen das Handwerk eines Waffenschmieds erlernte und dasselbe mit Glück betrieb.
Er wallfahrtete nach Jerusalem, wo er in der Verzückung des Gebetes, auf dem Berge Moria, ein Gesicht hatte. Was sah er? Er offenbarte es nie.
Ein unabhängiger Beduinenstamm, der sich nicht zum Islam, sondern zu einer Art Mosaismus bekannte und in einer der unbekannten Oasen der nordafrikanischen Sandwüste gleichsam sein Absteigequartier hatte, wählte ihn zu seinem Anführer oder Scheich. Dieses kriegerische Völkchen lebte in Fehde mit allen Nachbarstämmen und war der Schrecken der Karawanen. Europäisch zu reden: mein seliger Großoheim, der fromme Visionär vom heiligen Berge Moria, ward Räuberhauptmann. In dieser schönen Gegend erwarb er auch jene Kenntnisse von Pferdezucht und jene Reiterkünste, womit er nach seiner Heimkehr ins Abendland so viele Bewunderung erregte.
An den verschiedenen Höfen, wo er sich lange aufhielt, glänzte er auch durch seine persönliche Schönheit und Stattlichkeit, sowie auch durch die Pracht der orientalischen Kleidung, welche besonders auf die Frauen ihren Zauber übte. Er imponierte wohl noch am meisten durch sein vorgebliches Geheimwissen, und niemand wagte es, den allmächtigen Nekromanten bei seinen hohen Gönnern herabzustürzen. Der Geist der Intrige fürchtete die Geister der Kabale.
Nur sein eigener Übermut konnte ihn ins Verderben stürzen, und sonderbar geheimnisvoll schüttelten die alten Muhmen ihre greisen Köpflein, wenn sie etwas von dem galanten Verhältnis munkelten, worin der ›Morgenländer‹ mit einer sehr erlauchten Dame stand, und dessen Entdeckung ihn nötigte, aufs schleunigste den Hof und das Land zu verlassen. Nur durch die Flucht mit Hinterlassung aller seiner Habseligkeiten konnte er dem sicheren Tode entgehen, und eben seiner erprobten Reiterkunst verdankte er seine Rettung.
Nach diesem Abenteuer scheint er in England einen sicheren, aber kümmerlichen Zufluchtsort gefunden zu haben. Ich schließe solches aus einer zu London gedruckten Broschüre des Großoheims, welche ich einst, als ich in der Düsseldorfer Bibliothek bis zu den höchsten Bücherbrettern kletterte, zufällig entdeckte. Es war ein Oratorium in französischen Versen, betitelt ›Moses auf dem Horeb‹, hatte vielleicht Bezug auf die erwähnte Vision, die Vorrede war aber in englischer Sprache geschrieben und von London datiert; die Verse, wie alle französischen Verse, gereimtes lauwarmes Wasser, aber in der englischen Prosa der Vorrede verriet sich der Unmut eines stolzen Mannes, der sich in einer dürftigen Lage befindet.
Aus dem Notizenbuch des Großoheims konnte ich nicht viel Sicheres ermitteln; es war, vielleicht aus Vorsicht, meistens mit arabischen, syrischen und koptischen Buchstaben geschrieben, worin sonderbar genug französische Citate vorkamen, z. B. sehr oft der Vers: Où l’innocence périt c’est un crime de vivre. Mich frappierten auch manche Äußerungen, die ebenfalls in französischer Sprache geschrieben; letztere scheint das gewöhnliche Idiom des Schreibenden gewesen zu sein.
Eine rätselhafte Erscheinung, schwer zu begreifen, war dieser Großoheim. Er führte eine jener wunderlichen Existenzen, die nur im Anfang und in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts möglich gewesen; er war halb Schwärmer, der für kosmopolitische, weltbeglückende Utopien Propaganda machte, halb Glücksritter, der im Gefühl seiner individuellen Kraft die morschen Schranken einer morschen Gesellschaft durchbricht oder überspringt. Jedenfalls war er ganz ein Mensch.
Sein Charlatanismus, den wir nicht in Abrede stellen, war nicht von gemeiner Sorte … Wie dem auch sei, dieser Großoheim hat die Einbildungskraft des Knaben außerordentlich beschäftigt. Alles, was man von ihm erzählte, machte einen unauslöschlichen Eindruck auf mein junges Gemüt, und ich versteckte mich so tief in seine Irrfahrten und Schicksale, daß mich manchmal am hellen lichten Tage ein unheimliches Gefühl ergriff und es mir vorkam, als sei ich selbst mein seliger Großoheim und als lebte ich nur eine Fortsetzung des Lebens jenes längst Verstorbenen! In der Nacht spiegelte sich dasselbe retrospektiv zurück in meine Träume. Mein Leben glich damals einem großen Journal, wo die obere Abteilung der Gegenwart den Tag mit seinen Tagesberichten und Tagesdebatten enthielt, während in der unteren Abteilung die poetische Vergangenheit in fortlaufenden Nachtträumen wie eine Reihenfolge von Romanfeuilletone sich phantastisch kund gab.
In diesen Träumen identifizierte ich mich gänzlich mit meinem Großoheim und mit Grauen fühlte ich zugleich, daß ich ein anderer war und einer anderen Zeit angehörte. Da gab es Örtlichkeiten, die ich nie vorher gesehen, da gab es Verhältnisse, wovon ich früher keine Ahnung hatte, und doch wandelte ich dort mit sicherem Fuß und sicherem Verhalten.
Da begegneten mir Menschen in brennend bunten, sonderbaren Trachten und mit abenteuerlich wüsten Physiognomien, denen ich dennoch wie alten Bekannten die Hände drückte; ihre wildfremde, nie gehörte Sprache verstand ich, zu meiner Verwunderung antwortete ich ihnen sogar in derselben Sprache, während ich mit einer Heftigkeit gestikulierte, die mir nie eigen war, und während ich sogar Dinge sagte, die mit meiner gewöhnlichen Denkweise widerwärtig kontrastierten.
Dieser wunderliche Zustand dauerte wohl ein Jahr, und obgleich ich wieder ganz zur Einheit des Selbstbewußtseins kam, blieben doch geheime Spuren in meiner Seele. Manche Idiosynkrasie, manche fatale Sympathien und Antipathien, die gar nicht zu meinem Naturell passen, ja sogar manche Handlungen, die im Widerspruch mit meiner Denkweise sind, erkläre ich mir als Nachwirkungen aus jener Traumzeit, wo ich mein eigener Großoheim war –«
Wie sehr Heine mit diesen Zeilen recht hat, wußte er damals nicht, hat er auch niemals erfahren. Ein Leitmotiv seines Lebens: Er war oft weiser, sang und schrieb aus tieferen Seelengründen hervor, als sein Oberbewußtsein wahrhaben wollte. »Ach Gott! im Scherz und unbewußt sprach ich, was ich gefühlet« …
Die Identifizierung mit dem Großoheim, die Heine halb spielerisch vornahm, können wir heute genauer als er am Tatsächlichen nachprüfen. Denn das in hebräischer Sprache und mit hebräischen Lettern geschriebene Notizbuch, das er seiner mangelhaften Hebräischkenntnisse wegen nicht zu entziffern, ja nicht einmal der Sprache und den Schriftcharakteren nach zu agnoszieren vermochte, hat sich erhalten, wurde von David Kaufmann 1896 teilweise publiziert, übersetzt und kommentiert. Leider nur teilweise, wie so viele wichtige Quellenschriften zur Geschichte des jüdischen Geistes, wie – beispielsweise – auch Reubenis Reisejournal, das noch heute der kompletten Übersetzung harrt. Und wenn es schon zu einer Publikation kommt, in welcher Gesinnung findet sie dann statt! So ist auch Kaufmanns verdienstvoll fleißige Gelehrtenarbeit – »Aus Heinrich Heines Ahnensaal«, Breslau 1896 – entstellt durch philiströs höhnische Ausfälle gegen eine Artung, die dem Herrn in sein bürgerlich wohlanständiges Weltsystem nicht paßte, überdies aber auch durch übertrieben entzückte, in der jüdischen Historik leider vielfach übliche, salbungsvoll grabsermonhafte Töne den andern Vorahnen Heines gegenüber, die ein geregelteres Leben geführt haben als jener Großoheim. Kaufmann maßregelt ihn tüchtig, den Abenteurer, Kabbalisten, Weltmann, Künstler, Bettler und Lebensgenießer. Uns aber sieht der seltsame Mensch mit den naiv angstvollen Augen des Vorboten an; wir verlieben uns in seine schillernde Unglückseligkeit, die so viel von Heines Schicksal vorausnimmt.
In Nordafrika (außer Ägypten) ist er zwar allem Anschein nach nie gewesen, und auch von Reiterstückchen und der Führerschaft eines reubenihaft kriegerischen Judenstammes verlautet in dem Tagebuch nichts. Aber wild, ruhelos und umgetrieben genug stellt sich sein Leben dar, das in so vielen Zügen Familienähnlichkeit mit Heines Schmerzen und Wirren hat, – Ähnlichkeit bis in bestürzende Genauigkeit des Details hinein, so daß einem beim Vergleich die Macht der Abstammung, des Gesetzes »nach dem du angetreten«, der seelischen Erbschaft recht deutlich wird … Ich folge nun den von Kaufmann erforschten Daten: Simon von Geldern ist 1720 geboren als Sohn des Lazarus von Geldern, der sieben Jahre später zum Hoffaktor des Kurfürsten von Jülich-Berg in Düsseldorf ernannt wurde. Der Glanz der Familie, der angesehensten Judenfamilie in Düsseldorf, hat ihren Höhepunkt erreicht. Aber der erstgeborene Sohn – erstgeboren wie Heinrich Heine – schlägt aus der Art. Man gibt ihm die besten Lehrer, vom vierten Jahre an lernt er Talmud, mit vierzehn entläuft er der Schule in Frankfurt. Frankfurt war, wie bei Heine, seine erste Station in der Fremde. Ohne die Einwilligung der Eltern eingeholt zu haben, verläßt er Frankfurt mit einem Mitschüler, durchstreift Deutschland. Seine erste große Liebe gilt einer Cousine. Sie erscheint ihm später in Träumen. Eine Krankheit, Fiebervisionen; Versuche, sich im Geschäft des Vaters zu betätigen, schlagen fehl. Er hat nicht das Zeug zu einem echten »Liverantier-Juden« in sich. So wirft er sich, allerdings mit gleichem Mißerfolg, auf die Lottokollektion, ein Gewerbe, das Heine später in der Figur seines Hirsch Hyazinth verewigt hat. Es beginnen die Reisen. Das Ziel ist, wie bei Heine, der reiche Onkel, nur diesmal in Wien, nicht in Hamburg. Die Reiserouten haben eine merkwürdige Ähnlichkeit mit den späteren des Großneffen. Simon durchstreift Holland, geht nach London, dann über München nach Wien. Hier interessiert er sich hauptsächlich für die Oper, Komödien, Kaffeehaus, Spiel. Aber ein Zehntel seiner Einkünfte, die er aus Sprachstunden an vornehme Herrschaften, vor allem aber aus Unterstützungen der reichen Verwandten bezieht, legt er stets für Bücherkäufe zurück. Aus sybaritischem, doch auch angstvollem Wohlergehen (in sein Notizbuch schreibt er u. a.: »Ich habe gespielt, ich habe gesündigt, ich werde es nie wieder tun … Gulden 1.19 … In die Oper gegangen, ich habe gesündigt und bereue … Gulden 0.23 u. s. f.«) jagt ihn plötzlich Sehnsucht auf, er will eine Bußreise nach Palästina machen, damals ein sehr ungewöhnliches und gefährliches Unternehmen. Er sieht nun Italien, verweilt in Florenz. Von da an wird das, was dem Großneffen zeitlebens Versphantasie der »Hebräischen Melodien« geblieben ist, zur Realität. Über Livorno erreicht Simon Alexandria, den Hafen Akko, die Kabbalistenstadt Safed, in deren Felslandschaft ihn ein Eselchen trägt. Hier verweilt er in Studien und Gebet, aus dem Lebemann der Wiener Kaffeehaus- und Opernwelt ist ein Weiser geworden. 1751 ist das Jahr seiner Askese, seines frommen Einsiedlerlebens. Dann neue Reise, Ägypten, nochmals Safed, stürmische Überfahrt, die nach Smyrna führt. »Sein weltmännisches Wesen hatte ihm hier auch bei allen Konsulaten Eingang verschafft. Wiederholt sehen wir ihn beim französischen, englischen, schwedischen, holländischen Konsul und dessen Kanzler zu Besuche.« Saloniki, Konstantinopel. Zwischen Sofia und Nisch wird er von Räubern überfallen und seiner Barschaft beraubt. Der Weg geht über Belgrad, Ofen, Preßburg nach Wien zur reichen Verwandtschaft zurück. Doch jetzt kommt er als Sendbote aus dem Heiligen Land, der Achtung verlangt und findet, – bekannter Typ in den damaligen jüdischen Gemeinden, die solche wenn auch noch so lose Verbindung mit Palästina immer hochgehalten haben. Spendensammeln ist sein Beruf. In dieser Funktion zieht er nach Mähren, Böhmen, verweilt kurz in der Heimat am Rhein, sieht wieder London, geht nach Paris, dessen Sehenswürdigkeiten er besichtigt, nach Versailles, wo er, wenn man seinen Aufzeichnungen glauben darf, in türkischer Tracht der Marquise von Pompadour vorgestellt wird, wieder nach Paris, wo er den Oberbibliothekar der königlichen Bibliothek kennenlernt, nach Metz, wieder nach Deutschland, Dänemark, in Berlin wird er vom Premierminister Grafen Heinrich von Podewils und dessen liebenswürdiger Tochter empfangen, ferner vom Markgrafen Karl von Anspach, dem Schwager Friedrichs des Großen. Was den ahasverischen »Wandermüden« immer neu zum Aufbruch stachelt, können wir nicht enträtseln. 1756 begibt er sich zum zweitenmal nach Palästina. Auf der Fahrt wird das Schiff von Korsaren aufgebracht und geplündert, Simon verliert seinen ganzen Besitz an kostbaren Andenken, ja an Lebensmitteln. »In der Nacht auf Mittwoch den 6. Elul erschien ihm seine fromme Mutter. Freundliche Gestalten zogen an ihm vorüber, Tote und Lebende, sein verstorbener Onkel Emanuel von Geldern, dessen Tochter Freudchen, die er einst geliebt und die vielleicht seinem ganzen Leben eine andere Richtung gegeben hätte, wenn der Bund mit ihr nicht gehindert worden wäre. Er war wieder unter den Seinen, im Traume nur, aber so süß war noch im Wachen die Erinnerung, daß sie ihm Öl in die Wogen des Meeres goß und den Gewittersturm, der draußen das Schiff umtobte, zu beschwichtigen schien. In qualvollen Religionsdisputationen, die sein theologisch angehauchter und obendrein noch tauber Kapitän, sekundiert von zwei Geistlichen, ihm aufdrängte, vergingen die Tage. Seltsam kontrastiert mit dieser grimmigen Unterhaltung das idyllische Spiel mit einem jungen Wolf auf dem Schiffe, den der Kapitän aus der Berberei mitgebracht hatte. Aber es war kein messianischer Wolf, mit dem man auf die Dauer spielen konnte. Vielmehr mußte das Tier, da es seine Zähne zu brauchen anfing und bissig wurde, ins Meer geworfen werden« (Kaufmann). Wie viele Heine-Motive, vom Fliegenden-Holländer-Wind des Schnabelewopski-Fragments umblasen, klingen allein in diesen wenigen Zeilen an!
Mit dem Blick auf den Karmel bricht dies Buch von »Reisebildern« ab. Aber einige Jahre später ist Simon de Geldern in den Pariser Polizeiberichten als »Aventurier« bezeichnet. »Rabbiner und Aventurier« zugleich, heißt es da. Dann finden wir ihn in Amsterdam, Mannheim, Hannover, 1763 in Prag, 1764 in Ungarn, in Hildesheim, Dessau, Leipzig, Dresden und nochmals in London. Er stirbt, 54 Jahre alt, im Elsaß. Außer dem von Heine erwähnten Oratorium, dessen richtiger Titel »The Israelites on mount Horeb« lautet, hat er ein seltsames Buch veröffentlicht, die Zeugnisse und Empfehlungen, die man ihm als frommem Sendboten mitgegeben hat. Ein Exemplar des Druckes – mit handschriftlichen Eintragungen – befindet sich in der Amsterdamer Stadtbibliothek.
Aus Simon von Gelderns an vielen Stellen der Welt verstreutem Nachlaß, aus Briefen, Konzepten, Zetteln und Listen hat Fritz Heymann das Hauptkapitel seines zündend farbenreichen Buches »Der Chevalier von Geldern« (Querido Verlag, Amsterdam 1937) komponiert, dem ich weitere aufschlußreiche Ergänzungen über diesen Ahnherrn Heines verdanke. Als die zwei ersten Auflagen meines Heine-Buches erschienen, standen Heymanns Forschungen noch nicht zur Verfügung. – Mit Recht vergleicht der geistreiche Autor den Abenteurer Simon von Geldern mit Casanova. Nur hat jener weniger Glück gehabt. In Palästina wird er diesmal (1757) ins Gefängnis geworfen, kommt wieder nach Italien, verliert im Pharao all sein Geld, das er bei Juden und Christen gesammelt hat, nimmt in Paris an einem Hofkonzert in den Tuilerien teil, erblickt sogar Ludwig XV., (als einer seiner jüdischen Freunde wird ein Mardoché Ravel genannt), er lebt vom Glücksspiel und Bücherhandel, verkehrt mit Spekulanten und Charlatanen, kommt nach Köln, endlich nach Düsseldorf ins Elternhaus zurück. Von da geht er in den Haag, der damals Treffpunkt aller politischen Geheimagenten war. Einmal ist er Gast und Diskussionspartner Voltaires in Les Délices. Auch hier die Parallele mit Casanova. Später pumpt er Voltaires Bankier vergeblich an. Immer wieder sucht er erfolglos einen passenden Beruf, seien es diplomatische Dienste, bibliothekarische Arbeit, Sprachstunden oder kabbalistische Prophezeiungen. Aus Wien wird er durch die Sittenkommission der Kaiserin Maria Theresia ausgewiesen, in Preßburg eingesperrt. Eine dritte Reise ins Heilige Land erweist sich abermals als Fehlschlag. Pest, Hungersnot, Völkerhaß verwüsten Palästina. Aber der Rat eines braven Vetters, die phantastische Tracht abzulegen und ein bürgerliches Leben zu beginnen, wird allen Enttäuschungen zum Trotz verschmäht. Er erlebt »Zeichen und Wunder«, wird von Arabern überfallen, bleibt am Leben, gebärdet sich dann als Frommer, als reuiger Sünder. Er will über Aleppo, Basra nach Indien gelangen. Da warnt ihn der dänische Forscher Niebuhr, der eben aus der Wüste zurückkehrt, wo er vier Kameraden seiner gelehrten Expedition verloren hat. Simon kehrt um. – In zwanzig Jahren weiterer Wanderungen, nun in Europa, sind ihm neben vielerlei bitteren Erfahrungen auch noch einige gute Tage bestimmt. In Wolfenbüttel ist er nahe daran, Bibliothekar zu werden. Ein anderer wird ihm mit Recht vorgezogen: Lessing. Er ist Lehrer an einer englischen nicht-jüdischen Boardingschool in London, läßt seine biblische Dichtung drucken. Später gerät er durch Zufall und Mißverständnis in die Kreise eines Freimaurerordens »von der strikten Observanz«, dem der Erbprinz von Hessen-Darmstadt und andere hochgestellte Personen angehören. Zuletzt erhält er offiziell den Titel eines »Hof-Cabbalisten, Geheimen Magischen Rats und Hoffaktors Seiner Hochfürstlichen Durchlaucht«. Seine letzten zehn Lebensjahre verlebt er in einem Schloßpavillon zu Buxweiler (Unter-Elsaß); ein otium cum dignitate, wie es etwas später Casanova im Schloß des Grafen Waldstein in Dux zuteil wird. »Zwei amüsante alte Narren« (Heymann). Die nur im Zeitalter der sogenannten Aufklärung mögliche Mischung aus rationaler Voltaireverehrung und abergläubischen Mystifikationen. Seltsamste aller Schlußwendungen: Dem eleganten Abenteurer wird es ernst um die Lage der überall entwürdigten Juden. Er liefert dem Abbé Grégoire das Material für dessen preisgekrönte Denkschrift über das Thema der Akademie in Metz: »Gibt es Mittel, die Juden in Frankreich nützlicher und glücklicher zu machen?« und damit die Grundlagen zur Judenemanzipation, die der Abbé einige Jahre später in der französischen Revolution erkämpft. – Wenige Monate nach Gelderns Tod wird die Bastille gestürmt. Über den Verbleib seines literarischen Nachlasses gibt Heymann Bescheid.
Simon (oder Simeon) von Geldern hat auch einen Stammbaum seiner Familie hinterlassen, der es ermöglicht, der Geschlechterfolge bis ins 17. Jahrhundert nachzugehen. Der Großvater Simons ist Josef oder Juspa von Geldern. Auch dessen Vater, also der Urgroßvater von Heines Mutter Betty (Peira), ist noch nachweisbar. Ebenso die Verschwägerung mit der berühmten Familie der Glückel von Hameln, deren Memoiren auf uns gekommen sind. »Der Vater, Josef, oder nach seinem geläufigeren Rufnamen Juspa genannt, hatte den damals seltenen, weil nur erlesenen Familien eigenen Vorzug, bereits über einen Familiennamen zu verfügen, der, gleichsam latent geführt, wohl in der Gasse – d. h. unter den Juden – keine Anwendung fand, aber überall da zu Tage trat, wo der Träger mit dem öffentlichen Leben urkundend in Berührung kam. Einer seiner Väter muß entweder aus dem holländischen Geldern nach Deutschland oder, was noch näher liegt, aus der benachbarten Stadt Geldern in Düsseldorf eingewandert sein und dadurch den Nachkommen den Namen Geldern oder von d. h. aus Geldern hinterlassen haben.« So schreibt Kaufmann. Der Name der Mutter »van Geldern« ist also ein geographisches und kein Adelsprädikat. Eine snobistische Äußerung, in der sich Heine rühmte, eigentlich adliger Abstammung zu sein – von Laube überliefert –, ist also nicht anders zu werten als der Hinweis der Memoiren auf das Porträt seiner schönen Großmutter väterlicherseits: »Hätte der Maler der Dame ein großes Kreuz von Diamanten vor die Brust gemalt, so hätte man sicher geglaubt, das Porträt irgendeiner gefürsteten Äbtissin eines protestantischen adeligen Stiftes zu sehen.« Mimikry solcher Art kommt in Heines Werk recht selten vor; ganz frei von ihr ist er aber nicht; dazu waren wohl auch die Versuchungen der Zeitrichtung zu stark.
Nicht Adel im gewöhnlichen Wortsinn, wohl aber der Adel jüdischer Art ist in Heines Ahnenschaft zu finden. Einer Elite des Geistes, der schaffenden Tatkraft und des Gemeinsinnes, – einer Trias von Eigenschaften, die in jenen Zeiten öfter als heute gemeinsam angetroffen werden konnte –, einer Elite gehören sie an, die Herren van Geldern. Schon Juspa ist »Obervorgänger« (Vorsteher) der gesamten »vergeleiteten« – d. h. auf Grund eines Schutzbriefes und hoher Abgaben im Lande wohnberechtigten – Judenschaft. Er wird Kammeragent, Hoffaktor des Kurfürsten Johann von Jülich-Berg, gründet 1712 auf Grund besonderen landesfürstlichen Privilegs die erste Synagoge Düsseldorfs.
»Ein Sonnenstrahl war in das Herz der Gemeinde gefallen; es war eine Urkunde landesfürstlichen Schutzes und gesellschaftlicher Erhebung, was die Judenschaft von Düsseldorf in der Aufrichtung des Gotteshauses begrüßte, das ihr da von ihrem Obervorgänger erbaut wurde. Es war dies nicht eine auf Zeit gewährte, für Geld erkaufte Duldung eines einzelnen, ein papierener Schutz zu vorübergehendem Aufenthalt, es war, wie man im Rausche der ersten Begeisterung vermeinte, ein Wahrzeichen öffentlicher Anerkennung des jüdischen Gottesdienstes, ein im Boden wurzelndes und stolz in die Lüfte ragendes Denkmal gleichsam des der gesammten Glaubensgemeinde fortan dauernd bewilligten Heimatsrechtes.«
Heinrich Heine, der Enkel des Enkels, weiß nichts mehr von diesem Ereignis, das die Seelen der Zeitgenossen Juspa Gelderns erhob. Er schreibt nur, den legendären Reichtum des Ahnen schildernd, gelegentlich: »Das jetzige Krankenhaus in der Neustadt gehörte ihm ebenfalls«, wozu Kaufmann bemerkt: »Heine ahnte also nicht, daß das Maximilian-Josephs-Krankenhaus in der Neustadt zu Düsseldorf die Synagoge seines Ahns Juspa von Geldern gewesen war.«
Auch Juspas Sohn Lazarus von Geldern wird Jülisch-Bergscher Hoffaktor und Obervorgänger der Judenschaft. Vorübergehend wohnt er in Wien, wohin er als Schwiegersohn des angesehenen und reichen Simon Preßburg gezogen ist. Er hat elf Kinder, darunter jenen unsteten Simon, aber auch den ehrenfesten Gottschalk, Heines Großvater, der 1752 als Doktor der Medizin an der Universität Duisburg promoviert. (Mit einer Dissertation über die Heiserkeit.) Auch Gottschalks erster Sohn wird Arzt, wird Hofrat. So ist die Familie am Niederrhein alteingesessen, angesehen bei Jud und Christ, zu akademischen Ehren weltlich aufgestiegen ohne Verleugnung der angestammten Religion. In Düsseldorf gab es kein Ghetto, die Juden wohnten in allen Teilen der Stadt. Verglichen mit den Zuständen in Preußen oder in Frankfurt war es für die Juden ein Zustand der Freiheit, der Weltoffenheit, der alleuropäischen Kultur. Übrigens kam Düsseldorf noch vor Heines Geburt in den Besitz der französischen Revolutionsarmee (1795, General Kléber in Düsseldorf). Das alles formte entscheidend an Heines Jugendeindrücken mit. Frei und aufrecht erwuchs er; wohl gab es einige Sticheleien gegen ihn in der katholischen Schule, die er als Kind besuchte; was aber kompakter Judenhaß, was Judenverfolgung bedeutet, erlebte er erst nach Verlassen der Heimat, zum erstenmal im Alter von 19 Jahren bei einem Judenkrawall in Hamburg.
Die väterliche Aszendenz kommt in den Memoiren Heines zu kurz. Den Grund hat er plausibel angegeben. Sein Vater Samson Heine war aus Hannover (oder Hamburg) zugereist, kein Einheimischer, es fehlten die Muhmen und Tanten, die dem Kind das Lob dieses Zweigs der Familie hätten singen können. Auch hier hat neuere Forschung (Gustav Karpeles »Heinrich Heines Stammbaum väterlicherseits« im »Gedenkbuch zur Erinnerung an David Kaufmann« Breslau 1900) vieles erhellt. Schon der Urgroßvater David Simon Heine lebt in Hannover und hat das Privileg eines Familiennamens. »Woher derselbe (dieser Name: Heine) stammt, ist nicht recht ersichtlich. Den Namen Heynn führte schon 1334 ein Jude in Straßburg.« David Simons Vater stammt aus Bückeburg. Er hieß Isak. Die Archive melden nichts von ihm. Dagegen spricht von David Simon das Memorbuch der Gemeinde Hannover als von einem frommen und wohltätigen Mann, der das Gesetz der Nächstenliebe erfüllte, der vor allem diejenigen, die dem Studium der Lehre oblagen, förderte und beschenkte, der die religiösen Satzungen heilig hielt und hierin von seiner Gattin unterstützt wurde. Sein Sohn, also Heines Großvater, ist Heymann Heine, wie er im Verkehr mit den Behörden hieß, in der »jüdischen Gasse« Chajim Bückeburg genannt, – ein Name, der von antisemitischen Witzlern gern auf den Enkel übertragen wird, ohne ersichtlichen Grund und übrigens auch ohne besonderen Witz. Über Heymann Heine wissen wir wenig. Er brachte es zu Wohlstand und heiratete in zweiter Ehe die Tochter des reichen Kaufmanns Meyer Samson Popert aus Altona. Dieser Ehe entstammt als zweiter Sohn Heines berühmter Hamburger Onkel, der Bankier Salomon Heine, als dritter: Heines Vater Samson. Heymann selbst wird unter den 18 Männern genannt, die 1762 in Hannover einen »Verein zum Studium der göttlichen Lehre, zum Krankenbesuch und zur Wohltätigkeit« gründeten, – Männern, die »den geachtetsten und ältesten Familien der Gemeinde angehörten«. Auch ihn rühmt das Memorbuch der Gemeinde Hannover. Sein Grabstein auf dem alten Judenfriedhof der Stadt ist erhalten.
Väterlicher- wie mütterlicherseits stammt also Heine aus Familien, deren Ansässigkeit in Nordwestdeutschland eine lange nachweisbare Geschichte hat, deren jüdische Tradition festgegründet und ungewöhnlich aktiv, sogar führerhaft war, ehe die Emanzipation dieser gesamten Geistigkeit eine neue Richtung gab. Die Vorstellung von nomadenhafter Wurzellosigkeit, krämerhaftem Ungeist, kurz von Unkultur der Vorfahren, wie sie durch manche Heine-Biographie spukt, muß also auf Grund neuerer Forschungsergebnisse berichtigt werden. Die Generation von Heines Eltern stand noch mitten in der jüdischen Überlieferung, im jüdischen Wissen, wenn auch bereits vom Umbruch der Judengesetzgebung berührt, der von Frankreich her den deutschen Westen eher erreicht hatte als das übrige Deutschland.
Hier ein letztes Beispiel, das die Tradition und Geistigkeit im Haus der Heine-Vorfahrenschaft belegt, zitiert nach Kaufmann:
»Lazarus von Geldern hatte schon aus der Heimat, aus dem durch den Kunstsinn und die Prachtliebe eines verschwenderisch freigiebigen Fürsten emporgeblühten Düsseldorf, den Sinn für den feineren Lebensgenuß und das Bestreben, sein Haus auf das Geschmacksniveau und den Bildungsgrad der Zeit zu heben, mit nach Wien gebracht. Noch hat ein kleines Denkmal sich erhalten, das, gleichsam vom Duft seiner Umgebung noch umwittert, von der feinen Sitte und dem kunstsinnigen Zuge, die in dem Hause Juspas von Geldern herrschten, Zeugnis ablegt. Einem jüdischen Schreibkünstler und Maler von bemerkenswerter Fertigkeit, Mose Jehuda, genannt Löb, dem Sohne Benjamin Wolf Brodas aus Trebitsch in Mähren, hatte er 1723 den Auftrag erteilt, das Ritual der beiden Abende des jüdischen Freiheitsfestes, die sogen. Pessachhaggada, auf Pergament zu schreiben und reich durch bunte, dem Inhalt entsprechende Illustrationen in leuchtenden Farben auszuschmücken. Vielleicht hat das Auge des späten Enkels, dem es vorbehalten bleiben sollte, die Poesie jener Festabende in einem ewigen Kunstwerke abgeklärt festzuhalten, vielleicht hat der Dichter des Rabbi von Bacharach, Heinrich Heine, als Knabe im Elternhause noch an den Bildern sich geweidet, die das Kunstbedürfnis seines Urgroßvaters in Wien hatte schaffen heißen.«
Sollte nun der hier genannte »Schreibkünstler und Maler« zu meinen Vorfahren gehören, was der Sachlage nach durchaus möglich erscheint, denn die Namen »Broda« und »Brod« sind identisch, und fromme Künste solcher Art unter meinen Ahnen nachweisbar, so dürfte ich hier einen Augenblick bei dem freundlichen Gedanken innehalten, daß schon einmal jemand meines Geschlechts in Dienst und Auftrag des Hauses Heine gestanden hat.
II
Jugend • Düsseldorf
Das Geburtsdatum Heinrich Heines ist nicht bestimmbar, denn die öffentlichen Originaldokumente hat ein Brand vernichtet und die privaten Angaben schwanken. So liegt Dunkel über dem ersten Tatbestand von Heines Leben; wie auch einer der letzten, die Persönlichkeit der »Mouche«, trotz allen Bemühungen der Fachwissenschaft nicht völlig erhellt worden ist. Daß in zwei Rätsel wie in einen dunklen Rahmen der Erdenwandel des angeblich so rationell durchlichteten, subjektiven, zynischen, seine Lebensumstände eitel und schamlos – so sagt man – wie auf der flachen Hand aufzeigenden Dichters eingespannt ist, sollte vielleicht doch zu denken geben, die gängige Charakteristik mit einem Fragezeichen versehen.
In der Neujahrsnacht 1800 ist Heine nicht geboren. Er gab das nur an, um den Witz anzubringen: »Ich bin einer der ersten Männer des Jahrhunderts.« Verließ ihn einmal seine tief eingewurzelte Neigung, die Leute zu mystifizieren, so bezeichnete er als »authentisch« das Datum: 13. Dezember 1799. Nach anderen Angaben wäre Heine um zwei Jahre früher, am 13. Dezember 1797, zur Welt gekommen. In den Düsseldorfer Archiven ist, wie Heine selbst in einem Brief an seine Schwester schreibt, das Datum der Geburt nicht richtig angegeben »aus Gründen, die ich nicht sagen will«. Hat er damit eine neue Mystifikation versucht? Welches waren die Gründe? Vermeidung des Militärdienstes – auf diesen Grund stürzt sich natürlich eine gewisse Forscherkategorie – oder frühere Aufnahme in die Mittelschule, das französische Lyzeum, das ein Minimalalter vorschrieb, oder Erleichterung der Auswanderung nach Hamburg? Darüber zerbricht man sich den Kopf. Es ist unwichtig. Friedrich Hirth, der verdienstvolle, doch wiederholt irrende Herausgeber der Gesamtausgabe von Heines Briefen, meint, daß Heine vor der offiziellen Eheschließung seiner Eltern zur Welt gekommen sei und daß die Familie, um diese Tatsache zu verdecken, seine Geburt falsch datiert habe. Die von Hirth angeführten Gründe seiner Behauptung scheinen mir nicht ganz überzeugend.
Das Kind wurde nach einem Geschäftsfreund – dem »Freund meines Vaters, der sich auf den Einkauf des Velveteens am besten verstand« – Harry genannt. »Ich höre mich noch jetzt sehr gern bei diesem Namen nennen«, heißt es in den »Memoiren«. Es war und blieb der Name für den Familienkreis. In der Kindheit provozierte dieser Name allerdings einen der ersten schmerzlichen Zusammenstöße mit der Umwelt. Schulkameraden und Nachbarskinder riefen dem Kleinen »Haarüh« nach, den Ruf des »Dreckmichels«, der seinen Esel antrieb. Dreckmichel hieß der Mann nach seinem Gewerbe, weil er jeden Morgen den vor den Häusern zusammengekehrten Kehricht auf seinen Eselskarren lud. »Meine Homonymität mit dem schäbigen Langohr blieb mein Alp. Die großen Buben gingen vorbei und grüßten ›Haarüh!‹, die kleineren riefen mir denselben Gruß zu, aber in einiger Entfernung. In der Schule ward dasselbe Thema mit raffinierter Grausamkeit ausgebeutet; wenn nur irgend von einem Esel die Rede war, schielte man nach mir, der ich immer errötete, und es ist unglaublich, wie Schulknaben überall Anzüglichkeiten hervorzuheben oder zu erfinden wissen.«
Zarte, verletzliche Seele des Knaben! Heine, der boshafte Spötter, ist diese übergroße Empfindlichkeit gegen Spott und Hohn, die ihm angetan wurden, nie los geworden. »Als ich mich bei meiner Mutter beklagte, meinte sie, ich solle nur suchen, viel zu lernen und gescheit zu werden, und man werde mich dann nie mit einem Esel verwechseln.« – Die Mutter weckt den Ehrgeiz, ihr Heilmittel ist rationaler Art, von ihr empfängt das Kind zum erstenmal, in primitivster Art, das Erbe der französischen Aufklärung: viel lernen, wissen, gescheit sein. Die Mutter ist es denn auch, die selbst den ersten Schreibunterricht gibt, die die Erziehung der Kinder leitet, – vier Kinder: Harry, Charlotte, Gustav, Max, – die für den Knaben zuerst eine Karriere im Stile des napoleonischen Reiches (Strategie, Staatsdienst), dann nach dem Fall Napoleons eine Rothschildsche Laufbahn, schließlich die eines Juristen erträumt. Allemal erfolglos, wie sich bei solch mütterlichem Schicksal-Spielen-Wollen fast von selbst versteht.
Die Liebe zur Mutter ist eine der festesten Grundlagen von Heines Leben geblieben. Ergreifend mischt sie sich mit dem Heimweh nach Deutschland. »Das Vaterland wird nie verderben, jedoch die alte Frau kann sterben.«
Seit ich die Mutter nicht gesehn,
Zwölf Jahre sind schon hingegangen;
Es wächst mein Sehnen und Verlangen.
Mein Sehnen und Verlangen wächst.
Die alte Frau hat mich behext.
Ich denke immer an die alte,
Die alte Frau, die Gott erhalte!
Die alte Frau hat mich so lieb,
Und in den Briefen, die sie schrieb,
Seh ich, wie ihre Hand gezittert,
Wie tief das Mutterherz erschüttert
Die Mutter liegt mir stets im Sinn.
Zwölf lange Jahre flossen hin.
Zwölf lange Jahre sind verflossen.
Seit ich sie nicht ans Herz geschlossen.
Nach Deutschland lechzt’ ich nicht so sehr
Wenn nicht die Mutter dorten wär’.
Bis zuletzt hat er ihr die katastrophalen Verschlimmerungen seines Siechtums zu verhehlen gesucht; die Kunde von seinem Krankenlager dringt von Paris nach Hamburg, da schreibt er ihr, das sei nur ein Verlegertrick, um den Absatz seiner Bücher zu steigern. Ob sie ihm geglaubt hat? Sie war sehr klug und sie stellte, wie wir aus »Deutschland, ein Wintermärchen« wissen – »mitunter verfängliche Fragen.« Eine resolute, eine tüchtige Frau. Sie hat den Sohn überlebt. Welch ein Portrait in wenigen Strichen, diese Begrüßung nach langer Frist, dieses Wiedersehen, wie Heine es malt; unübertrefflich knapp und wahr:
Und als ich zu meiner Frau Mutter kam,
Erschrak sie fast vor Freude;
Sie rief: »Mein liebes Kind!« und schlug
Zusammen die Hände beide.
»Mein liebes Kind, wohl dreizehn Jahr’
Verflossen unterdessen!
Du wirst gewiß sehr hungrig sein –
Sag an, was willst du essen?
Eine Realistin. Man muß freilich diesen jüdischen Familienmüttern in eigener Erfahrung begegnet sein, um sie beurteilen zu können. Unter rationaler Oberfläche strömen oft Fluten mächtigen Gefühls. Die Art ist auch heute nicht ausgestorben. Ich bilde mir ein, diese Frau Betty Heine zu kennen wie meine eigene Mutter, – meine eigene Mutter war allerdings ganz anders, aber mit Frau Betty Heine bin ich schon mehr als einmal im Leben zusammengetroffen. Nicht von ihr hat Heine, so erzählt er selbst, den Sinn für das Phantastische und die Romantik. Sie hatte »eine Angst vor Poesie«, entriß dem Kind jeden Roman, den sie in seinen Händen fand, erlaubte ihm keinen Theaterbesuch, schalt die Dienstboten, die in seiner Gegenwart Gespenstergeschichten erzählten. Indes konnte sie nicht verhindern, daß eine alte Magd aus dem Münsterland, die in großer Menge Märchen und Volksgesänge kannte, das Herz des Jungen frühzeitig mit dem süßen Grausen alter deutscher Überlieferungen erfüllte. Und die erste zage Liebe des Heranwachsenden, der erste Kuß galt der roten Scharfrichterstochter, – jene Seiten der »Memoiren«, die von dem roten Sefchen, ihrem Richtschwert, ihrer »bis zur Klanglosigkeit verschleierten« Stimme und den seltsamen Mahlzeiten und Zeremonien in der einsamen Scharfrichterei berichten, sind wohl – neben dem Bild des Vaters und einigen politisch-philosophischen Abschnitten – die schönste Prosa, die Heine geschrieben hat, ernst und festgefügt, von keinerlei Witzelei durchlöchert, der klassischen deutschen Prosa im Range ebenbürtig; was man im Ganzen von Heines Prosawerk durchaus nicht sagen kann.
Das Bild des Vaters: es steht um vieles geheimnisvoller neben dem der Mutter, obwohl vom gütigen Licht einer gewissen Kindlichkeit umflossen, die sich freilich an der Grenze des Leichtsinns oder gar Schwachsinns bewegt. Seltsames Gegenstück jedenfalls zum scharf konturierten Bild der Mutter, die eine »strenge Deistin« von »vorwaltender Vernunftrichtung« war, Tochter eines gebildeten Mannes, der als Arzt bereits der deutschen Kultur angehörte, selbst hochgebildet, – »schon als ganz junges Mädchen mußte sie ihrem Vater die lateinischen Dissertationen und sonstige gelehrte Schriften vorlesen« –. Zu dieser Angabe bildet die Tatsache, daß die von ihr erhaltenen Briefe in deutscher Sprache, aber in hebräischen Lettern geschrieben sind, keinen Gegensatz; denn das Deutschschreiben mit hebräischen Schriftzeichen ist eine bloße Form, entsprach dem Brauch der Zeit. In »aufgeklärter« Art eifern diese Briefe gegen Etikette und Konvention, die Schülerin Rousseaus hebt »Empfindungen« über alle »Bewegungsgründe«, ist aber gegen die »sogenannte modische Empfindsamkeit«, – ein klarer, reiner Geist, dabei leidenschaftlich; in den Zeilen, die sie nach dem Tod ihres Bruders – 1796 – schrieb, mag man schon die bildhafte Stilkraft des Sohnes vorgebildet finden: »Vergebens suchten meine Freunde mich mit dem Unglück meiner Mitmenschen zu trösten; meines Nachbars Wunde heilet die meine nicht. Vergebens sucht die Vernunft das vom tobenden Schmerze zerrissene Herz zu beruhigen … O es ist zum Erstaunen, wie viel diejenigen, welche das Schicksal zum Ziel seiner Pfeile gemacht zu haben scheint, zu dulden vermögen, bis sie endlich fest und abgehärtet dastehen als lebendige Denkmäler menschlicher Leiden und Kräfte.« Zwischen solch einer Mutter und ihrem Kind hat es jedenfalls geistige Brücken, Möglichkeiten der Verständigung gegeben.
Zum Vater führte eine solche Brücke nicht. Zu dem lebensfrohen, ein wenig einfältigen Vater, der als Proviantmeister den Feldzug des Prinzen von Cumberland in Flandern und Brabant mitmachte, der zeitlebens eine Vorliebe für Soldatenwesen und noble Passionen behielt, glücklich war, die schöne dunkelblaue Uniform der Düsseldorfer Bürgergarde tragen, an der Spitze der Kolonnen an seinem Haus in der Bolkerstraße vorbeidefilieren, zu seiner Frau »mit allerliebster Courtoisie« hinaufsalutieren zu dürfen, der auch sein Geschäft nur wie zum Spiel betrieb, »wie die Kinder Soldaten und Kochen spielen«, zu diesem hübschen »niedlichen« Vater, der sich vom Haarbeutel des Rokoko nicht trennen wollte, gab es nur die Brücke der Liebe, nicht die der Verständigung. Und so hebt denn auch der dem Vater gewidmete Abschnitt der Memoiren wie mit einer Beschwörungsformel an, die durch ihre Bestimmtheit irgendein Gegengefühl bannen möchte: »Er war von allen Menschen derjenige, den ich am meisten auf dieser Erde geliebt.« Und dann heißt es – man vergleiche dazu die analoge Stelle im »Schnabelewopski« –:
»Er ist jetzt tot seit länger als 25 Jahren. Ich dachte nie daran, daß ich ihn einst verlieren würde, und selbst jetzt kann ich es kaum glauben, daß ich ihn wirklich verloren habe. Es ist so schwer, sich von dem Tod der Menschen zu überzeugen, die wir so innig liebten. Aber sie sind auch nicht tot, sie leben fort in uns und wohnen in unserer Seele.
Es verging seitdem keine Nacht, wo ich nicht an meinen seligen Vater denken mußte, und wenn ich des Morgens erwache, glaube ich oft noch den Klang seiner Stimme zu hören, wie das Echo eines Traumes. Alsdann ist mir zu Sinn, als müßte ich mich geschwind ankleiden und zu meinem Vater hinabeilen in die große Stube, wie ich als Knabe tat.
Mein Vater pflegte immer sehr frühe aufzustehen und sich an seine Geschäfte zu begeben, im Winter wie im Sommer, und ich fand ihn gewöhnlich schon am Schreibtisch, wo er ohne aufzublicken mir die Hand hinreichte zum Kusse. Eine schöne, feingeschnittene, vornehme Hand, die er immer mit Mandelkleie wusch. Ich sehe sie noch vor mir, ich sehe noch jedes blaue Äderchen, das diese blendend weiße Marmorhand durchrieselte. Mir ist, als steige der Mandelduft prickelnd in meine Nase, und das Auge wird feucht.
Zuweilen blieb es nicht beim bloßen Handkuß, und mein Vater nahm mich zwischen seine Knie und küßte mich auf die Stirn. Eines Morgens umarmte er mich mit ganz ungewöhnlicher Zärtlichkeit und sagte: ›Ich habe diese Nacht etwas Schönes von dir geträumt und bin sehr zufrieden mit dir, mein lieber Harry.‹ Während er diese naiven Worte sprach, zog ein Lächeln um seine Lippen, welches zu sagen schien: mag der Harry sich noch so unartig in der Wirklichkeit aufführen, ich werde dennoch, um ihn ungetrübt zu lieben, immer etwas Schönes von ihm träumen.«
Dieser gefühlsmäßig-naiven, irrationalen Anlage entspricht es, daß die jüdische Tradition im Vater einen treueren Behüter fand als in der Mutter, die frühzeitig ihren jüdischen Vornamen Peira (= Zippora, nach Zunz) in Betty änderte. Vater Heine dagegen blieb Samson Heine bis an sein Lebensende. Es ist festgestellt, daß er Vorsteher der »Gesellschaft zur Ausübung menschenfreundlicher Handlungen und zum Rezitieren der Psalmen« in Düsseldorf war, einer orthodoxen Vereinigung von der Art der Prager Chewra oder »Beerdigungsbrüderschaft«. Zum Vorsteher konnte er wohl nur als »Frommer« gewählt werden; doch muß man darin – im Gegensatz zu Karpeles, dessen oben zitierter Schrift über Heines Stammbaum ich die Daten entnehme – nicht unbedingt einen Gegensatz zu den Angaben Heines über die Lebensfreude und Weltlust seines Vaters finden; wie ich überhaupt der Ansicht bin, daß man autobiographischen Angaben eines Dichters im allgemeinen mehr Glauben schenken müßte, als es zünftigerseits geschieht, und daß bei Vorhandensein scheinbar entgegensprechender Daten immer erst auch noch die Frage zu stellen wäre, ob sich die von andern mitgeteilten Dokumente und Tatsachen nicht doch mit den Nachrichten des Autobiographen in irgendeiner Form vereinbaren lassen, und ob nicht am Ende manchmal die andern Tradenten – und nicht der Dichter – das Unrichtige weitergegeben haben. Auch widerspricht einander so vieles auf dem Papier, was im Leben auf geheimnisvoll flüssige Weise sehr wohl miteinander auskommt. Der Schulgebrauch dagegen ist geneigt, im Zweifelsfall immer gegen den Verfasser einer Autobiographie zu entscheiden, ja derartige Zweifelsfälle künstlich zu schaffen. Es ist ja ein so schönes Gefühl, klüger oder doch gewissenhafter, nüchterner zu sein als der Autobiograph, ihm auf seine Schliche und Phantastereien zu kommen. Dieses Gefühl verschafft man sich daher gern auch gewaltsam, – womit ich aber schon weit über das hinausgegangen bin, was gegen den wackeren Mann zu sagen wäre, der sich so große Verdienste um die Heineforschung erworben hat. – Im folgenden zitiere ich Karpeles vorbehaltlos: »Später wurde Samson Heine allerdings durch seine aufgeklärte Gattin immer mehr aus jenen – orthodoxen – Kreisen entfernt. Zu Anfang des neuen Jahrhunderts hält er sich schon zu den Aufklärern innerhalb seiner Glaubensgemeinschaft, ja er hatte sich sogar in die Loge ›zur Morgenröte‹ in Frankfurt a. M. aufnehmen lassen. Im Jahre 1804 finden wir Samson Heine mit einem Beitrag unter den Männern verzeichnet, die die Begründung der ersten oder doch einer der ersten (sc. deutsch-jüdischen) Schulen, des Philanthropins in Frankfurt a. M., unterstützen.«
Heines Vater wurde aber niemals ein Deist nach Frau Bettys Geschmack, er hielt sich an die Form des Judentums, die jüdischen Inhalt richtiger bewahrte, als die damalige philosophische Ausdeutung der Religion mit ihrer scheinbaren Ehrfurcht vor dem »Kern« des Judentums es vermochte. Die »Schale« erwies sich als robust, hielt standhafter aus als der sogenannte Kern, selbst wenn sie, wie gerade auch bei Vater Heine, oft nicht viel mehr als gedankenlos geübte Praxis blieb. In dieser »Schale« steckte trotz allem, unbeachtet, fast unbewußt, das volkhafte Element des Judentums, das eigentliche Leben, sei es in noch so erstarrter und abstruser Gestalt. Volkhafter Brauch und religiöse Praxis hingen eng, ja ununterscheidbar zusammen. Irreligiöse Äußerungen des Knaben werden Herrn Samson Heine hinterbracht. Da beweist er »nicht dieselbe Nachsicht« wie im Falle der Scharfrichterstochter, sondern hält jene merkwürdige »Standrede«, »die längste, die er wohl je gehalten hat«, mit deren flackernder, doppelbodiger Ironie das Memoirenfragment schließt:
»Lieber Sohn! Deine Mutter läßt dich beim Rektor Schallmeyer Philosophie studieren. Das ist ihre Sache. Ich, meinesteils, liebe nicht die Philosophie, denn sie ist lauter Aberglauben, und ich bin Kaufmann und habe meinen Kopf nötig für mein Geschäft. Du kannst Philosoph sein, soviel du willst, aber ich bitte dich, sage nicht öffentlich, was du denkst, denn du würdest mir im Geschäft schaden, wenn meine Kunden erführen, daß ich einen Sohn habe, der nicht an Gott glaubt; besonders die Juden würden keine Velveteens mehr bei mir kaufen, und sind ehrliche Leute, zahlen prompt und haben auch recht, an der Religion zu halten. Ich bin dein Vater und also älter als du und dadurch auch erfahrener; du darfst mir also aufs Wort glauben, wenn ich mir erlaube, dir zu sagen, daß der Atheismus eine große Sünde ist.«
Der Vater hatte in gewissem Sinne recht. In die jüdische Gemeinschaft gehört Heinrich Heine, und zwar in die Kehilla Düsseldorf, die jüdische Gemeinde Düsseldorf, und noch genauer: in ein bestimmtes Entwicklungsstadium dieser Kehilla, das durch die Zeit – Anfang des 19. Jahrhunderts – und die französische Herrschaft im Rheinland bestimmt ist. Nur in diesen Zusammenhängen sind die Anfänge von Heines Erziehung und Entwicklung zu begreifen. Womit nicht gesagt ist, daß nicht auch die nichtjüdische Umgebung von größter Bedeutung für ihn geworden ist, sowohl die frommkatholische Bevölkerung und ihre Denkweise – »Wallfahrt nach Kevelaar« – wie der altgermanisch-heidnische Mythos, der in Volkssagen, Märchen, in den vielfachen Gestalten der »Elementargeister«, der Landschaft und geschichtlichen Überlieferung, in das empfängliche Gemüt des Knaben einging. Landschaft, Sage, Geschichte der Heimat … noch in späten Jahren, in Paris schreibt Heine: »Nein, die Erinnerungen an den alt-germanischen Glauben sind noch nicht erloschen. Wie man behauptet, gibt es greise Menschen in Westfalen, die noch immer wissen, wo die alten Götterbilder verborgen liegen; auf ihrem Sterbebette sagen sie es dem jüngsten Enkel, und der trägt dann das Geheimnis in dem verschwiegenen Sachsenherzen. In Westfalen, dem ehemaligen Sachsen, ist nicht alles tot, was begraben ist. Wenn man dort durch die alten Eichenhaine wandelt, hört man noch die Stimmen der Vorzeit, da hört man noch den Nachhall jener tiefsinnigen Zaubersprüche, worin mehr Lebensfülle liegt als in der ganzen Literatur der Mark Brandenburg. Eine geheimnisvolle Ehrfurcht durchschauerte meine Seele, als ich einst, diese Waldungen durchwandernd, bei der uralten Siegburg vorbeikam. ›Hier‹, sagte mein Wegweiser, ›hier wohnte einst König Wittekind‹, und er seufzte tief. Es war ein schlichter Holzfäller, und er trug ein großes Beil. – Ich bin überzeugt, dieser Mann, wenn es darauf ankommt, schlägt sich noch heute für König Wittekind; und wehe dem Schädel, worauf sein Beil fällt!« Man sieht, jene Leute haben es nicht leicht, die aus Heine einen geschichtslosen Blagueur, Asphaltliteraten und materialistischen Sozialisten machen wollen, mögen sie dieser Vorstellung nun in lobender oder herabsetzender Absicht nachgehen. Ebenso sicher aber wie die Tatsache seiner innigsten Verknüpfung mit der deutschen heimatlichen Umwelt ist es, daß Möglichkeit und Maß solcher Verknüpfung durch den rechtlichen und tatsächlichen Zustand der Judengemeinschaft, in der er aufwuchs, bedingt erscheint.