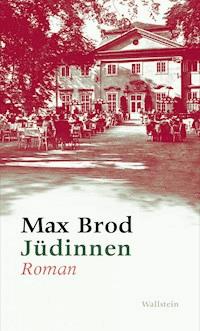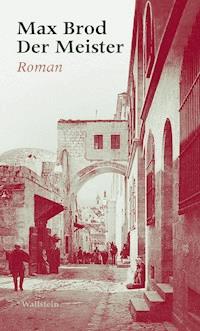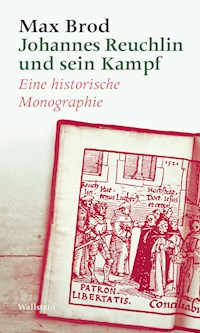Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Max Brod - Ausgewählte Werke
- Sprache: Deutsch
Arnold Beer ist ein junger Mann, der nach dem Vorbild der Flugschau von Brescia, die Brod und Kafka gemeinsam besucht hatten, eine Flugschau in Prag veranstalten möchte. Er sammelt Geld und baut Bretterbuden. Die unscheinbare Lina, ein böhmendeutsches christliches Mädchen, das ihm als Sekretärin zur Seite steht, verliebt sich in ihn. Er weist sie zurück, kann aber auf ihre Hilfe nicht verzichten. Schließlich kommt, was kommen muss: sie verführt ihn - eine schöne Variante in den an Verführungsgeschichten reichen Liebesromanen Brods. Am Schluss des Romans besucht Arnold seine Großmutter auf dem Lande: eine wunderliche und wunderbare Frau, die den Enkel - in ihrem böhmischen Deutsch mit starken jiddischen Einsprengseln - kaum zu Wort kommen lässt. Die Welt des Prager deutschen Judentums, die manche Leser bei Kafka suchen, können sie bei Max Brod finden.Der Band enthält außerdem den kleinen Roman "Ein tschechisches Dienstmädchen" (1909) sowie die Novelle "Weiberwirtschaft" (1913).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Max BrodAusgewählte Werke
Herausgegeben von Hans-Gerd Kochund Hans Dieter Zimmermannin Zusammenarbeit mit Barbora Šramkováund Norbert Miller
Max BrodArnold Beer
Das Schicksal eines Juden
Roman
und andere Prosaaus den Jahren1909–1913
Mit einem Vorwortvon Peter Demetz
Gefördert von der Fritz Thyssen Stiftung Köln undunterstützt vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfondssowie dem deutschen Auswärtigen Amt
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnetdiese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internetüber http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2013www.wallstein-verlag.deVom Verlag gesetzt aus Aldus RomanUmschlaggestaltung: Susanne Gerhards, DüsseldorfDruck und Verarbeitung: Hubert & Co, GöttingenISBN (Print) 978-3-8353-1268-5ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-2456-5ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-2457-2
Inhalt
Vorwort(Peter Demetz)
Arnold Beer.Das Schicksal eines Juden. Roman (1912)
Prosa aus den Jahren 1909 – 1913
Ein tschechisches DienstmädchenKleiner Roman (1909)
Weiberwirtschaft (1913)
Nachwort (Barbora Šrámková)
Editorische Notiz
Über den Autor
Vorwort
Max Brods literarische und ideologische Entwicklung zu verfolgen ist nicht einfach. Er hat viel über sein Leben und sein Werk geschrieben, ein unwiderlegbar scharfes Bild von sich skizziert und von Beginn an nahezu kategorisch seine eigenen Ideen und jene seines Freundes Kafka interpretiert. Im ersten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts verfolgte er das persönliche und politische Ziel, sein Judentum Schritt für Schritt zu bedenken und sich zu ihm zu bekennen. Er kam einer spezifischen zionistischen Lösung der jüdischen Frage nahe, wobei er lange eher zu Martin Bubers Vorstellungen von der jüdischen Kultur neigte, als sich mit Theodor Herzls Bemühungen um einen eigenen Staat zu identifizieren. Oft beschrieb er seinen intellektuellen Werdegang und erklärte den Wandel seiner Ideen als philosophisches Problem, in dem seiner Entwicklung als Romancier nur geringe Bedeutung zukam. Er schuf sich seinen persönlichen Kanon, indem er den Wert der späteren Romane – von Tycho Brahes Weg zu Gott (1916) zu Stefan Rott, oder das Jahr der Entscheidung (1932) hervorkehrte und damit seine Interpreten drängte, die frühen Werke auszuklammern, darunter Ein tschechisches Dienstmädchen (1909), Jüdinnen (1911) und Arnold Beer: Das Schicksal eines Juden (1912) mit ihren erotischen Affären, der vornehmen Gesellschaft, dem mondänen Sportinteresse, darunter auch einige Erinnerungen an das von Brod und Kafka 1909 besuchte Flugmeeting, den circuito in Brescia. Aber gerade in dem Roman über Arnold Beer überwindet Brod die Welt des Dandys und entscheidet sich für eine dauerhafte Anerkennung der jüdischen Traditionen, Familienbande und für ein metaphysisches Engagement.
Es trifft sicher zu, dass Brod die Bedeutung seiner jüdischen Herkunft in den drei oder vier Jahren nach der Brescia-Reise in einem zögernden und häufig widersprüchlichen Prozess erfasste und einen radikalen Wandel seiner Selbsteinschätzung vollzog. Gegen Ende des ersten Jahrzehnts war er noch immer davon überzeugt, in einer Stadt zweier Nationen, der Deutschen und der Tschechen, zu leben, wobei er sich selbst zu den deutschen Schriftstellern zählte. Ein paar Jahre später sprach er von drei Nationen, den Deutschen, den Juden und den Tschechen, und hielt sich selbst für einen »jüdischen Schriftsteller deutscher Sprache« (1913). Sein kleiner Roman Ein tschechisches Dienstmädchen (1908) markiert ein Stadium seiner Entwicklung: Wie in vielen deutschsprachigen Prager Romanen verliebt sich ein junger Deutscher, zumeist ein Student oder Büroangestellter, in ein slawisches Mädchen, das immer aus der Unterschicht stammt. Der junge Mann, der sich dabei ziemlich herablassend verhält, erfährt trotz der ernsthaften Bemühungen des Mädchens wenig über ihr Volk. Brods William, der aus Wien stammt, erfasst nicht einmal, dass seine reizende Pepitschka auf der Flucht vor ihrem Ehemann ist, einem brutalen Flößer aus dem Vorort Podskal, und am Ende bringt sie sich um. In der zweigeteilten oder eigentlich dreigeteilten Stadt wurde Brods Erzählung nicht mit Begeisterung aufgenommen. Růžena Jesenská, Autorin vieler Gesellschaftsromane aus dem tschechischen Bürgertum, die ihre Nichte Milena an Bekanntheit übertraf – in Hašeks Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk verwendet ein gebildeter Leutnant als Ausdruck größter Missbilligung Seiten aus einem ihrer Romane als Toilettenpapier –, empfand das Buch als Beleidigung ihres Volkes, denn Brod bestätigte darin die bloß physiologische Natur der tschechischen Frauen, und jüngere jüdische Leser wunderten sich über die totale Absenz der dritten Nation in der Stadt. Leo Hermann schrieb in der Selbstwehr, dem Sprachrohr der jungen zionistischen Intellektuellen, er sei von Brods Vorsatz, die beiden Nationen miteinander zu versöhnen, beeindruckt gewesen, fügte jedoch hinzu, eine solche Annäherung könne allerdings nicht nur im Bett vor sich gehen. Autor und Kritiker trafen einander kurz darauf, und Leo Hermann, Mitglied der Bar-Kochba-Vereinigung, unterrichtete Brod bei dieser Gelegenheit über die Grundlagen des jüdischen Lebens und der jüdischen Geschichte.
Um 1910/1912 hatte sich der junge Jurist Brod mit Martin Bubers Ideen über eine neue jüdische Bewusstseinsbildung ernsthaft auseinandergesetzt, frequentierte gemeinsam mit Kafka die Vorstellungen eines jüdischen Wandertheaters, nahm an den Versammlungen des Bar-Kochba teil und suchte häufig seinen philosophischen Mentor Hugo Bergmann auf – er war später Philosophieprofessor an der Hebräischen Universität in Jerusalem –, der ihm die Lektüre von Theodor Herzls Roman über die Heimkehr in Israel empfahl. Der Romancier Brod hatte bisher also nur ein einziges Mal – und da auch indirekt – das Porträt eines jüdischen Charakters skizziert. In dem Roman Schloss Nornepygge (1908) verrät Herr Pollodi, ein Verfechter untadeligen Benehmens – hier nimmt Brod Thomas Manns Chaim Breisacher aus Doktor Faustus vorweg –, durch leichte Anflüge einer jiddischen Syntax in seiner Sprache, dass er aus dem Ghetto kommt, und überkompensiert, was er als soziales Manko empfindet, durch die künstliche Aura einer guten Erziehung. Im Roman Jüdinnen (1911) knüpft Brod an die im 18. Jahrhundert von Jane Austen und Walter Scott begründete Gattung des »Baderomans« an und setzt sich mit der jüdischen Bourgeoisie seiner eigenen Herkunft auseinander – freilich kann sich das jüdische Teplitz, wo die Prager jüdische Bourgeoisie zur Kur weilte, nicht mit Bath oder Cheltenham und ihren eleganten Kurhotels messen. Ein Student, der sich im Sommer Hals über Kopf in eine Affäre stürzen möchte, ist sich unklar darüber, ob er das Schicksal der attraktiven Irene, die sich hier mit ihrer Mutter auf der Suche nach dem passenden Ehemann befindet, missbilligen oder Mitleid mit der drallen Olga aus der Provinz haben soll, die zwar eine starke Persönlichkeit, aber keine Kultur besitzt. Alle tun einigermaßen vornehm: Die Eltern tadeln das »jüdische Verhalten« ihrer Kinder, was immer das sein mag, gewisse jiddische Ausdrücke sind verboten, und man unterhält sich über zionistische Ideen. Kafka mochte diesen Roman nicht besonders, möglicherweise berief er sich dabei auf eine in der Selbstwehr erschienene Rezension; er wusste nicht viel mit dem Studenten in der Rolle des Erzählers anzufangen und, zu einem Zeitpunkt, als der Zionismus die Diskussion über eine mögliche Lösung der jüdischen Frage angeregt hatte, verzichtet Brod in dem Text auf eine persönliche Stellungnahme. Es war dies das erste Mal, dass Kafka den Ausdruck »Zionismus« in seinen Schriften verwendete (Tagebücher, vermutlich 27. März 1911), und ironischerweise wirft der Produzent so vieler Bedeutungen seinem Freund vor, er habe nicht einmal eine einzige geboten.
In seiner Autobiographie Streitbares Leben (1960) gesteht Brod, er habe endgültig mit seinem ethisch gleichgültigen und rein ästhetisch verpflichteten Schopenhauerismus der frühen Jahre gebrochen, als er 1908 Walder Nornepygge in seinem Roman sterben ließ. Ganz sicher aber kann man Nornepygges gelangweilte Haltung noch in der Figur des Arnold Beer wiedererkennen, der einen Sinneswandel erfährt. Brod hatte einmal angedeutet, der Tod seiner Großmutter sei bei seiner Rückbesinnung auf das Judentum eine kurze Episode gewesen; ihre Darstellung in dem Roman – erdverbunden, impulsiv und in der früheren Welt des Jiddischen und der Religion verwurzelt – zwingt Arnold zu einer Entscheidung, die sein Leben nachhaltig verändert. Die ersten sechzig Seiten von Arnold Beer: Das Schicksal eines Juden zählen zu den besten, die Brod je geschrieben hat, denn er sieht sich selbst mit ironischem Blick als Dandy, und kein anderer Schriftsteller hat die kleine Welt der Prager assimilierten Jeunesse dorée vor dem Ersten Weltkrieg danach mit größerer Detailtreue und ratloserer Skepsis nachgezeichnet. Vor unseren Augen präsentieren sich die wechselnden Gruppenbilder in der Schule, auf dem Korso, dem Tennisplatz, in den Ballsälen, den Ruderclubs und bei den Pferderennen. Der in dieser abgeschlossenen Welt bewunderte Arnold hält sich für ein »einmaliges Individuum« und erwirbt sich das Ansehen seiner Freunde, indem er ihre Interessen imitiert, ohne selbst von einer wirklichen Leidenschaft gepackt zu sein. Er kennt die Prager Nachtlokale, doch hindert ihn seine Selbstgefälligkeit, Beziehungen einzugehen, die über eine schnelle Affäre hinausreichen. Nicht weiter verwunderlich ist, dass Arnold und Walder Nornepygge – von Brod aus dem früheren Roman übernommen – einander nicht ausstehen können. Walder hält Arnold für ziemlich primitiv, und Arnold sieht in Walder einen eingebildeten Narren. Der eine dient dem anderen als Spiegel.
Arnolds reicher Freund Philipp, der ihn um seine Meinung zu Blériot, Brods Helden, befragt, lobt die jüngsten grandiosen Leistungen der Flugkunst: »Die Brüder Wright hatten sich mit ihren Apparaten in beträchtliche Höhen erhoben, Zeppelin war mit seiner ersten Reise erfolgreich gewesen, Blériot hatte den Ärmelkanal überflogen.« Philipp macht sich Brods Idee über die großartigen Geschäftsmöglichkeiten zu eigen, die dieser dem zögernden Kafka bei ihrem Aufbruch in der brughiera aufgedrängt hatte, und es bedarf keiner großen Anstrengungen, Arnold zu überzeugen, wie wichtig und einträglich es wäre, Blériot nach Prag zu holen oder, bei dessen Absage, einen seiner Freunde oder Schüler. Aus völlig unterschiedlichen Motiven – Arnold denkt dabei an sein Prestige und Philipp an seinen Geldbeutel – gründen die beiden unverzüglich ein aus lokalen Honoratioren bestehendes Komitee zur finanziellen Absicherung. Arnold, der seinen Erfahrungshorizont erweitern möchte, akzeptiert den Vorsitz – ein krasser Gegensatz zu Brods billiger Eintrittskarte für den recinto –, verhandelt mit den Delegationen aus den Vororten über die Lage des Aerodroms, erörtert mit der Eisenbahnbehörde die Transportmöglichkeiten, prüft Sicherheitsfragen mit der Polizei, schreibt einen langen, konfusen Artikel über die Entwicklung der Flugkunst von Ikarus bis zur Flugwoche in Brescia und eröffnet sein eigenes Büro in einem der getreu nach dem Vorbild von Brescia errichteten Hangars unweit eines kleinen Kurortes bei Prag, wo der Schauflug stattfinden soll. In seinem Kopf rollen »Ideen wie Steinlawinen«, wie der Erzähler spitz bemerkt, und Arnold glaubt allmählich an die »ungeheure Zusammenfassung des Seins in einer nahen stürmisch-blitzenden Zukunft«. Blériot lehnt die Einladung ab, der Rekordflieger Farman ist anderweitig beschäftigt, das Komitee einigt sich schließlich auf Monsieur Ponterret, einen drittklassigen belgischen Piloten, der ein Flugzeug eigener Konstruktion vorführen soll. Wie Latham, Blériots Herausforderer, ist er Kettenraucher, und er gehört, wie der Romancier uns versichert, einer unserer Zeit schon etwas entfremdeten »Kinderstammelperiode« der Flugtechnik an. Dem redlichen Ponerret ist das Glück nicht gerade hold; bei seinem ersten Versuch lässt sich das Flugzeug nicht starten, und am Abend vor dem Schauflug bricht ein Flügel – Ersatzteile müssen in Paris bestellt werden. Die Schau wird vertagt, doch im Unterschied zu Brescia, wo das Komitee die Gültigkeit von Eintrittskarten für Tage, an denen nicht geflogen wird, verlängerte, weigert sich der tief verschuldete Philipp, das Geld zurückzuerstatten. Arnold begreift allmählich, dass er von seinem geldgierigen Freund manipuliert worden ist. Entmutigt und beschämt beschließt er fortzuziehen – am liebsten weit, weit weg.
Die Reise – eine kleine Strecke auf der Landkarte, aber ein weiter Weg für Geist und Seele – führt Arnold in eine andere Welt, in eine andere Zeit. Er begleitet die Mutter an das Krankenbett seiner Großmutter in ein kleines Dorf im Nordosten von Böhmen. Brod, der am Beginn des Romans die stilistischen Mittel des Fin-de-Siècle-Romans in Anlehnung an Thomas Mann modifiziert, konfrontiert im zweiten Teil Arnold sprachlich und kulturell mit der jüdischen Tradition, die in dem abgelegenen Dorf länger als in der Stadt zu überleben vermochte. Arnold hatte eine todkranke Großmutter erwartet, doch die schwache, liebevolle und unerschütterliche alte Frau empfängt ihren Enkel voll Freude. Sie zu verstehen bereitet ihm allerdings beträchtliche Mühe, denn sie spricht einen mit jiddischen Ausdrücken vermischten und der jiddischen Syntax entsprechenden schlesischen Dialekt. Ein historischer Moment von ganz besonderer Art; zum letzten Mal in der Prager deutschen Literatur ertönt ein Jiddisch, das die frühere Sprache der Prager und der böhmischen jüdischen Gemeinden vom 11. Jahrhundert bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts ins Gedächtnis ruft, ehe die jüdischen Gemeinden zur deutschen oder tschechischen Sprache überwechselten. Die alte, geschwächte und kranke Frau erinnert Arnold mit ihrer leicht reizbaren, starrsinnigen, ja nahezu wilden Energie an die Prophetin Deborah. Ihre mächtige Präsenz wirft einen Schatten auf seine bisherigen Erfahrungen. In einem plötzlichen Sinneswandel beschließt er, sein leeres Leben, die Gesellschaft, die Pferderennen, den circuito, der ohnedies ein Fehlschlag war, und seine laue Affäre mit einer nordböhmischen Schickse hinter sich zu lassen, und wendet sich seiner jüdischen Herkunft zu. Seine Vorfahren erscheinen ihm als makkabäische Krieger, die impulsive Großmutter erinnert ihn an das urjüdische »Erbe jenes biblischen Zornes, mit dem ein Volk von Raubtieren aus der Wüste sich über den Jordan schüttet und die Städte unbekannter Stämme mit der Schärfe des Schwertes austilgt«; zugleich spürte er auch die sanftere Seite der alten Juden, »ihr Klagen wie das Rauschen eines Waldes, ihr natürliches Führertum und Erzählertum, ihren selbstverständlichen Lebenswandel«. Er nimmt Abschied von der Großmutter und begibt sich – nach Berlin, damals die größte liberale Weltstadt, wo er die jüdische Sache als Journalist verfechten will.
Peter Demetz
Arnold Beer
Das Schicksal eines Juden
Roman
Und Simson sprach:
»Mit dem Kinnbacken eines Esels einen Haufen, zwei Haufen – mit dem Kinnbacken schlug ich tausend Mann. Und als er vollendet zu reden, da warf er den Kinnbacken aus seiner Hand und nannte selbigen Ort: Ramath-Lechi.«
Die Richter, 15
I.
Arnold Beer war ein hübscher junger Mann, nicht einmal sehr elegant, aber da er in der Stadt häufig mit den elegantesten Leuten zusammen – überdies auch oft mit anderen – angetroffen wurde, nannte man ihn den Eleganten. »Aha, da kommt das Gigerl«, – oder »Die Parta ist da. Ich erkläre den Bummel für eröffnet«, hieß es am Abend auf dem Korso, wenn in den Reihen der gewohnten Spaziergänger und Nichtstuer Arnold samt seiner Freundschaft erschien; denn schon hatte man hier und dort begonnen, sein unnützes Treiben mit einigem Mißwollen zu beobachten. – Was überdies seine Eleganz anbelangt, so irrten die Leute ganz entschieden. Näher betrachtet, bestand Arnolds so effektvolle Kleidung durchaus nicht aus den tadellosesten Stücken, war vielmehr häufig betupft mit einzelnen großen und mit vielen kleinen Flecken und Tropfen, manchmal auch leicht angerissen und zerfasert, der Strohhut vom Regen mattbraun überflossen und weichgedrückt, die Stiefel ohne den rechten Glanz. Alle diese Fehler erschienen nun freilich niemals beisammen, sondern sie führten ein einsames Dasein, jeder für sich und an einem andern Tag, konnten aber dem aufmerksamen Beobachter auch in dieser gleichsam fluchtartigen Abwechslung nicht entgehen. Übrigens war Arnold selbst der letzte, der sich den merkwürdigen und komischen Einzelheiten seines Anzugs verschlossen hätte; im Gegenteil, er pflegte laut und ungeniert, vor Damen und Herren, auf solche gelegentliche Schönheitsmängel hinzuweisen und sich selbst auszulachen, um desto sicherer alle, die über ihn erschraken, auslachen zu können. Er nannte sich – denn er hielt für alles Worte bereit und hatte besonders über seine so fragwürdige Wesensart schon oft und unter Schmerzen nachgegrübelt – »eine typische Fernwirkung« und hob hervor, daß er diese »gute Sache« seiner schlanken Gestalt, seinem vorzüglichen blassen Teint und seinen feinen Händen verdanke, lauter Dingen, »für die er natürlich gar nichts könne«, wie er in einem Anflug pessimistischer und unklarer Philosophie hinzuzusetzen pflegte. Dann versank er, noch anschließend, über das Thema »Kleider machen Leute« in ausgedehnte trübe Betrachtungen. »Ja, meine Eltern haben das Geld dazu, mein Papa ist eine gute alte Firma. Also gelange ich, wie von selbst, an den ersten Schneider der Stadt, und der macht mir Röcke und Hosen, ohne daß ich ihn darum bitten muß, ja bitten darf, aus den teuersten Stoffen und nach den neuesten Schnitten. Kann ich dafür, nun bekommt sogleich mein Anblick einen reizenden Schwung und Schmiß, ohne mein Mitarbeiten, und ich biege ein in eine Richtung des Angeschautwerdens und sogar des Michselbstfühlens von innen her, die mir gar nicht so besonders paßt. Wie machtlos ist man dagegen. Schließlich würde mir ja diese Richtung auch passen, warum nicht, hätte ich nur Zeit dazu. Aber wie kann ich mich mit solchen Kleinigkeiten abgeben! Es geht einfach nicht. Stärker wie Löschpapier bin ich eben nicht. Und daher auch meine schlechte primitive Frisur, meine ungepflegten Nägel, meine Schnalle nur am Schuh links und nicht auch rechts.« Er pflegte sich die Haare zu scheiteln, aber aus Unlust, die richtige Teilungsstelle zu suchen, wurde oft, wenn der erste Hieb mißlang, nur ein Gestrüpp hängender Strähnen aus den schönen Wellen.
Derselbe äußere Schwung nun, den er mit einiger Selbstgehässigkeit an seinen Kleidern bemerkt hatte, wallte durch seine ganze Person und mit so gewaltigem unwiderstehlichem Antrieb, daß er nach allen Seiten hin sein Schicksal aufbauschte, aber auch begrenzte. – Arnold war eine überaus lebhafte Natur. Schon in der Volksschule hatten alle Lehrer darüber geklagt, daß er »kein Sitzfleisch« habe, und einige hatten später, bei aller Anerkennung seiner Intelligenz, durch mindere Noten ihn für sein Übermaß an Temperament strafen zu müssen geglaubt. Er antwortete auf Fragen, die niemand an ihn gerichtet hatte; er schrie plötzlich laut auf, rannte aus der Bank und aus der Klasse hinaus, weil er draußen einen so komischen großen Schmetterling gesehn hatte, der sich später als eine langsam aus dem dritten Stock herabflatternde alte Kravatte erweisen mußte. – Einmal rief ihn der Lehrer zum Weiterlesen auf; »Bitte, die Übung ist hier zu Ende« meldete mit hoher Stimme der Kleine, statt in dem gewöhnlichen dumpfen Tonfall der Schüler fortzuspinnen. Da bekam er seine erste Strafe. »Ich soll nicht vorlaut sein«, zehnmal abzuschreiben. Seine Lebhaftigkeit und Naseweisheit hatten ihn nämlich schon in der ganzen Schule so berühmt gemacht, daß man immer geneigt war, in seinem Benehmen einen kleinen Unfug zu sehn, auch wenn, wie in diesem Fall, gar nichts daran war. Denn die Übung war wirklich zu Ende, und obwohl die nächste Übung ja in unmittelbarem Zusammenhang mit der eben gelesenen anschloß, wäre wohl auch ein anderer Schüler geneigt und vielleicht kouragiert genug gewesen, mit dem Herrn Lehrer sich in einen näheren, gleichsam kameradschaftlichen Zusammenhang durch eine solche höfliche Frage nach dessen weiterer Absicht zu setzen statt mechanisch einfach die leere Zeile zu überspringen und sich im Text als armseliger Lernknabe fortzuhaspeln. Einen Pfiffigen gar wie Arnold mußte die Situation reizen, und es soll nicht verschwiegen werden, daß er sich schon oft genug mit aller Sehnsucht in sie hineingewünscht hatte, als in die einzige, wo er einmal dem hochverehrten Herrn Lehrer ebenbürtig, sozusagen als Mensch, gegenübertreten könnte, daß er oft im voraus die Zeilen abzuzählen pflegte, um herauszubringen, ob diesmal, nach der Sitzordnung, bei der entscheidenden Übergangsstelle die Reihe an ihn kommen würde. Und nun war der Moment da und Arnold hatte mit Anstand und stolzer Gefaßtheit, vollkommen richtig, seine oft vorbereiteten Worte herausgesungen, hatte sich ausgezeichnet … mit diesem traurigen Erfolg leider. Er weinte die ganze Stunde lang, denn er war sehr ehrgeizig. Und als die liebe Mama sorgfältig um elf Uhr ihn abholen kam und ihm das Schultäschchen abnahm, weinte er wieder, kaum beruhigt, und erzählte alles. Nun mußte er gar noch in das schöne verehrte Papiergeschäft eintreten, wo er sonst nur die ausgestellten »Münchener Bilderbogen« sich anzuschaun pflegte, zufrieden und heiter nach der Schultätigkeit, oder zaghaft die imponierenden Schatzhaufen verschiedenartiger Klaps-, Glocken-, Kuhn-, und Aluminiumfedern, mußte eintreten und um einen Bogen liniierten Papiers kaufend bitten. Schon dieser Umstand, daß er einen einzelnen gottverlassenen losen Bogen kaufen mußte statt wie sonst ein ordentliches Heft zum ehrenvollen Vollschreiben, schien ihm so sehr schlampig, heruntergekommen und Sache eines schlechten Schülers, daß er sich schämte, – und als ihn gar noch der Kommis mit irgend einer gleichgiltigen Frage nach der Zeilenbreite beunruhigte, brach er aufs neue in Tränen aus und erklärte heulend: »Es ist für eine Strafe.« Er weinte so bitterlich, daß alle im Geschäft stockten und auf den Knirps hinsahn. Zwei in Schwarz gekleidete Damen traten näher und, tief zu ihm herabgebeugt, begannen sie, ihm zuzusprechen. Er aber hielt die Händchen in Fäusten vor den Augen, so daß er nichts sah und auch gar keine Anstalten machte, zu zahlen und den Laden wieder zu verlassen. Sondern rücksichtslos und ohne Verlegenheit ergab er sich seiner Reue und seinem tiefen Schmerze, bis die Mutter, der das lange Ausbleiben draußen verdächtig wurde, hereinkam und ihr Kind, dem sich inzwischen das allgemeine Mitleid der Angestellten und Kunden, der Kassiererin, des Geschäftsinhabers sogar zugewendet hatte, energisch herausholte.
Natürlich konnten Strafen und schlechte Klassen dieser Lust des lebendigen Gemüts wenig anhaben. In der Schule lernte er allmählich die kalte Ordnung respektieren, nun warf er sich aber auf Eltern und Verwandte. Der Vater mußte ihm schon Ohrfeigen androhn, um sein ewig erregtes »Papa, schau …« auf den Spaziergängen zum Schweigen zu bringen. Niemand wollte mit ihm ausgehn, denn er war gefürchtet wegen seiner unaufhörlichen bohrenden Fragen, die sich mit keinerlei Ausweichen abstellen ließen. Eine Gouvernante nahm ausdrücklich deshalb ihren Abschied. Und noch in späteren Jahren pflegte ihn Frau Direktor Wahlberg, mit der seine Eltern verkehrten, mit einem seiner Aussprüche zu necken: »Tante, bitte, erkläre mir, ist der Mond ein Fixstern oder ein Planet«, das hatte er in großer öffentlicher Prachtgesellschaft ihrer damenhaften Glätte zugemutet.
Es kam eine Zeit, in der er von den Menschen, die seinen reißenden und dabei so liebevollen Ansturm nicht aushalten mochten, sich abwandte und nichts tat als stille vertrauliche Bücher lesen. Nachmittags auf dem Sopha, wenn er aus der Schule kam; nicht liegend, nicht sitzend, sondern zusammengekauert, den ganzen Körper zwischen Polster und Lehne gedrängt, während das Buch frei auf dem Sopha lag – so ruhte seine Wange über den beiden verschränkten Armen, und nur wenn er umblättern mußte, langte er unter Verrenkungen eine Hand aus dem Knäuel hervor … sonst rührte er das Buch nicht an, er hatte es gern in einiger Entfernung von sich, selbstständig wie ein lebendiges Wesen, mit dem man sich unterredete, vom Polster her blickte es ihn an, gab seine schrägen tiefen Blicke atmend zurück. Und er las so ziemlich alles, was sein angebeteter Vater, ein in jüngeren Jahren kunstbeflissener Mann, im Bücherkasten hatte. Dieser Kasten war versperrt. Arnold mußte jeden Mittag, in der knappen Zeit zwischen der Beendigung der Mahlzeit und dem Mittagsschläfchen des Vaters, sein Anliegen vorbringen, um dieses oder jenes Buch: »Papa, gib mir heraus …« Dann wurde der rätselhafte Kasten mit den undurchsichtigen Scheiben geöffnet, und nur in diesem Augenblick durfte der Sohn die Verlockung all dieser mannigfachen Goldrücken empfinden und, schnell einige Titel überfliegend, bei sich die Bücher feststellen, die er die nächsten Male herausverlangen wollte. Niemals wurde ihm erlaubt, einer seltsamen Pedanterie des Vaters zufolge, alle Bücher der Reihe nach durchzusehen und in Ruhe auszuwählen. Niemals wurde ihm auch mehr als ein Buch geborgt. Und so rasch ging der Vater dabei vor, militärisch mit Wunsch und Ausführung, Hinzeigen und Herausnehmen, daß manchmal ein Fingerlein oder die Nase des in all die Pracht versunkenen Knaben Gefahr lief, an der Kante der wieder zuklappenden Türe eingeklemmt zu werden. Allmählich kam er daher auf Listen; er sagte um »Kleist« und zeigte dabei auf die oberste Reihe, obwohl er gut wußte, daß die Kleist-Bände rechts unten aufmarschiert waren. Aber in der Zwischenzeit, während der Vater vergeblich oben kramte, hatte er Zeit, einen Überblick über andere nie gesehene Partien des großen Büchergartens zu erwischen. Oft allerdings nützte alles nichts, und er sah sich mit einem Buch, das er nur des fremden Titels oder des hübschen Einbandes wegen gewählt hatte und das ihn bei näherem Durchblättern gar nicht interessierte, enttäuscht und leer vor den wieder gesperrten Kasten gestellt, in einen steinigen leeren Nachmittag verschlagen wie ein Schiffbrüchiger auf eine öde Insel, wo der ersten Freude des Gerettetseins eine umfassendere Angst vor der Zukunft folgen muß. Denn niemals nahm der Papa ein schon herausgegebenes Buch noch an demselben Tag zurück, das war eherne Regel … Im Verlauf der Zeit nun las Arnold alles, von der Bibel und Goethe an bis zu dicken staubigen Lieferungsromanen wie »Die Geheimnisse der Bastille«, die noch uneingebunden in den untersten Schubläden lagen. Sein Kopf füllte sich mit den Gestalten Schillers und Heines, mit den Kreuzfahrern und Schillschen Offizieren der Weltgeschichte, mit Lokomotiven aller Konstruktionen aus einer vielbändigen »Geschichte der Erfindungen und Industrien«, mit den Jägergeschichten und rührenden Affen-Szenen der Gefangenschaft aus »Brehms Tierleben«. Und nur eines hatte ihm der Vater verboten, in den Shakespearebänden den Othello. Arnold befolgte auch getreu diese Absperrung, ängstlich wich er dem Stück aus, obwohl seine Neugierde aufs höchste erregt war und niemand ihn überwachte, und nur die Vorrede mit der Inhaltsangabe las er einmal doch, indem er sich sagte, daß die ja nicht eigentlich zu dem gebannten Stück gehöre. Welch ein Geheimnis, diese überblätterten und stets wie mit Leim zusammengehaltenen Seiten hie und da, wie durch Zufall, aufzuschlagen, vom Wind aufblättern zu lassen, unbeachtet ein Wort, einen Satz aus dem Zusammenhang zu packen, eine Abbildung vorbeiträumen zu sehn, niemals aber dem lieben strengen Vater durch wirkliches Lesen der Reihe nach ungehorsam zu werden. Wie peinigte das sein pochendes Herz! … Überdies hatte der Vater dieses Verbot nur einmal und nur beiläufig fallen lassen, nie mehr wiederholt, vielleicht selbst nicht so wichtig genommen und längst vergessen. Und als Arnold, zu Jahren gekommen, später einmal diesen fürchterlichen »Othello« durchnahm, fand er zwar gleich in der ersten Szene eine obszöne Phrase, im Ganzen aber nichts, was dieses Stück vor den vielen, die er lesen gedurft hatte, ausgezeichnet hätte. Derartige Phrasen hatte er ja als Kind zu hunderten unverstanden eingeschluckt. Und so blieb ihm dieses Verbot seiner Kinderjahre weiterhin ein Geheimnis, über das er seinen Vater aus Respekt auch nachmals nicht weiter auszuforschen sich getraute.
Indessen kam der Hausarzt einmal, anläßlich einer Masernerkrankung – man mußte dem Kerlchen mit den verklebten Augen unermüdlich von früh an bis in die späte Nacht vorlesen – auf Arnolds überreichen Bücherkonsum. »Ihr Junge ist mit achtzehn Jahren ein Idiot«, schrie er die tödlich erschrockene Mutter an, und von nun an war es mit der Lektüre zu Ende. Furchtsam wachte die Mutter darüber, daß Arnold keine Zeile mehr außer den Schulaufgaben zur Hand nahm. Auf vielfaches Jammern und als sich die Folgen der Langweile in seiner gesteigerten Wildheit zu zeigen begannen (er stach der Köchin mit ihrer Hutnadel den Daumen durch), wurde ihm endlich jeder dritte Tag als Lesetag eingeräumt … Arnold erinnerte sich überdies später oft mit Vergnügen daran, wie großen Eindruck der Schrei des erzürnten Arztes auf ihn gemacht hatte. Bis zu seinem achtzehnten Jahre erwartete er allen Ernstes mit Grausen täglich das Eintreten der prophezeiten Verblödung, erst nachher fiel es ihm plötzlich als Erlösung ein, daß der Arzt vielleicht nur in einer Metapher geredet hatte. Ja, als Kind pflegte er eben Aussprüche älterer Leute unauslöschlich ernst zu nehmen …
Die Lesewut machte zu Beginn des Gymnasiums einer unbändigen Sammelfreude Platz. Arnold besaß bald, wie ein Onkel sich ausdrückte, eine »Sammlung von Sammlungen«, er hob alte Tramwayzettel auf, flehte alle Abreisenden an, ihn in fremden Städten auf Zahnradbahnen und Elektrischen ja nicht zu vergessen, ferner ordnete er in Schachteln und Kistchen abgesondert: Knöpfe, alle Arten von Zündholzschachteln, Zigarrenbinden, Ansichtskarten mit und ohne Marke auf der Bildseite, Bleistifte, Autogramme, Münzen, Vereinsmarken, Siegelabdrücke, Mineralien, hinter Glas spannte er Schmetterlinge und Käfer auf, in Mappen hatte er bald mehrere Tausende von Bildern, aus alten Zeitschriften ausgeschnitten und sauber auf dünne Pappendeckel aufgeklebt. Er brannte um diese Zeit auf derartige alte Bände der »Gartenlaube«, der »Guten Stunde«, und unzerschnitten schienen ihm diese Hefte ihren wahren Zweck vollständig verfehlt zu haben, so daß ihm bei ihrem Anblick und wenn er sie nicht in seine Sphäre ziehen konnte, das Herz zerbrach. – Wie alles, betrieb er solchen Sport mit dem ganzen Eifer seiner ganzen Natur, und wenig fruchtete da die stereotype Warnung des Vaters: »Arnold, du übertreibst alles.« Dem Kinde, das zwei oder drei Sachen derselben Art beisammen sah, lag nichts näher als der Gedanke, solcher Dinge noch mehr auf einen Haufen oder in schöne Reihen zusammenzukriegen, und namentlich bestärkte ihn in diesem immer neu wiederholten und dadurch schon ganz geläufigen schnellen Gedankengang die Beobachtung, daß es ja so leicht war, eine Sammlung irgendwelcher Manier anzufangen, ja, daß eigentlich die Sammlungen schon um ihn herumlagen, nur freilich noch unentdeckt, ungeordnet, daher unwirksam. Es bedurfte aber jedenfalls keiner schöpferischen Tätigkeit, keines Hervorstampfens. Er mußte nur, wenn er beispielshalber auf die Idee gekommen war, Stahlfedern zu sammeln, seine alte Liebe, zuerst einmal seine Pennale ausleeren. Da lagen sie ja schon beisammen, halbverbraucht, aber immer noch Muster ihrer Art, er brauchte nur die besten herauszuklauben. Dann ging es über die Vorräte des Vaters im Comptoir her, wo die seltenen großen Stücke, wie Kolumbusfedern, oder die komisch verkrümmten Soennecken oder die zierlichspitzen Stenographiefedern, die fast wie Nadeln aussahen, eiligst zusammengerafft wurden. Und mit dem Taschengeld, das ihm zum Ankauf von Schreibzeug übergeben wurde, ging nur eine kleine Verschiebung vor, er kaufte, statt wie bisher gedankenlos Federn immer derselben Art, möglichst verschiedenartige und exotische, natürlich nicht zum Schreiben, sondern zum Aufheben, während zum Schreiben möglichst lange derselbe Invalide herhielt. So rückte die Sammlung feurig vorwärts, es war gar keine Unmöglichkeit, tausend Stück zusammenzubekommmen oder die größte Sammlung von Europa überhaupt, es galt nur die richtigen Stege und Zuflüsse zu graben, durch rein geistige Überlegungen, denn der Rohstoff war ja vorhanden. Nur ihn gescheit in die Grube zu leiten, das war das Problem, ihn nicht unnütz an den Seiten abrinnen zu lassen. So hatte er beim Sammeln das Gefühl, nicht nur sich durch nützliche Tätigkeit auszuzeichnen, sondern auch irgendwie der ganzen Welt zu dienen – und übersah er dann an einem der ersten Abende, da alle Quellen noch munter der neuen Sammlung zuflossen, seinen sauber geschlichteten Reichtum, so überfiel ihn ein beinahe schwindelndes Glück von Größe, Schönheit und Triumph, und der Wunsch, mit dem er einschlief, die Sammlung möge so weiter und weiter gedeihn, war um nichts weniger innig als das Nachtgebet … Freilich nahm sein Interesse bald ab, wenn in seiner Nähe keine neuen Höhlen mehr zu sprengen waren, in denen schon große Haufen der gewünschten Dinge wie vorbereitet dalagen und auf ihn warteten; wenn es galt, nun ein Stück ums andere mühsam heranzulocken. Dann wurde die Sammlung aus den Kasten ins Dunkle gestellt, halb vergessen, eine andere trat mit neuen Hoffnungen ans Licht. So ging es zwei Jahre lang, bis endlich sein Streben an einer Briefmarkensammlung hängen blieb und sich gewitterwolkenähnlich verdichtete, da hier nebst dem Reiz der Ausdehnung und Vollständigkeit nun auch der des nicht mehr bloß kindischen Wertes in Aussicht gestellt wurde. Nun begann er in den Zehnuhrpausen zu »tauschen«, nicht ohne Streit und Schwindel, nun wußte er bald alle Wasserzeichen, Fehldrucke, Zahnungsunterschiede und Farbennüancen auswendig, niemand kam ihm darin gleich, ja sein stürmisches Interesse für alles, was mit Marken zusammenhing, ging so weit, daß er sogar den Flächeninhalt, die Hauptstadt und die Münzsorten jedes Landes wie dies in seinem Album angegeben war, schnell und genau erlernte. Mit seinem »Senf« in der Tasche, den er stets sorgfältig nach der neuesten Ausgabe korrigiert hatte, galt er unter den Kollegen als Autorität, wurde in schwierigen Fällen befragt und entschied unwidersprochen. Und nur etwas unterschied ihn von einem kühlen Fachmann: während er die verlockendsten Stücke fremder Sammlungen nachsichtslos, von ängstlichen Blicken ungerührt, als »falsch« oder »Neudruck« verurteilte, konnte er selbst sich von den Fälschungen, die ihm gehörten und die er als solche längst erkannt hatte, in einer seltsamen grundlosen Zärtlichkeit nicht trennen. Er glich da dem glühenden Liebhaber, der seine Leidenschaft nicht bezwingen kann, obwohl er die triftigsten Gründe hat, von dem Unwert des geliebten Gegenstandes überzeugt zu sein. So besaß Arnold, beispielsweise, eine alte Schweiz »mit der sitzenden Helvetia« – nachgemacht, ganz plump nachgemacht. »Ich weiß ja, daß sie falsch ist« pflegte er zu sagen und sah die Marke mit stillverliebten, unendlich traurigen Blicken an, »aber ich laß sie doch drin, sie schadet ja doch nichts«, während er einen Kameraden in gleichem Fall unfehlbar mit den Worten: »So ein Stück ist eine Schmach für jedes anständige Album« ausgescholten hätte … Ja es gab sogar Zeiten, allerdings nur zu Anfang der Markenperiode, in denen Arnold selbst fälschte, sich selbst betrog, indem er aus einem alten Album einfach die vorgedruckten Markenbilder, sofern sie mit »grau« oder »schwarz« bezeichnet waren, ausschnitt und als wirkliche Marken in sein Album einklebte. Davon ließ er bald, konnte aber von den einmal gewonnenen Exemplaren auch in der Folge nicht Abschied nehmen, in einer ganz unbestimmten, sinnlosen Hoffnung, wie sie eben den Ekstatiker auszeichnet: diese Scheinmarken könnten eines Tages doch vielleicht, wie durch ein alchymistisches Wunder, in echte und allgemein anerkennenswerte verwandelt werden. Ebensowenig mochte er sich entschließen, beschmutzte oder lädierte Stücke auszuscheiden. »Sie fehlt mir ja gerade zum Satz«, dieses Zauberwort hielt ihn fest. O welche Freude war das, welcher Anblick konnte schöner sein als der einer Albumseite, deren vorgezeichnete Reihen –, manche sind länger, manche kürzer, mancher seltsame »Satz« besteht nur aus zwei oder drei Stück – komplett mit Marken besteckt waren; »komplett«, das war das Wort, das er mit scheinbarer Flüchtigkeit, mit leichter stolzer Handbewegung dem Kollegen zurief, vor dem er eben die Sammlung durchblätterte, »Belgien komplett«, o wie das klang! Und dabei wurde schon umgeblättert, mit selbstverständlichem Besitzergleichmut, während des andern Augen bewundernd umherschossen; da flatterten wie kleine bunte Regenbogenwimpel die Marken, jede sauber gewaschen, jede von ihrem geknickten Spannleisten lustig getragen. Manchmal blies Arnold unter eine Reihe, um die Wasserzeichen, Netz oder Posthorn, Gummierungsfeinheiten oder die Stampiglie »Geprüft« einer großen Firma zu zeigen – dann drückte er sanft wieder mit weichen Fingerballen die kostbaren Papierchen nieder. Sie waren leuchtend wie sein Ehrgeiz, vielfältig wie seine Träume, leicht erregbar in ihren Reihen wie sein junges Gemüt. Seinen einzigen Schatz machten sie aus, beinahe seine Religion. Markensammler zu sein schien ihm, wenn er sich selbst ernstlich bewertete, seine beste Eigenschaft und jeden Burschen, den er kennen lernte, fragte er sofort: »Was ist mit dir? Sammelst du?« … An langen Nachmittagen grübelte er über Auswahlsendungen nach, verglich die Vorteile und Preise der heimatlichen Markenhändler, studierte Katalog oder Sammlerzeitung, oder er ließ leise Glücksschauer über seinen Kopf kräuseln, indem er sich einbildete, er käme durch Zufall, Fund oder glücklichen Tausch, zu den gepriesenen Glanzstücken der Philatelisten, Mecklenburg oder Bergedorf, Mauritius, Kirchenstaat, alte Sachsen. Für die kleinen verschollenen Staaten, deren Marken in seinem Album sämtlich den hochzuverehrenden Vermerk R oder GR trugen, was »Rarität« oder »Große Rarität« bedeutete, hegte er eine schwärmerische Verehrung, die sich auf ihre längstverstorbenen Regenten und Tyrannen, auf ihre ganze Historie ausdehnte. Schon vor S, das ist: Seltenheiten, erzitterte er in Glücksfieber. Denn seine Sammlung war ja leider, trotz aller Anspannungen und theoretischen Kenntnisse, nur klein … Allmählich erweiterte er sie, übertrug sie, nach Art großer Sammler, aus dem festen Album auf lose Pappendeckelblätter, gab dann hochmütig die »Ganzsachen« und alle außereuropäischen Länder auf. Nur Europa sammeln, das war die Devise eines soliden vornehmen Kenners; diese exotischen Gschnasstückerl sind ja nur schön fürs Auge, nichts wert. Mit wachsendem Taschengeld stiegen seine Ankäufe und so blieben die Marken, zu Zeiten vergessen, dann wieder einmal hervorgeholt und gestreichelt, immer aber wohlbehütet, seine liebste Spielerei bis in die Mannesjahre hinein.
Diese Sammlung führte ihn auf dem Wege des Verkehrs und der allgemeinen Schätzungen wieder zu den Kameraden zurück, denen er eine Zeit lang eigensinnig ausgewichen war. Gegen das Obergymnasium hin wurde er wieder kollegialer und bald entwickelte sich als erste Frucht dieses menschlichen Umgangs eine neue Eigenschaft aufs höchste in ihm … die unbezähmbare Schwatzhaftigkeit. Es war, als müsse er für jahrelanges stilles Vorsichhinspielen auf einmal sich entschädigen. Angepfropft mit Zitaten, mit Bücherereignissen, wie er war, begann er zunächst in den Pausen, auf den Korridoren vor den Kollegen lange Reden zu führen, in denen keiner ihn unterbrechen konnte, denn er hatte die lauteste müheloseste Stimme, die selbst, wenn er gemütlich sprach, zu zanken und zu drohn schien. Man hörte ihm in einer Mischung von Spott und Bewunderung zu, wenn er einen Professor mit Don Quixote und die andern mit den Pickwickiern spaßhaft verglich. So gezierte ausgewählte Scherze klangen allen ungewohnt, ja unbehaglich; da er aber in seinem Eifer die frostige Wirkung, die er hervorbrachte, selbst nicht zu bemerken schien, vielmehr immer in derselben Richtung sich steigerte, sich überbot, berauscht von eigenem Beifall immer freundliche Zurufe der andern um sich zu hören glaubte und so sich noch mehr erhitzte, begann er zu imponieren. Jedenfalls bereicherte er den seit langer Zeit festgewordenen Gesprächsstoff, brachte ein paar neue Redensarten auf. Man ahmte ihn nach, eine Partei bildete sich um ihn. Einige begleiteten ihn täglich nach Hause. Auf offener Straße nun entfaltete sich seine neue Kunst, denn anders als in den öden glatten Gängen gab es hier tausend Dinge, an die er seine effektvollen Betrachtungen anknüpfen konnte. Von der Tramway kam er auf Elektrizität zu sprechen, brachte verworrenes Zeug vor, das er sich selbst nach wenigen Andeutungen seiner Erfahrung zurechtgemacht hatte und von dem die andern nur wußten, daß sie »das noch nicht genommen hatten.« Wie erbebte er vor Entzücken, wenn ihn nun einer seiner Anhänger um Erklärung einer Sache bat, wie begann er gleich mit sanftem Anstand, ernsthaft, auch wenn er gar nichts wußte, zu erklären. »Das ist a sehr einfach« waren immer die ersten Worte. Allen Ernstes glaubte er, daß es nur eines recht guten innigen Drauflossprechens bedürfte, um alle Dinge der Welt klar zu machen. Und wenn er es dann nur aushielt, recht lange bei dieser einen Sache zu bleiben, recht ausführlich und immer verwickelter über sie zu reden, meinte er, seine Aufgabe aufs beste vollführt zu haben. Er glaubte nämlich, auch in den sogenannten wissenschaftlichen Büchern einigemal bemerkt zu haben, daß das Erklären nur in einem recht langen, mannigfachen und undurchsichtigen Brei bestehe, den man um die Dinge gieße, und diese Regel bewahrte er als ein Schlauer, der nun dahintergekommen war und der sich von dem allgemeinen Vorgeben nicht mehr täuschen ließ, wohl im Gedächtnis. Wenn er aber an seine Kindheit zurückdachte und an die Mühe, die seine Erzieher angeblich mit seiner Wißbegierde gehabt, so lachte er sie noch nachträglich aus. Was für Kunststücke! Nur ein wenig Geistesgewandtheit gehörte dazu und man hatte die ganze Welt in der Hand, wie ein Ausleger die Bibel. – So moralisierte er auch nicht schlecht, hatte Gedanken über den Staat, über Religion, Gott, Theater, Mode, gute und böse Menschen. Darin vornehmlich war er Meister: wenn er ein Sprichwort irgendwo oder einen Satz aufgegabelt hatte, diesen zum Motto langer Erörterungen zu nehmen, beständig in neuer und überraschender Form zu wiederholen, hin- und herzuschrauben, so daß ohne viel inneres Wissen ein verwunderliches farbenreiches Getön und Hohlwerk aus großartigen Worten entstand. – Widersprach ihm jemand, so kam ihm das gerade recht, denn nun konnte er gar erst mit aller Kraft losbrechen, an die fremden Worte wie an Kähne sich anklammern und sich von ihnen durch das Wasser obenauf mitschleppen lassen. Ganz naiv munterte er auch manchmal solche, die ihm dazu geeignet schienen, auf: »Du, komm, debattier ein bißl mit mir.« Und das war ein Herumirren in den Straßen, ein Begleiten hin und zurück, die Gasse hinunter und nochmals hinauf bis zur Ecke, ehe er nach so einem Schulweg endlich zu Hause anlangte. Gewöhnlich war es eine ganze Gruppe von Burschen, jeder seinen Pack Bücher lose unter dem Arm (denn Riemen oder gar Schutzleder waren als unmännlich und schülerhaft längst verworfen), Arnold immer in der Mitte, neben ihm die Bevorzugten, die auch schon etwas verstanden, und an den Seiten unbedeutende Flügelmänner, die sich abwechselnd immer wieder bis zum Zentrum der Gruppe durchzuquetschen suchten, immer um die Mittleren mit unbeachteten Fragen und unbegehrten Antworten herumtanzten und immer wieder, wie nach einem Naturgesetz, an die kühlen äußeren Enden der Reihe gedrängt wurden, wo sie gelangweilt mitstolperten. Vor dem Haus sammelte Arnold nochmals alle um sich, gab gleichsam die Parole aus, irgend eine Schlußpointe, aus dem allgemeinen Lachen aber gerieten die Zurückgelassenen, sobald Arnolds Licht verschwunden war, schnell in die gewohnte Balgerei; »wo bist du wieder so lange gewesen?« empfingen indessen oben den Helden die besorgten Eltern. – Nicht zufrieden mit diesen Heimschlendereien ging Arnold bald dazu über, die Freunde zu sich zu laden, am liebsten gleich rottenweise, erzürnte die sparsame Mutter mit seinen ewigen Kaffee- und Kuchenbestellungen und gab ihr, da er nicht immer die Saubersten sich aussuchte, Anlaß zu häufiger Wiederholung ihrer beliebten Grußformel: »Guten Tag. Bitte, putzen Sie sich die Stiefel ordentlich ab, aber ordentlich!« Er gründete einen Lesezirkel für die »Intelligenz der Klasse«, der sich im Sommer als Fußballklub fortsetzen sollte; denn Stubenhocker wollten sie ja nicht sein. Da er um diese Zeit mit einigen Genossen das Schachbuch von Dufresne studierte, war man auch von einem Schachklub nicht mehr weit entfernt … Aber auch sonst noch, auf den Gassen, hielt er die Kollegen fest, führte sie mit sich oder schloß sich an ihre Besorgungswege an, oft auch setzte er sie in Verlegenheit, indem er aus einer Quergasse wie aus einem Hinterhalt hervorstürzte: »Da bin ich. Jetzt aber laß ich dich nicht los, ob du willst oder nicht willst. Jetzt bist du mein.« Und zärtlich eingehängt überströmte er den Zuhörer mit seinen neuesten rhetorischen Eingebungen. Da half kein Abschied, keine Eile, kein Zugversäumen. Denn es galt ja auch allgemein als interessant, ihm zuzuhören, und nur ungern und lässig wurden höhere Pflichten gegen ihn geltend gemacht. Bis ins Tor der Häuser, bis an die Wohnungstür vor die Glocke folgte er den Geduckten, geschmeichelt Gepeinigten, eifrig redend, nach und es hatte gar nicht den Anschein, als sei er der Spender und gieße aus seinem Innern etwas in den Krug des andern aus; sondern so war es, als spende der andere, als hinge Arnold mit den Lippen saugend an dem Zuhörer wie an einem Gefäß mit süßem Wein, das man von ihm wegziehn wolle und dem er deshalb in Abhängigkeit, immer saugend, nachfolgen müsse. Rufend entfernte er sich um einen Schritt, machte aber plötzlich noch einmal einen zwei Schritte langen Sprung nach vorn, um aus dem Mann an der Türklinke noch das Anhören von sieben oder acht Sätzen auszupressen.
Es konnte nicht fehlen, daß ein Jüngling solcher Vorzüge bald auch echte Freunde an sich zog, nebst dem Schwarm geringerer Mitläufer. Der erste, der sich näher ihm zugesellte, war Philipp Eisig und dieser Seelenbund blieb fest durch viele Altersstufen hindurch, obwohl er nur dem kleinen Zufall das Entstehen verdankte, daß die Eisigsche Familie eines schönen Tages übersiedelt war und nun dem Hause Beer gerade gegenüber wohnte. Jetzt war ein ständiger Gefährte für die Heimwege gefunden – und das genügte als Grundstein einer so langen und folgenreichen Freundschaft, wie sich überhaupt Arnolds Beziehungen oft durch ganz geringe Fügungen und gleichsam ohne seinen Willen anknüpften, in aller Hast. Arnold stürzte sich nun gleich mit wahrer Glut in das neue Gefühl, seine Redeströme bekamen einen Inhalt, zum erstenmal ein heimliches inneres Zittern zu ihrem glatten äußeren Schimmer, enthusiastisch schwärmte er vom Bund fürs Leben, von Intimität und Herzensgemeinschaft, er machte sogar kleine witzige Gedichtchen und ein Akrostichon auf den Namen seines Auserwählten. Alles erzählte er ihm, was er sich bei allen Gelegenheiten dachte, und sorgsam trug er nach, woran er sich aus der noch nicht gemeinsamen Vergangenheit erinnerte. Offenheit und Mitteilsamkeit waren ihm die selbstverständlichsten Freundespflichten, ja eine gewisse Kühnheit im Aussprechen von Dingen, die man sonst nur mit einer gewissen Scheu nennt, schmeichelte ihm wie ein Opfer, das er dem andern brachte, dem Freunde, der mit seinem großen dicken gelben Gesicht still neben ihm ging, schaukelnd über dem breiten Bauch. Denn ein Umstand kam dem Verkehr vornehmlich zustatten: Eisig stotterte ein wenig, daher war es dem lebhaften Arnold leicht möglich, ihm geschickt in die Rede zu schnellen, während er selbst in seinem Hinstürmen nie unterbrochen werden konnte. Arnold schien ihn förmlich mit seiner Zunge zu regieren, sowie er auch mit den Händen oft durch einen kleinen starken Ruck dem großen, aber haltlos wankenden Körper des Freundes schnell die richtige Wendung gab, um ihn auf irgend eine flüchtige Erscheinung aufmerksam zu machen oder um ihn in die gewünschte Gasse einzubiegen. Und dieses angenehme Gefühl des sofortigen Befolgtwerdens, der Ungehemmtheit, das er übrigens nicht durchschaute – so natürlich und triebhaft entströmten ihm die Befehle – verschmolz ihm in eins mit den zärtlichen Aufwallungen der ersten Zuneigung, mit den Geheimnissen, die die beiden einander mitteilten, mit dem erhabenen Beispiel von Orest und Pylades, das ihn seit jeher begeistert hatte. Er fühlte sich zu jeder Heldentat bereit, hätte gern stoisch Folterungen ausgehalten, um den andern in nichts zu verraten. Abends gingen sie manchmal, eingeschlossen trotz der ungleichen Statur und mit seltsam gezwungenem Schritthalten, auf den Feldern draußen vor der Stadt spazieren, sie starrten in die Sonne oder vom reinlichen Quai hinab in den großen tiefen Fluß, dann sprachen sie wieder etwas, und obwohl es nur ein Witz oder Schultratsch war, kam oft eine ahnungsvolle Verworrenheit in ihre Worte, wie Wind in die Seiten einer Äolsharfe, und solche Innigkeit verklärte noch ihr geringstes Gespräch, daß Arnold nicht selten die Tränen in seinen Augen aufsteigen fühlte. Dann wischte er sie mit dem Rockärmel ab, während der Dicke in feinfühligem Verständnis sich zur Seite wegwandte, um ihn nicht beschämen zu müssen. Erst zur Nachtmahlzeit schieden sie voneinander und am nächsten Morgen, während des Ankleidens, brannte Arnold unbändig schon wieder auf die nächste Zusammenkunft, denn es hatten sich ihm noch am Abend vor dem Einschlafen so viele Dinge aufgehäuft, die er dem Freund auf dem Schulweg mitzuteilen hatte und die er nun sorgsam ordnete, das minder Wichtige voran, das Schönste zuletzt, um alles in der richtigen Reihenfolge und mit der richtigen Wirkung an den Mann zu bringen … Indessen war Eisig bei all der aufgedrängten Schweigsamkeit der Überlegene in diesem Verkehr, da er Billard spielen konnte, auch schon hie und da Kaffeehäuser besuchte und den Frauen nicht mehr ganz ferne stand; was alles er dem Muttersöhnchen Arnold binnen kurzem beibrachte. Welch neue interessante Blütenwelt! Arnold war bald bis über die Ohren in sie versunken, bestrebt, den Lehrer womöglich zu übertreffen. Denn kein Ding machte ihm eigentliches Vergnügen, wenn er nicht andere darin übertreffen konnte. Nur Geld fehlte ihm, Eisig borgte willig die Hälfte seiner Taschenbezüge, was Arnold übrigens als selbstverständlich auffaßte und in Eisigs Lage genau so gemacht hätte. Dafür half er dem Geliebten bei Hausübungen nach. Eisig war nämlich einer der Schwächsten und Faulsten in der Klasse, Arnold natürlich Primus, was ihn jedoch nicht hinderte, auch bei den gröberen, untergeordneten Naturen, die sonst das Fleißige und Erfolgreiche hassen, sehr beliebt zu sein, an allen ihren Streichen teilzunehmen und bald sogar ihre Führung an sich zu reißen, während er trotzdem bei den Lehrern das Ansehen eines willigen Glanzes behielt.
Besonders schlecht stand Eisig beim Professor des Griechischen, Schleiderer mit Namen, dessen Laufbahn auch sonst von vielen Verwünschungen der unruhigen Schüler widerhallte, als eines unglücklichen Menschen übrigens, der er war. Seine Bosheit war berüchtigt. Und sollte man da nicht wild werden, wenn er dem Eisig die griechische Schularbeitstheke süßlächelnd mit den Worten reichte: »Eisig Philipp – diesmal etwas besser gearbeitet. – – Nicht genügend«. Eisigs gewöhnliche Note bei Schleiderer war nämlich »Ganz ungenügend« … Da trat Arnold als Vertreter eines Gedankens auf, der schon lange ungesprochen durch die Klasse gebebt hatte: »Wir müssen einen Anti-Schleiderer-Verein gründen!« Der Name machte allen alles klar, nun wurde die längst vorbereitete Bewegung grausam organisiert und als alleiniger Zweck des Vereins wurde die Losung ausgegeben: den Schleiderer heraus- oder totzuärgern. Während aber die schlechten und eingeübten Randalierer zu unfeinen Mitteln, wie: Knallerbsen, Stinkbomben – rieten, war Arnold erfinderisch. Er leitete es ein, daß einmal während der Griechischstunde hier und dort einer von seinem Platz aus langsam und allmählich sich erhob, das Buch in der Hand, an verschiedenen Stellen der Klasse, so daß es zunächst nicht auffiel. Die Ängstlichen standen in geknickter Verrenkung, als sei ihnen nur das Sitzen für ein Weilchen unbequem geworden und als wollten sie sich in halb aufrechter Stellung ein wenig ausruhn; andere hielten ihre Hefte oder Bücher dem Lichte zu, als hätten sie unten nicht Licht genug für ihre Arbeit; manche kratzten sich, wie geistesabwesend, verlegen in den Haaren. Unbemerkt standen nun andere wieder auf, immer mehr, bis entsetzt der Professor plötzlich die ganze niegesehene Veränderung rätselhaft aufgestellter, gleichsam gespensterhafter Schülerreihen vor sich hatte. – Oder er gab das »Bänkerücken« an; langsam schoben die in der ersten Bank ihre Sitze vor, die nächsten folgten, möglichst ohne Geräusch, nur ein kleines Knarren oder Seufzen des Holzes manchmal, angestrengt arbeitete die ganze Klasse dem gemeinsamen tückischen Ziel entgegen, keiner paßte auf den Homer auf, den der Professor wie über aller Köpfe und Ohren hinweg in die Luft vortrug, – und schließlich erschreckte den nichtsahnenden Feind wieder ein so ungewohnter Anblick, als er vom Katheder herabsteigen wollte und keinen Zwischenraum wie sonst zwischen dem Podium und der ersten Bank vorfand, da die Bänke bis an die Erhöhung, wie Belagerer, vorgerückt standen. Und alle machten ein möglichst unschuldiges dummes Gesicht dazu, ja sie schienen nicht einmal etwas Auffallendes zu bemerken, so daß sein Blick ratlos an ihren kalten teuflischen Gesichtern hin wanderte. – Oder die Derbsten in den letzten Flegelbänken rauchten gar – auf Arnolds Anreiz –, verborgen hinter Büchern, bliesen den Rauch in ihre Hüte, die sie immer wieder sorgfältig umklappten, bis endlich diese Sammelbüchsen voll waren und nun schlugen sie sie um, daß ein weißes dampfendes Gewölk unbekannten Ursprungs langsam zur Decke emporstieg, eindrucksvoll qualmend wie zum Aktschluß einer Zauberposse … Jetzt war Arnold Liebling und Stolz der Klasse; und immer noch brav, immer noch: »Sittliches Betragen: musterhaft« auf dem Zeugnis. Der Verein hätte ihn aber doch vielleicht entschiedener in den Unfug gezogen: da ereignete es sich eines Tages, daß Professor Schleiderer, der Verhaßte, wie von selbst auf der Schloßtreppe hinstürzte und sich den Schädel brach. War es Wahnsinn? Selbstmord? Niemand erfuhr es, auch in der Folge nicht. Die jungen Sieger aber standen nicht an, dies als Folge ihrer gutgelungenen sinnverwirrenden Quälereien zu erklären und an demselben Tage ein fröhliches Zusammentreffen in der Eisigschen Wohnung einzurichten, das ohne Reue als eine Art von kannibalischem Triumphfest geplant war, in das sich aber unvermerkt mit immer bedenklicheren Reden und gar nicht mehr knabenhafter Unfrische ein geheimes Todesgrauen einzuschleichen begann – viele von den Burschen hatten überhaupt noch nie einen Todesfall in ihrer näheren Umgebung erlebt – und das schließlich ganz appetitlos, ernsthaft, ja mit dem Entsetzen, das in Erfüllung gegangene Flüche und Orakel umwittert, und in Angst vor allen unberechenbaren Zufällen des Lebens zu Ende ging – des Lebens, das auf alle diese Kinder draußen lauernd wartete.
Die Mutter sah es nicht gern, wenn ihr Arnold in das Eisigsche Haus hinüber ging. Das ganze Treiben dort gefiel ihr nicht. Schon den dicken Philipp mochte sie nicht besonders leiden und ermahnte ihn immer, wenn er sie verlegen anstotterte: »Langsam sprechen, nur hübsch langsam«, sie hegte nämlich den Wahn, daß alle Krankheiten und üblen Zustände, die sie nicht verstand, nur schlechte Gewohnheiten seien … Arnold aber, der gemach in das Alter kam, in dem man die Freunde über die Eltern setzt und überhaupt die Ansichten der Eltern mit einigem Trotz und Mißtrauen prüft, ging nun erst recht zu Eisigs. Dort konnte sich ein gewisser toller bubenhafter Zug seines Charakters zu üppiger Entwicklung durchringen, dort hatte alles einen Strich von ungebundener Räuberromantik, schon die ungeheuerliche Unordnung und Verwüstung in den großen hohen, dabei nicht hellen Sälen des alten Gebäudes: all dies mit der ordentlichen Sparsamkeit zu Hause kontrastierend … Die Eisigskinder, fünf Söhne recht verschiedener Altersstufen, bekamen alles, was sie nur wünschten, in Verschwendung, sie hatten, außer dem besonders auffallenden Billard, in ihrer Wohnung eine Laterna magica, ein herrliches Puppentheater mit zahllosen Kulissen, Turngeräte, sämtliche Bände von Jules Verne, Gerstäcker und Karl May, und überdies durften sie nach Herzenslust alles zerreißen, verborgen und verbrauchen, wobei ihre lustigen Eltern noch spitzbübisch mitlachten, während bei Beers alles abgezirkelt und wie am Schnürchen gehn mußte. Schon daß die Eisigsjungen fünf waren und so mannigfache Talente – einer konnte Karrikaturen zeichnen, einer photographierte, einer konnte mit dem Mund das Geräusch einer Säge nachmachen u. s. f. –, mußte dem einzigen Sohn Arnold imponieren. Welche Kombinationen gab es da, welche von altersher eingelebten Scherze und Neckereien, welche Wirkungen vereint und gegeneinander, und wieviel Gerümpel und altes Spielzeug, da jeder von den ersten Jahren an seine eigenen Sachen hatte! Besonders aber fand Arnold an dem Ältesten Gefallen, an dem Herrn Gottfried, der allerdings, wie er sich recht wohl eingestand, eigentlich »noch nichts für ihn war«, der ihm aber trotzdem hie und da ein Stündchen traulichen Geplauders gewährte, in unbegreiflicher Herablassung. Arnold bewunderte den Studenten schrankenlos, der, wie er häufig erklärte, die Schauspielerei studierte, eigentlich schon alles irgendwie Nötige gelernt hatte und nur vorläufig, da er ohne Engagement blieb, Gedichte »im modernsten Genre« schrieb, selbst verfertigte, Verse, die sich nicht reimten und in denen häufig Worte wie »Glast, Sehnsüchte, kranke Finger, geistern, Silber, Onyx, Chysopras« vorkamen. Gottfried rezitierte sie selbst gelegentlich im Familienkreise und vor Gästen, nicht ohne Anflug eines kleinen Familien-Stotterns … O hier gab es Anregung, hier waren die neuen Sachen, hierher verlegte Arnold bald das ganze Leben seiner freien Zeit, und da schließlich das Etablissement Eisig als gewaltiges Hutexportunternehmen in ansehnlicher Blüte stand, hatten die Eltern Beer nach näheren Erkundigungen gegen diesen Umgang im Grunde nichts mehr einzuwenden.