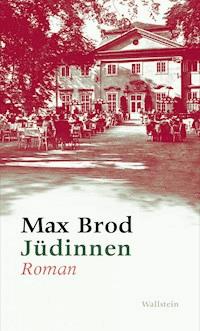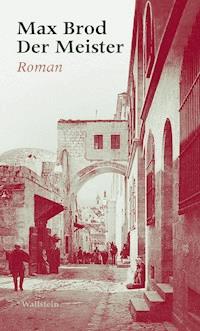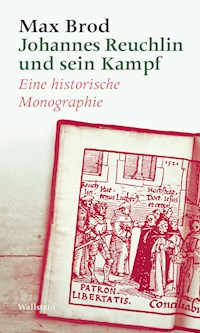Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Max Brod - Ausgewählte Werke
- Sprache: Deutsch
Mit seinem Roman um eine "femme fatale" erzählt Max Brod eine spannende Liebesgeschichte und erweist sich als Meister der Charakterzeichnung. Der rätselhaften Stascha verfallen gleich zwei Männer: Der Held Mayreder flieht mit der launischen Schönheit nach Italien, durch teure Hotels und prächtige Landschaften, verfolgt von seinem Konkurrenten Dr. Karkos. Bis Stascha unerwartet die Seite wechselt, was ihr zum Verhängnis wird."Die Frau nach der man sich sehnt" wurde Brods erfolgreichster Liebesroman, schon 1929 kam er als Film in die Kinos: mit Marlene Dietrich als Stascha und Fritz Kortner als Dr. Karkos (im Film Karoff). Es war der letzte Stummfilm der Dietrich und der erste Film, in dem sie die "femme fatale" verkörperte, als die sie schon bald weltberühmt werden sollte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Max BrodAusgewählte Werke
Herausgegeben von Hans-Gerd Kochund Hans Dieter Zimmermannin Zusammenarbeit mit Barbora Šramkováund Norbert Miller
Max Brod
Die Fraunach der mansich sehnt
Roman
Mit einem Vorwortvon Franz Hessel
Gefördert von der Fritz Thyssen Stiftung Köln und unterstützt vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds sowie dem deutschen Auswärtigen Amt
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnetdiese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internetüber http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2013www.wallstein-verlag.deVom Verlag gesetzt aus Aldus RomanUmschlaggestaltung: Susanne Gerhards, Düsseldorfunter Verwendung eines Fotos von Marlene Dietrichaus dem Film »Die Frau, nach der man sich sehnt« (1929),Fotograf: Otto Behrens, © Deutsche KinemathekDruck und Verarbeitung: Hubert & Co, GöttingenISBN (Print) 978-3-8353-1333-0ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-2452-7ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-2453-4
Inhalt
Vorwort(Franz Hessel)
Die Frau, nach der man sich sehnt. Roman
Begegnung
Folies Bergère
Unter dem Donner der Kanonen
Dorothy
Kalte Liebe
Rockenhaus Tuch
Agnes
Stascha
Die Bar Papagei
Es ging alles so leicht
Glückstage
Die Schwester
Omina et portenta
Das dritte Gefühl
Lieb mich weniger, so liebst du mich recht!
Wenn Liebe stirbt
Doktor Karkos
Morgendämmerung
Nachwort(Hans-Gerd Koch)
Editorische Notiz
Über den Autor
Vorwort
Statt darüber zu schreiben und das schön Zusammengefügte auseinanderzusetzen, möchte man dies Buch lieber gleich noch einmal lesen, frei von der Spannung, die bei der ersten Lektüre das Verweilen verhindert. Man möchte all das festhalten, was hier an süßen und bitteren, spielerischen und tiefen Weisheiten über die Liebe gesagt ist. Dies Buch handelt nämlich wirklich – und das ist heute etwas sehr Seltenes – von der Liebe selbst, dieser verbotenen Sache, die wir nicht aushalten, für die wir zu schwach sind. Wir halten nur »die Abschwächungen der Liebe« aus. Dies Buch spielt fast ganz in der schwebenden Sphäre dessen, was der Dichter »das dritte Gefühl« nennt, das weder Freundschaft noch Sinnlichkeit, auch keine Zusammensetzung aus beiden ist, sondern ein drittes Unabhängiges. Der Leser fühlt mit dem Helden, wie solche Hingabe rastlos zum bürgerlichen und ethischen Untergange drängt. Den möchte der junge ehemalige Offizier der weiland österreichischen Armee, der das ganze in einer pariserischen Nacht beichtet, bisweilen aufhalten. Eingedenk, daß »aller Verkehr unter Menschen ein Kunstwerk sein soll«, möchte er aus echtem Liebesdienst, nicht aus Berechnung, sein Erleben formen, aber das duldet sie nicht, die schöne Stascha, seine letzte und einzige Geliebte, sie sprengt ihm alle Brücken zur Außenwelt, die nur noch als Schrecktraum seiner Nachtangst in sein Leben hineinspielt mit verlorenen Attesten, zu schreibenden Briefen, gespensternden Pflichten und Bestrebungen, nur noch als haltloses Erschrekken vor der Unmöglichkeit der eigenen Situation in Hotel, Familie und Welt. Das Chaos, das in dieser Frau mit den »laukalten« Armen immer wieder aufsteigt, ist unter vielen andern an einer Stelle wunderbar deutlich gemacht, da, wo erzählt wird von ihrem schön geordneten glattgewellten Haar, »das aber doch an der Schnittfläche über dem Hals in Locken aufgeht, wie etwa eine Amethystdruse rundum schönen Schliff, an der Bruchstelle aber ihre Kristalle zeigt«.
Als Werk eines bewährten Erzählers ist die Geschichte von »der Frau, nach der man sich sehnt« auch als Roman sehr gut und wird nach Gebühr gelobt werden. Um so mehr möchte ich auf lauter Einzelheiten hinweisen, auf Sätze in Parenthese wie: »Wir aßen immer an derselben Seite des Tisches, nie förmlich einander gegenüber«, auf kleine Schilderungen wie die von den Stätten der Liebenden, ihrem Berlin zum Beispiel, das wie ein Erfrischungsgetränk ist, eisigfroh mit ganz leichtem Alkoholprickeln darin und eine Grundfarbe hat: rosig bis sandsteingrau, auf all das, was der Dichter in Darstellung, Dialog oder in Gleichnissen wie dem vom brennenden Papier über die »Durchlöcherung des Wunders« aussagt: »Wenn man ein großes Stück Papier in die Ofenglut wirft, kann man ganz genau ein Stadium abpassen, in dem das Papier zwar schon an allen Ecken und Enden brennt, aber dennoch im Ganzen seine alte Form bewahrt zu haben scheint – man sieht es immer noch wie es war, aber zu retten ist es nicht mehr.«
Mit der leidenschaftlichen Exaktheit Stendhals sind in diesem Buch die kleinen und großen Dinge der Liebe gesagt, die den Erwin Mayreder soweit bringt, dass er endlich statt der Geliebten und ihrem Räuber nachzusetzen, tiefsinnig und ergeben in »unserm« Zimmer sitzt, stundenlang mit einer Arbeit beschäftigt, die sich beide schon lange vorgenommen hatten: Ordnen und Einkleben von Photoaufnahmen der Reisen ihrer glücklichen Zeiten. Da ruht er in Todeslust des Verweilens aus von der Leidenschaft, der er dann den Rest seines Lebens tatenlos und wissend nachschauen wird. Und wir kehren mit ihm zum Anfang zurück und lesen noch einmal von vorne.
Franz Hessel
Die Fraunach der mansich sehnt
Roman
Wir halten es nicht aus, wirklich zu lieben, wir sind zu schwach. Daher sind es nur die Abschwächungen der Liebe, die wir aushalten.
(Aus diesem Roman)
Trotz allem können wir ja nicht umhin zu wissen, daß nur absolute Lösungen menschlich anständig sind.
(Emil Strauß)
Begegnung
Der Titel ›Eine Nacht toller Liebe‹ nahm sich recht unglaubwürdig aus über den schrillen Bildern des Revueplakats, aber geradezu wie eine Gotteslästerung neben dem zum Zerbröckeln alten Livreediener, der müden Gesichts das Portal der »Folies Bergère« flankierte und zusammen mit zwei ebenso abgehetzten und verärgerten Wachleuten das Vorfahren der Autos mühsam genug zu überwachen hatte.
›Eine Nacht der Liebe‹ – oder vielmehr eine große angestrengt arbeitende Fremdenindustrie-Mühle? Die Antwort war so traurig, so klar.
Ich weiß nicht, warum ich hinging. Überaus glücklich war ich. So konnte es einerlei sein, wo ich den Abend verbrachte. In meiner Rocktasche knitterte ein Brief, der mich glücklich machte. Ein Brief, den ich viele Tage lang erwartet hatte. Aber heute hatte mir ihn die Post gebracht. Ein Brief von dem geliebten Mädchen, zu dem ich nun in ein oder zwei Wochen, nach Erledigung meiner Pariser Angelegenheiten, heimkehren konnte …
Im Foyer, dessen vielfach gespiegeltes Licht die Augen in Brand steckte, waren weitere Bestandteile der Fremdenindustrie-Maschine klappernd an der Arbeit. Der Kassier. Dann ein seltsamer Gerichtshof von drei würdigen Greisen in Frack, hinter einem gemeinsamen Pult sitzend, an dem man die gekaufte Karte aus irgendeinem unklaren Grund nochmals zur Überprüfung vorzulegen und gegen eine andere umzutauschen hatte. All das geschah sachlich, unerbittlich, bös. Der rechte Empfang für eine ›Nacht der Liebe‹. – Zahlte man an der Garderobe, so wurde einem von dem dicken blassen Mädchen, das da bediente, etwas nachgeschrien, was ungefähr wie »Un petit benefice« klang, also eine Bitte um ein Trinkgeld, jedoch durchaus nicht als Bitte vorgebracht, sondern etwa so, als sollte gesagt sein: ›Du Trottel, du weißt also nicht einmal, daß du mir ein Trinkgeld zu geben hast. Sogar das muß man dir sagen, Idiot!‹
Beschämt wandte man sich um und erlegte nun auch das Trinkgeld.
Beschämt, doch nicht etwa ärgerlich. Zu Ärger war kein Anlaß. Daß man das alte liebenswürdige Paris an solchen Stätten rohen Vergnügens für rohe Fremde nicht suchen darf, wußte man ja. Hier vielmehr suche man nur eines: unglückliche, arme, ausgeblutete Angestellte, die sich an uns ausländische Portemonnaies heranmachen. Übrigens ohne besondere böse Absicht, nur mückenähnlich, in tierisch instinktivem Drang, vom Saugtrieb beherrscht. –
Eine solche Existenz glaubte ich abzuschütteln, als ich an einem älteren zerlumpten Menschen, der mich ansprach, schnell vorüberstrich.
»Ich habe mir nämlich – habe mir nämlich einen freien Abend gemacht« brummte der Mensch hinter mir her. »Und da wollte ich Sie bitten …«
Diese Leute, die einen in Paris deutsch ansprechen, sind die allerärgsten. Gefährliche Schlepper für Wurzlokale. Gefährlich, weil sie bieder aussehen, sich vor lauter Biederkeit sogar ein wenig ungeschickt und steif benehmen, so tun, als liege auf dem Grund ihrer Seele noch etwas Unaufgelöstes, in Worten gar nicht Ausdrückbares. Und dabei ist ihr Programm so einfach und klar. Unter dem Vorwande, unerhörte Laster zu zeigen, die man schon aus anthropologischem Interesse nicht ungesehen lassen dürfe, bringen sie einen in ein gewöhnliches, im Kitsch-Orient-Stil aufgeputztes Bordell, wo bereits das bloße Über-die-Schwelle-Treten auf Grund irgendeines ungeschriebenen und nicht nachprüfbaren Gewohnheitsrechtes zur Zahlung von ein halb Dutzend Champagnerflaschen verpflichtet, die mit rätselhafter Schnelligkeit auf dem Tisch des Cabinet particulier erscheinen. Dazu drehn sich sechs häßliche Mädchen, nicht so sehr nackt als ausgekleidet, in schäbigem ›Schönheitsreigen‹ vorbei – und will man eiligst aufbrechen, unter Protest, daß man weder den Champagner noch den Tanz bestellt habe, so erscheint ein gewaltiger Negerboxer in der Türe, um einem die Unanfechtbarkeit der Rechnung stumm, gewissermaßen durch seinen bloßen Anblick, klarzumachen. Der ›deutsche Führer‹ aber ist schon vorher spurlos durch einen Tapetenspalt verschwunden.
»Und da wollte ich Sie bitten …« brummte der Mann, der mich überholt hatte und nun vor mir stand.
Wortlos wollte ich vorbei – die einzige Methode, sich diesen Schwindlern gewachsen zu zeigen.
»Un petit benefice« rief der Diener, dem ich ein Programmheft abgekauft hatte.
Wieder vergessen! schalt ich mich, gab das Geld, – da stand mir der Fremde wieder, diesmal seitlich, im Weg.
»Schamlos – wie alles hier« murmelte er und hatte meine Gedanken ausgesprochen – allerdings mit einem Nuancenunterschied. Mich betrübte die schamlose Bettelei, hinter der ich Not zu spüren glaubte. Der Fremde rieb sich fröhlich die Hände.
Das aber war es noch nicht, was mich in Erstaunen setzte. – Alle diese Schlepper sind ja Philosophen. Gescheiterte Existenzen, mit einer gewissen Vorbildung von früher her. Das weitere bringt dann ihr schwieriger Beruf. – Seine Bemerkung also verblüffte mich nicht. Doch als ich ihm ein Geldstück in die Hand drückte, schlug er es aus. Da sah ich mir den Menschen doch etwas näher an.
»Ich bettle nicht« sagte er ruhig und einfach.
Er war schlank, auffallend groß und mager. Das Merkwürdigste war sein abgezehrtes gelbliches Gesicht, das sich in der Farbe von dem hellbraunen Vollbart und Bakkenbart nur wenig abhob. Der Bart schien gepflegt, machte aber trotzdem einen armseligen, ich möchte sagen: krankhaften Eindruck. Als sei jedes Haar einzeln müde, jedes einzeln von irgendeiner geheimnisvollen Krankheit befallen. Gepflegt und doch schäbig – das war überhaupt der Gesamteindruck. Deshalb war er mir zuerst ›zerlumpt‹ vorgekommen; bei näherem Hinsehen aber fand man gar nichts Zerlumptes an ihm. Nur Ärmlichkeit. Die Ärmlichkeit war in den schlechten, glänzendgewetzten Anzug förmlich wie ein zäher Saft infiltriert. Die Hosen aber hatten trotzdem scharfe Bügelfalten. Gerade diese scharfen Falten im schlechten Stoff sind ja ein deutliches Zeichen der Deklassiertheit.
»Erwin Mayreder« sagte der Fremde, sich verbeugend, da ich ihn so ausführlich betrachtete. Der Verbeugung folgte noch ein mehrmaliges Schlenkern des Oberkörpers, was mich sofort an die Manieren ehemaliger österreichischer Offiziere erinnerte. Dazu stimmte auch das dünne Bambusstöckchen, das er trug – ein Stöckchen ohne Krücke, mit dem er gelegentlich leicht von der Seite an die Hosen schlug, wie mit einer Reitgerte.
»Was wollen Sie eigentlich von mir?« sagte ich. »Sie haben mich doch angesprochen, haben mich gebeten …«
»Ja, ich wollte – ich wollte – das da« – er hielt mir eine grüne Eintrittskarte vors Gesicht. »Ja, bitte, tauschen Sie mir dieses Billett gegen ein besseres um …« Und da er meine Verwunderung merkte: »Ich muß nämlich mehr sehn … besser sehn … alles sehn. Von ganz vorn, allen Leuten ins Gesicht.« Dabei weiteten sich seine Augen, und wie er im Eifer recht nahe kam, stach mir ein leichter, aber sehr giftig riechender Alkoholschwaden in die Nase. – Übrigens schien er nicht betrunken. Es gibt ja Menschen, deren Körper von geistigen Getränken so durchsetzt ist, daß sie unangemessene Quanten gar nicht mehr spüren. Jedenfalls machte der Mann, wieder zurücktretend, keinen unangenehmen Eindruck. Er bewegte sich sogar sehr graziös, sprach allerdings stockend, was aber nur wie Schüchternheit und gleichfalls anmutig wirkte. Seine Bitte dagegen war sonderbar. Statt eines Abendessens, das ihm, dem verhungerten Aussehn nach zu schließen, sehr wohlgetan hätte, verlangte er eine Luxuskarte für »Folies Bergère«. Doch an jenem Abend konnte ich nicht ›nein‹ sagen, des Briefes wegen, der endlich eingelangt war. Alle Minuten einmal fühlte ich in die Tasche, das zerdrückte Papier war wie eine Liebkosung für meine Hand.
Ich ging zur Kassa zurück.
Hartnäckig folgte mir der Mann: »Einen recht guten Platz, bitte.« In seinen blauen, wie von überirdischem Glanz (oder von Alkohol) ausstrahlenden Augen flammte etwas auf, was mir das plötzliche Gefühl einer Nähe, einer geistigen Verwandtschaft eingab. ›Wir beiden Leidenschaftlichen – inmitten dieses tot lärmenden Betriebs‹ dachte ich. Es gibt ja Stimmungen und Zeiten, in denen man einem solchen geahnten Verwandtschaftsgefühl besonders leicht und gern erliegt. Der Brief in meiner Tasche war es, zweifellos dieser Brief, – er hatte mich beweglich gemacht, schenkte der Zukunft blühende Farben und der nächsten Stunde: Ruhe, wie sie mir so selten beschieden ist – Ruhe, Bedenkenlosigkeit. Ja, so ist es; eine rechte Freude heilt alle Kleinlichkeiten und Stockigkeiten des Lebens. Ich kaufte dem Mann einen Sitz neben dem meinen. Es war ja übrigens kaum der Rede wert.
Folies Bergère
Dann sah er sehr ernst neben mir, benahm sich aber ganz anders, als ich erwartet hatte.
An die Bühne, das weiße, von siedendem Licht überschüttete Riesenloch, mit all dem Stampfen und Johlen drin, wandte er nur wenige Blicke. Gleichsam nur zur Kontrolle. Seine Augen gingen von Anfang an im Schweigen des Parterres spazieren. Auch der weite Parterreraum war halbhell, Dämmerlicht regnete von den breiten Reflektorstreifen, die bläulich zitternd über ihm lagen wie parfümierte Wasserstrahlen aus unsichtbaren Dampfspritzen. Das leise siedende Geräusch der vielen Reflektoren, das wie ein wilder Kriegsgesang der Wollust das ganze wölbige Haus, den Lärm der Bühne wie die Starre des Publikums durchdrang – lauschte der Fremde dieser Grundmelodie, die aus den Tiefen aufstieg? Er lauschte, er glotzte. Was er wohl suchen mochte? Warum hatte er mitgenommen sein wollen, wenn er nun all die Beine der Revue und die weißgeschminkten Brüste mit ihren rotgeschminkten Knospenpunkten, Brüste, die sich im Tanz schüttelten und dabei doch garantiert fest und in Form blieben, auch ohne hochgehobene Arme (diese Scheidewasserprobe für den Kenner wurde öfters gemacht), wenn er all dies Aufgebot von sorgfältig ausgesuchtem Edelfleisch gar nicht beachtete?
Prüderie war es nicht, was seine Blicke begrenzte. Das merkte man an seinem Gesichtsausdruck. Der wies eher auf Freude, Sich-Behaglich-Fühlen, untermischt mit einer Art von eigensinnigem, kindlichem, nicht bösartigem Hohn. Nichts Tadelndes dabei, vielleicht sogar eine Art von Beifall und Billigung.
Sein Schweigen, sein Von-der-Bühne-Wegschaun machte mich allmählich nervös. Auch ich begann im Zuschauerraum umherzusehn. Das entlockte ihm die erste Bemerkung: »Nicht wahr, es ist doch viel interessanter …«
Ein Bild, das eben gezeigt wurde, unterbrach ihn.
Auf der Szene war der ›alte Abonnent‹ aus seiner Loge aufgesprungen und hatte Protest erhoben, daß die Revue ›nicht nackt genug‹ sei. Der Titel »super-nue« sei jedenfalls eine Irreführung u.s.f. Abgang des mit dem Band der Ehrenlegion geschmückten Greises. Verwandlung: ›Die Hühner am Spieß‹.
›Die Hühner am Spieß‹. Da sieht man einen offenen Küchenherd auf der Bühne, unnatürlich vergrößert, mit ebenso gigantischen Kerzen und Nippesfiguren auf dem Sims, die halbe Manneslänge erreichen. All dies, damit die Hühner, die am Spieß dieses Herdes gebraten werden, richtige Menschengröße haben können (während Cyrano und der Koch Rageneau ganz klein, das heißt: nicht größer als die Hühner, neben dem Herd stehn, was einen phantastischen, fast märchenlieben Eindruck macht). Und am Spieß also, wagrecht über dem bengalischen Herdfeuer, zwei formlose Wesen – die gerupften Hühner – oder sind es wirklich Menschen, Frauen, in dieser geduckt zusammengedrückten Haltung? Vollständig nackt, wie eben gerupfte Hühner zu sein pflegen. Solches wird bei diesen unglückseligen Mädchen-Hühnern diesmal ohne Zutat auch nur des geringsten Tüllschleiers dadurch ermöglicht, daß ihr Kopf tief in die Brust gedrückt ist, vom Gesicht sieht man überhaupt nichts, nur eine Haarkugel stößt an die hockend heraufgezogenen Knie und die ganze Fleischmasse ist mit Stricken festgeschnürt, richtig ›Ware‹. Langsam drehn sich die Spieße. Mit ihnen die Hühnchen, deren Hüftchen und hübsche Schenkel dem Doppelsinn des französischen »poule« alle Ehre machen.
»Wie lustig, wenn man nicht traurig dabei wird« sagt mein Nachbar.
Es ist wahr. Selbst wenn man allen Spaß der Welt versteht, nach solch einem Anblick möchte man sich die Augen desinfizieren lassen.
»Alles applaudiert« bemerkte ich und fühle mich mit dem Fremden schon ganz vereinigt, im Kampf gegen die Menge.
Doch er ist nicht empört. Vielmehr schimmert sein mageres Gesicht von freundlicher Weisheit, wie bei einem Forscher, der eben die Bestätigung für ein von ihm behauptetes Naturgesetz entdeckt hat.
Jetzt fiel mir ein, daß er den bessern Platz erbeten hatte, um »ganz von vorn, allen Leuten ins Gesicht« zu schaun. Es war, als lese er jedem einzelnen, Männern wie Frauen, die Energie der hervorgeschwitzten sinnlichen Erregung vom Gesichte ab. Doch auch dies nicht etwa mißbilligend. Im Gegenteil: die erhöhte Temperatur, die deutlich in heiserem Keuchen und verlegenen Lächel-Grimassen ansteigende Begehrlichkeit des Publikums schien ihm wohlzutun. Nun applaudierte auch er und wurde mir vollends unverständlich.
Nächstes Bild, noch frecher als die ›Hühner‹, weil bis ins innerste Gefühl hinein frech. Was ist physische Entkleidung gegenüber solcher Preisgabe des Nichts in der Seele!
Einsamer Wald, See, Herbstbäume, Vollmond. Falsches grünes Glitzern und mittendrin ein sentimentales Liebespaar mit seinem Lied. »Un chant d’amour« – damit ihr es nur ja glaubt, wiederholen sich diese Worte immer wieder. So dick aufgetragenes Gefühl, das aber doch zart und poetisch wirken will. Eine Zumutung, als sollte man, ins Gebiet des Komischen übertragen, ein Erdbeben direkt für einen Clownspaß ansehen. Etwas ganz entfernt an Clownspaß Erinnerndes ist ja an einem Erdbeben. Ebenso etwas, was entfernt, aber wirklich nur ganz entfernt mit Poesie zu tun hat, an den Waldelfen, die jetzt erscheinen. Eine, die zweite, die dritte Frauengestalt. Immer noch, immer noch neue. Jetzt sind es schon sieben, sie treten im Gänsemarsch aus der Kulisse, eine wie die andere die Beine hochhebend, Schritt für Schritt, Busen nackt, die Hände immer an der Taille der vorangehenden – und eine wie die andere spult ihr harmloses Girl-Lächeln über die Rampe hinunter. Noch andere, immer mehr, ganz dicht hintereinander, ein wandelnder Staketenzaun von Frauen, schließlich also siebzig Stück, hundertundvierzig nackte Beine auf und ab. Abmarsch, vorbei. Das Liebespaar ergibt sich weiterhin seinen Schwüren von Treue und Unschuld. Der Wald glitzert grün. Dazu aber schiebt sich nun im Hintergrund von der anderen Seite her dieselbe Elfenmauer vorbei – nur weiß man jetzt, wozu die Szene an einem Waldsee spielt. Der See ist aus Glas, die Girls spiegeln sich in ihm. Zweihundertundachtzig Beine mithin. Und das Lied sagt hiezu:
Un chant d’amour
Qui monte au bord de l’eau
Et qu’alentour
Repète un tendre écho !
»Großartig« brüllt mein Nachbar, applaudiert drauf los.
»Was denn? Was wollen Sie eigentlich?«
Auf die Bühne hat er auch jetzt kaum hingesehn, immer nur auf die Zuschauer rings.
»Dieser ganze Massenaufwand, mit dem man nach Gold gräbt – an einer Stelle, wo absolut kein Gold zu finden ist, – wodurch man aber nur gereizt wird, den Aufwand immer noch zu vervielfachen. Passen Sie auf, es muß noch toller kommen!« Und er hielt wirklich aus, bei all den törichten Szenen, die ›Weinlese in Bordighera‹ oder ›Schwarze Messe‹ hießen und bei denen die Girls nacheinander die Weine Italiens und Frankreichs oder verschiedene Parfüms oder Pelzsorten oder Engel, Teufel und Folternonnen darstellten, stets an den unwahrscheinlichsten Körperteilen nackt, die Kleider wie von den Scheren der Reflektorstreifen aufgeschnitten. Es war immer dasselbe und schon furchtbar langweilig. Warum blieb ich eigentlich? Der Mann neben mir interessierte mich längst mehr als das ganze Schauspiel; das war es. Auf ihn wartete ich. Ich wollte mit ihm reden. Irgend etwas in mir war durch seine Worte berührt worden, eine meiner vielen Unsicherheiten. Ich hatte merkwürdigerweise ziemlich von Anfang an das Gefühl, daß der närrische Mensch mir Aufschlüsse zu geben hatte, über vielerlei, unter anderem auch über den Brief, den ich in der Tasche trug. ›Man gräbt nach Gold, wo absolut keines zu finden ist‹ – das ging mir nicht mehr aus dem Kopf, das und das schmerzliche Grinsen, eingespalten ins fleischlose Gesicht des Fremden.
In einer Pause bekam ich ihn endlich in den großen Vorsaal hinaus. Wir saßen bei einem Cobbler am Büfett. Promenade, Hunderte von Dirnen, die wie Flöhe die zirkulierenden Männer ansprangen, eine Bar in jeder Ecke, der Springbrunnen in der Mitte des Riesenraumes, oben die Galerie mit der amerikanischen Kegelbahn, die dröhnte, und gleich daneben lockte eine Schalmei zum Bauchtanz hinter dem Vorhang, offenbar für solche, die keine Minute verlieren wollen. »Das alles ist nichts« meinte Herr Mayreder verächtlich. »Das war schon immer so. Vor zehn und zwanzig Jahren. Aber drin auf der Bühne werden wirkliche Fortschritte gemacht. Da sehn Sie diese Girls, Massenfabrikation, Amerika. Wie sie als Einheitsware paketiert sind, gleiches Kostüm, gleiches Lächeln, gleiche Schritte, zu vertauschen wie Zigarettenschachteln oder Schokoladetafeln. Es gelingt nicht mehr, eine einzelne von ihnen mit dem Blick festzuhalten. Man verwechselt sie im Hinschaun. Typenprodukte wie Ford-Automobile. Ist das nicht niederträchtig? Verstehn Sie mich recht, mein Herr: lieben und nicht unterscheiden können! Lieben und siebzig Stück zugleich! Für Industrieerzeugnisse hat ja dieses Massenaufgebot einen Sinn, auf Liebe übertragen ist es offenbar der reinste Widersinn. Daß man aber diesen offenbaren Widersinn riskiert, das eben ist das Neue, das Bedeutsame, der Fortschritt. Da muß doch dem Einfältigsten klar werden, daß solche Darbietungen etwas ganz anderes bedeuten müssen als sich selbst – in sich selbst sind sie sinnlos, sie weisen also auf etwas anderes hin, auf ein unausgesprochenes Geheimnis, das hinter ihnen steht, auf einen Traum, einen kaum geahnten Wunsch …«
In seinen großen, weisen, tiefblauen Augen leuchtete es auf. Er trank tüchtig, doch blieb ihm ein reizender Anstand zu eigen, so etwas wie trockene Luft umwehte ihn freundlich. Er hat alles hinter sich, fühlte man, hat das schwere Leben mit allen, mit den schwersten Mitteln bewältigt. Ich kam mir, wiewohl vielleicht an Jahren gleich alt, vor ihm ganz unerwachsen vor.
»Und worauf also weisen sie hin?« fragte ich. »Wo ist das Geheimnis?«
Ich mußte recht dringend geworden sein, denn er wich mit einer gewissen Ängstlichkeit zurück: »Nein, … wenn Sie es nicht fühlen … ich weiß nicht, zu erklären ist es nicht.«
»Etwas fühle ich schon« ließ ich nicht locker. »Daß da drinnen etwas recht Verdorbenes, auf die Spitze Getriebenes vorgeht, das fühle ich schon. Aber in Worte fassen, wie es Ihnen wohl vorschwebt … sehn Sie, vielleicht bin gerade ich der Einfältigste, von dem sie vorhin sprachen, und mir ist es eben doch nicht klar geworden …«
»Nein, vielleicht soll man es nur fühlen und nicht in Worte fassen.« Aber im Gegensatz dazu legte er nun doch los, überdies immer leise und fein. »Da wundern Sie sich wohl, junger Mann, warum ich es dann so registriere, warum ich meine Zeit nicht mit einer nützlicheren Tätigkeit verbringe. O wenn Sie wüßten! Für mich kann es nämlich gar keine nützlichere Tätigkeit geben. Sie erhält mich geradezu am Leben. Sonst hätte ich Sie, junger Freund, nicht erst um die noble Karte angebettelt. Sonst nicht! Man hat doch seinen Stolz. Prosit, junger Freund! Und aufrichtigen Dank. Denn was Sie mir da bieten – Sie wissen gar nicht, wie fabelhaft das für mich ist. Ja, ja, man hat da drinnen solide Fortschritte gemacht. Fortschritte im tauben Gestein, oder wie der Bergmann das sonst nennt. Im leeren Gestein, wo nicht zu graben ist. Da gräbt man Hals über Kopf, und keine Kosten gespart, und neue Ideen, führende Intelligenzen zu hundert am Werk. Bravo, großartig! Sie haben keine Ahnung, was ich meine, nicht wahr? Prosit, Jüngling! Sie sehen wahrhaftig aus, als hätte Sie das Leben noch nicht besonders rauh angerührt. Guter Posten, Tischlein deck dich, he? Und da spüren Sie wahrscheinlich auch nicht – Prosit, Muttersöhnchen, wie einem solch Lächeln einer schönen Tänzerin durch Mark und Bein gehen kann. Nicht etwa, weil man sich in sie verliebt. O Gott, wie weit ab liegt das! Was ich meine, ist ja gerade das Entmenschte in diesem quasidemokratischen Lächeln der Dame – in diesem Lächeln ›an alle‹ – und doch kriegst du sie nicht, etsch, sie ist ja sehr teuer, ist Qualität. Wozu lächelt sie also? Um den Reiz zu steigern, um hier, wo im Grunde für Geld alles möglich ist, doch das Unmögliche zumindest anzudeuten, die Liebe, die große reine Liebe, das Seltenste von all dem Seltenen, was es auf Erden gibt. Kommt sie denn überhaupt noch vor? Ist sie je gewesen? Ob ja, ob nein, was tun die Menschen nicht alles, um sich wenigstens Ersatz für sie zu schaffen! Un chant d’amour – und ähnlicher Dreck – was für erlesene Gegensätze werden aufgeboten, um zu steigern, aufzuregen, einzuheizen – sehn Sie, es ist ja hier alles absichtlich voll von Gegensätzen, das Unsinnige bietet man an Stelle des Unfaßbaren, das eben die große Liebe ist – das Paradox an Stelle des Mysteriums. Paradoxe wie diese banale Melodie, in Sichtbarkeit umgesetzt von den tadellos schönsten Frauenbeinen. Oder solch ein englischer Schlager, bitte nehmen Sie ihn, zergliedern Sie ihn – I want to be happy, but I am not happy, if you are not happy too – ist er nicht sittlich, nein direkt kindlich, herzig, lieb, goldig, jedes Wort ein freundlich sich öffnendes Kinderauge – und dazu sucht man sich den betörendsten Frauenkörper aus, um diesen aufs äußerste harmlosen und anständigen Text vorzuführen! Sinnlos, nichtwahr? Aber gerade der Unsinn ist der Sinn dabei. Ja, merken Sie denn nicht, wie das verwirren und auf das Unmögliche, auf das Geheimnis hinter all dem hinstoßen soll, auf das leere Goldbergwerk, in dem man Leben schürfen will und doch absolut nichts zu schürfen findet.«
Ich lauschte, ich schwieg. Zwar war ich, wie schon bemerkt, an jenem Abend absolut glücklich und trug den bewußten Brief in der Tasche. Mich selbst also und meine Angelegenheiten konnte der verzweifelte Ton nichts angehn, den ich aus den trockenen, manchmal sogar lustigen Worten des Fremden heraushörte. Und doch – etwas reizte mich. Schwer zu bestimmen, was. Vielleicht war es zuerst nur die banalste Form, in der menschliche Teilnahme sich äußert: Neugierde. Aber bald ging die Sache tiefer. Ich konnte mich von dem, was Mayreder erzählte, doch nicht so ganz ausschließen (so schien es mir), ja bald glaubte ich, daß sich kein Mensch der Welt davon ausschließen dürfe. Das ist natürlich übertrieben ausgedrückt. Aber etwas ist daran. Zumindest an jenem Abend schien es mir so. –
Wir saßen dann in einem guten Restaurant, nahe der Madeleine. Ich hatte ihn zum Souper geladen. Einen Moment lang dachte ich, die Kellner würden ihn in dieses vornehme Lokal gar nicht einlassen, seines ärmlichen Anzugs wegen. Und ich erschrak, daß mir das erst im Toreingang einfiel. Aber die Pariser Kellner haben ja einen so feinen Blick. Sie sahn sofort, daß es sich um einen besondern Menschen handelte, reihten ihn vielleicht stillschweigend in die Künstlerkategorie ein. Es gab nicht den geringsten Anstand. Und wir aßen und tranken aufs beste. Überdies griff Herr Mayreder nur sehr wenig und sehr artig zu – war also gar nicht so ausgehungert, wie er aussah, oder wollte es wenigstens nicht zeigen. In der abgetragenen graugrünen Dienstbluse saß er vornehm, schlank, kavaliermäßig da. Ich erinnerte mich an den Ausspruch eines Freundes: Das Eleganteste ist doch, in uneleganten Kleidern elegant auszusehn.
In dieser Nacht hat mir Mayreder sein ganzes Leben erzählt. Wir wechselten mehrmals das Lokal, saßen in Kaffeehäusern an den Boulevards, besuchten unterschiedliche Stadtviertel, waren zuletzt in einer kleinen Brasserie bei den Markthallen, im Morgennebel schon. Ich könnte nicht sagen, was mich verführt hat, die ganze Nacht mit ihm zusammenzubleiben. Seine Art ergriff mich, das war es vielleicht – er mochte ein sehr verschlossener und wohl auch hochmütiger Mensch sein und plötzlich war er ins Schwatzen gekommen, da brach gewaltsam, unbeherrscht etwas so Dunkles aus ihm hervor, daß es einen wie der Schauer eines eiskalten Bades überkam – in einer unterirdischen Grotte, die niemand vorher betreten hat. Gott weiß, wie viele Jahre er geschwiegen hatte – und mit einem Male diese geradezu unnatürliche schmerzhafte Redseligkeit. Warum er nun eigentlich erzählt hat, sein ganzes Leben, mehr als sein Leben – sich selbst mit allen Tiefen und Tücken einer Menschenseele – warum gerade mir? Vielleicht weil er die Leidenschaft in mir fühlte, die der seinen antwortete; – ich gehe so ratlos durch die Welt, nichts verstehe ich bis ans Ende, überall suche ich Hilfe. Im Licht seiner blauen Augen, so schien es mir, gab es irgendeine, allerdings sehr ferne, ihm selbst sehr ferne Hilfe. Dahin flüchtete ich also und hörte ihm ganz andächtig, geradezu schülerhaft zu. Das mochte seine Zunge gelöst haben, dies Aufpassen, dies ehrliche Lernenwollen. – Nein, ein Bauernfänger war er gewiß nicht, wie ich zuerst gedacht. Nur einer der Merkwürdigsten von den vielen merkwürdigen Menschen, die in Paris an den Strand geworfen werden. Als wir über die Place Clichy gingen (ja auch dahin, auf den Montmartre waren wir gekommen in dieser langen Nacht), blieb er bei einem Kessel stehn, auf dem Haselnüsse geröstet wurden. »Nehmen Sie« sagte er zu mir. Und dann durfte ich nicht zahlen. »Das ist nämlich mein Gewerbe und mein Standplatz, dieser hier«, erklärte er »und Ernest, der Bursche da, ist mein Stellvertreter für die eine Nacht, da ich wieder mal die unabweisliche Notwendigkeit verspürte, solch ein Bummslokal aufzusuchen. Na, vorbei, vorbei. Schmeckt’s? Feine Sache, diese reschen Nußkerne, nichtwahr? Ich suche ein kleines Kapital, um diese Art von Straßenhandel bei uns einzuführen, in Wien und Berlin – bei uns werden ja blöderweise immer nur Kastanien gebraten, immer dasselbe – glauben Sie nicht, daß mit Haselnüssen, geröstet, im Straßenhandel ein gutes Geschäft zu machen wäre? Alle guten Ideen sind einfach, naheliegend. Es kommt nur darauf an, sie mit Energie zu ergreifen und auszuführen. Man kann auf diese Weise Millionen verdienen. Und um gewisse Schulden abzuzahlen, ich gestehe es Ihnen offen – wäre es mir gar nicht unlieb, einmal einen größeren Coup zu machen.«
Doch das war schon gegen den Morgen hin gesprochen, in Katerstimmung. –
Anfangs sprach er ganz anders. Begeistert, mit einer Springflut von Worten, die auch einen weniger Willigen als mich untergetaucht hätte. Und dabei, das war immer wieder das Besondere an ihm, so liebenswürdig und zart; angenehm, selbst wenn er aggressiv wurde.
Im Anfang nämlich war er in der Tat recht aggressiv. »Da rennen die Leute hinein« sagte er. »Immer diese Weiber! Dummes Zeug. Und auch ich renne in das Bummslokal; das wollen Sie doch einwenden, mein Herr. Ja, aber bei mir hat das einen andern Grund. Einen ganz andern Grund hat das. Gier ist da wahrhaftig nicht dabei. Sie aber selbst, Sie gehören zu denen, denen vor lauter Gier nach Weibern die Zunge raushängt. Woran ich das erkenne? Ein bestimmter Zug im Gesicht sagt es mir. Hohlwangigkeit und ein starrer Blick wie ohne Wimpern. Sie brauchen mir nicht zu sagen, daß Sie Wimpern haben – ganz normal lange Wimpern sogar, wie ich eben sehe. Aber dessenungeachtet ist Ihr Blick wimpernlos, mein Herr, das heißt feucht, gequält, unbeweglich und ohne Freiheit. Ja, es können aber auch andere Leidenschaften sein, die einen hohlwangig und wimpernlos machen, meinen Sie – und daß man das mit den Weibern überschätzt. Ähnliches hört man jetzt oft: Nur eine gewisse Art von Mitmenschen nehme die Weiber so wichtig, die andern aber hätten ganz andere Interessen – Ehrgeiz, Geschäft, Politik. Oder man kommt mir gar mit Redensarten wie: ›Eine neue Zeit hat begonnen. Früher, ja früher war dies und jenes, jetzt aber …‹ Wissen Sie, nichts ist mir so lächerlich wie die Menschen, die immerfort dabei zu sein glauben, wenn der Weltgeist in Person den Vorhang zu einem neuen Akt der Geschichte aufzieht. Solche Leute schnuppern in der Luft herum, wenn sie auf der Gasse gehn, ganz schamlos vor Neugierde: Na, wie ist’s, hat soeben eine neue Ära angefangen? Halten wir beim Individuum oder beim Kollektivum? Wo sind die Maschinen, das neue Tempo, die Sachlichkeit? – Diese Herren Epochemacher, es gibt nichts Phrasenhafteres, sehn so wichtig drein, als müßten im nächsten Augenblick hier die Alleebäume an den Boulevards einen vollständig geänderten Anblick darbieten, blau etwa statt herbstlich rot. Unsinn, Unsinn! Natürlich ändert sich vieles, aber doch lange nicht so grob und öffentlich. Und die Hauptsachen bleiben dabei doch immer gleich und bleiben so kompliziert und zarträdrig, daß man über sie gar nicht hinwegkommt: das Herz und die Liebe und die Frau, nach der man sich sehnt. Das wollen die Herren Epochemacher gern vergessen lassen. Aber man könnte möglicherweise in all dem epochalen Lärm, der heute gemacht wird, nichts als den Versuch wittern, die ewige Sehnsucht zu übertönen. Was wünschen wir denn anderes, wir alle zusammen, als innerlich von Grund aus umgewandelt zu werden – Menschen, denen, sei es auch nur ein einzigesmal, ein vollkommenes und geradezu flekkenloses Glück zuteil geworden ist – und das heißt eben: ein neuer Mensch sein, oder wie die Bibel sagt: ›Gib mir, Herr, ein neues Herz und einen neuen gewissen Geist.‹ Denn aus dem einleuchtenden und unwiderlegbaren Grunde der persönlichen Erfahrung läßt man, wenn man solches erlebt hat, all die trübseligen Ideen wie z. B. die, der Mensch sei nur zur Qual oder zum vorübergehenden Genuß geboren, einfach für immer fallen, selbst wenn die Glücksstunde nie mehr wiederkehrt und wenn man nachher auf dem Trockenen schnappt. Nein, es geht wirklich nicht darum, irgend etwas Epochales zu erleben, sondern in aller Privatheit einen Tag vollkommenen Glücks, eine Zeit wie jene Frühsommertage, beginnend am Lift des Berliner Hotels, am Lift, der so langsam und doch unwiderstehlich in seinen Gitterschacht hinabfuhr, wie meine Qual, die gleichsam mit ihm in den Boden versank, unter freudigem Aufleuchten zweier Augen. Jung, anspringend, voll von kindlichem Vertrauen …
Hier begann Mayreders Erzählung.
Er hat mir dann auch später noch öfters erzählt, ich bringe seine Beichten vielleicht etwas untereinander, aber es ist ja auch nicht nötig, sie auseinanderzuhalten – als erste, zweite, dritte Eröffnung etwa u. s. f. – wozu die Pedanterie! Wenn nur das Bild dieses merkwürdigen Menschen bleibt, der an die Liebe so fest gleichzeitig geglaubt und nicht geglaubt hat. Er erzählte, so oft ich ihn in seiner Wohnung, hoch im vierten Stock eines alten Hauses der Insel St. Louis, aufsuchte – bis er dann plötzlich aus dieser Wohnung verschwand und überhaupt nicht mehr aufzufinden war. Ich kam zu Besuch wie gewöhnlich. Er war ganz einfach nicht da, niemand wußte, wann er zuletzt ausgegangen war. Noch eine Stufe tiefer in dieser grausamen Stadt, die die Menschen ruiniert? Vielleicht ganz untergegangen? Ich setzte alles daran, es herauszubringen und ihm zu Hilfe zu kommen, konnte aber nichts erfahren. Es ist aber wohl auch sehr schwer, einen Menschen oben zu erhalten, der sich durch einige Tage erlebten hohen Glückes für alle kommende Schmach im voraus entschädigt glaubt. Solch eine Idee muß ja auf alles Dunkle eine förmlich ansaugende Wirkung haben.
Auf seiner Insel fühlte er sich indes noch recht wohl und ich hatte an alles andere eher als an das Ende geglaubt. Seine Lage bezeichnete er (im Anschluß an einen Witz der Inflationszeit, die eine solche, auch innere Bedeutung für ihn gehabt hatte) als ›hoffnungslos, aber nicht ernst‹. Wiewohl er viel trank, behielt er den Kopf oben und dachte an seinen Haselnuß-Plan als an eine gute ehrenvolle Zukunft. Die hohen alten Laubbäume des Seine-Kais sahn auf die eifrigen Gespräche, die wir auf dem Balkon sitzend führten, auf meine Ermahnungen und Ratschläge, auf sein trotziges Hohnlachen, das dem vornehmen mageren Gesicht so gut stand. Diese Bäume hatten etwas unendlich Beruhigendes. Blickte man auf sie hinunter, so konnte man eigentlich überhaupt nicht an Katastrophen glauben. Das fügte sich nun wieder recht hübsch zu den närrischen Ideen, die zu jener Zeit auf der guten Insel umliefen. Ile St. Louis hatte sich eben, dem Vorbild der Republik Montmartre folgend, selbständig und unabhängig von Frankreich erklärt. Einige Künstler und Trinker arrangierten unter Zulauf vielen Volkes jeden Sonntag festliche Umzüge auf der Insel und unter Scherzen und mit rechtem Kinderernst wurde als Hauptstück dieser Feste jedesmal eine hölzerne Kanone mitgeführt, mit der man die Seine zu sperren und gegebenenfalls alle Schiffahrt in Paris verhindern zu können behauptete. Man gründete aber auch eine ›Zeitung der Insel St. Louis‹, dachte an Volksbildungskurse, ernannte einen Präsidenten der neuen Inselrepublik und zahlreiche Würdenträger, Mayreder mit seinem Haselnuß-Plan war als ›Minister für den Export‹ in Vorschlag gebracht. Er hatte allerdings als Ausländer die gewichtige Absicht abzulehnen und gab eine Reihe von Gründen dafür an. So spielten die amüsanten Einfälle der Inselrepublik doch eine gewisse Rolle in seinem Denken. Sie stimmten zu Freude und Leichtigkeit, ebenso wie die milde Pariser Herbstluft und etwas an dieser ganzen verhutzelten und doch so fortschrittlichen Bauart der alten Pariser Häuser mit ihren vielen Korridoren und niedrigen, doch von Sonnenstrahlen förmlich durchschossenen Zimmern zur Zuversicht einlud. Da gibt es ausgetretene Wendeltreppen und Rost, nach verfaulten Brettern und nach Mäusen riecht es – und doch schaut alles sehr stolz und großstädtisch drein, so etwa: ›Europa, Augen hierher, wir marschieren voran, und, was immer wir tun, wir sind an der Spitze!‹ – Es ist vielleicht das Besondere, daß man auch an alten halbverfallenen Häusern in Paris den Vorsprung merkt, den sie zu ihrer Zeit, da sie neu waren, vor der übrigen Welt voraus hatten, einen Vorsprung, der durch nichts mehr einzuholen ist. Mag dies nun bloße Einbildung oder ein Nachzittern ehemaliger Energien sein, die in diesen Bauten gehaust haben, – jedenfalls paßte Erwin Mayreder, gewesener Offizier des nicht mehr vorhandenen Österreich, aufs beste in diese alte Pracht – Erwin Mayreder in seiner jetzigen Gestalt, in der ich ihn kennen lernte, notdürftig zusammengehalten, ärmlich und dennoch von bezaubernder Grazie, und als er aus den beiden engen, doch nobel durchlichteten, ruhigen Zimmern verschwunden war, da wußte ich eigentlich von Anfang an, noch vor den Auskünften der Polizei und Privatinstitute, daß er in diesem Leben nirgendwo mehr eine passende Wohnung gefunden hatte.
Unter dem Donner der Kanonen
Tage des Glücks! Von seinem Glück sprach er so gern, immer ging er, wenn er erzählte, von den Glückstagen aus, den Stascha-Tagen, wie er sie nannte.
›Glückstage‹ sagte er und sang es förmlich, in jener seltsamen Mischung von Trockenheit und Rausch, die das Besondere an ihm war.
›Glückstage‹ – man kann ganz klar sagen, wodurch sie sich auszeichnen. Kein Schwindel, keine Phrase – diese Tage haben ihre besondere Farbe, die mit nichts anderem zu verwechseln ist.
Zwei Kennworte. ›Es ging alles so leicht‹. Und ›Tautologie‹. Davon wird noch die Rede sein.
Nicht gleich, aber bald nach den ersten Stascha-Tagen stellte sich mir die Erkenntnis ein: Alles ging so glatt, so leicht. Zuerst hatte ich (und das ist das Wesentliche) gar nichts davon bemerkt, daß alles glatt ging. So durchaus glatt war es eben gegangen, daß ich gar nichts Besonderes daran fand, keine Veränderung gegen früher, überhaupt nichts Auffallendes oder irgendeiner Aufmerksamkeit Wertes. Das ist der eigentliche Zustand des Glücks. Daß es etwas unendlich Schönes war, was ich erlebte, das wußte ich natürlich. Etwas Träumerisches war dabei – und doch so viel Beschäftigung – vor lauter Beschäftigung kam man gar nicht zum Träumen, und dieses Ständig-und-wechselnd-vom-Traum-Abgehaltensein, das ist ja das eigentlich Träumerische, gegen das die billige Melancholie der Poeten und Nichtstuer sehr schematisch und konventionell wirkt. Am deutlichsten fühlte ich dieses Träumerische, wenn ich viertelstundenweise nicht bei ihr war. Denn in ihrer Gegenwart fühlte ich nicht einmal, daß ich träumte – wußte nur noch von ihr. Wenn ich aber allein war – Beschäftigung, angeregtes Treiben war immer dabei, aber doch auch verhältnismäßig etwas Ruhe – dann überfiel mich das Neue, das Unwahrscheinliche meines Zustands völlig. Nach der Szene am Lift etwa oder als ich den Arzt zur Bahn expediert hatte und nun zu ihr zurückfuhr – ich war allein, mitten in dem massiv lärmenden, so eiskalt süß lärmenden Berlin. Ich wußte damals schon oder fühlte, daß sie mich liebte. Ich wußte, daß sie mich erwartete. Sie hatte es angedeutet und ich verstand, daß es ihr ernst damit war. Träumend saß ich im leise schlingernden Auto – dort in der Papageienbar (so dachte ich) sitzt sie wirklich und wartet – eine Wirklichkeit: auf eine Wage gestellt, würde sie ein gewisses Gewicht haben. Sie trägt Kleider von dieser und dieser Art. Ich hatte viel von dem, was sie schon gesprochen hatte, im Kopf. Aber die Hauptsache wußte ich nicht, über die wesentlichsten Umstände ihres Lebens hatte sie noch nichts gesagt. Ein Beweis, daß sie eine Wirklichkeit ist und nicht etwa meine bloße Erfindung. So bewies ich mir immer aufs neue ihr Dasein … und gerade das ist ja die Art, in der man träumt – immer sich vorsagend: »Nein, ich träume nicht.« Wie ich entzückt war! Wie ich – mehr als das, es ist gleichsam der höhere Grad des Staunens – das Neue als etwas ganz Selbstverständliches hinnahm. Und doch konnte man sich keinen größeren Gegensatz denken als den zwischen den Stascha-Tagen und meinem Leben vordem.
Vordem hatte ich in einem fürchterlichen und gleichzeitig alles Großartigen baren, nichts als häßlichen Trubel gelebt. Das Furchtbare kann ja zuweilen großartig sein. Mein Schicksal aber hatte nichts Großes an sich, es war nur häßlich gewesen und dennoch grauenvoll bis zur Absurdität. Schon rein äußerlich war es so: Mit vielen Menschen hatte ich zu tun, nachdem ich mir Tag für Tag die keineswegs leichte Büroarbeit von den Händen gewaschen hatte. Und diese Menschen waren lauter Halunken, Angeber, Spione, Bankrotteure, Dirnen. Seit ich eingesehn hatte, daß alle redliche Arbeit für ›Rockenhaus Tuch‹ (das ist die Fabrik meiner Familie) wertlos war – wertlos, wenn ich in jener bösen niederträchtigen Zeit der Inflation nicht etwas Neues organisierte, einen Detektivdienst gegen die unlautere Konkurrenz – seither war ich dieser Horde unzuverlässiger verräterischer Individuen ausgeliefert. Sie kamen und gingen, sie betrogen mich und die andern. An Disziplin war nicht zu denken. Aus der Gelbsucht kam ich nicht heraus. Gleich früh ins Bett flog mir meist ein Telegramm, nach dessen Lektüre ich am liebsten in die Kissen zerplatzt wäre. Man parierte mir nicht, meine Aufträge änderte man eigenmächtig ab. Es kam vor, daß ich beim Anhören der Berichte geradezu erbrach. Um dies zu vermeiden, schränkte ich meine Mahlzeiten ein, aß nur das Nötigste. Infolgedessen schwächte ich meinen Magen, meine Nerven. Stundenlang litt ich an Ohrensausen, halbseitigen Kopfschmerzen, an Nadelstichen im Rückgrat. Ich magerte so ab, daß mir die Jochbeine aus den Wangen traten und mein gelbes Gesicht dem kalmückischen Typ zu ähneln begann. So wie jetzt ungefähr. Nur den Vollbart trage ich erst seit kurzer Zeit. Damals ging ich noch glattrasiert. – Meine Arbeitsfähigkeit nahm übrigens durch all dies Übelbefinden nicht ab. Im Gegenteil: es schien mir, daß ich mit zunehmendem Körperverfall immer klarsichtiger wurde. Tatsache bleibt, daß meine Pläne kühner, umfassender, energischer ausholten, je kränker ich mich fühlte. Das paßte auch völlig in mein damaliges Weltbild: Seele und Körper im Boxkampf gegeneinander, man kann nur auf einen der beiden Gegner setzen, entweder auf körperliche Gesundheit oder auf die feinen Reaktionen, die sich erst dann einstellen, wenn gewissermaßen das Fett von den Nerven abgekratzt ist, daß sie bloßliegen wie die empfindlich zuckenden Muskeln eines galvanisierten Frosches. – Oh, wie ich mich quälte! Und diese Qual hielt ich auch noch für meinen und aller Menschen Normalzustand, für die richtigste, ja einzig anständige Art zu leben.
Unsre Gegner überwachten jeden Schritt, den wir taten. So kamen wir oft zu spät. Eine kleine Schraube versagte – und der ganze Aufwand vielmonatiger Anstrengungen war vertan. Dann hieß es wieder, in übermenschlicher Arbeit das Gehirn umstülpen, Nächte durchwachen, um den Vorsprung aufzuholen, neue Beziehungen anzubahnen – ›Rockenhaus Tuch‹ mußte ja leben, die Flut durfte über meiner bedrohten Familie nicht zusammenschlagen. Schließlich aber mußte man doch nur wieder einsehen, daß das Resultat nicht von unseren Bemühungen abhing, sondern von irgendeinem tückischen Zufall, über den ich keine Macht hatte. So hatte ich in mir eine Philosophie ausgebildet, die wohl die wahrhaftige Philosophie der Unerquicklichkeit war – ich glaubte an den Zufall, aber nur an den bösen, ich betete das Schicksal an, aber nur das zerstörende.
Dabei empfand ich diesen Kampf um den äußeren Erfolg als das minder Aufregende, verglichen mit dem, was ich meinen ›Liebesgram‹ nannte – ›Liebesgram‹ ist allerdings nicht das richtige Wort. Man denkt zu sehr an Verliebtheit dabei. Ich sollte besser von ›Liebesverantwortung‹ sprechen (nur klingt das zu kalt), von ›Verantwortung in der Liebe‹ oder ›Verantwortung für die Liebe‹. Das ist es, denn das ist der Gram, an dem ich am meisten gelitten habe. Zumal in jener ärgsten Zeit, knapp ehe Stascha wie eine Erscheinung aus dem Lift trat, der dann in seinen Gitterschacht sank. Liebesgram – o es ist vielleicht das Menschangemessenste von allem, es ist unser Teil. Aber gleichzeitig, wie fürchterlich ist es, mein Gott! Auf die Dauer kann es von niemandem ausgehalten werden und vielleicht ist dies, nicht die Gebrechlichkeit unseres Leibes, der eigentliche Grund, warum wir sterben müssen. Ohne Liebesgram wären wir unsterblich – steht es so nicht auch in den Anfangskapiteln der Bibel? Da wir aber Böses und Gutes unterscheiden und dennoch lieben wollen, begehren müssen, schwinden wir dahin. Es ist zu verzehrend, zu feuerartig für uns, selbst dann, wenn man die legendäre Kraft hätte, immer nur das Gute zu wählen, selbst dann würde man an ›Liebesgram‹ zugrundegehen. Es sei denn, daß uns eine ›Hilfe‹ zuteil wird. Es gibt zwei Arten von ›Hilfen‹ – eine wirkliche Hilfe vom Himmel herab, wie sie mir mit Stascha kam; und daneben menschliche ›Scheinhilfen‹. Mit solchen ›Scheinhilfen‹ frettet man sich sein Leben lang fort, um schließlich doch irgendwo an einem dunklen Kreuzweg zu verrecken. Die Hilfe des Himmels ist ganz anderer Art. Ich will nicht sagen, daß sie uns ganz und gar dem Tode (dem Tode in jeder Gestalt) entrückt – so weit bin ich noch nicht, für unmöglich würde ich es allerdings nicht halten – jedenfalls aber schiebt sie gewissermaßen eine Falte Unsterblichkeit ins brüchig zerfallende Herz. Wie eine Frau über ihr Kleid streicht und es ordnet, so fährt man dann einmal über seine Seele hin – und sieh da! sie fühlt sich an einer gewissen Stelle ganz anders an, viel glatter und straffer – das ist der Ewigkeitsfleck in der Seele. An dieser Stelle ist sie dem Tode nicht mehr zugänglich, denn an dieser Stelle hat der Himmel sie berührt und die Schmach von Gut und Böse hat er von ihr abgewaschen.
Heute weiß ich das. Damals aber, ehe ich Stascha kannte, wußte ich nichts davon, lebte in lauter ›Scheinhilfen‹. Eine solche Scheinhilfe war mein Beruf, war ›Rockenhaus Tuch‹ und die Rettung meiner Angehörigen, gleichsam eine einzige auf die Spitze getriebene Pflicht, der ich mich freiwillig unterzog, um tausend anderen Pflichten, um dem ›Liebesgram‹ zu entgehen. Alles hatte ich auf die eine Karte gesetzt. Wurde die gezogen, so waren alle die Schurkereien, die ich tat (Schurkereien muß ich sie wohl nennen), recht getan, wo nicht, mußte ich der Hölle überantwortet werden. So hatte ich mich entschieden, nach diesem Leitsatz lebte ich, in diesem Elend, bis zu den Stascha-Tagen. – Dann kam nach der Scheinhilfe die wirkliche, ohne Ankündigung, ohne Vorboten, unerwartet.
Mit dem Liebesgram aber hatte es ebenso begonnen: an einem bestimmten Tage, ohne Übergang, plötzlich. Es war im Felde, im Winter 1916 auf 17, ganz genau weiß ich das Datum: in der Silvesternacht und am Neujahrstag geschah es. An der Isonzofront, Abschnitt Tolmein. Plötzlich war das Grauen und die Erkenntnis da.
In den Krieg war ich nämlich ohne alle Erkenntnis gezogen, ohne mir irgendwelche andere Gedanken zu machen, als daß es so sein müsse. Als patriotischer Österreicher und patriotischer Christ, wie sie eben in der schönen Waldecke von Österreichisch-Schlesien unter dem Altvatergebirge gedeihen, dazu als Berufsoffizier, junger Leutnant und aus einer Offiziersfamilie, in der die Tradition Radetzkys noch lebte – daß mir jede Art von Pazifismus ganz fern lag, brauche ich kaum zu sagen.
Mit dem Offizierstum in unserer Familie hatte es übrigens doch eine besondere Bewandtnis. Zunächst das: der älteste Bruder hatte immer, so wurde es schon seit drei oder vier Generationen gehalten, das Stammgut zu bewirtschaften, das in jener Waldecke lag, den eigentlichen Reichtum der Familie, den gerade mein Vater durch Ankauf einer der größten Tuchfabriken der Gegend, der berühmten Tuchfabrik Rockenhaus, vermehrt und gesichert hatte. Als stillschweigende Vereinbarung galt, daß der jeweilige Senior auch für die militärische Laufbahn der jüngeren Brüder und deren Söhne gewisse, in ihrem Ausmaß nur dem Gefühl nach bestimmte Zuschüsse zu leisten hatte. Über die Höhe dieser Zuschüsse nun herrschte allerdings niemals irgend ein Streit, nicht einmal in leisesten Andeutungen, das wäre bei der Gesinnung der ganzen Familie gar nicht möglich gewesen; wohl aber lag doch in dieser ganzen Verteilung der Lasten und Berufe etwas Verhängnisvolles, indem die Mitgliedschaft der Familie in zwei Gruppen, in Erwerbende und in Genießende, zerfiel, in Schwerarbeiter gleichsam und solche, die einem freien und ruhmvollen Berufe hingegeben zum Teil auf Kosten der andern lebten. Verhängnisvoll: denn die Freien und Genießenden, wir Militärleute, wollten aus Stolz hinter den andern nicht zurückstehen und so strebten wir nach besonderen Bravourleistungen, sei es auch im Rahmen soldatischer Disziplin – und das eben ist es, weshalb ich sagte: mit unserem Offizierstum stand nicht alles so ganz richtig. Das Eingeklemmtsein zwischen dem Wunsch, sich hervorzutun, und dem strengen, aber im Grunde ruhigen Gang unserer Dienstverrichtungen hat in mehr als einem Unheil gestiftet. Das in der Familie sprichwörtlich gewordene, weil deutlichste Beispiel hiefür hatte mein Großonkel geboten, der in der Schlacht bei Magenta, im Feldzug gegen Sardinien und Napoleon III., einen falschen Befehl überbracht hatte; und zwar aus übertriebenem Diensteifer, dessen Folge der Verlust der Schlacht wie des ganzen Feldzugs war. Im Grunde war es zudem gar kein falscher Befehl gewesen, sondern der richtige, den nur ganz besondere Umstände nachträglich zum falschen gemacht hatten, was kein Mensch dem Oberleutnant Mayreder übelnehmen konnte und auch keiner übelnahm, keiner außer ihm selbst. Er verfiel nämlich in Schwermut und erschoß sich zehn Jahre später, in einem unbewachten Augenblick. Der Vorfall mit dem ›falschen Befehl von Magenta‹ (so pflegte man ihn in der Familie zu zitieren) war nun folgender gewesen: Damals stand das Korps Clam-Gallas am Tessin bei Buffalora und Feldzeugmeister Gyulai hatte nach dem unglücklichen Treffen bei Turbigo den Rückzugsbefehl gegeben. Mein Großoheim war Adjutant bei Gyulai und ritt mit dem Befehl durch Tod und Teufel, schlug sich durch die Franzosen durch, die den Tessin schon überschritten hatten, und erreichte richtig unter tausend Gefahren die Adresse. Und das war das Unglück. Denn keiner im Hauptquartier hatte es für möglich gehalten, daß der Befehl tatsächlich in die Hand des Korpskommandanten gelangt sein konnte, für den er bestimmt war. Die Zwischenstraßen waren längst in Feindeshand, jede Verbindung unterbrochen. Zwanzig Adjutanten, die mit dem Widerruf des Befehls dem allzu schnellen, allzu tollkühnen Boten nachgeschickt worden waren, kehrten um, kamen zurück. Gyulai hatte nämlich bald nachher Verstärkungen aus Mailand bekommen und wollte am andern Tag die Schlacht erneuern. Am andern Tag aber stellte es sich heraus, daß das Korps Gallas und mit ihm auch Liechtenstein, von meinem treuen Großoheim instruiert, längst abgezogen war. In der Verwirrung, die daraus entstand, ging unsere Armee in die Binsen.