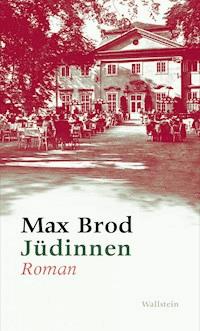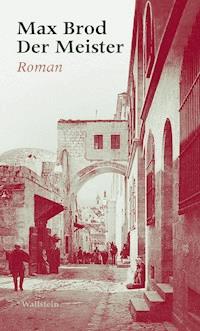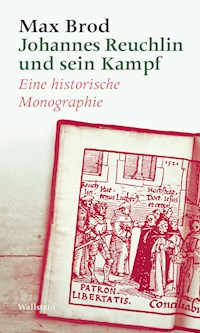
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Max Brod - Ausgewählte Werke
- Sprache: Deutsch
Max Brods Biographie eines streitbaren humanistischen Gelehrten. Max Brod, eigentlich mehr Erzähler als Historiker, widmete sich intensiv der Lebensgeschichte Johannes Reuchlins (1455-1522), dem mutigen Verteidiger des Talmud, und fügte diese zu einem intellektuellen Panoptikum zusammen. "Vom Wunder wirkenden Wort" – dieser Titel von Johannes Reuchlins erstem Buch über die Kabbala kann als Motto über seinem ganzen Leben stehen, und dies in seiner vielfältigen Bedeutung. Als Richter des schwäbischen Bundes glaubte er an das Recht schaffende Wort, als Diplomat im Dienste des Grafen Eberhard schmiedete er mit Worten Allianzen. Doch waren es die geheimnisvollen hebräischen Wörter, die Reuchlin faszinierten. Als Verfasser einer Grammatik und Deuter ihrer Wundermacht mit dem Wissen der Kabbala, aber auch als katholischer Christ und Begründer der christlichen Kabbala war er Verteidiger und Missionar der Juden zugleich. Max Brod beleuchtet in seiner Biographie Leben und Werk des bedeutenden Humanisten. 1965, unter dem Eindruck der Shoah im Exil in Palästina geschrieben, zeugt dieses Buch dennoch von einer Liebe zur deutschen Sprache, der Hochachtung vor einem den Juden beistehenden Deutschen. Deutlicher wird zudem der Stolz auf die neue hebräische und staatliche Gegenwart.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 676
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Max Brod
Ausgewählte Werke
Herausgegeben von Hans-Gerd Koch
und Hans Dieter Zimmermann
in Zusammenarbeit mit Barbora Šramková
und Norbert Miller
Max Brod
Johannes Reuchlinund sein Kampf
Eine historische Monographie
Mit einem Nachwort von Karl E. Grözinger
Der Verlag dankt der Stadt Pforzheim,
die die Drucklegung dieses Werks zum Gedächtnis an das
500. Todesjahr des Humanisten und Hebraisten
Johannes Reuchlin großzügig gefördert hat.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet
diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© The Literary Estate of Max Brod at the
National Library of Israel 2022
www.wallstein-verlag.de
Umschlaggestaltung: Susanne Gerhards, Düsseldorf, © SG-Image
unter Verwendung des Titelholzschnitts der ›Ketzerpredigt‹ von 1521
ISBN (Print) 978-3-8353-5129-5
ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-4813-4
ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-4812-7
DEM ANDENKEN
MEINER LIEBEN SCHWESTER
SOPHIE
Inhalt
ERSTES KAPITELUmwälzung der Seelen: ein Zeit-Hintergrund
1 Der Beginn der Renaissance, nicht deutlich. Das Ende (Umschlag in die Karikatur) ist leichter zu fassen. – Ein Beispiel: Das Auftreten ›Agamemnons‹ in der Erzählung ›Euryalus und Lucretia‹ von Enea Silvio Piccolomini.
2 Verweltlichung im Zeichen der römisch-griechischen Kultur. Warum gerade damals? – Renaissancemenschen. ›Anziehendes Verbrechen‹. Protest; die zehn Gebote. – Die Thesen Heers: ›offene‹, relativ freie Periode des mittelalterlichen Europas, gefolgt (seit dem 13. Jahrhundert) von der ›geschlossenen‹, strengen Periode. – Die Grenzscheide: Ausrottung der Albigenser. – Richtiger: der 1. Kreuzzug. – Kastein übersetzt den Bericht eines jüdischen Zeitgenossen aus dem Jahr 1096. – Huizinga über den ›Herbst des Mittelalters‹. – Unerträglichkeit des kirchlichen Drucks. – Reliquienverehrung. – Dante über Aristoteles. – Höllenmilieu. – ›Die Gerechten aller Völker haben Anteil an der ewigen Seligkeit‹ (›an der kommenden Welt‹), ein Satz des Talmud.
3 Das Maß der Unduldsamkeit war voll. – Äußere Momente tragen zur seelischen Umwandlung bei. – Exzesse der neuen Freiheit. – Hutten an Pirckheimer. – Eine Mitte wird gesucht. – Der Jubelruf des Rabelais. – Dürers ›Meerwunder‹.
4 Syphilis. – Die Blague bei Rabelais.
5 Erasmus sieht die Katastrophe der Religionskriege voraus. – Seine allzu ängstliche Vorsicht. – Laurentius Valla. – Heidnische und christliche Motive, gemischt. – Die Dunkelmännerbriefe, ohne viel Witz wirksam.
6 Die Antike als Rettung. – Neuplatonismus. – Der echte Platon. Florenz. – Dirumpamus vincula eorum (Hutten).
ZWEITES KAPITELDer junge Reuchlin
1 Die freien Reichsstädte. – Pforzheim. – Pflügers Chronik der Stadt. – Die Bibliothek Reuchlins. – Ruinen seines Wohnhauses.
2 Seine Liebe zur Heimatstadt. – Lage der Stadt. – Sagen. – Hinweis auf Mörike und auf Reuchlins träumerische Veranlagung, verbunden mit scharfer Erfassung des Wirklichen und mit Sachlichkeit.
3 Sprachstudien. Brief des Contoblacas an den Zweiundzwanzigjährigen. – Rückblick: Die Lateinschule in Pforzheim; 1473 Pariser Universität. – Kampf zwischen Realisten und Nominalisten. – Via antiqua, via moderna. – Reuchlins ›Philosophie in Symbolen‹. – Sein Lehrgang. Freundschaft mit Sebastian Brant. – Das erste Buch, der vocabularius breviloquus, in Basel, anonym. – Es ist heute noch nichts von Reuchlin in hochdeutscher Übersetzung erschienen. Ein Skandal! Dagegen Erasmus … – Orléans, Poitiers. – Der ungeliebte Beruf: Jus.
4 Tübingen. – Stuttgart. – Erste italienische Reise 1482, Florenz, Rom. – Die Medici. – Die 2. italienische Reise 1490 von größerer Bedeutung für Reuchlin. – Doktorat. – Reuchlins Familienleben, nach Decker-Hauff. – Im Dienste des Grafen Eberhard, in Italien und in Linz.
5 Der Dominikanerprior Jakob Louber in Basel. Der Kodex aus Ragusa. – Der Ordensprovinzial Sprenger. Der ›Hexenhammer‹. Reuchlin zwischen Mittelalter und Humanismus. Der Hexenwahn. Unangebrachte Höflichkeit Reuchlins. Die jüdische ›sitra achra‹.
DRITTES KAPITELDas jüdische Problem meldet sich. (Pico, Loans, Sforno) 1490–1494, 1498
1 Schicksalvolles Zusammentreffen Reuchlins mit Pico da Mirandola. – Die Orphiker und Neuplatoniker. Gegenwirkung Savonarolas. – Ein höfischer Brief Picos im ›Stil der Zeit‹.
2 Picos Porträt und Abstammung. – Ein Lieblingskind des Schicksals. – Sprachstudien, auch hebräische. Geplanter Philosophenkongreß in Rom. Päpstlicher Bann. Kabbala (laut Pico) als Beweis für die Wahrheit des Christentums, von Reuchlin übernommen. Unrichtigkeit dieses Gedankens. Zobels Buch über den Messias. Sowohl spirituale wie politische Erlösung gefordert, beides gehört zur richtigen Konzeption des Judentums.
3 Einfluß des Cusanus auf Pico und Reuchlin. ›Genauigkeit gibt es nur in Gott‹. – Pico über die Kabbala. – Pico und Reuchlin beanstanden Fehler in den üblichen Bibelübersetzungen. Absolute Wahrheit gegen ›Engagement‹. – Andere Einflüsse Picos auf Reuchlin. – Mühlberger über Pico.
4 Reuchlin nach der 2. italienischen Reise. Juristerei. – Bei Kaiser Friedrich III. in Linz. – Reuchlin auf der Suche nach hebräischen (kabbalistischen) Büchern. Rabbi Margolith von Regensburg und sein Nachkomme. – Zwei Arten von Apostaten sind zu unterscheiden. – Jossel von Rosheim (S. Stern). – Sein Verwandter Jakob Loans, der Hebräisch-Lehrer Reuchlins. – ›Ad fontes‹. – Erasmus gegen das Hebräische. – Reuchlin orthodoxer Katholik, aber mit starkem Interesse für die Ursprache der Bibel. Dabei durchaus kein Judenfreund. Loans, die große Ausnahme. – Reuchlin schafft die Gestalt des schöpferischen ›guten‹ Juden, lange vor den zerstörerischen Gegentypen Marlowes und Shakespeares. – Das Dreigespräch in ›de arte cabalistica‹. – Reuchlin in Linz. Geadelt. Sein Wappen. – Der zweite Lehrer: Owadja Sforno aus Cesena. – Der Rationalismus der ersten modernen jüdischen Historiker. Er muß korrigiert werden. Die Arbeit Gershom Scholems. – Sforno spricht.
VIERTES KAPITELDas vorbereitende Werk ›Über das wundertätige Wort‹. 1494
1 Der Brief des Leontorius an Wimpheling. – Johann von Dalburg und der Musenhof des Wormser Bischofs in Heidelberg. – Vorrede des Buches an den Bischof J. von Dalburg. – Die Absicht: Sieg des Christentums.
2 Inhalt des Werkes. – Skepsis des Sidonius. – Baruchias über das gottgesandte Wissen. Kabbala. – Sidonius verteidigt den Epikur und Lukrez. – Baruchias gegen Lukrez. – Capnion über das Gebet, gegen Lukrez. – Sidonius: Die Verwerfung des jüdischen Volkes, die Erwählung der Christen. Kirche und Synagoge. – Reuchlins heftigste Attacke gegen das Judentum. – Pfefferkorns Irrtum verständlich. – 12 Zeilen von Heine.
3 Reuchlins ablehnende Haltung gegen Baruchias. – Sidonius gegen die ›Thalmudim‹, von keinerlei Sachkenntnis (Reuchlins) getrübt. – Ein Streit, in dem beide Parteien das Streitobjekt nicht kennen. – Verwerfung der Magie. – Analogien und Unterschiede der beiden Dreigespräche.
4 Über Wunder. Naturphilosophie. Lob der hebräischen Sprache. – Heilige Namen. – Reuchlin über Unvollkommenheit der Übersetzung (Brief an den Abt von Ottobeuren). – Die Namen Gottes. – Einheit von Namen und Genanntem (Kratylos, Cusanus). – Volksglauben der Eskimos. – Seltsames über Erbsünde. – Capnion über die Gottesnamen. – Die Sfirót. – Das Tetragrammaton. – Der entfaltete Namen.
5 Reuchlins Orthodoxie. Er war kein Vorläufer Luthers. In wissenschaftlichen Fragen frei denkend, in religiösen überaus dogmatisch. – Linguistische Fehlgriffe. – Das wundertätige Wort wird aufgezeigt. Einschiebung eines 5. Buchstabens. – Hinweis auf Mörike, den mythenbildenden Dichter. Ekstatischer Abschluß des Buches. – Ein Druckfehler in der 4. Ausgabe des Buches.
FÜNFTES KAPITELHumoristisches Zwischenspiel: Die beiden Komödien
1 Flucht Reuchlins nach Heidelberg 1496. – Diskussionen und Symposien. – Celtes, Dracontius, Wernher, Vigilius.
2 Vorläufer. – ›Sergius oder Das Haupt des Hauptes‹. – Sprachlicher Manierismus. – Kritik des chaotischen Stückes. – Satire gegen die Poetenfeinde. – Gegen den Reliquienmißbrauch. – Aufstieg des Stückes im 3. Akt. – Zerfahrener Schluß.
3 Die zweite Komödie (Progymnasmata, – ›Henno‹) wesentlich bedeutender. – Das Vorbild: Maître Pathelin. – Bee und Blee, der originelle Grundeinfall. – Hinweis auf Goldoni und Nachwirkung bei Shakespeare (Petrucius?). – Dichterbegabung Reuchlins. Neuaufführungen des Henno 1955, 1964.
4 Elsula tritt auf. Dann Henno. Das Stück rollt ab. Ein dramaturgischer Vorschlag, Abra betreffend. – Die höchst gelungene Szene beim Astrologen. – Gericht und happy end. – Erfolg. Nachahmungen. Wiederentdeckung durch niemand andern als Gottsched. Etwas über die Fragwürdigkeit mancher Polemik.
SECHSTES KAPITELRechtslage und Zustand des jüdischen Volkes in Deutschland zur Zeit Reuchlins. – Missive und Rudimenta
1 Reuchlin auf der Höhe seines Ruhmes. Richter des schwäbischen Bundes 1502–1512. – Privatpraxis als Anwalt. – ›Literatorum monarcha‹.
2 Reuchlins Sorge um den befürchteten Untergang der hebräischen Sprache. – Habimah. – Anathi. – 2000 Jahre der Knechtschaft. – ›Aber fragt mich nur nicht: wie?‹ – Umrisse der jüdischen Existenz im Exil. – Die Römerzeit. – E. L. Ehrlich über Beschränkung der jüdischen Rechtsgleichheit (Konzil von Nicäa). – Die Schriften von Guido Kisch über den ganzen Komplex dieser Fragen. – Der besondere Rechtsschutz für die Juden und das Waffenverbot. – Sachsenspiegel. – Katastrophale Folgen. – Eine Glosse zum Sachsenspiegel 1325.
3 Das allmähliche Hinabgleiten der Juden auf der sozialen Skala (seit dem 1. Kreuzzug). – Die beiden Gründe hiefür: Haß seitens der Kirche, systematische Ausschließung aus den anständigen Berufen, Landwirtschaft und Handwerk. – Die Tragödie der Diaspora: Substanzverlust bis zum Selbsthaß. – Widerstand, autonome Wertskala. – Die Kammerknechtschaft der Juden, ursprünglich eine theologische (Augustinus u.a.), später eine politische Konzeption. – Gerade Kaiser Friedrich II., der geniale Hohenstaufe, der Verehrer der Kabbala, von Stefan George besungen, führt in Sachen der jüdischen ›Knechtschaft‹ den entscheidenden Schwertstreich 1236, 1237. – Entwicklung bis zu Kaiser Maximilian (Ranke). – Das odiose Privileg des Wuchers. – Generalprivilegium Friedrichs II. von Preußen.
4 Jossel von Rosheim versucht eine Sozialreform im jüdischen Sektor (Selma Stern). – Luthers fanatischer Antisemitismus. – Ablehnung seines monströsen Nazi-Programms durch heutige protestantische Autoritäten. (Analoge Bemühungen der Päpste Johannes XXIII. und Pauls VI., im Abschnitt 3.) – Reuchlin kein Judenfreund, doch ein redlich nach Gerechtigkeit strebender Mann, das Seltenste auf Erden.
5 Das deutsche Missive 1505. Ein flüchtiges Gelegenheitswerk. – Unterschied vom späteren, viel reiferen ›Augenspiegel‹. – Reuchlins mildes, vornehmes Wesen. – Die ›Rudimenta‹ hebräische Grammatik und Wörterbuch. – Reuchlins seltsame Stellung zur deutschen Sprache, später durch seinen kraftvollen Gebrauch des Deutschen korrigiert. – Pionierleistung eines worst-sellers. – Benützung hebräischer Quellen. – Stellt Raschi weit über Lyra. – Dennoch zwiespältiges Festhalten an Vorurteilen gegen die Juden.
SIEBENTES KAPITELDer Streit mit den Kölnern beginnt
1 Der ›taufft Jud‹ Pfefferkorn. – Biographie eines widerlichen Menschen. – Zwei Arten von Konvertiten. Pfefferkorn gehört zu der aggressiven Sorte. – Sein Äußeres. Seine Streitschriften gegen das Judentum. – Ortwin Gratius.
2 Große Vergangenheit der Dominikaner. – Die Inquisition als Ursache des damaligen Verfalls? – Heutige Blüte dieses Ordens. – Hochstraten. Daten seines Lebens.
3 Kaiser Maximilians Mandat von Mantua 1509. – Charakteristik des Kaisers. – Sein Glanz, sein Schwanken. – Pfefferkorn besucht Reuchlin. – Pfefferkorn konfisziert in Frankfurt und anderwärts. – Mandat von Rovereto. – Rückstellung der beschlagnahmten Bücher (Mandat 1510). – Das vierte Mandat wählt einen langen Weg. – Indifferenz der Juden gegenüber dem ganzen weiteren Streit. Zwei Ausnahmen. – Reuchlins ›Ratschlag‹ gegen das Pfefferkornsche Anliegen. – Die Gutachten der Universitäten. – Mutian und sein Kreis.
4 Der Kaiser macht einen ›Schieber‹. – Pfefferkorn veröffentlicht unlegal den geheimen ›Ratschlag‹ Reuchlins. – Stilistisches Talent Pfefferkorns, ›Handspiegel‹.
ACHTES KAPITELDer Augenspiegel
1 Reuchlins Antwort auf den ›Handspiegel‹ 1511. – Einteilung des ›Augenspiegels‹.
2 Reuchlins Pathos. – Sieben Gruppen der hebräischen Literatur. – Der Talmud. – Reuchlin gibt seine mangelhafte Kenntnis des Talmud zu. – Einige Irrtümer Reuchlins. – Fehlerhafte Verteidigung einer Gebetstelle. Ismar Elbogens Standardwerk über den ›Jüdischen Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwicklung‹. – Der getretene Wurm krümmt sich. – Pfefferkorns dumme Verleumdung der Redensart ›Seid wilkum‹. Reuchlins Abwehr. – ›Die Heimlichkeit mancher Kunst‹. – Die weiteren 4 Gruppen der hebräischen Literatur werden verteidigt. – Reuchlins Toleranz. – Seine Sophismen. – Scholastische Disputation, 52 Argumente. – 34 Unwahrheiten Pfefferkorns. – Die Juden sitzen mit den Christen ›in einem Bürgerrecht und Burgfrieden‹. – Nächstenliebe, auch den Juden geschuldet. – Verwahrt sich empört gegen die Verleumdung Pfefferkorns, der ihm Bestochensein vorwirft.
NEUNTES KAPITELWeiterer Kampf. Bis zum päpstlichen Endurteil 1520
1 Pfefferkorn predigt in Frankfurt gegen Reuchlin. – Der Frankfurter Stadtpfarrer Peter Meyer berichtet an die theologische Fakultät in Köln. – Arnold von Tungern. – Warnungsbrief Udalrics. – Reuchlin fühlt sich krank und schwach. – Submisser Brief an Tungern. – Weltmacht der dominikanischen Inquisition.
2 Reuchlin an Konrad Collin und an die Fakultät. – Parallel-Korrespondenz. – Barocke Konvention des Briefstils.
3 Unverhüllte Ansprüche der Kölner: Widerruf des Augenspiegels verlangt. – Reuchlins feste Haltung. – Abbruch der Korrespondenz. – Pfefferkorns ›Brandspiegel‹.
4 Der Kaiser gegen den Augenspiegel. – Reuchlins ›Defensio‹ 1513. – (Geigers ›Masochismus der Objektivität‹). – Audienz bei Kaiser Maximilian. – Die Kölner mobilisieren vier Universitäten. – Dann auch die Universität Paris. – Paris gegen Reuchlin. – Die deutschen Humanisten und einige deutsche Fürsten nehmen Reuchlins Partei. – Erasmus, Mutian, Pirckheimer. – Gefahr für Reuchlin: die hohen Kosten des Prozesses. – Ketzermeister Hochstraten lädt ihn vor sein Gericht in Mainz. – ›Dies irae‹ in Mainz. Niederlage Hochstratens. – Appellation an den Papst. – Das Urteil von Speyer 1514, Sieg Reuchlins (sein einziger Sieg in dem langdauernden Verfahren). – Die Kölner appellieren an Papst Leo X. – Das Gericht wird in Rom konstituiert. – Empfehlungen und Helfer. Unter ihnen groteskerweise auch Maximilian. Trotz des päpstlichen Schweigeverbots: umfangreiche Literatur auf beiden Seiten. – Die Dunkelmännerbriefe. – Rom vertagt die Entscheidung 1516. – Die Mitarbeiter der Dunkelmännerbriefe. – Analysen von David Friedrich Strauß und Walter Brecht. – Crotus Rubeanus und der Erfurter Kreis. – Einige Proben aus den Briefen. Der Magister Conradus aus Zwickau u. a. – Keine Äußerung Reuchlins über die Briefe. – Erasmus fällt um. – Nachahmungen. – Päpstliches Breve gegen die Briefe 1517. – Triumphus Capnionis (Hutten). – Pfefferkorns ›Beschyrmung‹. – Reuchlins Arbeiten: 1517 Kabbala, 1518 De accentibus. – Illustrium virorum epistolae. – Die beiden Apologien Hochstratens 1518, 1519. – Der Graf von Nuenar. – Erasmus an Hochstraten. – Pfefferkorns letzte Schmähschrift. – Hochstraten ovans. – Das Eingreifen Sickingens, er droht den Dominikanern mit der Fehde 1519. – Urteil des Papstes gegen Reuchlin 1520. – Das Ereignis wird von den Wirren um Luther in den Hintergrund gedrängt. – Ein ironischer Schnörkel der Weltgeschichte: Leo X. regt die Drucklegung des ganzen babylonischen Talmud durch die Bombergsche Offizin in Venedig an. – Der wesentliche Unterschied der humanistischen und der reformatorischen Bestrebungen wird in Rom zu Reuchlins Schaden übersehen.
ZEHNTES KAPITELDas vollendete Werk ›De arte cabalistica‹
1 Gerade in der Zeit der wütendsten Angriffe gegen Reuchlin gelang ihm sein Meisterwerk. – Der einleitende Teil des Buches. – Veränderte Auffassung der Kabbala. Das Verdienst Gershom Scholems. – Merkaba-Mystik und jüdische Gnosis. – Kosmogonie und die Frage nach dem verborgenen Leben des Transzendenten. – Beziehungen zwischen Glauben und Naturwissenschaft. – Reuchlins ›symbolische Philosophie‹. – Die Planetengötter (Archonten) und Kafkas Legende ›Vor dem Gesetz‹. – Reuchlins Darstellung ist eine Mischung der früheren Merkawá-Mystik und der späteren theosophischen Lehre von den Sfirót. – Eine seiner Hauptquellen (Gikatilla) hat an diesen beiden Stufen Anteil. – Reuchlins (Simons) Lehre von den Kreaturen, vom ›Baum der zehn Zählungen‹; Naturphilosophisches.
2 Simon definiert die Kabbala. – Anlehnung an Pico. – ›Portae lucis‹. – ›Das Zerbrechen der Gefäße‹. – Simon über die Quellen seines Wissens. – Vier-Welten-Theorie. – Die höchste Stufe: Gott oder die Dunkelheit (das Nichts). – Philos überragende Bedeutung. – Die Lehre vom Demiurgen in der nicht-jüdischen Gnosis. Ein ›metaphysischer Antisemitismus‹ (Scholem). – Maßvolle Haltung Reuchlins. – Ejn-Soph (Unendlichkeit).
3 Reuchlins unrichtige Darstellung des angeblichen Gegensatzes zwischen Talmud und Kabbala. – Deutung des Buchstabens B, des ersten Buchstabens der Heiligen Schrift. – Symbolsprache. – Die doppelte Hölle. – Lobpreisung des glücklichen Kabbalisten. – Eine Geschichte von Rabbi Meir. – Warnung vor Magie.
4 Die beiden Partner ohne Simon. – Pythagoras. – Seine Zahlenlehre. – Pythagoras und die Seele des Euphorbus. – Seelenwanderung. – Verteidigung des Rätselstils. Platons ›Kratylos‹. – Bedeutsame Darstellung der pythagoräischen Lehre. – Das Gemeinsame der Weltreligionen. – Punkt, Linie, Fläche, Raum. – Gleichnissprüche. – Hinweis auf Lukian, auf Porphyrius.
5 Der Schankwirt schaltet sich ein. – Die Kölner Verleumder. – Wiederaufnahme von Simons Lehrvortrag: Die 50 Pforten der Erkenntnis. – Die Zahl 72. – Der richtige Kern der paradoxen und bizarren Zahlenmystik. – Das Buch Jezira. – Scholems Exegese der Sfirót-Theorie. – Reuchlin über Engel und Namen der Engel. – Dichterischer Vergleich mit der Musik (Reuchlin). – Jeder Mensch sieht die Engel in anderer Gestalt. – Die Sfirót, dem Buch ›Portae lucis‹ gemäß. – Gikatilla, zuerst unter dem Einfluß Abulafias, dann des Sohar (Mosche de Leon). – Simons Ekstase.
6 Die rationale und die irrationale Methode. Berührungspunkte. – Leben und Lehre Abulafias (nach Scholem und Jellinek). – Die Techniken der Schriftauslegung. – »Nur ein friedfertiger Mann, der sanft mit der Kreatur zu reden versteht«, kann den richtigen Weg finden. – Die Potenzen der Gegenseite, des Bösen. – »Durch gutes Leben einen guten Tod gewinnen.« – Weiteres über Abulafia. – Tagebuch eines seiner Schüler, von Scholem veröffentlicht. – Abschied der beiden Partner von Simon. – Widmung an den Papst.
ELFTES KAPITELDie letzten Lebensjahre. Nachruhm, Porträts und Grabstein
1 ›Der arme Konrad‹. – 1519 dreimalige Eroberung Stuttgarts. – Reuchlins redliche Bemühungen, Frieden zu stiften. Brief an Pirckheimer.
2 Er flieht nach Ingolstadt. – Akademische Tätigkeit. – Beziehung zu Luther, Melanchthon, Eck. – Reuchlin als Mitglied der Salve-Regina-Bruderschaft, als Priester (Decker-Hauff).
3 Lehramt in Tübingen 1521. – Letzte Veröffentlichung. – Briefe aus Bad Liebenzell. – Anadyomene. – Tod im Juni 1522. – ›Apotheose Reuchlins‹ von Erasmus.
4 Nachruhm. Nicht lebendig geblieben. Nicht viel mehr als ein großer Name. Trotz Hinweisen von Seite der Humanisten, von Goethe, Wieland, dem Sohn Schubarts. – Biographien: Das klassische Werk L. Geigers. Es erschien vor fast 100 Jahren. Seither ist viel neues Material und richtigere Auffassung des Judentums, der Diaspora, speziell auch der von Reuchlin geliebten Kabbala, veröffentlicht worden. – Das Humoristikum der beiden gefälschten Porträts (das ›alte Weib‹ und der ›humanistische Einheitstyp‹). Das einzige echte Porträt.
5 Das Grab. – Irrtümer, Fehlschlüsse. – Das Grabmal in der Leonhardskirche zu Stuttgart.
NACHWORT
BIBLIOGRAPHIE
Nachwort von Karl E. Grözinger
REGISTER
Editorische Notiz
Über den Autor
ERSTES KAPITELUmwälzung der Seelen:ein Zeit-Hintergrund
1
Wenn eine weltanschauliche oder künstlerische Bewegung ihren Höhepunkt erreicht, ja schon in ihre Karikatur umzuschlagen und absurd zu werden beginnt, dann ist sie am leichtesten zu konstatieren. Dann ist sie unfehlbar kenntlich. Freilich ohne großen Nutzen, denn die Bewegung ist ja schon in Entstellung oder im Abklingen begriffen, hat ihre ursprüngliche Kraft und Naivität verloren.
Der Beginn einer Bewegung dagegen liegt wesentlich im Dunkeln. Vor der eigentlichen italienischen Renaissance gibt es eine Früh-Renaissance, vor dieser eine Vor-Früh-Renaissance – und so weiter zurück bis zum karolingischen Renaissanceversuch einer universalen europäischen Bildung und noch weiter zurück bis zum unmittelbaren Anschluß an den letzten Wortführer der römischen Literatur, an Namatianus, der um 400 klagend die Ruinen des vom Westgoten Alarich verwüsteten Rom und des ganzen Römerreiches in schönen lateinischen Versen besingt. Die Neigung der Humanisten, in römischer Sprache oder doch im Bannkreis der Antike zu schreiben, zu gestalten, beginnt also, genaugenommen, fast ohne Lücke bereits am Ende des originär lateinischen Schrifttums und der Heidenwelt. Nur mit großer Ungewißheit, nur gradweise lassen sich Stufen unterscheiden: Zur Zeit Karls des Großen der Abt von Fulda, Hrabanus Maurus (dessen »Veni creator spiritus« bei Gustav Mahler neu auftönt), – späterhin Abälard – Dante, Petrarca, Boccaccio – Ariost, Tasso – und so bis zu Michelangelo. Ein machtvoller Strom reißt uns fort, es gibt keine oder nur wenig-merkliche Übergänge.
Die Karikatur hingegen – sie macht sich leicht bemerkbar; sie grinst uns an. Man kann sie nicht übersehen. Heute zwar verwischt sich auch dieses Leicht-Bemerkbare, da sich so viel Karikatur in die Künste drängt, da allenthalben ein wenig talentvolles ›Theater des Absurden‹ begönnert wird, da die Ausnahme den Seltenheitswert verliert, indem alles Ausnahme sein will. Auch da kann es Schönheit geben; der Geist weht, wo er will; man muß sich dann allerdings schon an die Ausnahmen von den Ausnahmen halten. Das Geniale ist glücklicherweise zu allen Zeiten und in allen Völkern da und dort vorhanden.
Ein Beispiel für jene Karikatur, die leicht auffällt, ist mir begegnet, als ich mich einst in die Briefe des Enea Silvio Piccolomini vertiefte, die Max Mell klingend übersetzt hat. In einem der Briefe (an Mariano Sozzini, 1444) ist die lieblich-sehnsüchtige Erzählung von ›Euryalus und Lucretia‹ enthalten, ein Meisterstück des sinnlichen Rausches und der allvernichtenden Melancholie, den besten Novellen des Boccaccio vergleichbar. Enea Piccolomini schrieb sie als junger Mann, indem er, um seinem Freund und Gönner, dem Reichskanzler Kaspar Schlick, zu schmeicheln, eine der köstlichsten Eroberungen des großen Lebemannes im Bilde festhielt, – er hat wohl dem Gegenstande viel von seiner eigenen Blutwärme und Verliebtheit mitgegeben. Später wurde dann aus Piccolomini Papst Pius II., einer von denen, die das Größte angestrebt und dabei viel Gutes bewirkt haben. Er kämpfte gegen den Sklavenhandel, gegen die Judenverfolgungen, war ein Freund des größten Philosophen vieler Jahrhunderte, des Nikolaus von Cues (Cusanus). Um das Vieldeutige auch hier nicht aus dem Blick zu verlieren: In Max Mells Einleitung zu den Briefen erscheint Piccolomini als ziemlich charakterloses Individuum, bloßer Stellenjäger, Karrierist, dessen angebliches ›Ethos‹ nur in seiner schönen Formgestaltung liegen soll, – doch solch ein Mensch hat nie existiert, denn solch ein Ethos gibt es nicht.
In der melodiereichen Jugendnovelle nun bleibt Siena Siena, Kaiser Sigismund als Mittelachse verändert sich gleichermaßen nicht, alles andere aber tritt im antiken Kostüm auf, durchsichtig pseudonym, aus Schlick wird Euryalus, aus der schönen Sienesin eine Lucretia, der betrogene reiche Ehemann bekommt sachgemäß den Namen Menelaos. Bis hierher ist alles (nebst den vielen Zitaten und Anspielungen auf Martial, Vergil und andere Klassiker der Antike) im Rahmen der von den Humanisten geliebten Methode gehalten. Nun aber wird, schon gegen Schluß der Erzählung, ein Bruder des betrogenen Gatten eingeführt, ein Bruder, der »fürchterlich argwöhnisch ist und Lucretia bewacht, als ob er für sie verantwortlich wäre«. Dieser Bruder des Menelaos hat zunächst, als ganz unbedeutende Nebenperson, gar keinen Namen – plötzlich aber heißt er … nun, wie heißt er? Nicht anders als Agamemnon, obwohl er gar nichts Königliches, nichts Zentrales und überhaupt nichts vom ›Hirten der Völker‹ an sich hat. Er ist nur eben der Bruder. Und als Bruder des Menelaos muß er, wenn er überhaupt heißt, Agamemnon heißen. Als ich zu dieser Stelle kam, mußte ich unwillkürlich auflachen. Und mir war, als hätte ich im Augenblick mehr über den Humanismus und die Renaissance erfahren, als wenn ich lange gelehrte Abhandlungen über diese so oft behandelten Ideenrichtungen gelesen hätte. Denn die Karikatur sagt eben oft mehr aus als der beste Spiegel. – Die leise Komik, die sich so mißlich in die humanistische Erneuerung, in eine der edelsten Bewegungen eingemischt hat, deren die Menschheit je fähig gewesen ist, – diese Offenbach-Komik macht in dem zufälligen ›Agamemnon‹ ihren ironischen Knicks. Wir werden auf diesen Seiten solchen Knicksen noch mehr, als uns lieb ist, begegnen.
2
Was uns hier als Karikatur erscheint, ist nicht bloße Formvollendung, Anpassung an die ›Kunst des Tullius‹ (so nannte man die bewunderte glatte rhetorische ciceronianische Latinität), später an die blutvolleren griechischen Originale – es ist mehr: es ist Verweltlichung im Zeichen der römisch-griechischen Kultur. Warum wurde diese gerade damals erneuert, in einem Schwung sondergleichen, in einer Entdeckerfreude, die ganzen Generationen zuerst in Italien, später in Frankreich, Deutschland, England den Lebensnerv gab? Die einfachste, allerdings nicht die exakteste Antwort auf diese Frage liegt wohl darin: daß man die strenge Zucht einfach nicht länger ertrug, daß das Maß voll, die Uhr abgelaufen war. Die Zucht, in der während des ganzen Mittelalters die Kirche und die christliche Gemeinschaft, auf der Disziplin des altrömischen Imperiums aufgebaut, – eine spirituelle Variante des antiken Kolonialismus –, den Erdkreis der westlichen Welt unterworfen und in vielleicht heilsamer, wenn auch allzu luftloser Ordnung gehalten hatte: diese Zucht war einfach nicht mehr auszuhalten. Man lehnte sich auf.
Man wollte frei sein. Freiheit der körperlichen Triebe, zuerst idyllisch oder ästhetisch oder vornehm-stoisch, dann immer ungehemmter bis zu rasender Wildheit, unbeherrscht bis zu dem, was man mit dem scheußlichen Etikett des ›Renaissancemenschen‹ versieht und was zu so schreckenerregenden Monstren wie Cesare Borgia und seinem Vater-Papst geführt hat. Einem Geschichtsforscher (Willy Andreas), dem ich sonst für viel Belehrung, lichte Darstellung, reiches Datenmaterial u. ä. verbunden bin, entfährt (offenbar unwillkürlich) die Bemerkung: »An die italienischen Tyrannenfiguren des Quattrocento und Cinquecento erinnert keiner dieser deutschen Fürsten. Nirgends die unheimliche Mischung von Verbrechen und Raffinement, die jene so anziehend macht.« – Es steht wirklich »anziehend« da! Verbrechen – und gleich darauf: anziehend. Von einer derartigen Geschichtsbetrachtung mich völlig geschieden zu halten, sehe ich als eine meiner Hauptaufgaben an. Auf mich wirkt ein Verbrechen nie anziehend, immer abstoßend. Ich bekenne mich zu den ›Zehn Geboten‹.
Frei wollte man damals, im Renaissance-Zeitalter, allerdings auch im geistigen Sinn sein – bis zum Machiavellismus oder bis zur Autonomie der forschenden Vernunft, in der Folge bis zur Atombombe und der Sackgasse des heutigen technologischen und politischen Zustandes, in dem, sagen wir es offen, ein ausreichender Ersatz für die Herrschaft der genauen mittelalterlichen Ordnung noch nicht oder nur in schwachen Ansätzen gefunden worden ist. – Ansätze, die allerdings die heilige, ja die einzige Hoffnung der Menschheit bilden. Mögen sie gedeihen und Macht gewinnen, diese heiligen Ansätze, eine Macht, die entgegen dem bekannten Wort nicht mehr böse wäre!
Denn böse war ja auch das Mittelalter, in seiner Art sogar menschenfresserisch böse, ein gleichsam geordnetes Grauen, im Gegensatz zu dem ungeordnet labilen Grauen, das heute unser Schicksal ist. Böse war das Mittelalter, mit seinen Kreuzzügen, seinen Albigenserkriegen, seinem (noch nicht voll entwickelten) Hexenglauben, seinen Scheiterhaufen, seinen Geißelbrüdern, seinem von Aberglauben umgebenen ›schwarzen Tod‹ und ungezählten andern, durch Menschenunsinn gesetzten Ängsten und Toden, die es plagten und mehr als einmal weite Provinzen ausmordend bis in ihre Wurzeln zur Wüste machten. Böse war es, auch wenn wir die Einteilung übernehmen, die Friedrich Heer in seinem wissenden Buch ›Mittelalter‹ in Vorschlag bringt: die Einteilung in eine vergleichsweise heitere ›offene‹ Periode der ersten Jahrhunderte des Mittelalters (›offenes Europa‹ mit seinen beinahe toleranten, bunten, noch nicht durchdogmatisierten Erscheinungsformen) und eine dem Unheil zugänglichere, unfreiere, gleichsam zornigere Zeit, die um 1200 begonnen habe. Damals erlitt das Papsttum (nach Heer) seinen schweren Schock, indem es die Erfahrung machte: »Ganz Südwesteuropa, aber auch West- und Süddeutschland sind von ›Ketzern‹, von religiösen Nonkonformisten, unterwandert, die in einigen Fällen zur Gründung einer Gegenkirche schreiten.«
Die Thesen Heers sind so markant, daß ich sie im Wortlaut hierhersetze, ohne den Versuch, sie umschreiben zu wollen:
»Geschlossenes Europa: Wer die im 13. Jahrhundert mächtig voranschreitenden Prozesse innerer Abschließung und der Gleichschaltung, von gewaltigen und gewalttätigen Unifizierungen, die ja bis heute nicht zu Ende gekommen sind, verstehen will, muß diesen ersten Schock kennenlernen: In der Erfahrung, daß diese eine Christenheit plötzlich von Elementen unterwandert und durchsetzt ist, die religiös, weltanschaulich und bisweilen auch politisch sehr anders denken als die Kirche und ihr Kirchenvolk, setzt jene Kettenreaktion an, die durch innere Kreuzzüge (gegen die ›Ketzer‹), durch die Inquisition, die staatliche und kirchliche Überwachung des Denkens und Glaubens, die Fixierung des kirchlichen Glaubens und des weltlichen Wissens immer weiter getrieben wird.
Der Unbefangenheit, mit der im offenen Europa der andere, der Mensch eines anderen Volkes, Glaubens, Geistes, nicht selten aufgenommen wurde, entspricht die Befangenheit, die große Angst vor dem anderen, die nunmehr in Europa gesteigert und immer wieder neu belebt wird durch neue Schocks, die aber alle mit den Schockerlebnissen des hohen und späten Mittelalters zusammenhängen. Auf den Ketzer-Schock folgt der Türken-Schock. Neben diesen tritt der Schock vor den Hussiten, deren Heere ganz Mitteleuropa durchziehen. Jeanne d’Arc, die Jungfrau von Orléans, wollte gegen die Hussiten ziehen; ihre Feinde in Frankreich und England aber sehen sie selbst als eine Verwandte dieser ›Ketzer‹.«
Es scheint mir allerdings, daß man die Grenzscheide zwischen dem »offenen« und »geschlossenen« Mittelalter besser um etwa 100 Jahre weiter zurück ansetzen sollte: Nicht erst die frevlerische Ausrottung der Albigenser, der provençalischen Hochblüte, einer farbigen Vor-Renaissance unter der kultivierenden Herrschaft der ›Dame‹ und mit dem Stempel des ritterlichen Frauendienstes, der an Platon anknüpfte, wiewohl nur halb-bewußt, gleichsam träumend, – sondern schon vorher bringt der Beginn der Kreuzzüge die schlimme Verwandlung. Die imposant unnachgiebigen, despotischen Figuren der Päpste Gregor VII. und Innocenz III. sind die Merksteine. Unter Gregors VII. Widersacher, dem fränkischen Kaiser Heinrich IV., hatten die Juden in Deutschland noch unangefochten leben, alle Gewerbe ausüben, Grundbesitz erwerben können. Mit den Kreuzzügen begannen die Judenverfolgungen am Rhein, in denen zum erstenmal die große Verdunkelung der Epoche ihren symbolischen (und freilich auch fürchterlich realen) Ausdruck fand. Die Inquisition mit ihrem entsetzlichen Geheimverfahren und ihren entsetzlichen Strafen, Nicht-Christen wie »häretischen« Christen gleichermaßen gefährlich, wurde allerdings erst 1215 durch das Laterankonzil zur bleibenden Institution verfestigt und erwürgte mit zunehmender Intensität alles freie Leben, drückte dem von der Kirche regierten Abendland den Stempel eines grausam totalitären Systems auf.
Über den ersten Kreuzzug, der die Wendung zum Schlimmen brachte, lese man den nachfolgenden Bericht eines jüdischen Zeitgenossen, wie ihn Josef Kastein in seinem Buch ›Süßkind von Trimberg‹ übersetzt hat: »Er erspart uns jeden Kommentar«, wie Kastein richtig hinzusetzt. Die alte Quelle sagt:
»Und nun werde ich erzählen von dem Hinrollen des Verhängnisses auch in den anderen Gemeinden, die erschlagen wurden für Seinen Namen, den Einzigen, und wie sehr sie Gott, dem Gott ihrer Väter, anhafteten, und wie sie Seine Einzigkeit bewährten bis zum Auspressen ihrer Seele. – Es war im Jahre 4856 (1096), damals, als wir auf Befreiung und Trost hofften … da erhoben sich zuerst freche Gesichter, ein Volk fremder Sprache, ein bitteres, ungestümes Volk der Franzosen und Deutschen; sie richteten ihr Herz darauf, nach der heiligen Stadt zu gehen, welche verbrecherisches Volk entweiht hatte, um das Grab des Nazareners dort aufzusuchen, die Ismaeliter, die Bewohner des Landes von dort zu vertreiben und das Land in ihre Hand zu zwingen. Sie machten ein Zeichen, ein Mal, das nicht gilt, an ihre Kleider, ein Kreuz, jeder Mann und jede Frau, die ihr Herz trieb, den Irrweg zum Grab ihres Gesalbten zu gehen, bis daß sie zahlreicher waren als der Heuschreck auf dem Erdboden. Als sie durch die Städte zogen, wo Juden waren, sprachen sie einer zum anderen: Seht, wir gehen einen fernen Weg, um das Grab zu suchen, unsere Rache zu nehmen an den Ismaeliten, und seht, unter uns sitzen die Juden, deren Väter ihn grundlos erschlagen und gekreuzigt haben; rächen wir uns doch zuerst an ihnen, tilgen wir sie weg aus den Völkern, oder sie mögen werden wie wir und sich zum Nazarener bekennen. … Als die Gemeinden ihre Reden hörten, ergriffen sie das Handwerk unserer Väter: Umkehr, Gebet und Wohltun. Damals aber erschlafften die Hände des heiligen Volkes, ihr Herz schmolz, ihre Kraft ward schwach, sie verbargen sich in innersten Gemächern vor dem kreisenden Schwerte und quälten ihre Seele im Fasten. Sie ließen einen großen und bitteren Aufschrei hören. Doch ihr Vater antwortete ihnen nicht. Er hüllte sich in ein Gewölk, daß ihr Gebet nicht hindurchdrang. … Als die Söhne des heiligen Bundes sahen, daß das Verhängnis sich erfüllen würde, die Feinde sie besiegen und in den Hof eintreten würden, da weinten sie alle, Greise und Jünglinge, Jungfrauen und Kinder, Knechte und Mägde, zu ihrem Vater im Himmel weinten sie über sich und ihr Leben. Das Urteil des Himmels nahmen sie als gerecht auf sich und sprachen zueinander: Wir wollen stark sein. Für eine Stunde werden die Feinde uns töten, aber unsere Seelen werden leben und bestehen im Garten Eden. Und sie sprachen aus ganzem Herzen und williger Seele: Dies ist der letzte Sinn: nicht nachgrübeln über die Weise des Heiligen. Er hat uns seine Lehre gegeben und das Gebot, uns töten zu lassen für die Einzigkeit seines heiligen Namens. Wohl uns, wenn wir seinen Willen tun. Wohl dem, der umgebracht, der geschlachtet wird. Für die kommende Welt ist er bestimmt. Ihm wird getauscht eine Welt der Finsternis um eine Welt des Lichts, eine Welt der Not um eine Welt der Freude. … Da schrien sie alle mit lauter Stimme und sprachen wie ein Mann: Nun haben wir nicht mehr zu zögern, denn die Feinde kommen schon über uns her. Gehen wir rasch, tun wir’s, opfern wir uns vor dem Angesicht Gottes. Jeder, der ein Messer hat, prüfe es, daß es nicht schartig sei, und komme und schlachte uns für die Heiligung des Einzigen; und dann schlachte er sich selbst an seinem Halse oder steche sich das Messer in den Leib. … Als die Feinde vors Dorf gekommen waren, da stiegen einige von den Frommen auf den Turm und warfen sich in den Rhein, der am Dorfe vorbeifließt, und ertränkten sich im Strom und starben allesamt. … Als Sarit, die bräutliche Jungfrau, sah, daß sie sich mit den Schwertern umbrachten, daß sie geschlachtet wurden, einer vom anderen, da wollte sie vor dem Schrecken, den sie sah, durchs Fenster auf die Gasse entweichen. Aber als ihr Schwiegervater, Herr Jehuda, Sohn des Rabbi Abraham des Frommen, das sah, rief er ihr zu und sprach: ›Meine Tochter, weil ich nun nicht gewürdigt ward, dich meinem Sohne Abraham zur Frau zu geben, so sollst du doch nicht einem anderen, einem Fremden zur Frau werden.‹ Er führte sie vom Fenster weg, küßte ihren Mund, erhob mit dem Mädchen zugleich seine Stimme im Weinen und sprach zu allen, die umherstanden: Seht ihr alle, dies ist das Trauzelt meiner Tochter. Und sie weinten alle, ein großes Weinen. Sprach zu ihr Herr Jehuda: Komm, meine Tochter, lege dich hin in den Schoß Abrahams unseres Vaters, denn mit einer Stunde erwirbst du seine Welt. – Er nahm sie, legte sie in den Schoß seines Sohnes Abraham, zerhieb sie mit einem scharfen Schwert mittendurch in zwei Stücke; dann schlachtete er auch seinen Sohn. Darüber weine ich, und mein Herz jammert. Und nachher, als die Söhne des heiligen Bundes getötet dalagen, kamen die Unbeschnittenen über sie her, um sie auszuziehen und aus den Gemächern zu räumen. Sie warfen sie nackt durch die Fenster zu Boden, Berge über Berge, Haufen über Haufen. Und viele unter ihnen lebten noch, als man sie hinuntergestürzt hatte; ein wenig Leben war noch in ihnen, und sie winkten mit ihren Fingern: Gebt uns ein wenig Wasser zu trinken. Als die Verblendeten das sahen, daß in ihnen noch eine Spur Leben war, fragten sie: ›Wollt ihr euch taufen lassen? So werden wir euch Wasser zu trinken geben, und noch könnt ihr gerettet werden.‹ Sie aber schüttelten mit dem Kopfe, blickten hin zu ihrem Vater im Himmel, als sprächen sie: ›Nein!‹, und wiesen mit dem Finger nach oben. Doch kein Wort konnten sie aus ihrem Munde hervorbringen vor der Menge der Wunden, die ihnen zugefügt worden waren. Und jene fuhren fort, sie zu schlagen, über das Maß, bis sie sie zum zweiten Male umgebracht hatten.«
Kastein fügt hinzu: »Was hier mitgeteilt worden ist, illustriert die Vorgänge, die sich im Beginn des ersten Kreuzzuges (1096) in Speyer, Worms, Mainz, Köln und Trier abspielten. Es ist zu ergänzen, daß vielfach Juden bei diesen Angriffen zwangsgetauft wurden.«
Wie schwer das kirchlich Systematische auf dem gesamten Geistesleben des späteren Mittelalters lastete, beschreibt J. Huizinga in einer schier unerschöpflichen Beispielfolge in seinem ›Herbst des Mittelalters‹, nachdem er zuvor die Modemanieren des Ritterdienstes und sein »schönes, lügnerisches Spiel« eben als Spiel entlarvt hat, dessen hohe ethische Grundsätze selten ernstgenommen wurden – außer von seinem seltsamen Relikt, dem Ritter Don Quixote, dessen rührendes Befolgen der hohen Moral des Rittertums in seiner Tragikomik und wahnhaften Naivität doppelt ergreifend wirkt. – Auch im Frauendienst des Mittelalters spricht modische Sitte das erste Wort, wenngleich (meiner Ansicht nach) hier wohl viel mehr Erfahrung und echtes Gefühl mitbeteiligt war, als Huizinga annimmt. Daß aber auch die Frömmigkeit des angeblich so frommen Mittelalters nicht vor ›Gschnas‹ und Routine geschützt ist, das ist das Erstaunlichste, was man aus dem zitierten wichtigen Buch herausliest. Da heißt es etwa: »Das Leben der mittelalterlichen Christenheit ist in all seinen Beziehungen durchdrungen und völlig gesättigt von religiösen Vorstellungen. Es gibt kein Ding und keine Handlung, die nicht fortwährend in Beziehung zu Christus und dem Glauben gebracht werden. Alles ist auf eine religiöse Auffassung aller Dinge eingestellt. Wir sehen eine ungeheuerliche Entfaltung innigen Glaubens, aber in der übersättigten Atmosphäre kann die religiöse Spannung, die wirkliche Transzendenz, das Heraustreten aus dem Diesseits nicht stets gegenwärtig sein. Bleibt jene Spannung aus, dann erstarrt alles, was doch bestimmt war, das Gottbewußtsein zu wecken, zu einer erschreckenden Alltäglichkeit (von mir kursiv gesetzt), zu einer erstaunlichen Diesseitigkeit in jenseitigen Formen.« Es folgen Beispiele aus dem Leben eines so hochstehenden Frommen, wie Heinrich Seuse. Sie wirken bei aller Echtheit recht verspielt, manieriert. – Kein Wunder, daß solch eine Tyrannis des christlichen Lehrgebäudes auf viele (und darunter auf sehr ehrliche und hohe Geister) als unerträglicher Druck wirkte. »Es ist ein Prozeß fortwährender Herabsetzung des Unendlichen zu Endlichkeiten, ein Auseinanderfallen des Wunders in Atome. An jedes heiligste Mysterium heftet sich, wie eine Muschelkruste am Schiff, ein Gewächs äußerlicher Glaubenselemente an, die es entweihen.« – Man könnte von einer Verpöbelung der hochgespannten Stimmungen des Christentums sprechen. Zu solch abergläubischen Entartungen gehört vor allem der Reliquienkult, gegen den Reuchlin eine seiner beiden lateinischen Komödien (›Sergius vel Capitis caput‹) schreibt. – Man möchte es nicht für möglich halten, aber in einem durchaus nicht kirchenfeindlichen, objektiven, in keiner Weise überschwenglichen, eher trockenen Buch der Wissenschaft, in Willy Andreas’ hier schon angeführtem ›Deutschland vor der Reformation‹ liest man über Reliquienverehrung: »Das Wittenberger Heiligtum enthielt Ruß aus dem Feuerofen der drei Jünglinge. Im Schleswigschen Augustinerkloster Bordesholm zeigte man von der heiligen Jungfrau die gesamte Nähausrüstung einer Dame von Rang, auch etwas von ihrem Haargeflecht und sogar ein wenig Ohrenschmalz.«
In einem System von so viel Verstiegenheit war begreiflicherweise der philosophierenden Vernunft, dem lumen naturale, nichts als die Rolle einer Gefangenen, einer Dienstmagd der Theologie (ancilla theologiae) zugewiesen. Sie besaß keine autonomen Rechte. Ihre Aufgabe war nur, mit kunstvoller schulmäßiger (scholastischer) Akribie weitläufig das zu untermauern, was als Gebäude der Glaubenssätze von vornherein unbezweifelbar feststand. Zu einem anderen Ergebnis durfte, ja konnte sie nicht kommen. Nur zu diesem bedingungslosen ›Ja‹. – Des Abälard ›Ja und Nein‹ (Sic et non) wurde verworfen, sein Leben grausam zerstört; wiewohl auch er die kirchlichen Autoritäten nicht zu erschüttern, sondern im Gegenteil »die Widersprüche in den Schriften der Kirchenväter zu harmonisieren« (solvere controversias in scriptis sanctorum) bestrebt war. – An der bona fides der großen Kirchenlehrer des Mittelalters, z. B. eines Giganten wie Thomas von Aquino ist selbstverständlich nicht zu zweifeln. Sie waren aufs tiefste überzeugt, daß die Vernunft zu keinem andern Ergebnis kommen könnte als zu einer möglichst engen Annäherung an die Glaubenssätze. Zu diesem Ziel nahmen sie den (allerdings scholastisch interpretierten) Aristoteles als Führer. »Philosophus ille omnium perspicacissimus Aristoteles« (den scharfsinnigsten aller Philosophen) nennt ihn Abälard. Und Dante sagt von ihm:
»Il maestro di color che sanno
(Der Meister derer, die da wissen)
Tutti lo miran, tutti onor gli fanno«
(Alle bewundern ihn, alle geben ihm Ehre.)
Er ist bei Dante auch gleich von seinem großen Erklärer begleitet, – denn infolge der Kriegserschütterungen und anderer verhängnisvollen Umstände kannte das Mittelalter nicht den originalen Aristoteles, sondern hauptsächlich den von arabischen und jüdischen Exegeten vermittelten. So findet ihn denn auch Dante in Gesellschaft des
»Averrois, che il gran commento feo«
(des Arabers Ibn Roschd, »der den großen Kommentar geschrieben hat« – ein Kommentar, der später in der Scholastik lebhaft angefochten wurde).
Es ist nicht überflüssig, eine Zeile über die Lokalität hierherzusetzen, in der Dante den von ihm hochverehrten Klassikern (neben Aristoteles und Averroës auch dem Homer u. a.) begegnet. Dieses erschütternde Treffen spielt sich nämlich – in der Hölle ab. Denn die genannten Helden der Wahrheit und Schönheit waren ja ungetauft (»perchè non ebbe battesmo«, Hölle 4. Gesang). Wohl sind sie in diesem obersten Höllenkreise durch ein »nobile castello« mit siebenfacher Mauer und mit einem schönen Flüßchen nebst grünem Wiesenhang von dem eklen Höllengraus der Tiefe getrennt, auch sonst durch mannigfache Privilegien ausgezeichnet, durch »Schmerz ohne Qualen« geadelt, – aber die Pforte, die zum »Volk der Verlorenen« führt, hat sich eben doch schon längst – und zwar für ewig – hinter ihnen zugetan. Es gibt kein ergreifenderes und ernsteres Sinnbild für das »geschlossene Europa« als diese schwermütige Begegnung seines größten Dichters mit den heidnischen Vorbildern, die er liebt, – eine Begegnung, aus der Dante unter Leitung des gleichfalls eigentlich ›verdammten‹ Vergil, völlig überzeugt und doch mit ganz leisem, kaum ausgesprochenem Protest aufbricht, unsagbar zart in diesem Protest, der harte Mann, dem schon zuvor, ehe er den Höllengang antritt, jedes nichtige Mitgefühl (ogni viltà) untersagt worden ist. – Indessen hatte lange vorher der von diesem fanatisierten Europa mit Vernichtung bedrohte Talmud, um dessen Rettung sich Reuchlin sein unsterbliches Verdienst erstritten hat, das erlösende Wort gefunden: Tosefta Sanhedrin 13, 2: »Die Gerechten aller Völker haben Anteil an der kommenden Welt, d. h. an der ewigen Seligkeit.«
3
Das Maß der Unduldsamkeit war eines Tages voll. Dieses innere Moment darf nicht übersehen werden; wiewohl selbstverständlich auch noch viele äußere Momente hinzutreten mußten (und tatsächlich hinzugetreten sind), die den Überdruß zum Überlaufen brachten. Das ließ lichtere, triebfreundlichere Luft in den Kerker einfließen. Das gute Gewissen der Natürlichkeit regte sich in dem alten, durch asketische Verbote beirrten und verdorbenen, wir würden heute mit Freudscher Terminologie, aber nicht in seinem Sinne sagen: allzu sublimierten Adam. Solche äußere Momente der Umwandlung waren: die Entdeckungsreisen der seefahrenden Völker, der einströmende Reichtum der Neuen Welt und die Erweiterung des Horizonts, die Auffindung antiker Skulpturen und antiker Handschriften, die Erfindung der Buchdruckerkunst, die Eroberung Konstantinopels durch die Türken und die schon vorher angebahnte, nun aber gewaltig verstärkte Überflutung des Westens mit Trägern der griechischen Kultur, ferner das Aufsteigen der Nationalstaaten und des landesfürstlichen Zentralismus, des Beamtentums, des römischen Rechts; kurz eine ganze Kette politischer und wirtschaftlicher Umwälzungen. Alle spielten hier entscheidend mit herein (Jacob Burckhardt ›Die Kultur der Renaissance in Italien‹, Ludwig Geiger ›Renaissance und Humanismus in Italien und Deutschland‹, Huizinga ›Herbst des Mittelalters‹). Die Zwangsgemeinschaft des totalitären Mittelalters zerfiel, aus den Trümmern stieg das souveräne allmächtige Individuum auf und orientierte sich an den Leitbildern der neu entdeckten Antike, in der man (zu Unrecht) die individuelle Komponente weit stärker empfand als den kollektiven Untergrund. Dieser Kollektivgeist hatte, zumindest bis zur skeptischen Spätzeit, das Altertum durchwaltet. Die Wichtigkeit dieses antiken Untergrunds sah man zunächst nicht. Man hatte vom kollektiven Zwang, von der Gewissensangst, den zurückgedrängten Velleitäten und ihren Zersetzungsprodukten einfach genug. Man exzedierte nun freilich in der entgegengesetzten Richtung, man genoß grenzenlos die problematische Freiheit des Freigelassenen. Indessen könnte nur die unendlich schwierige, die richtige Ausgewogenheit der Persönlichkeit gegenüber dem Gemeinwesen, der Freiheit gegenüber den Bindungen ein wirklicher Fortschritt genannt werden. Zurückblickend sehen wir heute, daß die einseitige Freilegung des Individuums, mag sie damals auch als allheilsamer Frühling bejubelt worden sein, in der Folge neben Großem auch durchaus Gemeines und tödlich Verderbliches erzeugt hat. Das »anziehende Verbrechen«, wie schon oben bemerkt.
Wir sind einen weiten und durchaus nicht einwandfreien Weg geschritten, bis zu der schmerzlichen Feststellung, mit der Strindberg eine große Epoche verwerfen konnte: »Es ist schade um die Menschen«, – am Anfang dieses Weges aber mochte das schlimme Ende oder doch die Gefahr eines solchen Endes nicht geahnt werden. Man glaubte, die schmutzige Roheit einer abgelebten Zeit glücklich überwunden zu haben, alles stand in Blüte; verlockend wie Sirenenruf erklangen die berühmten und so oft zitierten Worte Ulrich von Huttens: »O Jahrhundert! O Wissenschaften! Es ist eine Lust zu leben, wenn auch noch nicht, sich zur Ruhe zu setzen, mein Wilibald. Es blühen die Studien, die Geister regen sich: du, nimm den Strick, Barbarei, und mache dich auf Verbannung gefaßt.« So heißt es in dem Brief des stürmischen Ritters (Ulrichi de Hutten ad Bilibaldum Pirckheymer, patricium Norimbergensem, epistola, vitae suae rationem exponens). Allen Bedenken zum Trotz, die manchem wohl von Beginn an aufdämmerten, klang das Schlagwort: »O saecula, o litterae! Juvat vivere!« »Es ist eine Lust zu leben.«
Die harte Wahrheit ergibt sich, daß die zuchtvolle Organisation durch die Kirche kein gutes Ergebnis gehabt hat. Aber auch die Freigeistigkeit, der man sich an Stelle der Unterordnung unter die Kirche hingab, hat bis heute keine endgültig und entscheidend besseren Resultate hervorgebracht. Das ist allem illusionären Fortschrittsglauben entgegenzuhalten, – allerdings nur provisorisch, in Erwartung einer besseren Ordnung. Der leise Hinweis auf meinen Entwurf in dem Buch ›Streitbares Leben‹ (Seite 525 ff.) sei hier gestattet.
Besitzvermerke Reuchlins in: D. Kimchi ›Prophetae priores‹. Inkunabel 1485; und in: D. Kimchi ›Ezechielkommentar‹. Handschrift.
Noch jubelhafter als bei Hutten äußert sich das Hochgefühl der Renaissance in dem derben, doch von Grund aus festlich hellen Rabelais, dem gesündesten ungehemmtesten Lacher jener Zeit. Rabelais ist (was man nie vergessen sollte) ein jüngerer Zeitgenosse Reuchlins, der Dunkelmännerbriefe, des Ritters von Sickingen und Huttens. In seinem ›Gargantua‹ wird das Vitale ins Absurde gekehrt. Der wackere Flaubert hatte seine spitzbübische Freude an den Massen von Wein, Morgensuppen, Rehziemern etc., die der Riese Gargantua vertilgt, – »ganz einfach, das Genie hat seinen wahren Mittelpunkt im Ungeheuren«. »Wie die Pyramiden wachsen diese Bücher (Rabelais, Don Quixote) in dem Maße, als man sie genau betrachtet, und schließlich hat man Angst vor ihnen«. Die scholastische Methode wird von der Sprache aus in Grund und Boden gebohrt. Nachdem der junge Riese Gargantua die Glocken von Notre Dame gestohlen hat, um sie seiner Stute um den Hals zu hängen, sucht ihm ein vom Stadtrat abgeordnetes ›Stück Malheur‹, ein Theologe, die Beute abzuschwatzen, bringt aber nicht viel anderes heraus als die in den üblichen Disputationen vielbenützten Schablonen und Worthülsen: »Omnis glocka glockabilia in glockando glockans glockativo glockare facit glockabiliter glockantes«. Doch auch dieser ungeschlachte und an Unflätigkeiten nicht arme ›Gargantua‹-Roman erweist sich letztlich als Erziehungsroman, ein entfernter Vorläufer des ›Wilhelm Meister‹, sei es auch mit den schärfsten und oft auch übelstriechenden Ironien durchsetzt. Die Schlußkapitel handeln von der Abtei Thélème, die am Loire-Ufer für den völlig aus der Art geschlagenen Bruder Hannes nach seinem Siege als Ehrengabe gebaut wird. Aber der Frater erklärt, er wolle keine Gewalt und Oberhoheit über Mönche besitzen. Es wird also ein »Kloster nach seiner Eingebung« eingerichtet, sehr verschieden von allen andern Abteien, – ein humanistisches Asyl des Frohsinns, in dessen Regel es nur die eine Verfügung gibt: »Fais ce que voudras«. Schroffer (und für die Zukunft gefahrenvoller) konnte das Mittelalter nicht verabschiedet werden. »Tu, was du willst«. – Und der Gründungsbrief? – 1910 haben Engelbert Hegaur und Dr. Owlglass, letzterer aus dem alten ›Simplicissimus‹ bekannt, die beiden Romane des Rabelais, fünf Bände, zu unserem Ergötzen in ein sehr würziges Deutsch übertragen. Es wird über die erwähnte bedeutende Urkunde, dieses welthistorische Klostergründungsstatut erzählt:
»Zum ersten, verordnete Gargantua in Übereinstimmung mit Hannes, dürften keine Mauern ringsum gebaut werden, weil alle andern Klöster durch solche von der Welt abgeschieden seien. – ›Freilich‹, setzte der Mönch hinzu, ›und von Rechts wegen. Denn hinter jeder Mauer kauert wer auf der Lauer und blickt sauer; drum gedeiht dort der Neid und das Verfolgungswesen.‹
Zum zweiten, weil in vielen Klöstern üblich ist, den Ort zu reinigen, den ein Frauenzimmer (ein anständiges und keusches mein’ ich) betreten hat: soll hier jeder Fleck gewischt und gefegt werden, auf dem zufällig ein Mönch oder eine Nonne gestanden.
Weil sonst alles nach Stunden eingeteilt und geregelt sei, ward bestimmt, daß es hier keine Uhr und keinen Stundenweiser geben dürfe; alle Besorgungen sollten nach Zeit und Gelegenheit erledigt werden. ›Denn was ist der größte Zeitverlust?‹ fragte Gargantua. ›Das Stundenzählen. Was hat es für einen Vorteil? Die gröblichste Torheit ist doch, sich nach einem Glockenschlag zu richten, statt nach Bedürfnis und Verstand.‹
Item, weil bis dato bloß schielige, hinkende, bucklige, häßliche, närrische, blöde, lästerliche und anrüchige Frauenzimmer den Schleier genommen hätten, und bloß gichtische, krumme, dumme und zu sonst nichts taugliche Mannsbilder die Tonsur: so wurde dekretiert, die Aufnahme stünde nur hübschen, niedlichen und anmutigen Dirnlein und nur schönen, gesunden und stattlichen Burschen frei.
Item, weil den Weibern der Besuch der Männerklöster und den Männern der Eintritt in Frauenklöster versperrt war – außer wenn es heimlich und verstohlen geschah – so wurde festgelegt, daß kein Mägdlein Schwester werden sollte, es seien denn schon Brüder da, und umgekehrt.
Item, weil sonst Männlein und Weiblein nach dem Noviziat sich für immer und alle Zeit der Klosterschaft verpflichten mußten, wurde bestimmt, daß sie hier nach Belieben ein- und austreten könnten.
Item, weil jeder Ordensangehörige das Gelübde des Gehorsams, der Keuschheit und Armut ablegen mußte, verfügte man, daß hier alle unabhängig sein, reich werden und heiraten dürften.
Das Aufnahmealter wurde für die Nönnlein zwischen dem zehnten und fünfzehnten, für die Fratres zwischen dem zwölften und achtzehnten Lebenslenz festgelegt.«
Zum Erstaunen manierlich geht es in dieser Abtei zu, in der auch »auserwählte Büchereien« ihre Aufstellung finden »und zwar in griechischer, lateinischer, hebräischer, französischer, italienischer und spanischer Sprache, in jedem Stockwerk eine Sprache.« Man beachte, daß die drei hier an erster Stelle genannten Sprachen genau dem Kanon entsprechen, für den Reuchlin sein Leben lang und in Deutschland als erster gekämpft hat, – er, der das ›dreisprachige Wunder‹ genannt wurde. – Dieser Reuchlinsche Kanon ist bei Rabelais um die in Entwicklung begriffenen Volkssprachen erweitert, nach deren einer, der deutschen, Reuchlin nur unter den sonderbarsten Ausreden, aber schließlich doch gegriffen hat, und zwar auf die allertüchtigste Weise.
Zur Erläuterung der Devise »Tu, was du willst« wird gesagt (und man kann diese Sätze bewundern, auch wenn man sie nach der optimistischen Seite hin etwa allzu leichtfertig aufgeplustert finden mag): »Tu, was du willst. Denn wackere, gut erzogene, gesunde und umgängliche Menschen haben von Natur aus einen Hang zum Guten und eine Abneigung gegen das Schlechte: ihre eingeborene Ehre. Knechtschaft und Zwang aber stachelt zu Widerspruch und Auflehnung und ist die Mutter alles Übels.«
Dem humanistischen Leitbild gelten auch in aller Urweltpracht ihrer Schönheit die Verse, die man auf dem großen Tor der Abtei Thélème liest. Und sie erheben sich im Licht ihrer Schönheit zu besonderer Deutlichkeit, ihre Sprache schärft sich zu absoluter Konkretheit, zu äußerster Präzision (in der Übersetzung wäre nur das einem späteren Zeitalter angehörige Wort ›Pietist‹ als Anachronismus zu bemängeln):
»Bleib vor der Türe, Heuchler, Pietist,
Ergrauter Affe, Schmerwanst, Gurgelkropf,
Du Hunne, der die kleinen Kinder frißt,
Waldmenschenurbild mit dem Weichselzopf,
Du Augenschmeißer, abgebrühter Wicht,
Wortdrescher, Blähbauch, kahlgewichster Kopf,
Windbeutel, Lispler, Stänker, Truggesicht,
Scher’ dich zum Kuckuck oder Wiedehopf!
Dein Lügendunst füllt meine Laubengänge,
Du meckerst grell in unsre Festgesänge,
Bleibt draußen, all’ ihr Tintenpharisäer,
Ihr Skribifaxe, Sudler, Lugerfinder,
Ihr feige Seelen, Kleckser, Rechtsverdreher,
Faszikelschmierer, triste Bauernschinder!
Zum Galgen mit euch bluterpichten Wanzen,
An den ihr manchen Braven dekretiert!
Dort mögt ihr wiehernd eure Tänze tanzen.
Hier, hohe Herren, wird nicht prozessiert!
Hier quillt der Freudenborn im Sonnenlicht;
Für euer Handwerk taugt die Sonne nicht.
Ihr aber, edle Herren, tretet ein,
Seid hochwillkommen, Reisige und Reiter!
Hier ist ein Heimatland für groß und klein,
Pflegstatt und Schild für tausend Lebensstreiter.
Kommt her zu mir: ich bin euch Bruder, Freund;
Derselbe Blutsaft rinnt uns durch die Glieder,
Dieselbe klare, warme Sonne scheint
Auf unsre heiter-kühnen Seelen nieder.
Hier ist der bunten Schönheit Adelssitz,
Und durch die Hecken huscht der frohe Witz.
Willkommen, die ihr für die Wahrheit streitet:
Hier ist ein Ort der Zuflucht, ein Asyl.
Hier blüht für euch, die ihr Verfolgung leidet,
Ein stiller Anger und ein Friedensbühl.
Die Lüge reckt ihr siebenfaches Haupt,
Der blinde Haß vergiftet jede Quelle.
So schließet alle, die ihr hofft und glaubt,
Den Bund der Wahrheit und der steten Helle.
Pflegt unser Kleinod, unsern Schatz und Hort,
Von Ewigkeit zu Ewigkeiten fort!
Seid hochwillkommen, schöngemute Frauen,
Bringt holden Sinn und bringt uns Glück herein!
Ihr Wunderblumen wie von Himmelsauen,
Nachsichtig, herzensklug und herzensrein.
In Freiheit grünt der Ehre feinste Blust!
Euch Frauen recht zum innigen Ergetzen
Schuf unser Herr die Gärten voller Lust
Und schmückte sie mit abertausend Schätzen.
So tretet ein! Die höchste Tugend übt,
Wer sich in Liebe einem andern gibt.«
Aus einer etwas früheren Zeit (1500), jedoch aus ähnlicher Stimmung stammt Albrecht Dürers bezaubernder Kupferstich ›Das Meerwunder‹, ein wahres Meisterstück der Gelöstheit und Südlichkeit. Trotz (oder gerade wegen) des kontrastierenden Hintergrunds der mittelalterlich getürmten, verwinkelten Ritterburg. An ihr vorbei zieht ruhig das mythologische Paar, die schöne nackte Frau und der pfiffig-würdige, ein wenig ins Bauernschlaue stilisierte Meergreis mit dem schuppigen Fisch-Unterleib, mit spärlichem, sehr spärlichem Gewand auf eine Riesenmuschel hingelagert. Welch eine Vision der Antike! Ich weiß ihr an einmaliger Größe und Traumhaftigkeit schlechterdings nichts an die Seite zu stellen. Das Wasser des breiten Flusses rauscht auf längs der Riesenmuschel, es geht ans Herz. Langsam, unaufhaltbar ziehen die beiden vorbei – wohin? Aufs offene Meer hinaus mit seinem Archipelagus, eis hala dian, zur heiligen Salzflut? Oder ins ewige zeitlose Nichts? Wie sind sie hergelangt, inmitten banale Wirklichkeit? Am Ufer, in der Ferne, ganz klein, wirft ein dicker Bewaffneter in ohnmächtigem Staunen beide Arme in die Höhe. Er weiß es so wenig wie wir, was der überraschende Anblick bedeuten soll. Vorbei, vorbei. Auf unbegreiflich geglückte Art ist dieses »vorbei, an uns Armen vorbei« zeichnerisch dargestellt, ein Blitz hat eingeschlagen, vorbei, vorbei, das ganze Bild singt geradezu dieses schmerzlich sehnsüchtige, glückselige, begnadete ›vorbei‹, es singt eine wilde Lorelei-Melodie, voll von Süßigkeit und elementhafter Übermacht. Und die Mienen der beiden Hauptfiguren, nicht minder rätselhaft als das berühmte Lächeln der Mona Lisa – die Miene der erschreckten, doch schon halb beruhigten blonden Frau – und die des selbstbewußten, von seinem Beuteglück ein wenig verwirrten oder berauschten See-Fauns mit seinem heidnischen Hirschgeweih, das wie ein Stern zackt, eine Krone. In panischem Schrecken schwimmen einige nackte Frauen ganz fern den Weidegebüschen des Ufers zu. Gehörte auch die blonde Schöne auf der Muschel zu der Schar der Badenden? Ist sie von dem Alten, einem Boten Neptuns, entführt worden? Hart genug hält er ihren runden Oberarm umklammert. Doch sie scheint sich in ihr Schicksal gefunden zu haben. Sie wird, selbst makellos schön, ins Reich der seligen Schönheit gebracht.
4
Die Wirklichkeit gestaltete sich freilich recht anders, als Rabelais und die Leute von Thelema und die Freunde des ›Meerwunders‹ es sich vorgenommen hatten. Dazu tat schon der morbus gallicus (auch malum Franciae genannt) das Seine, dem der stürmische Hutten und viele tausend andere erlagen; Hutten, nicht ohne seine grauenerregende Schmierkur mit wissenschaftlicher Objektivität und sogar mit einer gewissen Ostentation dargestellt zu haben – die Schrift ist in aller Naivität seinem Erzbischof zugeeignet. Und die bald den Humanismus ablösenden Glaubenskämpfe heizten den Kessel, in dem der fluchbeladene Körper der Menschheit weiterhin schmorte. – Als ein Aufwachen aus jahrhundertelangem Alpdruck, als ein Augenblick und Atemzug reiner Menschlichkeit behält der Traum von der Abtei Thélème seinen unverlierbaren Wert, wiewohl er nur Verse, Sinnsprüche, Aufrufe liefert. Aber da nun einmal Verse und Sinnsprüche leuchtende Sterne sind und überdies gelegentlich auch anregen, und zwar gute Taten, wollen wir sie immerhin gelten lassen, wenn auch ohne allzu große Prahlerei.
Übrigens fehlt auch bei Rabelais die Blague nicht; und das Schlußkapitel, in dem ein ›Rätsel‹, das man auf einer Bronzeplatte bei der Grundsteinlegung der Abtei findet, zunächst von dem sehr weise gewordenen Gargantua mit einem tiefen Seufzer dahin gedeutet wird, »daß die Jünger der reinen Menschenbotschaft (immer) verfolgt und verleumdet wurden«, – von Frater Hannes dagegen simpel als »eine verworrene und verknöselte Beschreibung des Ballspiels«: dieses Schlußkapitel liest sich ganz wie eine antizipierte Parodie auf die heute zur schlechten literarischen Gewohnheit gewordene Mode, einen berühmten Autor (man weiß wohl, wen ich meine) auf irgendeine weithergeholte, sonst aber beliebige Weise zu deuten.
5
Rabelaishaft also ging es zu, als die Renaissance ihren Höhepunkt erreicht hatte und schon drauf und dran war, in Manierismus und Barock umzuschlagen. Der maßvolle Humanismus hatte sich für eine knapp bemessene Weile durchgesetzt, jetzt räumte er wieder der ›rabies theologorum‹ das Feld, dem Wüten von Reformation und Gegenreformation mit ihren neuerdings sich verengenden Himmelsgewölben, unter denen Europa sein kostbarstes Blut in Bächen zu vergießen begann. Erasmus von Rotterdam hatte diese Katastrophe vorausgesehen – doch aus der Art, wie er sie abzuwenden suchte, aus den völlig unzulänglichen Gegenmaßnahmen, die er vorschlug (vgl. Friedrich Heers Einleitung zu seiner Anthologie ›Erasmus‹, über den Fürstenspiegel für den jungen Kaiser Karl V. et passim) scheint mir mehr des Erasmus ängstliche Vorsicht hervorzugehen, sein »Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht naß«, als echte Menschenliebe. Sein Bestreben war, die dominierende Stellung als Autorität in allen Kulturfragen beizubehalten und gleichzeitig der persönlichen Gefahr auszuweichen, – aus diesem Grund, nicht aus Milde und wirklicher Friedensfreundschaft wollte er neutral dastehen. Denn wo er über einen Wehrlosen, Abgetakelten herfallen konnte (wie über den armen Hutten), tat er es gar nicht mild, sondern mit zerfleischendem Haß, rücksichtslos. Aber klug war er, sehr klug. Und es bleibt ihm der Ruhm, das Unheil vorhergesagt und, sei es auch mit dünner Stimme, unermüdlich gewarnt zu haben.
Mit der Höchstschätzung eines natürlichen Lebens hatte der italienische Humanismus begonnen, hatte stillen Einspruch gegen das Zwangsgefüge der allmächtigen Kirche erhoben. Laurentius Valla stellte das Recht der Natur über alles. Das ist nicht das »secundum naturam vivere« (»der Natur gemäß leben«), das die Stoiker verkündeten. Es ist mehr. »Idem est enim natura quod deus«, sagt Valla, ein seltsames Vorspiel zu der viel späteren Lehre Spinozas, aber offenbar weniger radikal gemeint, denn vorsichtig setzt der als politischer antipäpstlicher Revolutionär verschriene Valla hinzu »aut fere idem«. (»Denn dasselbe ist die Natur wie Gott – oder beinahe dasselbe«.) Und Valla lehnt zwar die bei den Christen von alters her beliebte Tugend- und Pflichtenlehre der Stoa ab, denn des Menschen sinnliche Natur verlange nach Lust und Glück. Aber er mündet dennoch in eine quasi-christliche Doktrin: Aller Epikureismus, den er gegen die Stoa ausspielt, genüge nicht, uns Glückseligkeit, unser höchstes Gut, zu verschaffen. Die wahre Lust ist im irdischen Leben nicht zu erreichen, sondern nur in der ewigen Seligkeit, im Glauben. – So verläßt auch dieser am weitesten Vorprellende, der Klarsichtigste unter den Zeitgenossen, der Übersetzer der Ilias und des Thukydides, der Polemiker gegen die Echtheit der ›Konstantinischen Schenkung‹, dessen bahnbrechende Schrift für Hutten so entscheidende Bedeutung gewann, verläßt durchaus nicht das religiöse Fundament. Nur Machiavelli wurde wirklich zum Helden, mit all den fürchterlichen Konsequenzen, die aus der Sprengung sämtlicher sittlichen Bindungen (vom exzessiven und zum Absolutum erklärten Patriotismus abgesehen) mit mechanischer Grausamkeit hervorgehen mußten.
Bei allen andern trieben christliche und heidnische Bestandstücke des Denkens mit einer uns heute seltsam berührenden Unbefangenheit bunt durcheinander herum. Allerdings ist diese Vermischung, oberflächlich gesehen, nur eine Modesache des literarischen Stils, – doch »der Stil ist der Mensch«, ohne tiefe innere Erschütterungen wäre es nie zu diesen gelegentlich konventionell anmutenden Manierismen des Ausdrucks gekommen, der die Gegenpole mischte. Wenn Boccaccio darlegen will, daß er seine verehrte Maria Fiametta zum erstenmal in der San-Lorenzo-Kirche in Neapel gesehen hat, so nimmt sein Bericht die folgende Gestalt an: »Es geschah an einem Tage, dessen erste Stunde Saturn beherrschte, an dem Phoebus mit seinen Rossen den sechzehnten Grad des himmlischen Widders erreichte, als ich in Neapel einen Tempel betrat, nach jenem benannt, der sich auf dem Rost verbrennen ließ, um unter die Götter versetzt zu werden.« – Und Enea Piccolomini schreibt einmal über den »fromm-heiligen« Papst Nikolaus, daß dieser gewiß im Paradies »mit Christus und dem alleinigen Gott Nektar schlürfe«. – Es geschah daher nur im Übermaß polemischen Eifers, daß der ehrliche Reuchlin einem Gegner, der ihn allerdings bis aufs Blut gereizt hatte, den verketzernden Vorwurf machte, dieser Gegner habe von der Jungfrau Maria als von »Jovis alma parens« (»Jupiters, d. h. Gottes erhabene Gebärerin«) geschrieben, – eine Metapher, die durchaus im Stile der Zeit lag und nur dann etwas Anstößiges gehabt hätte, wenn man diesem Stil abschwor (was Reuchlin gewiß nicht wünschte und was er auch persönlich nicht praktiziert hat).
Daß die genauere Bekanntschaft mit der griechisch-römischen und hebräischen Denkart (Kabbala) die ernste Folge gehabt hat, das Joch der uniformen kirchlichen Oberherrschaft zu lockern: darin lag die entscheidende Wendung des humanistischen Abschnitts innerhalb der Renaissancebewegung. Nur durch die Erleichterung, die die Herzen und Sinne infolge dieser Lockerung spürten, ist das ungeheure Lachen zu erklären, das von dem zentralen literarischen Ereignis in jener Zeit ausgelöst wurde, von den ›Dunkelmännerbriefen‹. Denn der Witz in diesen, zugegebenermaßen recht geschickt gemachten ›Briefen‹ ist so dürftig, daß er allein das gewaltige Lachen und die Befreiung, die von ihm ausging, nicht zu rechtfertigen vermag. Man lachte nicht über die primitiven Witze, sondern darüber, daß es plötzlich »eine Lust war, zu leben«. Es war ein politisches Lachen, eine Art Kriegs- oder Trotzlachen, ein quasi-programmatisches Lachen aus endlich befriedigtem Haßgefühl. Ich gestehe offen, daß ich nicht mitlachen kann, daß mich die Lektüre dieser berühmten ›Briefe‹ ihrer Witzlosigkeit wegen immer nur melancholisch gestimmt hat, sooft ich zu ihnen griff. Und dabei lache ich gern und gut. Ich wüßte nicht, daß ich dem noch so hanebüchenen Humor bei Chaucer, bei Rabelais, im Don Quixote, in den besseren Geschichten des Boccaccio irgend etwas an Dienstwilligkeit schuldig geblieben wäre. Bei den ›epistolae obscurorum virorum‹ aber versage ich, obwohl ich durch so gute Autoren wie D. F. Strauß, Ludwig Geiger, Walther Brecht Unterweisung über die spezifische Art der Komik dieser ›Briefe‹ empfangen habe. Das Ergebnis: ich lache nicht, – aber ich weiß doch oder glaube zumindest zu wissen, warum die andern, die Zeitgenossen der Umwälzung, gelacht haben. – Das ist wohl auch etwas wert.