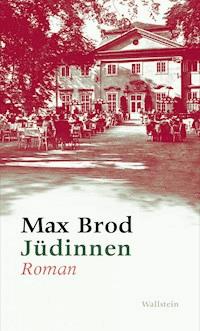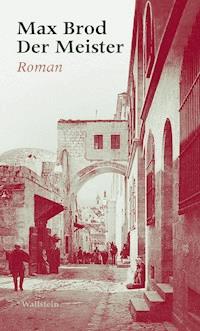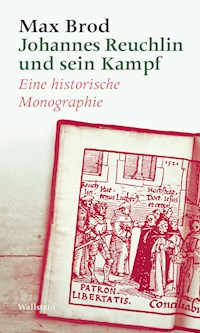Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Max Brod - Ausgewählte Werke
- Sprache: Deutsch
»Ein Vademecum für Romantiker unserer Zeit" ist der Untertitel der Sammlung von Essays, die Max Brod mit 29 Jahren 1913 bei Kurt Wolff in Leipzig veröffentlichte. Die Verbindung von Romantik und Moderne kommt in dieser Sammlung nirgends deutlicher zum Ausdruck als in dem brillanten Essay zu Robert Walser, dessen Größe zu dieser Zeit kaum jemand sah. Doch es sind nicht zuletzt die kleinen Dinge des Alltags, die den Flaneur Brod entzücken: die kitschige Wiener Historienmalerei, die ihn erregt, wiewohl er sie ablehnt, die modernen Möbel, die dem Benutzer eine Lebensweise aufzuzwingen versuchen, das veraltete Kaiserpanorama, das den Zauber der Kindheit wiederbringt, und die okkultistischen Sitzungen mit Gustav Meyrink, die ihn beeindrucken. Es ist der Reiz der Oberfläche, der ihn fasziniert. Brod begegnet allem vorurteilsfrei und zeigt eine intellektuelle Beweglichkeit sowie eine Ironie, die auch vor ihm selber nicht haltmacht. Ergänzend zu dem 1913 erschienenen Buch enthält der Band noch viele weitere, teils erstmals wiederveröffentlichte Essays, u. a. aus dem »Prager Tagblatt".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Max BrodAusgewählte Werke
Herausgegeben von Hans-Gerd Kochund Hans Dieter Zimmermannin Zusammenarbeit mit Barbora Šramkováund Norbert Miller
Max Brod
Über die Schönheithäßlicher Bilder
Essays zu Kunst und Ästhetik
Mit einem Vorwortvon Lothar Müller
Gefördert von der Fritz Thyssen Stiftung Köln und unterstützt vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds sowie dem deutschen Auswärtigen Amt
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet
diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2014
www.wallstein-verlag.de
Vom Verlag gesetzt aus Aldus Roman
Umschlaggestaltung: Susanne Gerhards, Düsseldorf
unter Verwendung des Fotos »Exhibition of the amateur painters«
(Roger-Viollet/Maurice Branger) © ullstein bild
Druck und Verarbeitung: Hubert & Co, Göttingen
ISBN (Print) 978-3-8353-1342-2
ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-2536-4
ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-2537-1
Inhalt
Vorwort(Lothar Müller)
Über die Schönheit häßlicher Bilder (1913)
Über die Schönheit häßlicher Bilder
Gegen moderne Möbel
Der Frauen-Nichtkenner
Der allerletzte Brief
Zufällige Konzerte
Mein Tod
Unter Kindern
Der Ordnungsliebende
Panorama
Kinematographentheater
Notwendigkeit des Theaters
Torquato Tasso
Bewegungen auf der Bühne
Die Liebe wacht
Louskáček
König Wenzel IV
Weiße Wände
Untergang des Dramas
Ideen für Ausstattungsstücke
Illusion
Die Vorstadtbühne
Das Wunderkind
Im Chantant
Liane de Vriès
Höhere Welten
Kommentar zu Robert Walser
Verworrene Nebengedanken
Meyerbeer
Gustav Mahlers dritte Symphonie, von ihm selbst dirigiert
Sechste Symphonie von Gustav Mahler
Kleine Konzerte
Smetana
Das Berlioz-Theater
Weitere Essays zur Kunst und Ästhetik (1906-1968)
Zur Ästhetik (1906)
Eine neue Theorie der Kritik (1906/07)
Zirkus auf dem Lande (1909)
Flugwoche in Brescia (1909)
Ein Besuch in Prag (1909)
Der Wert der Reiseeindrücke (1911)
Axiome über das Drama (1911)
Eine Pragerin (1911)
Meditation über Eifersucht (1922)
Das verkannte Genie (1922)
Der Biograph (1922)
In memoriam Hašek (1923)
Bei Casanova in Dux (1925)
Schallplatten (1927)
Etwas Unerklärliches (1929)
Piscator und Schwejk (1929)
Liebe im Film (1930)
Bühnenperspektive (1936)
Umgang mit Büchern (1937)
Von Sinn und Würde des historischen Romans (1956)
Umgang mit Verlegern (1968)
Nachwort(Peter-André Alt)
Editorische Notiz
Über den Autor
Register
Vorwort
Mit einer gewissen Nonchalance gibt Max Brod im Jahr 1911 in der Zeitschrift Pan Auskunft über seine Weltanschauung: »Ich bin weder Spiritist noch Antispiritist, weder Antitheosoph noch Theosoph. ›Welcher Weltanschauung gehören Sie also an?‹ Ich bin Literat.« Mit dieser Pointe beginnt der kleine Essay »Höhere Welten«, in dem Gustav Meyrink auftritt, als ein Cicerone im Reich des Okkulten, und Max Brod selbst in eine spiritistische Gesellschaft gerät, die sich zum Tischerücken und Geisterbeschwören um ein Medium versammelt, das in Prag ein gewisses Aufsehen in den interessierten Kreisen erweckt hat. Was macht ein Literat, wenn er auf ein Medium trifft? Er macht daraus ein Feuilleton. Wie er das macht, kann man in diesem Band nachlesen. Schauen wir uns aber zuvor die Visitenkarte etwas genauer an, die er in der Anfangspointe gezückt hat. Als Max Brod ein Junge von elf Jahren war, 1895, gab der Brockhaus die Auskunft, der »Litterat« komme vom lateinischen »Litterator« und sei »ein Gelehrter, im speziellen ein Schriftsteller von Beruf«. Im Jahr 1904, als der zwanzigjährige Max Brod in der Zeitschrift Jugend mit einem Essay zum Thema ›Religion‹ debütierte, war der Literat schon auf dem Weg zu einer luftigeren Existenz, seine lateinische Herkunft begann zu verblassen, und um 1910 war der Literat für einen ernsthaften Gelehrten wie Max Weber zur wissenschaftlich nicht mehr satisfaktionsfähigen Kontrastfigur geworden. Ihm war nun alles mögliche zuzutrauen, und der Schriftsteller Jakob Wassermann eröffnete sein Buch Der Literat oder Mythos und Persönlichkeit (1910) mit den Sätzen: »Der Literat, ein geheimnisvoll beschlossenes Wesen, hat der Kultur unserer Zeit seinen unverwischbaren Stempel aufgeprägt. Ja, man könnte sagen, daß alles, was sich heute gemeinhin unter dem Titel Kultur begreift, ein Werk des Literaten ist.« Sehr schmeichelhaft ist das Porträt nicht, das Wassermann von diesem Geheimwesen zeichnet, in dem sich der Dilettant und der Tribun, der Psychologe, der Apostel und der Schöngeist vermischen und das so sehr Ausdruck der modernen Zeit ist, daß selbst der schöpferische Mensch seiner Allgegenwart Tribut zollen muß. Das Jahrhundert ist noch jung, als der Literat zur zeittypischen Figur zu avancieren beginnt. Noch wird dabei in verschiedene Richtungen improvisiert, Thomas Mann zum Beispiel nähert ihn in seinem Essay »Der Künstler und der Literat« (1913) dem Propheten an, aber schon bald in den Betrachtungen eines Unpolitischen wird er ihn zum »Zivilisationsliteraten« machen und damit zu seinem künftigen Profil entscheidend beitragen. Schon ehe er zum »Asphaltliteraten« wird, ist der Literat eine durch und durch unmetaphysische Natur, seine Stammheimat ist das Kaffeehaus, und wenn er es verläßt, geht er in die Redaktion oder ins Theater. Schriftsteller von Beruf wie einst im Brockhaus kann er immer noch sein, aber zumindest im Nebenberuf ist er auch Journalist. In den antiurbanen und antimodernen Polemiken wird er zu einem beliebten Haßobjekt werden.
Max Brod hat seine schriftstellerische Karriere als selbstbewußter Literat begonnen. In der Entfaltung seiner Autorschaft mögen Romane wie Schloß Nornepygge (1908), mit dem er Furore machte, Schlüsselereignisse sein. Aber sie beruhen auf der hohen Frequenz, mit der er zu den Zeitungen und Zeitschriften beiträgt, in denen die Gegenwartsliteratur des frühen 20. Jahrhunderts ihre Tendenzen erprobt, ausprägt und debattiert, ehe sie die feste Gestalt des Buches annimmt. Max Brod hat bis zum Frühling 1939, als er vor dem Nationalsozialismus nach Palästina floh, in Prag seinen festen Wohnsitz gehabt. Aber von Beginn an war seine Autorschaft an ein Publikum weit über Prag hinaus adressiert, an die gesamte deutschsprachige Öffentlichkeit. Die Zeitschrift Gegenwart, für die er in jungen Jahren viel schrieb, saß in Berlin, nicht anders als der von Paul Cassirer neu begründete und von dem jungen Journalisten Wilhelm Herzog redigierte Pan, in dessen erstem Jahrgang 1910/11 er an der Eingangstür zu den ›Höheren Welten‹ des zeitgenössischen Okkultismus die Visitenkarte des Literaten zückte. Bis in die 1930er Jahre hinein wird diese publizistische Achse Prag – Berlin stabil bleiben, und bei den nicht seltenen Reisen nach Berlin wird er in Leipzig Station machen, wo der Kurt Wolff Verlag seinen Sitz hat, in dem er 1913 das Jahrbuch Arkadia herausgibt und Franz Kafka seine ersten Bücher publiziert. Früh wird er Kontakt zur Neuen Rundschau des S. Fischer Verlages in Berlin suchen, dem Zentralorgan der literarischen Moderne in Deutschland, in der ebenfalls in Berlin ansässigen Schaubühne Siegfried Jacobsohns wird er häufig auftauchen, rasch wird er Zugang suchen und finden zu den Zeitschriften der expressionistischen Avantgarde in Berlin, zur Aktion Franz Pfemferts und dem Sturm Herwarth Waldens. Es gehört sich für einen Literaten, Fehden nicht zu scheuen, und so wird er 1911 in der Aktion in der Fehde zwischen Karl Kraus und Alfred Kerr für letzteren Partei ergreifen, Karl Kraus wiederum wird ihn unter die kleinen Literaten einreihen und sich über seinen Roman Jüdinnen in aufgespießten Zitaten lustig machen.
Es ist für einen Literaten nicht ungehörig, die Technik der Mehrfachverwertung zu beherrschen. Max Brods Feuilleton über den Wert der Reiseeindrücke erscheint zuerst in der Frankfurter Zeitung und dann noch einmal im Prager Tagblatt. Der Aufschwung des deutschsprachigen Feuilletons im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts ist die Bedingung sowohl für eine einigermaßen stabile ökonomische Existenz des Literaten wie für seine Ausgestaltung zur zeittypischen Figur in einer Unzahl von Essays, Satiren und Polemiken. Brod war von 1929 bis 1939 Redakteur des Prager Tagblatts, auch das ist eine Hintergrundvoraussetzung seines rund 1500 Artikel umfassenden journalistischen Werkes. In Auswahlbänden wie Über die Schönheit häßlicher Bilder (1913) und Sternenhimmel (1923) ist nur ein Bruchteil davon eingegangen. Im vorliegenden Buch sind zudem Beispiele für das publizistische Werk Brods nach 1945 eingegangen, so der Essay über den historischen Roman aus der Neuen Rundschau des Jahrgangs 1956 und die Bemerkung über den Umgang mit Verlegern, die in seinem Todesjahr 1968 erschien, in der Zeitschrift Der Literat.
Berühmt geworden ist Max Brod schließlich auch durch seine Funktion als posthumer Herausgeber der Werke Franz Kafkas. Er war aber schon zu Lebzeiten dessen Impresario, und dies nicht zuletzt im Umgang mit den Zeitschriften und Zeitungen. Seinen eigenen Artikel »Flugwoche in Brescia«, der in diesem Band wieder abgedruckt ist, hatte Brod ursprünglich in der Neuen Rundschau in Berlin unterbringen wollen. Als deren Redakteur Oscar Bie die Publikation ablehnte, gab er ihn an die Münchner Halbmonatsschrift März. Zu dem »Wir« dieses reportageartigen Textes zählen neben dem »Ich« des Autors »Otto und Franz«, »die mit mir sind«, Max Brods Bruder Otto und Franz Kafka. Das Gegenüber zu Brods »Flugwoche in Brescia«, Kafkas »Die Aeroplane in Brescia«, erschien Ende September in der Prager Tageszeitung Bohemia, der vernetzte Literat Brod, der mit dem für Literatur zuständigen Redakteur der Bohemia, Paul Wiegler, gut bekannt war, hatte den Abdruck vermittelt. Nicht ohne Grund hatte Brod die Idee, den Artikel Kafkas, als Pendant zu seiner »Flugwoche in Brescia« in seinen Auswahlband Über die Schönheit häßlicher Bilder aufzunehmen. Er hätte dort gut hineingepaßt, denn er gehörte zu der von der Nachwelt oft übersehenen Seite im Schreiben Kafkas, die dem Journalismus zugewandt war und auf die er zeitweilig seine Hoffnung gründete, nach Berlin gehen und dort eine publizistische Existenz aufbauen zu können. Ein Veto Kurt Wolffs, dem der Band ohnehin schon zu umfangreich war, verhinderte diese Parallelaktion. Sie hätte zum ersten vollständigen Abdruck von Kafkas Artikel geführt, in dessen Mittelpunkt nicht anders als in Brods Text das reportagehafte »Wir« und damit eine Konvention des zeitgenössischen Journalismus steht. Denn in der Bohemia waren Kafkas »Die Aeroplane in Brescia« mit erheblichen Kürzungen durch einen offenkundig erfahrenen Redakteur erschienen. Sie führten nicht dazu, daß Kafka den Text nicht mehr als den seinigen anerkannt hätte. Gegenüber Felice Bauer bezeichnete er die Druckfassung als »erträglich«.
Als Mitbringsel von einer Reise wie von seinem Stoff her und durch seine Publikationsgeschichte ist der Artikel »Flugwoche in Brescia« charakteristisch für den Literaten Max Brod. Er zeigt ihn als Netzwerker wie als Feuilletonisten, der sich auf die Artikel zur Ästhetik, Berichte aus dem Theater – und aus dem Kino, bis hin zur Schwelle zwischen Stummfilm und Tonfilm –, aus dem Musikleben und der literarischen Welt nicht beschränkt, sondern immer wieder Zeitereignisse, Moden, technische Neuerungen etc. aufgreift und Plaudereien darüber nicht scheut, wie Soubretten eine Bühne betreten.
Es gibt in dieser Vielfalt der Stoffe und Motive eine Grundlinie, die auch im vorliegenden Band greifbar wird: Wie die Zeitung, für die er vor allem schrieb, das Prager Tagblatt, gehört Max Brod zu den wichtigen Vermittlern zwischen der tschechischen und der deutschen Kultur in Prag, von der Zeit vor dem ersten Weltkrieg bis hinein in die erste tschechische Republik. Dazu gehören seine Würdigungen des kaum bekannten Jaroslav Hašek und seines Romans Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk, der zunächst als Fortsetzungsroman in einer Zeitung erschien, ebenso wie sein beharrliches Eintreten für den Komponisten Leoš Janáček. In Prag standen sich aber nicht nur die deutsche und die tschechische Kultur gegenüber: Es kam die dritte Facette hinzu, der Brod selbst – wie sein Freund Kafka – entstammte: das jüdische Prag. Es gewann in der publizistischen Tätigkeit des Literaten Max Brod erst ab 1913 an Bedeutung, als er sich zu einer Schlüsselfigur des Prager Kulturzionismus zu entwickeln begann. Zeitschriften wie die seit 1907 in Prag erscheinende Selbstwehr und die Monatsschrift Der Jude, die Martin Buber ab 1916 in Berlin und Wien herausgab, bezog er seitdem in sein Netzwerk ein. In seiner Autobiographie Streitbares Leben (1960) und vor allem in seinem Buch Der Prager Kreis (1966) hat Brod selbst vor allem diese Linie akzentuiert, die von Prag nach Jerusalem führt. Um sie herum sind die Debatten gruppiert, in denen es um Weltanschauliches im substantiellen Sinne geht. In diesem Buch steht die andere Linie im Vordergrund, in der das Wort »Weltanschauung« das Programm des Literaten meint, allem, was er sieht und hört, das Berichtenswerte, Auffällige, für das Tagespublikum Interessante abzumerken und aufzuschreiben: »Ich gestehe von vornherein und mit Stolz, ich bin Literat, ich interessiere mich auch für ›Höhere Welten‹ nur literarisch. – Kommt einer und predigt mir, daß die ganze sinnliche Welt nur Schein ist, daß es ganz andere Dinge gibt, die zu sehen für mich von der allerhöchsten Wichtigkeit ist, ja die nicht zu sehen mich in ewige Verdammnis stürzen wird, – so werde ich nicht umhin können, die seltsame Haarformierung und Frisur etwa dieses Drohenden in erster Linie, als Hauptsache zu beobachten und im Geiste unwillkürlich die treffenden Worte und Vergleiche dafür zu suchen. Ganz einfach: er stellt mich in seine übersinnliche Weltanschauung, ich ihn in meine literarische.« Was Brod hier die literarische Weltanschauung nennt, ist die Kunst der Isolierung und Reflexion des Details, der Lektüre der Oberfläche, des Ausspinnens von Paradoxen und Pointen, des Flirts von großer Stadt und kleiner Form. Subjekt dieser Weltanschauung ist ein »Ich«, das nicht selten sich selbst an den Beginn eines Feuilletons setzt, gern mit dem Leser ins Gespräch kommt und ihm, wenn er ein treuer Leser ist, alles mögliche verrät. Darum kennt er am Ende dieses Buches nicht nur das Geburtsdatum Max Brods, sondern auch seine zeitweilige Wohnungseinrichtung und die junge Balletteuse, die ihm einmal in einer Weinstube gewisse Regionen ihrer Beine zeigt.
Lothar Müller
Über die Schönheithäßlicher Bilder
Ein Vademecum für Romantikerunserer Zeit
Über die Schönheit häßlicher Bilder
»Ach, warum ist nicht alles operettenhaft.«Laforgue.
Noch heute, wenn aus der bronzierten Netzfläche einer Dampfheizung lauer Hauch von ungefähr mich befällt (o Erinnerung, erfolgreiche Schmutzkonkurrentin des Gegenwärtigen!) … dann fällt mir jene Kunstausstellung im Künstlerhaus zu Wien ein, die mich erzogen hat. Das war reizend, damals. Schon unterwegs im rauhen Märzwind der Straßen, der allen Damen längs empörter Frisuren die Hüte in die Höh’ trieb (Balzac würde sagen: In diesem Wind, der für Wien ebenso charakteristisch ist wie usf.) … schon unterwegs freute ich mich auf dieses Künstlerhaus, das ich mir warm und nach seinem Namen als einen Versammlungsort hochgemuter Künstlerrecken vorstellte, ja lauter solcher Tiziane, die dort auf und ab gehn, patrizisch, und in Prunkwämsern ohne Farbflecke mit Königen Gespräche führen. Doch ich war kaum enttäuscht, als ich nur Bilder vorfand, Bilder ohne Zahl, und an manchen Stellen der Wand zwischen zwei Bildern diese braven Siebe der Zentralheizung, die unversehens mit Garben tropischer Witterung überschütten. Ich blieb immer zwischen den Bildern. Aber meine Gefährtin war von künstlerischen Entzückungen schon umzingelt, attackiert, überwältigt. Die Luft deutlich gemalter Sonnenuntergänge atmete sie, wiewohl in dieser Luft fettglänzende Wolken aus Himbeerlimonade hingen, mit Vergnügen ein, sie fuhr in sauberwuchtige Fjordkulissen, wurde durch Charlie Stuarts Hinrichtung erschüttert zugleich und belehrt … »Aber das ist doch lauter Kitsch! Wie kann Ihnen so etwas gefallen?« rief ich lächerlich-ernsthaft, indem ich meiner durch Wärmebedürfnis erklärbaren Stellung ein satirisches Cachet zu geben bemüht war. Sie sah mir gekränkt zu und ging in den nächsten Saal. Ich folgte … Auch hier Korbsessel, Teppiche, Palmen, Oberlicht, und an den Wänden führten Schutzengel mit aufgereckten Gänseflügeln kleine Mädchen über Stege unpraktischer Bauart, ein Lohengrin, dessen Bewegungen trotz seines Silberpanzers wie unter geselligstem Frack sich zierten, küßte sein kokettes Elschen, nebenan sagten gesund und doch melancholisch aussehende Handwerksburschen in vormärzlichen Kostümen ihrer aber schon sehr poetischen Heimatstadt Ade, blondeste Backfische, rosarot, frisch vom Konditor, hatten Noten und eine Lyra und einen auch im Schlafe blassen Dichter, den sie amüsant bekränzten, auf Schneelandschaften (weiß, fraise, perlgrau) erschienen krächzende Raben durch das ein für allemal feststehende Zeichen zweier aneinander gefügter Beistriche angedeutet, und das Exotische war vertreten durch Beduinen, Schwerttänzerinnen, slowakische Bauern, Szenen aus Buchara, Zentauren im Galopp, Fellahfrauen neben den bekannt schrägen Raen der Nilbarken. Ja, dieser Orient, das ist doch noch was … Indes mit mehr als meinem Tone der Entrüstung »Und das gefällt dir nicht?« führt mich meine Gefährtin vor die reizendste Zofe der Welt, die ihr Händchen so geschickt hinter eine Kerze zu halten weiß, daß die heraufsteigenden Lichtstrahlen rotgelb ihr Gesicht schminken … Und nun bin ich besiegt, nun gefällt mir schon alles. Ich vergesse die Franzosen, den Fortschritt, Meier-Graefe, die Verpflichtungen eines modernen Menschen. Schon zurückgetaucht in Jahre unverantwortlicher Jugend, freue ich mich über die Zahnlosigkeit eines gutmütigen Mönches, der rechts-links umflochtene Weinflaschen an sich preßt, wie einfach-menschlich; und bin verblüfft von glattlasierten Schlachten, den sorgfältigblutigen Kopftüchern der Verwundeten, den sauberen Reitersäbeln. Und »Rast im Manöver« heißt es, wenn auf Tornister gepackte Blechgefäße grau dem grauen Straßenstaub entgegenblitzen. Und deutlich strichliertes Schilf wächst »vor dem Gewitter« aus zinnweißen Reflexen eines Sumpfspiegels. Am Klavier wird Abschied genommen, für ewig vielleicht. Rosen lösen sich welkend aus Wassergläsern. Kühe ruhen im Grünen. Miß nur, kleines Mäderl, wer höher ist, du oder euer Barry …
Seit damals liebe ich die Behaglichkeit, die bewußtlose Grazie schlechter Bilder, diese Ironie, die von sich selbst nichts weiß, diese Eleganz der unbeabsichtigten Effekte. Wie ärmlich stellen sich seriöse Bilder daneben dar, die den Geist des Beschauers in eine einzige, vom Künstler eben gewollte Richtung drängen. Sie sind so eindeutig, so vollkommen, so häßlich … die schönen Bilder. Aber Wonnen eines triebhaften Balletts, die unwillkürliche, unausschöpfliche Natur selbst, das Chaos und urzeitliche Zeremonien lese ich aus Annoncenklischees, Reklamebildern, Briefmarken, Klebebogen, aus Kulissen für Kindertheater, Abziehbildern, Vignetten; mich entzückt die Romantik des Geschmacklosen.
Seit damals sind die Plakate an den Straßenecken meine Gemäldesammlungen. Da steht und zeugt für »Laurin & Clement« ein rotes Prachtautomobil, bewohnt von Herr und Dame in totschicker Dreß, steht vor einer gelben Gebirgslandschaft aus aufgetürmten Rühreiern. Der Herr scheint mit eleganter Handbewegung dieses seltene Naturschauspiel der Dame zu präsentieren, die indes, ungerührt von den Blicken aus seiner imposanten Schutzbrille eines Tauchers, ihren Schleier mit spitzer Nase zu zerstechen sucht … Ein Chamberlain mit Monokel und imperialistisch-frechen Mundwinkeln macht auf die Eröffnung eines Herrenkonfektionsgeschäftes geziemend aufmerksam … Nicht ganz so glücklich führt sich »Altvater Jägerndorf« durch einen triefäugigen Greis, mit Federbarett und Grubenlampe jedoch, ein … Werden wir dieser arglos hochgeschürzten Galathea, dem witzreich verzeichneten Knaben einer Varieté-Affiche widerstehen? … Und nieder auf die Knie, die Knie vor dem Porträt Zolas, vor seinem Stirnknittern, das dem Autor ernster Bücher wohl ansteht, und das ein einsichtsvoller Plakatkleber durch besonders runzliges Ankleben gerade dieses Plakates noch verstärkt hat … Falls du immer noch die Wirkung dieser wahrhaft primitiven Kunst anzweifelst, schwebt schon, nicht um zu strafen, nein, um sanft zu überreden, ein Genius herbei, massiv, doch jungfräulich, in ein aus Bolero und Chiffon kombiniertes Kleid gehüllt und mit unbeteiligt-symmetrischen Flügeln, während wilde Falten den unteren Gewandsaum wegblasen. Er verkündigt »Maifestspiele«, schleudert in der Linken einen Kranz nach vorn und, um sich im Gleichgewicht zu erhalten, hat er den rechten Arm eingeknickt, wobei ihm freilich das Versehen geschieht, die Posaune statt an den Mund ans Ohr zu setzen, so daß sie einem pompösen Hörrohr ähnelt. Doch scheint dies kein unpassendes Symbol, da er so vortrefflichen Opern, die er anzeigt, auch wohl selbst zu lauschen Lust bekommt. Und unbekümmert um all dies jedenfalls dringt er in die Photographie des Theatergebäudes ein, trotz sichtlichen Gegenwindes, und obwohl das Licht verwirrend genug ihn von links, das Theater von rechts bestrahlt.
Glückselig darüber, daß nicht immer die Physik das letzte Wort behält, wende ich mich weiteren Kunstgenüssen zu. Sie warten in allen Auslagen, diese zauberhaften Offenbachiaden des Lebens, auf mich. Die Parfümerien stehen im Farbenschmuck so schematischer Blumen, daß man »Kinder Floras« mit Lächeln sie zu nennen versucht ist … Van Houtens Kakao ist schon undenkbar ohne diese etwas nördliche Dame, die im Eisenbahnkupee vornehmer Klasse einer trostlosen Winteröde den Rükken kehrt, um desto neckischer ihr Lieblingstäßchen zu schlürfen, de smakelijkste, in’t Gebruk de vordeeligste. Klingt es nicht wie das phantastische Deutsch eines ganz souveränen erstklassigen Schriftstellers? Lustig, lustig … In einem Seidengeschäft ist die »Wiener Mode« aufgeschlagen. Was für seltsame, von mystischen Rhythmen beherrschte Gestalten, und die Gesichter offen, klug, unschuldig, wie eben aus der »Wiener Mode« … Papierfirmen stellen Ansichtskarten aus, lustig, lustig, diese verschneiten Kapellen im Walde, die photographierten Liebespaare im Fortschritt der Situationen, harmlose Ostergrüße, als Hasen verkleidete Kaninchen, operettenhafte Alpengletscher, Leid und Freud, Schusterbuben, Villa Miramare, handkolorierte Unwahrscheinlichkeiten … Und der Delikatessenhändler nebenan. Wie drollig zieht das Baby seinen Karren voll von Schokolade Suchard, wie abenteuerlich und unkontrollierbar wird auf diesen Päckchen der Tee gepflückt. Von einer Weinflasche schwingt ein Herrenreiter höflich uns den Zylinder entgegen, Spanierinnen verführen von Konservenbüchsen herab, an Bonbonnieren treten wie in einer Zauberposse Feen und Ritter auf, der Karlsbader Sprudel plätschert auf jener Kolonne von Oblatenschachteln sechsfach dazu, manche Schnapsfabrikanten ziehen Berglandschaften, andere den biederen Jäger vor, der die Pfeife auf den Holztisch stemmt, Herolde verkünden den Ruhm deutschen Schaumweins, während Biscuits Pernod mit ihren rothosigen piou-pious Deutschland okkupieren.
Ich gehe heim, verlasse das populäre Ausstattungsstück des Täglichen. Doch auch noch zu Hause habe ich Unterhaltung genug, die Phantastik der Zigarettenschachteln, die Etiketten auf Parfumflaschen, märchenhafte Vaudevilleszenen auf Briefkassetten und Wandkalendern, Diplome, Reiseandenken …
Und gar die geliebte Mappe japanischer Holzschnitte .. Halt! Zurück! … Japanische Holzschnitte sind doch anerkannt schön! Mir scheint, da habe ich etwas sehr Blamables gesagt (»gesagt« ist Ziererei … nein, geschrieben) … Doch die Grenze zu ziehen, das ist die Schwierigkeit dieser an sich so einfachen Sache.
Und ich sehe schon, daß die gesamte Menschheit nichts dringender bedarf als mein neues System der Ästhetik, das ich gewissenhaft und mit fast barbarischem Fleiß schon lange schreibe, jedoch an meinem fünfzigsten Geburtstage erst, das ist am siebenundzwanzigsten Mai 1934, herauszugeben felsenfest entschlossen bin. Indes bin ich schon vorher für Abordnungen der durch diesen Aufsatz besonders in Verwirrung versetzten Erdstriche zu sprechen, täglich zwischen drei und vier. Um diese Stunde sitze ich sehr behaglich zu Hause und spiele Karten mit zwei gleichgesinnten Freunden. Ach die Feerie dieser Bildchen auf den Karten übertrifft doch alles. Lockige Burschen mit müden, träumerisch-verschauten Augen turnen, kreuzen ein Schwert und ein stumpfes Rapier, trommeln, flöten, tragen stolz ihre weißen Halskrausen, die gestickten Westen. Auf Rot-Zehn schaut ein Amor ins Publikum und trifft dennoch seitlich das zinnoberrote Herz. Welches Lied spielst du, Knabe, in merkwürdiger Tracht, deinem treuen Hunde vor? Gravitätische Könige, würdevoll trotz der zu kurzen Beine, wo sind eure Untertanen, eure chimärischen Länder?… Dann legen wir den Skat weg. Und in den Taroks mit ihren Sarazenen, Albanesen auf Vorposten, mit Csardastänzerinnen, Liebespaaren in Fez und Jägerhut, jugendlichen Eheleuten, die an der Schalmei sich ergötzen, mit Wahrsagerinnen und edlen Rossen umgibt uns der Zauber der Levante, Lord Byrons, die abenteuerliche Luft der Türkenkriege, vielleicht der Kreuzzüge. Uns belustigt der heraldische Aar, der wütend seine altertümliche Devise in den Klauen hält: »Industrie und Glück.« Wir zittern für das Schicksal der edlen Dame, die zögernd den Gondoliere nicht anblickt und doch so gern entführt werden möchte …
Gegen moderne Möbel
Ich habe mich mit modernen Möbeln im Grunde ebensowenig ernstlich befaßt wie mit den andern Dingen, über die ich so schreibe. Ich gehe meines Weges und denke eigentlich über ganz andre Sachen nach, zuweilen aber fällt mir hier und dort etwas wie zwischen zwinkernden Augenlidern auf, und dann notiere ich es, mögen andre zusehen, wie sie damit fertig werden. – Dies alles soll nicht etwa ironisch aufgefaßt werden. Ich glaube nämlich, daß in mancher Beziehung die oberflächliche Meinung wirklich besser ist als die fachmännische. Wir improvisieren nicht ohne Grund.
Gegen moderne Möbel nun trage ich seit langem eine merkwürdige Art von Haß in mir, nicht gerade gierig, eher übersättigt … nun, man wird sehen. Ich will der Einteilung wegen bemerken, daß ich moderne Möbel a) aus Zeitschriften, b) aus Möbelausstellungen und c) aus bewohnten Räumen kenne – und habe somit den Schein der pedantischen Wissenschaft nicht minder als den des Leichtsinns schon auf mich geladen. Sehe ich nun diese Zeitschriften, deren Titel man sich durch beliebiges Zusammensetzen der Worte »Kunst«, »Kunsthandwerk«, »Innendekoration« und so weiter selbst bilden kann, so habe ich sofort die Zwangsvorstellung: »Das muß man überblättern.« Als solche erkannt, veranlaßt mich nun diese Zwangsvorstellung just zum bedächtigen Lesen und Bilderanschauen, da haben wir das Malheur. Und obwohl ich dieses abwechslungslose Zeug längst schon kenne: stets wieder stehe ich vor Villen, denen übermächtige Schindeldächer wie Hauben über das Gesicht gerutscht sind, wie Zylinderhüte über den kleinen Gernegroß. Und wieder trete ich, vor Langeweile meine Zunge mit den Zähnen zerpflückend, in diese Vorhallen oder Dielen, wo dieselbe schamlos freistehende Treppe auf denselben Kamin herabsieht … Kurz, um es gleich hier zu sagen, wir sind einer Konvention imitierter Renaissance entflohn, aber sofort in eine andre Konvention geraten, die bedeutend unangenehmer ist, weil sie »guter Geschmack« sein und bleiben will … Hier einige Grundeinfälle unsrer Raumkünstler, die sich zum Überdruß wiederholen: Die Wände sind mit spiegelnden Holzplatten belegt. Dazwischen hängen ein paar Bildchen, wie gemaßregelt, in Rahmen von jener impertinenten Einfachheit, die das Aufdringlichste ist, was es gibt. Hier und dort in Vasen verteilte Bäume sollen leben, aber sie erfrieren sichtlich. Um den Kamin schart sich etwas aus farbigem Marmor, Blöcke und leere Flächen, dann ein Dächlein aus Metall. Niemals fehlen Sitze, in Nischen eingebaut, von der ungemütlichsten Gemütlichkeit, zu dünn oder zu dick bepolstert; ich weiß nicht, was mich stört. Gibt es denn in diesen Familien immer etwas zu erzählen, wozu das lodernde Herdfeuer traulich paßt? Oder stehen diese Sitze leer, noch ärger!… Schaudernd treten wir in das Herrenzimmer. Ich will die Klubfauteuils nicht bemerken, sie machen es mir zu leicht. Aber diese Beleuchtungskörper, offenbar vom Juwelier, nicht vom Klempner, mit Ringen, rasselnden Ketten, strengen, geschlossenen Fransenröckchen. O Gott, speit niemand aus vor dieser erlesenen Kultur! Oder diese immerdar in die Wand versenkten Bücherkästen, hat noch niemand das traurige Einerlei dieser Novität bemerkt! Da findet sich immer Glas, dahinter schräge, müde Buchrücken wie Kornfelder nach Hagelschlägen, und immer das Glas durch schmale Holzstäbe in Rechtecke und Rhomben zerlegt. Rhomben, das ist die Hauptkunst unsrer Wohnungskünstler. Rhomben und auf die Spitze gestellte Quadrate, die in ein Netz von Meridianen und Parallelkreisen, mehr oder minder dicht, Abwechslung bringen sollen: wer befreit uns von dieser Tyrannei! Und wer zerbricht endlich diese Rähmchen- und Fensterl-Kultur, deren Vertreter nur darin originell sind, daß sie die unerläßlichen Stäbchen bald kantig, bald gerippt, bald glattgerundet anzufühlen machen … Gehn wir weiter, über die Treppe etwa, deren Geländer als Gitter derselben ewigen Vertikallineale wie eine schräge Borte durch die Halle ziehen muß. Oben empfängt uns die moderne Schablonenveranda, unbarmherzig ein seichtes Kreissegment, die Fenster nahe beisammen, polygonal gestellt, die schmalen, vom Licht überfluteten Streifen zwischen ihnen durch die eingezogenen Vorhänge befahnt. Und wieder eingebaute Holzbänke, über ihnen breite Fensterbretter, Gesimse, und daß überall so viel bequemer Platz ist, Sachen hinzustellen und zu vergessen, das macht die Fadheit vollständig. Die Uhr versäumt nicht, an einen aufgestellten Sarg zu erinnern. Die Kredenz ist ein Grabmonument. Und daß alles so materialecht ist, daß man den Birkenwald so vor den Augen hat – es ist zuviel, es macht auf mich wenigstens den Eindruck eines ungeheuren Wasserkopfs. Ja, etwas Unheimliches liegt in der Behaglichkeit, etwas zu Fettes und zu Süßes, etwas wie verdorbener Magen. Und genau so kann ich mir nicht vorstellen, daß in diesem übertrieben hellen oder übertrieben dunklen Musikzimmer wirklich gute Musik gemacht wird.
Ich gelange zum Kern der Sache: Sollen Möbel schön sein? Kann man es wünschen, in einer Fuge von Bach zu schlafen und ein Gedicht von Goethe als noch so ästhetischen Speisetisch zu verwenden? – Nein, ich bin dafür, daß das Kunsthandwerk in seine ehemalige Verächtlichkeit zurückfalle, es verdient nicht mehr. Die Möbel seien bequem – und es lohnt sich nicht einmal, besonders lange über neue Bequemlichkeit nachzudenken. Aber wozu Brüsseler Weltausstellungen, Kulturtaten, wozu diese Pracht und dumme »angewandte Kunst« bei Sektkellereien! Ich bin dafür, geschmacklose Möbel in Massen zu fabrizieren – nicht aber der Menschheit einzureden, es lasse sich auch nur ein Funken der reinen, tugendhaften, göttlichen Schönheit, wie er etwa eine inspirierte Prosazeile Gottfried Kellers erleuchtet, so nebenher auch noch in Sesseln, Kredenzen und Türklinken einfangen. Ich will begeistert sein, edel, getragen, heroisch – nicht aber in einem lauen Mittelmaß abgetragener Ornamente und zimperlicher Vitrinen mit zufriedener fortschrittlicher Miene ausruhn.
Ich finde moderne geschmackvolle Möbel einfach unmoralisch. (Und nicht anders geschmackvolle Buchausstattungen, künstlerische Photographien, kurz: alle Mittelglieder und Vermittlungen zwischen Kunst und Alltag.)
Doch nein, etwas Schönes sind Möbelausstellungen, etwas phantastisch Schönes, von niemandem noch bemerkt. Da stehen in einem großen, prunkvollen Ausstellungspalais, in ganz kalten Riesensälen, in Nischen verteilt: nicht einzelne Möbel, nein, ganze Zimmereinrichtungen, den Blicken aller preisgegeben. Man ermesse die tiefe Komik und die Wehmut zugleich dieser Situation. Die Zimmer sind keine Zimmer, nur Nischen eines alten Riesensaales sind als Zimmer ausgebaut, und das soll man für ein gemütliches Zimmer halten. Für ein Kinderzimmer dieses hier, die Spielsachen sind auf dem Boden hingestreut wie von Kinderhänden, nicht von Arrangeurhänden – für ein Schreibzimmer dieses, der fleißige Herr ist nur für einen Moment hinausgegangen, seine junge, schöne Frau liebkosen etwa, und hat seine Feder im Tintenfaß gelassen, das offene Heft hier, die dicken, funkelnagelneuen Nachschlagewerke auf dem Regal – oder dieses für ein liebenswürdiges Speisezimmer, knapp vor dem Eintritt der Familie, alles ist schon zur Mahlzeit vorbereitet, schon die Themen der künftigen Unterhaltung lauern sprungbereit in den Schatten der Serviette, die man gleich, sofort entfalten wird. – Dieser Schein ist beabsichtigt. Und doch, wie anders, merkt es niemand, stimmt die Wirklichkeit. Traurige Zimmer, eure vierte Wand hat man eingerissen, und nun steht ihr, nur durch eine luftige, gewellte, rote Seidenschnur, durch schwache Stangen vom Gehweg getrennt, jeglichem Einbruch der Barbaren offen. Niemals werden die idealen Besitzer, deren Geister jetzt harmonisch euren unwesenhaften Raum bevölkern, niemals wird dieses märchenhafte, heroische, bescheidene Gedränge biedermännischer und ehrbarer Gestalten zwischen euren Sesseln schreiten auf zarten Teppichen, den Napf vom Ofen nehmen, in die Kanapeehöhlung sich hinflegeln. Sondern ein von euren Jugendträumen gewiß sehr verschiedenes Einzelindividuum wird euch roh kaufen, einpacken, in den Speditionswagen aufladen – und ade, reizvolles Nachdenken in ungewissem Licht. Denn auch diese Atelierbeleuchtung, die durch einen in ausgespannte Leinwand verdünnten Plafond fällt, werdet ihr aufgeben müssen, diese Aquariumsbeleuchtung, diese hellgelbe Teegebäck-Sonne. Man wird wahrhaftige Fenster in eure bisher noch geschlossenen Wände bohren, alles wird sich verändern. Traurige Zimmer, und man geht an ihnen vorbei, als wären sie schon jetzt gewöhnliche Zimmer. Indessen stehen sie auf Podien, jedes auf seiner mäßigen Holzerhöhung wie ein kleiner, wenig begabter Violinspieler, kein Virtuose etwa im Glanz der Konzerte, sondern ein armer Knabe, den reiche Verwandte für ihr Geld ins Konservatorium geschickt haben und der jetzt nach dem Diner vorspielen soll, etwas Eingelerntes mit mißklingenden Doppelgriffen. So warten sie und schauen die Betrachter an, beschämt im voraus vor lauter Angst. Und ist es da zu verwundern, daß sie ein wenig in Unordnung geraten sind, in künstlerische Verwirrung, ganz, ganz klein wenig in Lampenfieber? Nein, man kann nicht die normalen Verhältnisse von ihnen verlangen, wird sich nicht darüber bei dem diensthabenden Aufseher beschweren, daß hier eine Vase umgefallen ist – hier eine Decke sich mit dem Futter nach oben schlägt – in diesen auf Podien gestellten Zimmern. Überhaupt, alles ist ein wenig, nur unmerklich anders als im Leben. Eine gespenstische Mißwirtschaft hat sich in das sorgfältige Arrangement eingeschlichen, man kann kaum davon sprechen, z. B. daß dieses Zimmer einen Eindruck wie etwas Breitgequetschtes macht, jenes mit seinen Rosentapeten und Seidenfauteuils trotz vorgespiegelter Eleganz entfernt an eine Rumpelkammer erinnert, an ein staubiges Zusammengedrängtsein und Zugrundegehen … Ich erschrecke. Ich glaube vor hundert Bühnen zu stehen, wo schlechte Schauspieler, als Zimmer verkleidet, unwahre Grimassen schneiden. Zitternd laufe ich an der in meiner Hand gleichfalls zitternden Seidenschnur hinaus, ich freue mich des neuen, schrecklichen Gefühls – endlich haben moderne Möbel einen Eindruck auf mich gemacht!
Wenn ich sie aber im Leben sehe, im brauchbaren Tageslicht, dann muß ich doch nur wieder lachen.
Ich besuchte auf einer Reise mehrere Schriftsteller. Und überall fand ich diese geometrischen Regelmäßigkeiten, diese Glasscheiben, die nicht flach in den Rahmen sitzen, sondern vorher noch funkelnd sich abschrägen, ehe sie münden – es sind gleichsam keine Glasscheiben, sondern riesige, simpel allerdings geschliffene Brillanten. Und überall die flache Veranda, die Metallbeschläge, die Rhomben, die weißlackierten Kästen, die das Innere der Wand wie einen Berg Sesam öffnen … Ein Freund gar führte mich in sein von oben bis unten ganz schwarz gebohntes Bibliothekszimmer, wie eine Totenburg ragte der Bücherkasten auf, Fabrikat der »Wiener Werkstätten«. Die monumentale Einfachheit dieser Riesenkiste stimmte mich weinerlich, das muß ich schon sagen, diese Einfachheit hat zu sehr das Gigantische einer großen Geldbörse, nicht eines großen Menschen. Dieses Kolossale ist nicht wie das Meer, nicht wie eine unermeßliche Aussicht auf eine Landschaft hinab: es gleicht eher einer Fabriksmauer oder einem unliebenswürdigen Vorgesetzten im Bureau. Kurz, es macht keinen lustigen Eindruck. Aber dann, als man mir im Speisesaal nebenan zu einem Braten kleine, weiße, säuerliche Perlzwieberl anbot, brachte mich die Erinnerung an den mächtigen Schrank plötzlich zum Lachen. Erklären kann ich das nicht, konnte das zu meiner großen Verlegenheit auch damals nicht. Nur das gleichzeitige Vorhandensein eines so königlichen Brokatmantel-Kastens und dieses winzigen Gemüses mit seinem schlechten, zähen, übelriechenden, delikaten Geschmack – man muß das empfinden, oder man versteht es nicht – man muß an Mephisto neben dem langbärtigen, dummen Faust denken oder an den merkwürdigen Zufall, der manchmal passiert, wenn man ein reizendes, rotbäckiges Baby auf den Schoß nimmt.
Wie ich mir also ein Zimmer vorstelle, damit man darin nicht immer weinen oder lachen muß, sondern arbeiten kann nach Herzenslust? … Möglichst kitschig und geschmacklos, natürlich … Ich habe mir z. B. ein Sofa machen lassen, aus rotem Plüsch, in der abscheulichsten Vorstadt-Sezession, mit einem Ornament aus gelben Dreiecken, die wie Zungen auflecken und die Bestimmung haben, wenn ich mittags zu lange schlafe, mich in den Leib zu zwicken. Mein Schreibtisch kann ohne gedrehte Säulchen, ohne imitierte Schlösser, die gar nicht für Schlüssel eingerichtet sind, ohne Balustraden und verkleinerte Palastarchitektur gar nicht existieren. So stört er mich nämlich am wenigsten, nur manchmal danke ich ihm, wenn ich ermüdet bin, durch leises Streicheln für seine diskrete Häßlichkeit. Man möge entschuldigen, daß rote Tücher flächenhaft über meine Büchergestelle niederwallen. Das soll kein Kunstwerk sein, nur das Billigste in seiner Art. Und die lange Leiter gehört dazu, die an den alten Biedermeierkasten gelehnt jede etwa reizvolle und stilechte Linie glücklich verhindert … So ist es, ich kann nicht heftig genug betonen (denn ich nehme von diesem Thema Abschied), wie gleichgültig mir Möbel sind, und daß ich die leuchtenden Erfrischungen meiner Sinne nicht bei ihnen und nicht stündlich suche, sondern in konzentrierter Form, in auserwählten Momenten. Und das Beste für diese Lebensweise wären natürlich Möbel aus Wasserstaub, aus Luft, aus Ätherwellen. Der Leser wird schon bemerkt haben: das geschmacklose Zimmer ist mein irdisches Surrogat für das unsichtbare, das ich einmal im Himmel bewohnen werde. Da ist alles in wohltuende Ruhe übergegangen, an keine Kante stößt man an, niemals ist ein Buch oder ein Manuskript verlegt, denn in dem Augenblick, in dem ich es hinter die lautlose, gewichtlose Kastenwand stelle, ist es verschwunden, hat sich ganz einfach in Nichts aufgelöst. Und im Nichts berühren sich ja alle Bücher, alle Dinge, die man sucht, alles ist vorhanden, ohne irgendeine leiseste Spur von Nervosität … Es klingelt. Der Briefträger ist es, und ich sehe an der Schrift auf dem Kuvert, daß eine unangenehme Nachricht von einem unangenehmen Menschen da auf mich eindringt. Keine Angst, ich ergreife den Brief, und er hat sich schon in so kristallhelle Luft verflüchtigt, daß ich statt seines Gegendruckes an meinen Fingerspitzen nur plötzliche Kälte spüre, wie wenn Salmiak verdampft … Also wirklich, ich soll jetzt glücklich sein, ich soll nichts mehr empfinden, als was aus meinem reinen Herzen wie ein Baum emporwächst, wie ein Baum, dessen Äste von innen her schon erschütternd mein Gehirn berühren. Keine Pulte mehr, keine Federstiele, keine Schubfächer, die stecken bleiben, wenn man sie öffnen will. Mit einem Wort, kein Hindernis mehr. Vor Jubel greife ich mir an den Kopf. Aber auch der ist, überflüssiges Möbelstück, weggezaubert, und in die geöffneten Nerven klingen die Diskantchöre der Sphären.
Der Frauen-Nichtkenner
Dank den Bemühungen einiger Schriftsteller, aus deren Liste mir augenblicklich die Namen: Marcel Prévost, Auernheimer, Maupassant (welch ein Zufall! gerade diese) einfallen, haben wir jetzt einen Typus der modernen Frau, einen Grundriß des Weiblichen. Gott sei Lob und Dank, ein Schema …
Also: die Frau ist naschhaft, immer lüstern nach Sensationen und zu Sinnlichkeit aufgelegt, der Grausamkeit nicht abgeneigt, hysterisch, begeisterte Lügnerin, eifersüchtig auch noch auf den Mann, den sie nicht mehr liebt, mäßig begabt im Geiste und für theoretische und zarte Probleme gänzlich ohne Interesse (nur Neulinge langweilen sie damit, Erfahrenere gehen direkt aufs Ziel los), dafür in der Praxis der Liebesangelegenheiten dem Manne weit überlegen usw. Diesem Typus »Frau« entspricht ein Typus »Frauenkenner«. Frauenkenner ist, wer in jeder Frau den Typus »Frau« mit scharfem Auge wiederfindet. Frauenkenner sind vornehmlich die genannten Dichter …
Ich ziehe es vor, ein Frauen-Nichtkenner zu sein.
Warum?… Ganz einfach, weil es mir mehr Vergnügen macht.
Wie geradlinig und schlicht wäre die Welt, wenn alle Frauen mehr oder minder dem Schema sich näherten. Vielleicht waren es beste Glücksfälle, daß gerade ich immer (nein, nicht immer, denn auch das wäre zu geradlinig; aber sehr oft geschah es) mit Frauen ganz anderer Artung zusammengetroffen bin. Ach, in Gesprächen, die so seltsam und ohne Bezug auf Dinge dieses Lebens waren, daß sie nur aus Schabernack noch in irdische Worte gekleidet schienen, gingen wir stundenlang um runde Wasserbassins aus indigoblauem Marmor, kauften Bretzel und fütterten die ruckweise auftauchenden Fischmäulchen. Es waren Spiele, sanfte Spiele, wir dachten keinesfalls an Regeln, Bedürfnis und Ordnungsliebe.
Ein einziges Mal war es mir vielleicht bestimmt, den Typus Weib zu sehen. Aber der trübe, regnerische Abend, an dem das geschah, verbietet mir, mich allzusehr auf meine Erinnerung zu verlassen … Es geschah dies in einer Hafenstadt wertlosen Namens …
Ein kleines Torpedoboot war eingelaufen, und nun lag es, müde und schmutzig, an der Holzverschalung des Ufers. Der gedrungene, dunkle Schornstein, der schief zurückgelehnt stand wie der Kopf eines, der sich ekelt, blies seinen letzten Rauch aus. Eine Weile verging ruhig. Ich dachte an einen gestrandeten schwarzen Vogel. Dann wurde das Brett angelegt und einige von der Bemannung verließen lustig das Schiff, große, braunrote Leute mit kühnen Augen, in breiten, wallenden Hosen, Blaublusen, tief dekolletiert, eine rote, dicke Bindkrawatte unter dem Matrosenkragen gewulstet … Nun konnte man an Bord gehen, und viele aus dem Hafen taten es aus Neugierde. Auch ich bestieg das enge, gewölbte Verdeck, machte schmale Schritte, da ich immerfort an Schrauben, eiserne Scheiben, Hebel mit dem Fuße anstieß. Die Damen hoben ihre Röcke, denn alles war vom Regen naß. Während die Mannschaft, die in weißen Arbeitskitteln auf dem Schiff geblieben war und eifrig an der Wäsche seifte oder sie an Stricke zum Trocknen hängte (es regnete aber immer noch ganz fein), um die Gäste wenig sich bekümmerte, zeigte uns ein junger, freundlicher Offizier die Hängematten, den kleinen Schlafraum in der Vertiefung des Vorderdecks, das imponierend-drehbare Maschinengewehr, die Falltüren zur Kapitänskajüte und zur Munitionskammer, die unverständlich große Dampfmaschine unten, die Ventilationsluken, die verderblichen Lancierrohre … Er erzählte lächelnd, daß solch ein Torpedoboot so und so nahe, sehr nahe, an den Feind heranfahren muß, um sein Geschoß abzufeuern. Und das ist gefährlich, die Scheinwerfer spielen und sehen, man riskiert sein Leben …
Neben mir steht eine hohe Blondine, sehr fahl im Gesicht, mit fast weißen Augenbrauen über den dunkeln Augen. Hart und gierig sieht sie den freundlichen Offizier an, und während der Wind rauschend über unsere Köpfe fährt, kommen aus der edlen, rosigen Kurve ihres Mundes diese Worte: »Sind Sie schon einmal in Lebensgefahr gewesen?«
Der Offizier enttäuscht sie sichtlich, da er mit »Nein!« lächelnd und wie ein sympathisches Kind antwortet.
Er geht weiter uns voran und zeigt uns das Rettungsboot. Mißmutig streicht die Blonde über die nassen Planken von weißer Lackfarbe. Der liebe Offizier erläutert den Kran, die Kommandos, er führt die Schwimmwesten aus Kork vor, die numeriert sind und schon dadurch ein wohliges Gefühl von Geborgenheit einflößen, er sucht uns wirklich auf alle Weise über das Schicksal der tollkühnen Angreifer zu beruhigen.
»Aber nein,« schreit die Blonde, grell, enttäuscht, »da können Sie ja überhaupt gar nie in Lebensgefahr kommen!«
Alle sehen sie verdutzt an. Ich halte mich zitternd am Kompaßständer fest.
Der Offizier verbeugt sich gefällig gegen sie, und so gut (ich liebe ihn schon wirklich) sagt er: »Nun, es ist ja allerdings doch nicht für uns alle Platz in dem Boot, Gnädigste.«
Sie wendet sich ab, ich bemerke noch, wie sie erleichtert und mit krankhaftem Zucken der Nasenflügel zu weinen beginnt. Der braune Wind rauscht, die benachbarten Schiffe schaukeln ein wenig, es ist fast Nacht …
Also, das war der Typus »Frau«, sensationslüstern, grausam, hysterisch …
Lieber Gott! wie mich diese Hysterie schon langweilt! Vielleicht brauchte ich nur die Augen aufzumachen, um mehr von diesem Typus zu sehen. Aber ich will gar nicht. Es ist ja so angenehm, liebenswürdige Haltungen des Kopfes vor den Augen einer Frau einzuüben, mit ihr über die Farbe einer Wolke zu streiten, gelinde, gelinde natürlich, das Dessert für übermorgen und die Mode unserer Urenkel zu beraten, nichts als zwecklose Dinge. Wie gesagt, ich ziehe es vor, ein Frauen-Nichtkenner zu bleiben …
Der allerletzte Brief
1. Der Brief.
Mein lieber Feind,
bisher bist mein Freund Du gewesen, aber mein gehaßter Freund. Und von diesem Haß, den Du vielleicht nie geahnt hast, wird heute noch viel die Rede sein … Vorläufig das eine: sei statt dessen, was Du mir bisher warst, lieber mein Feind; mein lieber Feind, wenn Du willst.
Seit vier Jahren, seit wir einander kennen, … verkennen wir einander. Unausgesetzt hast Du mich mißverstanden, unermüdlich. Du hast mich mißverstehn wollen, das ist das Schlimme, und daß es dir auch gelungen ist, nur eine nebensächliche Verschärfung … Erinnre Dich nur, was für merkwürdige Eigenschaften, die ich ganz und gar nicht besitze, Du in mir entdeckt hast. Vor allem ist Dir immer meine Feinheit bewundernswert gewesen, meine zarten und eigentümlichen Fingerbewegungen, »diese Aquarelle von Liebesstunden, die Mousseline des Benehmens, die Zierstücke seltsamer Einflüsterungen« … Nun wisse (Du weißt es schon längst, immer), ich bin gar nicht so vornehm geartet, bin gar nicht so eigentümlich. Ich würde es für beleidigend halten, wenn jemand eine kultivierte Frau mich benennte. Ich bin eine schöne Frau, weiter nichts. Mein Äußeres ist mein Tiefstes, wirkt als einziger Schatz um so glänzender vor dem im übrigen schattigen Hintergrund meiner gewöhnlichen Persönlichkeit … Und ich verzichte gern darauf, den klügsten Männern ebenbürtig und Arbeitsgenosse zu sein. Da ich sie beherrschen kann.
Du hast mir ferner eingeredet, ich sei gut. Nicht im Sinne der herkömmlichen Sittlichkeit, die ich um Deinetwillen oft gering schätzte. (Und das tut mir auch heute nicht leid, das nicht.) Aber ich sei brav, sagtest Du, von Mildheit zukünftiger Generationen erfüllt, dem kategorischen Imperativ einer bessern Welt gehorsam. Und so unschuldig sei ich, sagtest Du … Was für Unsinn! Ich lehne es entschieden ab, unschuldig zu sein. Unschuldige Frauen sehen dumm aus. Und nur die Schuldigen wissen Mienen von Unschuldigen zu tragen.
Du dichtetest mir an, ich sei treuer als die andern; Du ließest mich unkokett sein (unschädlich mithin für Dich und weniger zeitraubend. Wie fein war das eingefädelt.)
Meine Redeweise, ehe ich in den Verkehr mit Dir geriet, war höchst läppisch. Ich gefiel mir in Witzen, in Wortspielen, in Stacheln und Qualen … Du hast als mir eigentümlich mir eine Lyrik der Sätze beigebracht. Glockentöne in der Stellung der Vokale und durch merkwürdige Drehungen der syntaktischen Fügung erzeugte Melodien. Weil es Dir gefiel, im Sommer abends am Flußnebel unklare Gespräche, geschmückt mit sehr langen Pausen, zu haben, deutetest Du meine Ratlosigkeit damals als ein Schweigen infolge verständnisvoller Stimmung. Ohne Unterlaß hast Du mich umgedeutet. Immer hast Du nur das an mir gesehn und gehört, was Du hören und sehn wolltest … So oft war ich trivial, meiner Natur nachgebend, habe alltägliche Dinge gesagt, ganz einfach Sprichworte, moralische Lehren aus dem Abreißkalender. Und Du bliebst auch dann stets noch heuchlerisch genug, diese dummen Redensarten in Entzückung einzufangen, die durch meine Lippen in Schwingung versetzte Luft mit kostbaren Ausrufen der Freude zu umrahmen. Du wolltest mich glauben machen, ich sei Dir ebenbürtig, ganz von selbst fließe mir eine Welle bedeutsamer Ansichten unversieglich zu und alles, was ich rede, klinge reizend, sanft und entrückt … Und Deine bestimmten Entgegnungen, wenn ich mich weigerte, wenn ich sagte, Du überschätzest mich! Deine manchmal beinahe überzeugenden Zwischenrufe, wenn ich im Zuge war, meine Werktäglichkeit zu beichten!…
Ohne darüber nachzudenken, daß ich vielleicht mir eigentümliche Vorzüge haben könnte, hast Du mir kurzwegs einige Vorzüge nach Deinem Geschmack obenauf angeschminkt. Du hast retouchiert. Schließlich war ich eine Vollkommenheit von Deinen Gnaden, ich danke schön.
Wenn Dir nur jemals irgend eine lebenskräftige Dummheit entschlüpft wäre! Aber nein, selbst Deine Dummheiten waren hübsch anzusehen, verzeihliche Streiche eines liebenswürdigen Kindes. Wenn Du mich nur jemals gelangweilt hättest! Aber nein, Du hast mich immer entzückt. Das verträgt keine Frau.
Wie ich Dich immer gehaßt habe! Mein Gott, wie ich Dich gehaßt habe!
Wenn ich so zu Dir kam, ein fehlerhafter Mensch, aber doch ein Mensch; frischauf atmende Lungen, ungleichmäßige Herzschläge, Finger voll Gift, boshaft-lebendige Wangen … wenn ich die Treppen zu Deiner Wohnung hinaufstürmte, mit dem festen Entschluß, heute Dir alles ins Gesicht zu schreien, Dir ins Gesicht zu schreien: Liebe mich, aber liebe mich endlich einmal so gemein, wie ich bin!… und wenn ich dann die Türe öffnete, die schauspielernde Luft Deiner Zimmer, den Dunstkreis des Unendlichen eintrank … dann war alles wieder vorbei … Wir sahn als zwei seltsame Menschen einander in die Augen, ich war bezaubert, ich war nach Deinem Wunsch. Wohin versanken da die Entschlüsse, die Selbständigkeiten …
Ein umgekehrter Fall der Nora: wie gern wäre ich die Puppe geblieben! Aber Du wolltest mich jedenfalls zu Gott weiß was Besonderem machen.
Ja, ich war glücklich … Welch eine sichere Zeit atmete ich bei Dir, nichts konnte mir etwas anhaben. Wir besprachen dies und jenes. Wir stellten zwecklose Dinge an. Wir küßten einander in aller Liebe, aber immer ein wenig pierrotmäßig. Alles war ein Spaß, ein Luftzug, eine Frage. Und die brutale Realität schien entfernt, das Leben ein klein-harmloses, unzerreißbares Bilderbuch nur … Und o! wie hast Du es immer abgewehrt, wenn ich Dir sagte: Du betrachtest das Leben als einen Spaß. Das durfte nicht ausgesprochen werden, durch so grobe Konstatierungen wären wir schon wieder ins Reich des Tätlichen gerückt. Daß Du das Leben wahrhaftig als einen Spaß betrachten konntest, wurde nur dadurch ermöglicht, daß Du immer behauptetest: O nein, ich nehme das Leben sehr ernst … Wie wunderbar warst Du oft durch das, was Du verschwiegst. Und nicht einmal das ließest Du zu, daß man Dein Verschweigen bewundere. Einen Firnis von Schlichtheit, Ungeschicklichkeit sogar legtest Du über Deine feinsten Dinge. Und durch graziöse Schnörkel des Schweigens und Sagens hieltest Du uns beide beständig in der Höhe, über den Wahrheiten. Nie machten wir einander Geständnisse. Nie waren wir intim und vertraut. Aber wenn ich zu Dir kam, verschwanden alle meine Sorgen, machten alle Befürchtungen ein unwichtiges, fast drolliges Gesicht. Gerade dadurch, daß Du mich nicht tröstetest, tröstetest Du mich … Und wie schön, wenn wir uns Mühe gaben, einander näher zu kommen! Diese Selbstbekenntnisse geschahn so unwegsam, in einer so verzwickten und schwierigen Manier, daß wir einander immer nur noch verhüllter, interessanter wurden. O diese fluoreszierenden Auseinandersetzungen, diese Erleuchtungen ohne Halt, diese unrichtigen Klarheiten und diese Unklarheiten!
Wie glücklich war all dies!
Wie ich dich immer geliebt habe! Mein Gott, wie ich Dich geliebt habe!
Ach, vielleicht ist es ein Unrecht, daß ich diesen Brief Dir schreibe. Gewiß tue ich Dir Unrecht, denn Du warst immer gut zu mir … Und jetzt verwirrt sich mir alles. Als ich diese Zeilen begann, war mir unser Verhältnis so klar, so schlimm, so verächtlich. Ein Magazin von Kontrasten und Angriffen stand mir zur Verfügung … Wie kommt es, daß in diesem Augenblicke verschwimmende Gebirge über mich stürzen, rosige Bergketten vom bewegten Horizont her, Zweifel, Subtilitäten ohne Zahl …
Vielleicht ist alles, was ich Dir heute schreibe, auch nichts anderes als solch eine fluoreszierende, verzwickte Auseinandersetzung, durch die wir einander nur noch interessanter werden?…
Ich will nicht darüber nachdenken. Aber eines: Habe Mitleid mit mir! Mitleid! Und wenn auch gerührte Leidenschaft, Verständnis für Tragik Deine Sache nicht ist …. aus Mitleid begreife dieses eine Mal die nackte Wahrheit, den großen Ernst der Tatsachen, die Schrecken meiner inneren Krisis. Gib mich frei! Gib mich endlich frei! Ich will Dir nie mehr schreiben. Ich will Dich nie mehr sehn. Es ist mein fester Entschluß, mich nicht länger von Dir beeinflussen zu lassen. Ich bitte Dich, vergiß mich oder sei mein Feind. Gib mich frei!
Anfissa.
2. Antwortbillett auf diesen allerletzten Brief.
Du vergißt doch nicht, Liebste? Morgen um 6 Uhr bei der Apollinariskirche.
Dein Carus.
Zufällige Konzerte
Ach wie auf Erden nichts, wie nichts auf Erden gleicht den Schauplätzen angenehmer Begebenheiten! Das Postamt war rot. Gleichfalls die Kirche machte kein Geheimnis aus ihren deutlichen Ziegelsteinfugen. Von da in den Kurpark reichten wenige Schritte. Und man erging sich in diesem ohne jegliche Verantwortung, dem Bewußtsein ungerechten Vorzugs fremd, wiewohl die vielfach krummen Wege so zeitverschwenderisch waren und die reichlichen Seelüfte darin eine ganz unverdiente Belohnung für uns Müßiggänger. Daran dachte man nicht; o die Schauplätze angenehmer Begebenheiten. Weil’s mir damals gut, so richtig gut ging, fiel mir nie es ein, die Anlage dieses Parkes auf Steuern und Taxen, seine freundliche Abwechslung der Gebüsche, Wiesen und Bauminseln auf ermüdende Studien ausländischer Werke über Hortikultur, die Kinderfeste auf geschäftstüchtige Tricks der Badeverwaltung und Toiletten der Damen auf Berufspein ihrer Ehemänner zurückzuführen; kurz alles auf das ökonomische Prinzip. Sonst erscheint mir doch die Welt so gnadenlos betrieblich und zielbewußt, im Dunst des Arbeiten-Müssens, von Fabrikswaren besetzt. Damals jedoch bewegte sie sich liebenswürdig. Und als ich einmal, von irgendwelcher Bank aus ganz ferne Kurmusik zu hören bekam, verübelte ich dies niemandem, sondern ich hörte gut zu und staunte nur … Das Stück, auf seinem Wege durch die Bäume her zu mir, hatte Blättergrün und Zweige, Tau, Sonnentupfen in seine Töne mitgenommen, sie wehten gefärbt und aufgefrischt. Das Herablassen einer Persienne im Hotelfenster links blinzte aus ihnen, mit den Spatzen des Sandwegs und mit dieser Vormittagsstunde in Südostbrise. Mein Herz klopfte. Wie ein hinter erglühender Luft bebendes Gebäude, wie ein Shawl in Bewegung, aus dem die eingewebten Metallstücke glänzen, standen die Akkorde vor mir, wie das Laforguische je ne sais quoi qui n’a de nom dans aucune langue, de même que la voix du sang … Indessen erkannte ich das Stück nicht, wiewohl es mir geläufig war. Ich ging zwischen seinen kontrapunktischen Stimmen wie zwischen Häuserfronten, und es war wie in der Heimatstadt manchmal, wenn man aus einem neuen Durchhaus tritt oder von ungewohntem Standpunkt her beobachtet. Alles ist fremd und dennoch alles vertraut. Ich weiß, daß ich zu Hause bin und dennoch kenne ich mich nicht aus. So vergißt man auch bisweilen, aus Träumen nachts erwachend, die Lage der Fenster, die Wand am Bettrand, rechts und links im Dunkel. Jeden Augenblick kann die richtige Orientierung einfallen, mit einem Schlag alles ins gewöhnliche Licht ordnen, aber das zieht man in süßer Qual hinaus, absichtlich verwirrt man sich und ist in fremder Stadt, in fremdem Bett. Endlich längs eines Geigenlaufs schwinge ich mich in die Erkenntnis, daß ich die Meistersinger-Ouvertüre vor mir habe … So wohlgetan hat sie mir schon lange nicht, seit ich vor Jahren mit ihr bekannt wurde, seit den ersten Entzückungen nicht mehr. Ich sitze da und, gerührt von jeder Modulation, danke ich dem lieben Gott für sie. Manchmal überrascht mich so die Musik, wie aus einem freundlichen Hinterhalt, und das wollte ich sagen: dann findet sie die Seele ganz anders offen als im Theater oder in den zweckdienlichen Konzertsälen. Zufällig kommt sie, Wind trägt sie her und löscht sie aus, Sonne wie über die Alpen gießt sich über Melodien. Niemand bietet mir Programme an oder das mit einer harfenschlagenden Dame gezierte Titelblatt eines thematischen Leitfadens. Keine Vor- und Nebensitzenden, keine Presse, keine Bonbons, nicht Gucker, nicht Begeisterung, nicht gemachte Begeisterung und keine aus Furcht, die Begeisterung könnte gemacht erscheinen, gemachte Nicht-Begeisterung. So natürlich geht alles und nicht einmal stolz sein auf seine Natürlichkeit kann man. Man hat weder Zeit, sich in Frack, noch aus Protest gegen Zeitvergeudung bei der Toilette nicht in Frack zu werfen. Einfach wird man vom Genuß attackiert, auf kurzem Wege vergewaltigt …