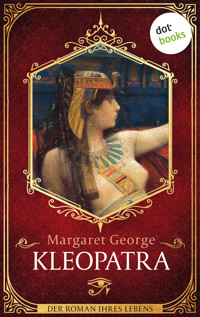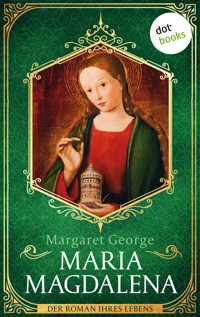12,99 €
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwischen Prunk und Intrigen: Die fesselnde Romanbiografie »Heinrich VIII. – Mein Leben« von Margaret George jetzt als eBook bei dotbooks. Er ist der König, der mit der Kirche brach, der sechs Frauen heiratete, und zwei davon zum Tode verurteilte … doch wer war der Mann hinter der Krone? Als zweitgeborener Sohn war dem jungen Heinrich eigentlich ein ganz anderes Schicksal bestimmt, aber nach dem Tod seines Bruders Arthur lastet plötzlich die Verantwortung eines ganzen Landes auf seinen Schultern. Heinrichs einziger Lichtblick ist seine schöne Frau Katharina – doch als die Ehe der beiden kinderlos bleibt, fürchtet er eine Strafe Gottes. Er ist überzeugt, dass nur eine Scheidung das englische Königreich noch retten kann, doch die römische Kirche verweigert sein Gesuch: Ein legendärer Machtkampf zwischen Kirche und Krone beginnt, der ein ganzes Land spalten und Heinrich zu einem der berühmtesten Könige der englischen Geschichte machen soll … »Fesselnde Unterhaltung für alle Liebhaber von historischen Romanen.« Kirkus Review Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Historienroman »Heinrich VIII. – Mein Leben« von Margaret George wird alle Fans der Bestseller von Rebecca Gablé und Alison Weir begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1986
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Er ist der König, der mit der Kirche brach, der sechs Frauen heiratete, und zwei davon zum Tode verurteilte… doch wer war der Mann hinter der Krone? Als zweitgeborener Sohn war dem jungen Heinrich eigentlich ein ganz anderes Schicksal bestimmt, aber nach dem Tod seines Bruders Arthur lastet plötzlich die Verantwortung eines ganzen Landes auf seinen Schultern. Heinrichs einziger Lichtblick ist seine schöne Frau Katharina – doch als die Ehe der beiden kinderlos bleibt, fürchtet er eine Strafe Gottes. Er ist überzeugt, dass nur eine Scheidung das englische Königreich noch retten kann, doch die römische Kirche verweigert sein Gesuch: Ein legendärer Machtkampf zwischen Kirche und Krone beginnt, der ein ganzes Land spalten und Heinrich zu einem der berühmtesten Könige der englischen Geschichte machen soll…
Über die Autorin:
Margaret George verbrachte als Tochter eines amerikanischen Diplomaten einen Großteil ihrer Kindheit auf Reisen nach Tel Aviv, Ägypten, Taiwan u.a. So wurde erstmals ihre Leidenschaft für die Geschichte fremder Kulturen geweckt.
George studierte englische Literatur und Biologie in Massachusetts, sowie Ökologie in Stanford und arbeitete schließlich als Wissenschaftsautorin. Ihre Liebe zur Geschichte hat sie jedoch nie losgelassen, weshalb sie 1986 ihren ersten historischen Roman »Henry VIII« veröffentlichte. Bis heute schreibt Margaret George Romanbiografien über faszinierende Persönlichkeiten der Vergangenheit, mit welchen sie immer wieder auf der Bestsellerliste der New York Times steht. Sie lebt heute mit ihrem Mann in Wisconsin.
Die Website der Autorin: margaretgeorge.com/
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin die historischen Romane »Maria Stuart – Der Roman ihres Lebens«, »Kleopatra – Der Roman ihres Lebens«, »Maria Magdalena – Der Roman ihres Lebens«, und »Ich, Helena von Troja«.
***
eBook-Neuausgabe Januar 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1986 unter dem Originaltitel »The Autobiography of Henry VIII.: With Notes by his Fool Will Sommers« bei St. Martin‘s Press. Die deutsche Erstausgabe erschien 1989 unter dem Titel »Ich, Heinrich VIII.« bei Franz Schneekluth.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1986 Margaret George
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1989 beim Franz Schneekluth Verlag, München.
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Paula Ochnio unter Verwendung eines Gemäldes von Hans Hohlbein
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-98952-017-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
In diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Heinrich VIII.« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Margaret George
Heinrich VIII. – Mein Leben
Die große Romanbiografie
Aus dem Amerikanischen von Rainer Schmidt
dotbooks.
Für Allison und Paul
PROLOG
Will Somers an Catherine Carey Knollys
Kent, England, den 10. April 1557
Meine liebe Catherine:
Ich sterbe. Besser gesagt, ich bin ein Sterbender – es gibt da einen kleinen (wiewohl nicht tröstlichen) Unterschied. Nämlich diesen: Wer stirbt, kann keine Briefe mehr schreiben, derweil ein Sterbender es kann und manchmal auch tut. Wie dieser Brief beweist. Liebe Catherine, verschont mich mit Beteuerungen des Gegenteils. Ihr habt mich seit vielen Jahren nicht gesehen (wie viele sind es, seit Ihr nach Basel ins Exil gingt?); Ihr würdet mich heute nicht wiedererkennen. Ich bin nicht sicher, daß ich selbst mich erkenne, wann immer ich so schlecht beraten bin, tatsächlich in einen Spiegel zu schauen – was zeigt, daß die Eitelkeit zum mindesten so lange lebt wie wir. Sie ist die erste Eigenschaft, die wir haben, und die letzte, die schließlich dahingeht. Und ich, der ich meinen Unterhalt bei Hofe damit verdient habe, die Eitelkeit anderer zu verspotten – ich schaue in den Spiegel, wie alle anderen auch. Und ich sehe einen fremden alten Mann, der entschieden unappetitlich aussieht.
Aber ich war schon fünfundzwanzig, als der alte König Harry (damals selber ein junger Mann) mich in seinen Haushalt aufnahm. Er ist nun seit zehn Jahren tot, und das ist der Grund, weshalb ich Euch schreibe. Laßt uns unverzüglich zur Sache kommen. Ihr wißt, ich war nie sentimental. (Ich glaube, dies schätzte Harry an mir mehr als alles andere, so unverbesserlich sentimental, wie er selber war.) Ich habe ein kleines Vermächtnis für Euch. Es ist von Eurem Vater. Ich kannte ihn ziemlich gut, besser noch als Ihr selbst. Er war ein prachtvoller Mann, der heute schmerzlich vermißt wird, selbst von seinen Feinden, möchte ich meinen.
Ich führe ein stilles Leben auf dem Lande, in Kent. Das ist weit genug weg von London, um einigen Schutz vor falschen Bezichtigungen zu bieten, aber nicht so weit, daß man nicht hören könnte, wie andere unter falsche Anklage gestellt werden. In Smithfield wird wieder verbrannt; wie Du höchstwahrscheinlich selbst vernommen hast, hat man Cranmer und Ridley und Latimer geröstet. Wie sehr muß Maria Cranmer gehaßt haben in all den Jahren! Bedenke nur, wie oft sie bei irgendeiner religiösen Feier neben ihm stehen mußte ... bei Edwards Taufe etwa, wo sie sogar Geschenke bringen mußte! Der liebe Cranmer – Heinrichs willfähriger Kirchenmann. Wenn es jemals einen Menschen gab, der als Kandidat für das Märtyrertum nicht in Frage kam, dann war er es. Ich habe immer angenommen, der Mann habe überhaupt kein Gewissen. Jetzt sehe ich, daß dies ein Irrtum war. Hast du gehört, wie er zuerst seinen Protestantismus widerrief, auf eine typisch cranmerianische Weise, und dann – oh, wie wunderbar! – seinen Widerruf? Es hätte spaßig sein können, wäre es nicht so tödlich.
Aber freilich, Ihr und die anderen Eurer ... Überzeugung ... spürten das schon früh und waren klug genug, England zu verlassen. Ich will Euch eine Frage stellen, und ich weiß sehr wohl, daß Ihr sie nicht beantworten werdet – nicht auf Papier, wenn Ihr noch hofft, irgendwann wieder hierher zurückzukehren. Wie protestantisch seid Ihr wirklich? Ihr wißt, der alte König betrachtete sich überhaupt nie als Protestanten, sondern als Katholiken, der sich mit dem Papst zerstritten hatte und sich nun weigerte, ihn anzuerkennen. Ein hübscher Kunstgriff, aber Harry kam eben manchmal auf wunderliche Einfälle. Sein Sohn Edward dann, dieser frömmelnde kleine Pinsel, der war Protestant. Aber keiner von der wilden Sorte, dieser Anabaptisten-Abart. Gehört Ihr zu dieser Sorte? Wenn ja, wird es für Euch in England keinen Platz geben. Nicht einmal Elisabeth wird Euch willkommen heißen, sollte sie jemals Königin werden. Das solltet Ihr wissen und Eure Hoffnung nicht an Dinge heften, die kaum jemals eintreffen werden. Eines Tages dürft Ihr heimkehren. Aber nicht, wenn Ihr Anabaptistin oder etwas Derartiges geworden seid.
England wird nie wieder katholisch sein. Dafür hat Königin Maria gesorgt, mit ihren Verfolgungen um des »Wahren Glaubens« willen und mit ihrer Spanien-Besessenheit. Harry hat niemanden je für etwas anderes bestraft als für Illoyalität gegen den König. Solange man den Gefolgschaftseid unterschrieb, konnte man glauben, was man wollte – vorausgesetzt, man benahm sich dabei wie ein Gentleman und rannte nicht in schwitziger Inbrunst umher, in diesem wie in jenem Fall. Thomas More wurde nicht enthauptet, weil er katholisch war (obgleich die Katholiken dem Volk dies gern einreden möchten, was ihnen auch fast schon gelungen ist), sondern weil er den Eid verweigerte. Der Rest seines Haushalts hat ihn geleistet. Aber More sehnte sich geradezu nach Märtyrertum und unternahm ... heroische? ... Anstrengungen, es zu erlangen. Er zwang den König buchstäblich dazu, ihn zu töten. Und bekam auf diese Weise die sogenannte »Himmelskrone«, nach der es ihn gelüstete, wie es den alten Harry nach Anne Boleyn gelüstet hatte. Harry fand den Gegenstand seiner Gelüste dann weniger genießbar, als er es sich gedacht hatte; hoffen wir, daß More nicht eine ähnliche Enttäuschung widerfuhr, als ihm sein Verlangen erfüllt worden war.
Ich vergaß. Ich darf solche Späße bei Euch nicht machen. Ihr glaubt ja ebenfalls an jenen Ort. Gläubige sind alle gleich. Sie suchen – wie war Mores Buch gleich betitelt? – Utopia. Das bedeutet »Nirgendwo«, wißt Ihr.
Wie gesagt, ich führe hier ein stilles Leben im Haushalt meiner Schwester in Kent, zusammen mit meiner Nichte und ihrem Gemahl. Sie haben ein kleines Häuschen, und Edward ist ... ich zögere, es niederzuschreiben ... Totengräber und Grabsteinmetz. Der Tod schafft ihm ein gutes Leben. (Wie mir Bemerkungen dieser Art.) Aber er pflegt seinen Garten, wie andere es auch tun (wir hatten wundervolle Rosen dieses Jahr), er spielt mit den Kindern, genießt seine Mahlzeiten. Nichts an ihm gemahnt auch nur im mindesten an den Tod; aber vielleicht braucht man eine solche Natur, um diesen Beruf zu verkraften. Obgleich ich ja denke, daß das Dasein eines Narren in gleichem Maße mit dem Tod verbunden ist. Jedenfalls sorgt so einer für einen Duft, der den des Todes überdeckt.
Ich kam vor Edwards Krönung hierher. Der Knaben-König und seine frommen Berater hatten keinen Bedarf an einem Narren, und so hätte ich herumgestanden wie ein loses Segel, das im Winde flattert. Königin Marias Hof ist aber auch nicht der Ort, an dem man Späße macht.
Erinnert Ihr Euch noch, Catherine, an jenen Sommer, als Ihr und ich und Eure ganze Familie, die Boleyns, und der König zusammen in Hever waren? Euch und Euren Bruder Heinrich hatte man dort hingebracht, damit Ihr Eure Großeltern Boleyn besuchtet. Hever ist entzückend im Sommer. Es war immer so grün, so kühl. Und in den Gärten wuchsen wahrhaftig die besten Moschusrosen von ganz England. (Erinnert Ihr Euch zufällig noch, wie der Gärtner Eurer Großeltern hieß? Ich wohne jetzt nicht weit von Hever, und vielleicht könnte ich mir von ihm einen Rat holen ... vorausgesetzt, er lebt noch.) Und von London aus war es ein bequemer Tagesritt. Wißt Ihr noch, wie der König immer oben auf dem Hügel stand, von dem aus man Hever zum ersten Mal sehen konnte, und in sein Jagdhorn stieß? Ihr pflegtet auf diesen Klang zu warten und ihm dann entgegenzulaufen. Und er brachte Euch immer etwas mit. Ihr wart das erste Boleyn-Enkelkind.
Erinnert Ihr Euch an Euren Onkel George in diesem Sommer? Er gab sich solche Mühe, ein Ritter ohne Furcht und Tadel zu sein. Er übte das Umherreiten in der Rüstung, ritt Turniere gegen Bäume und verliebte sich in das schlampige Mädchen aus dem »Weißen Hirschen«. Sie schenkte ihre Gunst jedem, der diese Schänke besuchte – bis auf George, glaube ich. Sie wußte nämlich, daß dann der Strom der Sonette versiegen würde, in denen er ihre Reinheit und Schönheit in den höchsten Tönen pries, und über die sie so gern lachte.
Eure Mutter Maria und ihr Mann waren natürlich ebenfalls da. Ich fand immer, Eure Mutter war Eurer Schwester Anne an Schönheit mehr als ebenbürtig. Aber ihre Schönheit war von anderer Art. Sie war wie Sonne und Honig; jene war wie die dunkle Seite des Mondes. Wir alle waren dort in jenem Sommer, bevor alles eine so schreckliche Wendung nahm. Die Flut ist wahrlich gekommen, und heute ragt jene kurze Zeitspanne wie ein tapferes Eiland über die schlammige, weite Fläche ringsum.
Ich schweife ab. Nein, schlimmer: Ich werde romantisch und sentimental, etwas, das ich bei anderen verabscheue und mir selbst nicht durchgehen lassen werde. Nun also zurück zum Wichtigen: zu der Erbschaft. Sagt mir, wie ich sie unversehrt über den Kanal und in Eure Hände bringen kann. Sie ist leider von recht unhandlichem Format: zu groß, als daß ein einzelner sie erfolgreich bei sich verbergen könnte, und zu klein, um sich selbst vor der Zerstörung zu schützen. Im Gegenteil, sie ist nur allzu leicht vernichtet, und durch mancherlei – durch die See, durch Feuer, Luft, gar durch Nachlässigkeit.
Ich bitte Euch, sputet Euch, mir zu antworten. Ich bin entschieden weniger erpicht darauf, Gestalt und Disposition meines Schöpfers aus erster Hand kennenzulernen, als Ihr und andere Eurer Sekte; aber ich fürchte, daß man mir schon in allernächster Zukunft die Ehre eines himmlischen Zwiegesprächs erweisen wird. Die Gottheit ist notorisch launenhaft, was die Objekte ihrer Zuneigung angeht.
Stets der Eure
Will Somers
Catherine Carey Knollys an Will Somers:
11. Juni 1557 zu Basel
Mein liebster Will:
Ich bitte Euch, vergebt mir, daß es so lange gedauert hat, bis diese Antwort in Eure Hände kam. Boten, die ganz unverhohlen Dinge aus England hierher zu uns ins Exil bringen, sind heutzutage rar; dafür trägt die Königin Sorge. Diesem Kurier aber vertraue ich, und gleichermaßen vertraue ich darauf, daß Ihr so diskret sein werdet, diesen Brief zu vernichten, wenn Ihr ihn gelesen habt.
Die Kunde von Eurer schlechten Gesundheit betrübt mich. Aber als König Heinrichs Lieblingsnarr neigtet Ihr in Euren Reden schon immer zur Übertreibung, und so bitte ich Gott, daß es auch diesmal nur eine weitere Probe Eurer Kunst sein möge. Francis und ich beten jeden Abend für Euch. Nicht in der götzendienerischen Messe – denn die ist nicht bloß unnütz, sie ist Schlimmeres: eine Travestie (oh, wenn die Königin dies läse!) –, sondern in unserer stillen Andacht. Es geht uns nicht schlecht hier in Basel. Wir haben genug Kleidung, um nicht zu frieren, genug zu essen, um bei Kräften zu bleiben, ohne fett zu werden, und mehr wäre eine Beleidigung Gottes, denn viele seiner armen Geschöpfe leiden körperliche Not. Aber wir sind reich an dem einzigen, was sich zu haben lohnt: an der Freiheit, unserem Gewissen zu folgen. Ihr in England habt sie nicht mehr. Die Papisten nehmen sie euch fort. Wir beten täglich darum, daß diese Tyrannei von euren Schultern genommen werde und daß Moses sich erhebe und euch aus der geistlichen Knechtschaft führe.
Doch nun zu der Erbschaft. Ich bin neugierig. Mein Vater starb 1528, als ich gerade sechs war. Weshalb solltet Ihr dreißig Jahre gewartet haben, um sie weiterzugeben? Skurrilität oder Verrat kann es nicht gewesen sein, was Euch dazu bewogen hat. Und da ist noch etwas, das mich verwirrt. Ihr sprecht von seinen »Feinden«. Er hatte keine Feinde. William Carey war ein guter Freund des Königs und ein gutherziger Mensch. Das weiß ich nicht nur von meiner Mutter, sondern auch von anderen. Er war hochgeachtet bei Hofe, und als er an der Pest starb, trauerten viele. Ich bin dankbar, daß Ihr jetzt daran denkt, aber wenn ich es früher bekommen hätte ... Nein, ich mache Euch keine Vorwürfe. Aber ich hätte meinen Vater besser kennengelernt, und früher dazu. Es ist gut, seinem Vater zu begegnen, ehe man selbst erwachsen ist.
Ja, ich erinnere mich an Hever im Sommer. Auch an meinen Onkel George und an Euch und an den König. Als Kind fand ich ihn schön und engelhaft. Gewiß war er von prächtiger Gestalt (dafür hatte der Teufel gesorgt), und es umgab ihn etwas Majestätisches, möchte ich sagen. Nicht jeder König hat dies; Edward hatte es jedenfalls nie, und was die derzeitige Königin angeht ...
Leider kann ich mich nicht mehr entsinnen, wie der Name des Gärtners lautete. Fing er nicht mit J an? Aber ich erinnere mich sehr wohl an den Garten, an den hinter dem Wassergraben. Überall waren Blumenbeete, und er – wie hieß er nur? – hatte alles so angelegt, daß dort immer etwas in Blüte stand, von Mitte März bis Mitte November. Und zwar in großen Mengen, so daß das kleine Landhaus zu Hever stets angefüllt war mit Massen von Schnittblumen. Seltsam, daß Ihr von Moschusrosen sprecht; meine Lieblingsblumen waren die Malven mit ihren großen, schweren Blütenglocken.
Was Ihr über Cranmer zu berichten hattet, hat mich betrübt gemacht. Er war also doch einer von uns. Auch ich hatte ihn stets nur für die Kreatur dessen gehalten, der jeweils gerade an der Macht war. Ich bin sicher, er hat seine Krone empfangen und ist (mit den Worten des armen, irregeleiteten Thomas More zu sprechen) »glücklich im Himmel«. Mag sein, daß More auch dort ist, aber dann trotz seiner falsch eingegangenen Allianz, nicht ihretwegen. Hätte er seinen Mantel nach dem Wind gehängt und bis heute überlebt, dann wäre er, daran zweifle ich nicht, einer der Richter gewesen, die Cranmer verurteilt haben. More war ein bösartiger Gegner aller sogenannten Abtrünnigen; wir halten sein Andenken nicht in Ehren. Sein Tod hat die Reihen unserer Verfolger um einen vermindert. Natürlich sind noch viele da, aber die Zeit ist unser Freund, und wir werden siegreich bleiben.
Dies ist für Euch schwer zu verstehen, denn Ihr gehört zur »alten Ordnung«, und Vorsicht war stets Eure Parole. Aber wie sagte Gamaliel, der pharisäische Rechtsanwalt, angesichts der ersten Christen Verfolgung? »Denn ist dieser Rat, dies Werk, von Menschenhand, so wird es zunichte werden; ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht stürzen, ihr möchtet sonst als Widersacher Gottes gefunden werden.« So steht es geschrieben im fünften Kapitel der Apostelgeschichte. Wenn Euch keine Übersetzung der Heiligen Schrift zugänglich ist (denn ich glaube, die Königin hat sie allesamt vernichten lassen), so kann ich dafür Sorge tragen, daß man Euch eine bringt. Ein vertrauter Freund hat sein Geschäft in London, und er sorgt dafür, daß wir dies und das bekommen. Mein Bote hier wird ihm Euren Namen nennen, und dann können wir unseren Austausch treiben. Ich glaube allerdings, daß die Erbschaft, als was sie sich auch immer erweisen mag, niemals so wertvoll sein kann wie die Schrift.
Stets Eure Dienerin in Christo
Catherine Carey Knollys
Will Somers an Catherine Knollys:
21. Juli 1557, Kent
Süße Catherine:
Eure Gebete müssen eine heilsame Wirkung gehabt haben, denn ich bin halbwegs genesen. Gott hat unser Zusammentreffen offenbar auf einen beiden Seiten genehmeren Zeitpunkt verschoben. Wie Ihr wißt, meide ich die Sprechzimmer der Ärzte wie die der Priester. In mehr als vierzig Jahren hat sich keiner an mir zu schaffen gemacht. Darauf führe ich zurück, daß ich noch lebe. Noch nie hat mich einer zur Ader gelassen, noch nie mich einer mit Salben aus zermahlenen Perlen bestrichen (wie Harry es so über die Maßen liebte), noch auch hätte es mich je gekümmert, welchen Ornat der derzeitige Hohepriester gerade trug. Ich will Euch nicht beleidigen, Catherine. Aber ich glaube an nichts, außer an das schnelle Vergehen aller Dinge. Auch die Religion hat ihre Moden. Gestern waren es fünf Messen täglich – ja, bei Harry war es üblich! – und Wallfahrten zu Unserer Lieben Frau von Walsingham; dann waren es Bibeln und Predigten; jetzt sind es wieder Messen, unter Hinzufügung von Scheiterhaufen allerdings, und als nächstes – wer weiß? Betet Ihr nur immerzu zu diesem Genfer Gott, den Ihr nach Eurem Bilde erschaffen habt. Er ist vorläufig mächtig. Vielleicht gibt es ja etwas, das Bestand hat, über die jeweiligen Moden der Anbetung hinaus und jenseits von ihnen. Ich weiß es nicht. Meine Aufgabe war es immer – und immer nur –, die Blicke der Menschen abzulenken vom Wandel, vom Verlust, von der Auflösung – sie zu unterhalten, während hinter ihnen die Kulissen umgebaut wurden.
Catherine: Schickt mir keine Heilige Schrift, und auch keine Übersetzungen. Ich wünsche dergleichen nicht zu empfangen, und ich wünsche nicht damit in Verbindung gebracht zu werden. Ist Euch nicht klar, in welche Gefahr es mich brächte? Und das wegen nichts. Ich habe sie bereits gelesen (ja, ich mußte es, damit ich in der Öffentlichkeit mit König Harry mein Geplänkel treiben und, wenn wir allein waren und Cranmer oder seine letzte Königin gerade nicht zur Verfügung standen, für sie einspringen konnte bei seinem liebsten Zeitvertreib: einer robusten theologischen Diskussion.) Ich bin unbekehrt geblieben, und ich habe ein einzigartig geringes Interesse daran, mich bekehren zu lassen. Da es aber außergewöhnlich schwierig ist, diese Schriften einzuschmuggeln, mögt Ihr jemand anderem den Lohn solcher Mühen zuteil werden lassen.
Ich will indessen mit Eurem Freund über den Transport Eures Erbes reden. Die Geheimniskrämerei muß ein Ende haben; ich will es Euch nun offen sagen. Es ist ein Tagebuch. Euer Vater hat es geschrieben. Es ist äußerst wertvoll, und es gibt viele, die es gern vernichten würden; sie wissen, daß es existiert, haben ihre Bemühungen bislang aber darauf beschränkt, sich danach zu erkundigen: beim Herzog von Norfolk, bei den Hinterbliebenen der Familie Seymour, und sogar bei Bessie Blounts Witwer, Lord Clinton. Früher oder später werden sie mit ihrer Schnüffelei den Weg zu mir nach Kent gefunden haben.
So, nun habe ich alles gesagt, bis auf eines. Nicht William Carey, Euer vorgeblicher Vater, hat das Tagebuch geschrieben, sondern Euer wahrer Vater: der König.
Catherine Knollys an Will Somers:
30. September 1557, Basel
WILL.:
Der König war nicht – ist nicht! – mein Vater. Wie könnt Ihr es wagen, derart zu lügen und meine Mutter zu beleidigen, meinen Vater, mich selbst? Ihr wühlt also all die Lügen aus längst vergangenen Zeiten wieder hervor? Und ich hielt Euch für meinen Freund. Ich wünsche dieses Tagebuch nicht zu sehen. Behaltet es für Euch, ebenso wie alle die anderen irregeleiteten Abscheulichkeiten Eurer Gedanken! Kein Wunder, daß der König Euch so schätzte. Ihr wart vom gleichen Schlag: niederen Sinnes und voller Lüge. Ihr werdet mein Leben nicht besudeln mit Euren unwürdigen Lügen und Unterstellungen. Christus hat uns aufgetragen, zu verzeihen, aber Er hat uns auch gesagt, wir sollen den Staub von unseren Füßen schütteln, wo Lügner, Ketzer und ihresgleichen hausen. Ebenso schüttele ich nun Euch von mir ab.
Will Somers an Catherine Knollys:
November 1557, Kent
Catherine, meine Liebe:
Versagt Euch, diesen Brief in Fetzen zu reißen, statt ihn zu lesen. Ich kann Euch Euren Ausbruch nicht verdenken. Er war großartig. Ein Paradigma von empörter Empfindsamkeit, Moral und so weiter. (Würdig des alten Königs selbst! Ah, was für Erinnerungen werden da wach!) Aber nun gebt es zu: Der König war Euer Vater. Das habt Ihr immer gewußt. Ihr sprecht davon, daß Euer Vater entehrt werde. Wollt Ihr den König entehren, indem Ihr Euch weigert, zuzugeben, daß es so ist, wie es ist? Das war vielleicht die oberste unter seinen Tugenden (ja, meine Gnädigste, er hatte Tugenden) und Eigenschaften: Er erkannte die Dinge immer als das, was sie waren, nicht als das, wofür man sie im Allgemeinen hielt. Habt Ihr das nicht von ihm geerbt? Oder seid Ihr wie Eure Halbschwester, Königin Maria (auch ich finde Eure Verwandtschaft mit ihr bedauerlich): Blind und von einzigartiger Unfähigkeit, etwas zu erkennen, und ragte es auch riesenhaft vor ihrem matten Äug’ empor. Eure andere Halbschwester, Elisabeth, ist anders; und ich nahm an, Ihr wäret es auch. Ich dachte, es sei das Boleyn-Blut im Verein mit dem der Tudors, das Euch zu einer unvergleichlich festen, klaren Sicht der Dinge verhelfe, ungetrübt von spanischem Unfug. Aber wie ich sehe, habe ich mich geirrt. Ihr seid ebenso voreingenommen und dumm und erfüllt von religiösem Eifer wie die spanische Königin. König Harry ist also wirklich tot. Seine langersehnten Kinder haben dafür gesorgt.
Catherine Knollys an Will Somers:
5. Januar 1558, Basel
WILL.:
Euren Beleidigungen muß Antwort werden. Ihr sprecht davon, daß ich den König, meinen Vater, entehre. Wäre er mein Vater, hätte er dann nicht mich entehrt, indem er mich niemals als sein eigen anerkannte? (Heinrich Fitzroy hat er anerkannt, ihn zum Herzog von Richmond gemacht – den Sprößling dieser Hure Bessie Blount!) Warum also sollte ich ihn anerkennen oder ehren? Erst verführte er meine Mutter vor ihrer Ehe, und jetzt sagt Ihr mir, daß er nachher ihren Gemahl zum Hahnrei machte. Nicht Ehre verdient er, sondern Verachtung. Er war ein böser Mensch und verbreitete Entsetzen, wohin er auch kam. Ein einziges Mal nur tat er etwas Gutes, und da war es bloß ein Nebenerzeugnis des Bösen: Seine Gelüste nach meiner Tante Anne Boleyn waren ihm Anlaß, mit dem Papst zu brechen. (So bediente der Herr sich eines Sünders für seine Zwecke. Aber das ist ein Verdienst des Herrn, nicht des Königs.) Ich spucke auf den verblichenen König und auf sein Andenken! Und was nun meine Base angeht, die Prinzessin Elisabeth (die Tochter meiner Mutter Schwester, weiter nichts), so bete ich, sie möge ... doch nein, es ist zu gefährlich, dies niederzuschreiben, mag der Bote oder der Empfänger noch so vertrauenswürdig sein.
Geht Eurer Wege, Will. Ich will von Euch nichts weiter hören.
Will Somers an Catherine Knollys:
März 1558 zu Kent
Catherine:
Habt noch einmal ein wenig Geduld mit mir. In Euren wunderbar verworrenen Brief fand ich eine wesentliche Frage; der Rest war pures Gepolter. Ihr fragtet: Wäre er mein Vater, hätte er dann nicht mich entehrt, indem er mich niemals als sein eigen anerkannte?
Ihr kennt die Antwort: Er war um den Verstand gebracht worden von dieser Hexe (und nun muß ich Euch schon wieder beleidigen) Anne Boleyn. Sie versuchte, den Herzog von Richmond zu vergiften. Hätte sie denn Hand auch an Euch legen sollen? Jawohl, Eure Tante war eine Hexe. Mit Eurer Mutter war es anders. Ihr Zauber war ehrlich, und ihre Gedanken und Taten waren es auch. Dafür mußte sie leiden, während es Eurer Hexentante glänzend erging. Ehrlich ist man selten ungestraft, und wie Ihr wißt, war Eure Mutter im Leben nicht auf Rosen gebettet. Er hätte Euch anerkannt, und vielleicht auch Euren Bruder (obgleich er sich da seiner Vaterschaft nicht so sicher war), hätte die Hexe ihn nicht daran gehindert. Sie war eifersüchtig, höchst eifersüchtig auf Eure liebreizende Mutter, obschon sie dem König, weiß Gott, selber reichlich Grund zur Eifersucht gab. Die Bewunderung der ganzen Welt war der Hexe nicht genug; sie mußte auch die Dienste sämtlicher Männer bei Hofe für sich in Anspruch nehmen. Nun, wie sie selbst sagte, als dem König die irdischen Ehrungen für sie ausgegangen waren, schenkte er ihr die Krone des Märtyrertums. Ha! Nicht alle, die er tötete, sind Märtyrer. Sie versuchte, sich mit Thomas Becket in eine Reihe zu stellen, ja, selbst mit Thomas More, aber es sollte nicht sein. Sie ist gescheitert in ihrem Streben nach posthumer Ehre und Verherrlichung.
Und nun nehmt dieses Tagebuch und macht Euren Frieden mit Euch selbst. Wenn Ihr es nicht könnt, verwahrt es für Eure ... Verwandte, die Prinzessin Elisabeth, bis zu jenem Tag, da sie ... doch auch ich darf mehr nicht sagen. Es ist gefährlich, und selbst für meinen runzligen alten Hals ist das Gefühl eines Stricks nicht eben verlockend. Ich kann es ihr jetzt nicht in die Hände legen, wenngleich sie, wie Ihr deutlich gemacht habt, offenbar als zweite in Frage kommt. Sie ist von Spionen umgeben und wird dauernd bewacht. Maria möchte sie wieder in den Tower werfen und dafür sorgen, daß sie nie mehr zum Vorschein kommt.
Wie ich in den Besitz des Tagebuchs gelangte, das trug sich so zu: Als Harry, der König, mich das erste Mal sah, war ich, wie Ihr wißt (oder auch nicht; wie kommen wir dazu, stets anzunehmen, unsere private Geschichte sei von allgemeiner Bedeutung und bei jedermann bekannt?), mit meinem Herrn, einem Wollhändler zu Calais, zufällig bei Hofe. Ich war kein Narr damals – nur ein junger Mann, der sich eine Stunde in den Gängen zu vertreiben hatte. Ich vergnügte mich, wie ich es zu tun gewohnt war, wenn die reizvollere Beschäftigung mit Sherry oder Wein mir verwehrt war: Ich redete. Der König hörte mich, der Rest, wie das gemeine Volk sagt, ist Geschichte. (Wessen Geschichte?) Er nahm mich in seine Dienste, gab mir eine Schellenkappe, band mich an sich auf mehr Arten, als mir damals bewußt war. Wir wurden zusammen alt; aber hier muß ich niederschreiben, was der junge Harry war: das Auge der Sonne, das uns alle blendete ... ja, sogar mich, den zynischen Will. Wir waren Brüder; und als er im Sterben lag in jener stickigen Kammer zu Whitehall, da war ich der Einzige, der ihn als jungen Mann gekannt hatte.
Aber ich schweife ab. Ich sprach vom Tagebuch. Als ich 1525 zu Harry kam (kurz bevor die Hexe ihn in ihren Bann schlug), führte er eine Art Journal mit rohen Notizen. Als er später – nachdem Catherine Howard, seine fünfte sogenannte Königin, in Ungnade gefallen war – so krank darniederlag, begann er mit einem persönlichen Tagebuch, um sich die Zeit zu vertreiben und um sich abzulenken, von den Schmerzen in seinem Bein, die ihn tagaus, tagein plagten, und auch von der wachsenden Zwietracht rings um ihn her. O ja, Tochter – er merkte, daß ihm die Zügel entglitten. Er wußte, daß sich ringsumher Parteien bildeten, die nur darauf warteten, daß er sterbe. Und so schlug er um sich – in der Öffentlichkeit, und insgeheim schrieb er alles auf.
Gegen Ende konnte er alles nur noch in groben Zügen notieren; später wollte er (der ewige Optimist) diese Notizen dann ausarbeiten. (Ja, nur einen Monat vor seinem Tode bestellte er für seine Gärten Obstbäume, die frühestens in zehn Jahren Frucht tragen würden. Welche Ironie: Wie ich hörte, haben sie voriges Jahr geblüht, und Maria hat sie umhauen lassen. Wenn sie unfruchtbar sein muß, dann hat der königliche Garten zwangsläufig die königliche Person nachzuahmen.) Er hat sie nie ausgearbeitet, und er wird es nun auch nicht mehr tun. Ich habe sie, wie alles andere, mit eigenen Aufzeichnungen und Erläuterungen versehen. Ich zögerte zunächst, das Tagebuch zu entstellen, aber als ich es las, war es, als hörte ich Harry wieder reden, und es war stets meine Art, ihn zu unterbrechen. Alte Gewohnheiten sind hartnäckig, wie Ihr seht. Aber so gut ich ihn auch kannte, das Tagebuch zeigte mir doch auch einen unbekannten Heinrich – was vermutlich nur beweist, daß wir allesamt Fremde sind, sogar für uns selbst.
Aber ich wollte erklären, wie ich in den Besitz des Tagebuches gelangt bin. Die Antwort ist einfach: Ich habe es gestohlen. Sie hätten es vernichtet. Sie haben auch sonst alles vernichtet, wenn es nur entfernt mit dem König zu tun hatte, oder mit den alten Zeiten: erst die Reformatoren, nun die Papisten. Die Reformatoren zerschlugen die Scheiben in sämtlichen Kirchen, und die Papisten gehen, wie ich höre, in ihrer Bestialität noch einen Schritt weiter, so daß selbst ich zögere, es niederzuschreiben. Die Agenten der Königin haben Harrys Leichnam – ihren eigenen Vater! – aus dem Grab genommen, verbrannt und in die Themse geworfen! Oh, diese Ungeheuer!
Dieses Tagebuch ist daher das letzte, was auf Erden von ihm übrig ist. Werdet Ihr eine ebenso unnatürliche Tochter sein wie die Königin und es auch noch verbrennen? Wenn Ihr seine Tochter nicht seid (wie Ihr behauptet), dann seid ihm ein besseres Kind als sein eigen Fleisch und Blut.
Wie humorlos dies doch ist. Humor ist ja in der Tat das Zivilisierteste, was wir haben. Er glättet alle scharfen Kanten und macht den Rest erträglich. Harry wußte das. Vielleicht sollte ich selber einen Narren einstellen, denn offensichtlich habe ich selber meinen Beruf hinter mir gelassen.
Der Segen Eures rätselhaften Gottes sei mit Euch.
Will
Beigefügt ist das Tagebuch.
Zu einer Anmerkung fühle ich mich genötigt: Bessie Blount war keine Hure.
DAS TAGEBUCH
Kapitel I
Gestern fragte mich irgendein Narr, was meine erste Erinnerung sei, und erwartete, daß ich beglückt in irgendwelche sentimentalen Kindheitsanekdoten verfiele, wie es wunderliche alte Männer angeblich so gern tun. Er war ganz überrascht, als ich ihn hinauswarf.
Aber der Schaden war angerichtet, und aus meinem Kopf war dieser Einfall nicht so leicht hinauszuwerfen. Was war meine früheste Erinnerung? Was immer es war, sie war nicht angenehm. Dessen war ich sicher.
War ich sechs Jahre alt? Nein, ich erinnere mich an die Geburt meiner Schwester Maria, und da war ich fünf. Vier also? Da starb meine andere Schwester, Elisabeth, und daran, schrecklich genug, erinnere ich mich auch. Drei? Vielleicht. Ja. Ich war drei, als ich zum ersten Mal Jubelrufe hörte – und die Worte »nur ein zweitgeborener Sohn«.
Der Tag war schön – ein heißer, stiller Sommertag. Ich sollte mich mit Vater zur Westminster Hall begeben, um dort Ehren und Titel entgegenzunehmen. Er hatte das Ritual mit mir geprobt, bis ich es vollkommen beherrschte: Ich wußte, wie ich mich zu verneigen, wann ich mich auf den Boden zu werfen und wie ich vor ihm rückwärts den Raum zu verlassen hatte. Das mußte ich tun, weil er König war und weil ich mich in seiner Gegenwart befinden würde.
»Man wendet einem König niemals den Rücken zu«, erklärte er.
»Auch wenn du mein Vater bist?«
»Auch dann«, antwortete er ernst. »Ich bin immer noch dein König. Und ich mache dich heute zum Ritter des Bath-Ordens, und du mußt gekleidet sein wie ein Einsiedler. Und dann kommst du noch einmal in die Halle, in Festgewändern diesmal, und wirst Herzog von York.« Er lachte sein trockenes kleines Lachen – wie das Rascheln von Blättern, die über einen gepflasterten Hof wehten. »Das wird sie zum Schweigen bringen und ihnen zeigen, daß die Tudors sich York einverleibt haben! Der einzig wahre Herzog von York wird mein Sohn sein. Sollen es nur alle sehen!« Plötzlich senkte er die Stimme und sprach leise weiter. »Du wirst vor dem gesamten Adel des Reiches stehen. Du darfst nichts falsch machen, und du darfst auch keine Angst haben.«
Ich sah in seine kalten grauen Augen. Sie hatten die Farbe des Novemberhimmels. »Ich habe keine Angst«, sagte ich, und ich wußte, ich sprach die Wahrheit.
Scharen von Menschen kamen, um uns zu sehen, als wir durch Cheapside nach Westminster ritten. Ich hatte mein eigenes Pony, ein weißes, und ich ritt gleich hinter Vater mit seinem großen, schabrackenverhängten Fuchs. Selbst zu Pferde war ich kaum größer als die Wand von Menschen zu beiden Seiten. Deutlich konnte ich einzelne Gesichter sehen, ihre Mienen erkennen. Sie waren glücklich und riefen uns immer wieder ihren Segen zu, als wir vorüberzogen.
Die Zeremonie machte mir Spaß. Es heißt, daß Kinder für Zeremonien nichts übrig haben, aber mir machte sie Spaß. (Eine Vorliebe, die ich bis heute nicht verloren habe. Hat auch sie damals ihren Anfang genommen?) Es gefiel mir, sämtliche Blicke in Westminster Hall auf mir zu wissen, als ich sie der Länge nach durchschritt, Vater entgegen. Die Einsiedlerkutte war rauh und kratzte, aber ich wagte nicht, mir mein Unbehagen anmerken zu lassen. Vater thronte auf einer Estrade auf einem dunklen, holzgeschnitzten Sessel aus königlichem Besitz. Er war mir fern und hatte nichts Menschliches – wahrhaft ein König. Ich trat ihm ein wenig zitternd entgegen, und er erhob sich und nahm ein langes Schwert und schlug mich zum Ritter und zum Mitglied des Bath-Ordens. Als er das Schwert wieder hob, streifte es leicht meinen Hals, und ich fühlte überrascht, wie kalt der Stahl war, selbst an diesem hochsommerlichen Tag.
Dann ging ich langsam rückwärts hinaus in den Vorraum, wo Thomas Boleyn, einer von Vaters Leibjunkern, auf mich wartete, um mir beim Anlegen der schweren roten Zeremoniengewänder zu helfen, die eigens für diesen Tag angefertigt worden waren. Sodann begab ich mich zurück in die Halle, wiederholte das Ganze und ward so zum Herzog von York.
Danach sollte ich geehrt werden; Sämtliche Edlen und hochrangigen Prälaten sollten kommen und sich vor mir verneigen und mich so als den höchsten Adeligen von England anerkennen – nach dem König und meinem älteren Bruder Arthur. Heute weiß ich es, aber damals verstand ich nicht, was es bedeutete. Der Titel »Herzog von York« war bei Thronprätendenten beliebt, und so gedachte Vater seinen Edlen einen Gefolgschaftseid abzunehmen, indem er ausschloß, daß sie spätere Prätendenten anerkannten – denn zwei Herzöge von York kann es schließlich nicht geben. (Ebenso wenig wie es zwei Köpfe von Johannes dem Täufer geben kann, wenngleich manche Papisten beharrlich beide verehren.)
Aber damals verstand ich davon nichts. Ich war erst drei Jahre alt. Es war das erste Mal, daß man mich zu etwas auserkoren hatte, was nur mich betraf, und ich hungerte nach solcher Aufmerksamkeit. Ich stellte mir vor, daß sich nun alle Erwachsenen um mich drängen und mit mir reden würden.
Es kam ganz anders. Ihre »Anerkennung« bestand in einem kurzen Blick in meine Richtung, einem leichten Neigen des Kopfes. Ich fühlte mich ganz verloren in diesem Wald von Beinen (so kam es mir vor; ich reichte einem erwachsenen Mann ja kaum bis an die Hüften), die sich bald zu kleinen Gruppen von drei oder vier Männern fügten. Ich sah mich nach meiner Mutter, der Königin, um, doch ich konnte sie nirgends entdecken. Aber sie hatte doch versprochen, zu kommen ...
Eine blökende Fanfare verkündete, daß an dem großen Tisch entlang der Westwand der Halle nun die Speisen aufgetragen würden. Eine lange weiße Leinendecke lag auf dem Tisch, und alle Platten waren aus Gold. Sie glänzten in dem matten Licht und bildeten so einen Gegensatz zu den Farben der Speisen, die darauf angerichtet waren. Mundschenke begannen umherzugehen; sie trugen große goldene Krüge. Als sie zu mir kamen, wollte ich auch etwas, und darüber mußte jeder außer mir lachen. Der Mundschenk erhob Einwände, aber ich blieb hartnäckig. So gab er mir einen kleinen ziselierten Silberbecher und füllte ihn mit Rotwein, und ich leerte den Becher auf einen Zug. Die Leute lachten, und dies erregte die Aufmerksamkeit meines Vaters. Er funkelte mich an, als hätte ich eine schwere Sünde begangen.
Bald war mir schwindelig, und die schweren Samtgewänder ließen mich in der stickigen Luft der überfüllten Halle schwitzen. Das Stimmengedröhn über mir war unangenehm, und noch immer war die Königin nicht gekommen, und es hatte sich niemand um mich gekümmert. Zu gern wäre ich nach Eltham zurückgekehrt und hätte diese langweilige Feier verlassen. Wenn das ein Fest war, so hatte ich genug davon, und ich würde Arthur sein Recht, an derlei teilzunehmen, nicht neiden.
Ich sah, daß Vater ein wenig abseits stand und mit einem seiner Kabinettsherren redete – mit Erzbischof Morton, glaube ich. Kühn vom Wein (ich zögerte sonst zumeist eher, Vater anzusprechen) beschloß ich, ihn zu fragen, ob ich nicht gehen und unverzüglich nach Eltham zurückkehren dürfe. Es gelang mir, mich unauffällig an Trauben von schwatzenden Adeligen und Höflingen vorbeizudrücken und mich ihm zu nähern. Meine so geringe Körpergröße bewirkte, daß niemand mich sah, als ich mich in der Nähe des Königs im Hintergrund hielt und, halb in den Falten der Wandbehänge verborgen, darauf wartete, daß er sein Gespräch beendete. Man unterbricht den König nämlich nicht, selbst wenn man des Königs Sohn ist.
Einzelne Worte wehten zu mir herüber. Die Königin ... krank ...
Wurde meine Mutter etwa durch eine Krankheit am Kommen gehindert? Ich schob mich näher heran und spitzte die Ohren.
»Aber sie muß diesen Schmerz begraben«, sagte Morton eben. »Doch jeder Prätendent reißt die Wunde von neuem auf ...«
»Deshalb war es notwendig, dies heute zu tun. Es mußte ein Ende gemacht werden mit all diesen falschen Herzögen von York. Wenn sie nur sehen könnten, wie es Ihre Gnaden schmerzt. Jeder von ihnen ... Sie weiß, sie sind Lügner, Prätendenten, und doch war mir, als habe sie Lambert Simnels Gesicht allzu lange betrachtet.
Sie wünscht es sich, versteht Ihr; sie wünscht sich, ihr Bruder Richard wäre noch am Leben.« Der König sprach mit leiser Stimme; er klang unglücklich. »Deshalb konnte sie nicht kommen und dabei zusehen, wie Heinrich seinen Titel verliehen bekommt. Sie könnte es nicht ertragen. Sie hat ihren Bruder geliebt.«
»Aber ihren Sohn liebt sie auch.« Es war eine Frage, als Feststellung verkleidet.
Der König zuckte die Achseln. »Wie eine Mutter ihren Sohn eben liebt.«
»Nicht mehr?« Morton klang jetzt eifrig.
»Wenn sie ihn liebt, dann um der Erinnerungen willen, die er in ihr wachruft – an ihren Vater Edward. Heinrich hat Ähnlichkeit mit ihm; das ist Euch sicher nicht entgangen.« Vater nahm noch einen Schluck Wein aus seinem schweren Becher, so daß ich sein Gesicht nicht sehen konnte.
»Recht edel sieht er aus, der Prinz.« Morton nickte, so daß sein Kinn fast seinen Pelzkragen berührte.
»Er sieht gut aus, das will ich nicht bestreiten. Auch Edward sah gut aus. Wißt Ihr noch, wie das Weib auf dem Marktplatz schrie: ›Meiner Treu, für dein hübsches Lärvchen sollst zwanzig Pfund bekommen!‹ Der hübsche Edward. ›Die Sonne in ihrer Pracht‹, so nannte er sich selbst.«
»Während wir doch alle wissen, wie es hätte heißen müssen. ›Der König in Mistress Shores Bett‹«, kicherte Morton. »Oder war es Eleanor Butler?«
»Kommt es darauf an? Er war immer in irgend jemandes Bett. Entsinnt Ihr Euch nicht jener Spottballade, in der er sich ›lümmelt in liederlichem Lotterbett‹? Es war gerissen von Elisabeth Woodville, seine Wollust auszubeuten. Ich will die Königinmutter nicht herabsetzen, aber sie war ein verdrießliches altes Biest. Ich fürchtete schon, sie werde niemals sterben. Doch jetzt sind wir schon seit zwei Jahren von ihr befreit. Gelobt sei der Herr!«
»Aber Heinrich ... ist er nicht ...« Morton interessierte sich offensichtlich mehr für die Lebenden als für die Toten.
Der König blickte in die Runde, um sich zu vergewissern, daß niemand sonst zuhörte. Ich drückte mich tiefer in die Vorhangfalte und wünschte, ich wäre unsichtbar. »Nur ein zweitgeborener Sohn. Gebe Gott, daß er nie gebraucht werde. Sollte er jemals König werden ...«, er hielt inne, und dann senkte er die Stimme zu einem Flüstern und sprach das Unaussprechliche aus: »Das Haus Tudor würde es nicht überstehen. Ebenso wie das Haus York diesen Edward nicht überlebt hat. Er sah gut aus und war ein großartiger Soldat – das muß man ihm lassen –, aber im Grunde war er dumm und ohne Empfinden. Und Heinrich ist genauso. Einen Edward könnte England überleben, aber niemals zwei von seiner Sorte.«
»So weit wird es niemals kommen«, entgegnete Morton geschmeidig. »Wir haben Arthur, und der wird ein großer König werden. Er trägt bereits alle Merkmale der Größe in sich. So gelehrt. So stattlich. So weise – weit über den Stand eines Achtjährigen hinaus.«
»Arthur der Zweite«, murmelte Vater, und seine Augen blickten verträumt. »Ja, das wird ein großer Tag werden. Und Heinrich wird vielleicht eines Tages Erzbischof von Canterbury. Ja, die Kirche ist ein guter Platz für ihn. Auch wenn ihn das Zölibatsgelübde vielleicht ein wenig hart ankommen wird. Euch nicht auch, Morton?« Er lächelte kalt im Eingeständnis der Komplizenschaft. Morton hatte viele Bastarde.
»Aber Euer Gnaden ...« Morton wandte in gespielter Bescheidenheit das Gesicht ab und hätte mich fast entdeckt.
Mein Herz pochte. Ich preßte mich in die Vorhänge. Sie durften nicht wissen, daß ich neben ihnen stand und alles gehört hatte. Ich hätte gern geweint – ja, ich fühlte schon, wie die Tränen aufwärts und in meine Augen drängten –, aber dazu war ich nicht empfindsam genug. Das hatte der König gesagt.
Stattdessen verließ ich, als ich nicht mehr zitterte und jede Andeutung von Tränen niedergekämpft hatte, mein Versteck, wanderte unter den versammelten Edlen umher und sprach kühn mit jedem, der mir begegnete. Dies gab später Anlaß zu mancherlei Bemerkung.
Ich darf nicht heucheln. Ein Prinz zu sein, war manchmal gut. Nicht in materiellem Sinn, wie die Leute es sich denken. Die Söhne des Adels lebten in größerem Luxus als wir; wir standen am unteren Ende der königlichen »Hauswirtschaft« und lebten und schliefen in spartanischen Unterkünften, wie gute Soldaten. Gewiß, wir wohnten in Schlössern, und dieses Wort beschwört Vorstellungen von Luxus und Schönheit herauf – was ich mir zu einem Teil als Verdienst anrechnen muß, denn ich habe in meiner eigenen Regierungszeit hart dafür gearbeitet, es wahr werden zu lassen –, aber in meiner Kindheit war das anders. Die Schlösser waren Überbleibsel aus einer früheren Ära – romantisch vielleicht, und durchtränkt von Geschichte (hier wurden Edwards Söhne ermordet; hier legte Edward II. seine Krone ab), aber sie waren entschieden unbehaglich: Dunkel und kalt.
Besonders abenteuerlich war es auch nicht. Vater ging nicht oft auf Reisen, und wenn er es tat, ließ er uns zu Hause. Die ersten zehn Jahre meines Lebens verbrachte ich fast ausschließlich innerhalb der Palastmauern von Eltham. Einen Blick auf irgend etwas außerhalb Gelegenes zu werfen, war uns praktisch verboten. Vorgeblich geschah dies zu unserem Schutz. Aber es war, als hausten wir in einem Kloster. Kein Mönch führte ein so karges, so eingeschränktes, so langweiliges Leben wie ich in diesen ersten zehn Jahren.
Und das war nur recht so, da Vater ja beschlossen hatte, daß ich Priester werden müsse, wenn ich groß wäre. Arthur würde König sein. Ich, der zweitgeborene Sohn, mußte Kirchenmann werden und meine Kräfte in Gottes Dienst stellen, statt sie darauf zu verwenden, die Stellung meines Bruders zu erobern. Und so erhielt ich, kaum daß ich vier Jahre alt war, meine kirchliche Ausbildung von einer Anzahl Priestern mit traurigen Augen.
Aber dennoch, es war gut, ein Prinz zu sein. Die Gründe dafür sind schwer faßlich, und es ist mir fast unmöglich, sie zu Papier zu bringen. Um die Geschichte zu vervollständigen, soll es geschehen. Ein Prinz sein, das bedeutete – etwas Besonderes sein. Wissen, daß man, las man etwa die Geschichte von Edward dem Bekenner oder Richard Löwenherz, durch mystische Blutsbande mit ihnen verknüpft war. Das war alles. Aber es war genug. Genug für mich, während ich endlose lateinische Gebete auswendig lernte. Ich hatte das Blut von Königen in mir! Sicher, es war verborgen unter schäbigen Gewändern, und ich würde es niemals weitergeben, aber es war nichtsdestoweniger da – wie ein Feuer, an dem ich mich wärmen konnte.
Kapitel II
Es hätte niemals auf diese Weise beginnen dürfen. Diese durcheinandergewürfelten Gedanken können nicht einmal als passable Sammlung von Eindrücken gelten, und schon gar nicht als Memoiren. Ich muß die Dinge in eine vernünftige Ordnung bringen. Wolsey hat mich das gelehrt: Alles braucht seine Ordnung. Habe ich das so rasch vergessen?
Ich habe damit (mit diesen Aufzeichnungen, meine ich) vor einigen Wochen begonnen, und zwar in dem vergeblichen Bestreben, mir Linderung zu verschaffen, derweil ich einen neuerlichen Anfall von Schmerzen in meinem verfluchten Bein zu erleiden hatte. Vielleicht hat diese Pein mich so sehr abgelenkt, daß ich außerstande war, meine Gedanken zu ordnen. Aber jetzt sind die Schmerzen vorbei. Wenn ich dies nun tun soll, muß ich es richtig tun. Ich habe von »Vater« gesprochen, vom »König« und von »Arthur«, ohne ein einziges Mal zu erwähnen, wie der König hieß. Oder zu welcher Herrscherfamilie er gehörte. Oder in welche Zeit. Unverzeihlich!
Der König war Heinrich VII. aus dem Hause Tudor. Aber ich darf gar nicht so großartig vom »Hause Tudor« sprechen, denn bevor Vater König wurde, war es überhaupt kein Königshaus. Die Tudors waren eine walisische Familie und (seien wir ehrlich) walisische Abenteurer noch dazu, die sich vor allem mit romantischen Abenteuern im Bett und in der Schlacht voranzubringen trachteten.
Mir ist sehr wohl bekannt, daß Vaters Genealogen die Tudors bis in die Morgendämmerung der britischen Geschichte zurückverfolgt haben und uns in direkter Linie von Cadwaller abstammen lassen. Aber den ersten Schritt zu unserer heutigen Größe unternahm Owen Tudor, der Gewandmeister der Königin Katharina, der Witwe Heinrichs V. (Heinrich V. war Englands mächtigster Soldatenkönig; er hatte einen großen Teil Frankreichs erobert. Das war etwa siebzig Jahre vor meiner Geburt. Jeder gemeine Engländer weiß das heute; aber wird das immer so sein?) Heinrich und die Tochter des französischen Königs heirateten aus politischen Gründen und hatten einen Sohn, Heinrich VI., der im Alter von neun Monaten zum König von England und Frankreich ausgerufen wurde. Aber nachdem Heinrich V. so plötzlich verstorben war, saß seine einundzwanzigjährige französische Witwe allein in England.
Owens Aufgaben führten dazu, daß er ständig in ihrer Gesellschaft war. Er war hübsch; sie war einsam; sie heirateten, heimlich. Ja, Katharina (die Tochter eines Königs, Frau eines anderen, Mutter gar eines dritten) verunreinigte – sagen manche – ihr königliches Blut mit dem eines walisischen Buben. Sie hatten zwei Söhne, Edward und Jasper, Halbbrüder Heinrichs VI.
Aber Katharina starb, als sie die Mitte der Dreißig erreicht hatte, und Owen ward nicht länger geduldet. Der Protektorenrat Heinrichs VI. ließ »einen gewissen Owen Tudor, welcher da lebte mit besagter Königin Katharina«, vor sich rufen, da er »so anmaßend gewesen, durch Heirat mit der Königin sein Blut mit dem herrschaftlichen Geschlecht der Könige zu vermischen«. Owen weigerte sich erst, zu erscheinen; später aber kam er doch und wurde zu Newgate eingekerkert, von wo er zweimal entkam. Er war schwer zu fassen und mit allen Wassern gewaschen. Nach seiner zweiten Flucht begab er sich zurück nach Wales.
Als Heinrich VI. mündig wurde und sich seines Protektoren entledigte, behandelte er die beiden Söhne Owens freundlich. Edmund ernannte er zum Earl von Richmond, Jasper zum Earl von Pembroke. Und Heinrich VI. – dieser arme, verrückte, liebe Mensch – fand in Lancaster sogar eine standesgemäße Braut für seinen Halbbruder Edmund: Margaret Beaufort.
Diese historischen Begebenheiten wiederzugeben, das ist, als ziehe man einen Faden auf: Man will eigentlich nur einen kleinen Teil berichten, doch dann kommt noch einer dazu, und noch einer, denn alle sind Teil desselben Gewandes-Tudor, Lancaster, York, Plantagenet.
Und so muß ich tun, was ich befürchtet habe: Ich muß zurück bis zu Edward III., dem unschuldigen Ursprung all der späteren Sorgen. Ich sage unschuldig, denn welcher König wünschte sich nicht Söhne im Überfluß? Und doch rührt Edwards Kummer wie der nachfolgender Generationen just aus seiner Fruchtbarkeit.
Edward, geboren fast zweihundert Jahre vor mir, hatte sechs Söhne. Ein Segen? Man sollte es meinen. In Wahrheit aber waren sie ein Fluch, dessen Echo bis zum heutigen Tage nachhallt. Den Ältesten, Edward, nannte man den »Schwarzen Prinzen«. (Warum, das weiß ich nicht; aber ich glaube, der Grund waren die Livreen, die sein Gefolge zu tragen pflegte. Er war ein großer Soldat.) Er starb noch vor seinem Vater, und so kam sein Sohn, Edwards Enkel, als Richard II. auf den Thron.
Die anderen Söhne Edwards waren William, der jung starb, Lionel, Herzog von Clarence, von dem letztlich das Haus York abstammt, John von Gaunt, der Herzog von Lancaster und Urahn des so benannten Hauses, Edmund, Herzog von York (Edmunds und Clarences Erben heirateten später und vereinten so ihre Ansprüche), und schließlich Thomas von Woodstock, Ahnherr des Herzogs von Buckingham.
Folgendes trug sich nun zu: Heinrich, der Sohn des John von Gaunt, stürzte seinen Vetter Richard II. und ließ sich als Heinrich IV. krönen. Sein Sohn war Heinrich V.; er heiratete Königin Katharina Valois, die hernach Owen Tudor heiratete.
Das findet Ihr verwirrend? Ich versichere Euch, in meiner Jugend war dieses verworrene Ahnengeflecht ebenso bekannt wie heute vielleicht die Worte einer populären Ballade oder die Reihenfolge der Fünf Schmerzensreichen Mysterien Christi. Es überschattete unser ganzes Leben und zwang uns, eine Rolle auf der einen oder anderen Seite zu übernehmen, eine Rolle, die auf geradem Wege zu Glück und Wohlstand führte ... oder in den Tod.
Aber der Sohn Heinrichs V., der zu Paris als Heinrich VI. zum König von England und Frankreich gekrönt wurde, vermochte sich sein Erbe nicht zu bewahren. Als er älter wurde, zeigte sich, daß er unfähig und halb verrückt war.
Wenn der König aber schwach ist, finden sich andere, die sich für stark halten. Und so wurde die Sache der Yorkisten geboren.
Einer Legende zufolge begannen die Kriege, als Richard Plantagenet (der spätere Herzog von York) sich mit seinen Gefährten und Rivalen Somerset, Warwick und Suffolk in Temple Gardens traf. Richard brach eine weiße Rose von einem Strauch, um damit die Abstammung von Lionel, dem dritten Sohne Edwards IIL, zu versinnbildlichen, und forderte jeden, der seines Sinnes sei, auf, sich ihm anzuschließen; Warwick, ein Sproß der mächtigen Familie Neville aus dem Norden, nahm gleichfalls eine weiße Rose. Somerset und Suffolk pflückten eine rote und stellten sich damit hinter John von Gaunt, den Herzog von Lancaster und vierten Sohn, und dessen Ansprüche. Sodann prophezeiten sie, daß diese Kluft wachsen und schließlich das ganze Reich durchtrennen werde.
Das ist eine hübsche Geschichte; ob sie stimmt oder nicht, das weiß ich nicht. Es stimmt allerdings, daß innerhalb weniger Jahre Hunderte von Menschen im Kampf für die Weiße oder die Rote Rose ihr Leben ließen.
Heinrich VI. wurde schließlich abgesetzt, und zwar von Edward IV., dem wackeren Sohn der Yorkisten. Er schlug drei Feldschlachten und verlor keine: ein militärisches Genie.
Die Linien aller drei Familien waren, wie ich schon sagte, miteinander verflochten. Es ist schwierig für mich, von den Grausamkeiten zu berichten, die sie einander zufügten, denn ihrer aller Blut fließt heute in meinen Adern.
Ja, Edward IV. war ein großer Streiter, und darauf bin ich stolz, denn er war mein Großvater. Mein Urgroßvater indessen kämpfte gegen ihn, unterstützt von meinem Großonkel Jasper Tudor. Sie wurden vernichtet, und Owen geriet 1461, nach der Schlacht von Mortimer’s Cross, in Gefangenschaft, und er wurde – auf Edwards Befehl – auf dem Marktplatz von Hereford hingerichtet. Bis der Scharfrichter erschien, um seines Amtes zu walten, glaubte Owen nicht, daß er tatsächlich sterben werde. Der Henker riß ihm den Kragen vom Wams, und da erst wußte er es. Er sah sich um und sprach: »Auf dem Block soll nun liegen der Kopf, der zu liegen pflegte in Königin Katharinas Schoße.« Später kam eine Verrückte und nahm seinen Kopf weg und stellte rings um ihn herum hundert brennende Kerzen auf.
Ich erzähle dies, damit man, wenn ich berichte, wie Owens ältester Sohn Edmund sich mit Margaret Beaufort, der dreizehnjährigen Erbin der Ansprüche des Hauses Lancaster, verheiratete, nicht auf den Gedanken kommt, sie hätten etwa ein ruhiges Leben geführt. Überall um sie herum tobten die Kämpfe. Edmund entkam all diesen Sorgen, indem er im Alter von sechsundzwanzig Jahren verschied und seine Frau gesegneten Leibes zurückließ. Das Kind war mein Vater, und es kam zur Welt, als seine Mutter gerade vierzehn Jahre alt war. Das war am 28. Januar 1457.
WILL SOMERS:
Bei diesem Datum überlief es mich eisig. Es war ebenfalls ein 28. Januar, als Heinrich VIII. starb. Im Jahr 1547 – die Ziffern also nur umgestellt – es ist wie eine Parenthese: Der Vater geboren, der Sohn gestorben ... doch ich glaube nicht an solche Sachen. Das überlasse ich den Walisern und ihresgleichen.
HEINRICH VIII.:
Sie taufte ihn Heinrich – ein königlicher Name des Hauses Lancaster. Doch zu jener Zeit war er keineswegs ein bedeutender Erbe, sondern nur eine Randfigur in dem alles in allem verworrenen Gewebe. Dies, obwohl er der Enkel einer Königin (väterlicherseits) und der Urururenkel eines Königs (auf mütterlicher Seite) war. Aber die Schlachten tobten weiter, und alle, die einen höheren Anspruch auf den Thron anmelden konnten, kamen dabei um (der einzige Sohn Heinrichs VI. nämlich, Edward, sowie Richard, Herzog von York), und jede Schlacht brachte Heinrich Tudor dem Thron ein Stückchen näher. In der Schlacht von Tewkesbury im Jahr 1471 wurden alle männlichen Mitglieder des Hauses Lancaster getötet, bis auf Heinrich Tudor. Er floh mit seinem Onkel Jasper in die Bretagne.
Heinrich VI. ward noch im selben Jahr im Tower vom Leben zum Tode befördert. Das besorgten die Yorkisten. Es war ein Gnadenakt: Heinrich VI. war vielleicht ein Heiliger, aber zum König war er nicht geschaffen. Dies beweist sein Gedicht:
Königreiche sind nur Bürden,
Staat ist ohne festen Halt.
Reichtum ist die Würgerfalle
Und wird nimmer alt.
Ein Yorkistenschwert erlöste ihn von den Sorgen, die sein Königtum ihm bereitete, und ich kann nur sagen, sie haben ihm einen guten Dienst erwiesen.
Aber die Geschichte meines Vaters ist ebenso lang; Historien dieser Art sind nicht simpel. Vater ging ins Exil; er reiste über den Kanal in die Bretagne, wo der gute Herzog Francis ihn willkommen hieß – gegen eine Gebühr. Edward IV. setzte ihm nach, versuchte, ihn entführen und ermorden zu lassen. Vater überlistete – Edward war ein Trottel– und überlebte ihn; er saß in der Bretagne und sah zu, wie Edwards grausamer Bruder Richard sich des Thrones bemächtigte und Edwards Söhne, Edward V. und Richard, Herzog von York, beseitigte. Es heißt, er habe sie im Schlaf ersticken lassen und irgendwo im Tower verscharrt.
Viele litten bald unter Richards Herrschaft und fielen von ihm ab; sie kamen zu Vater in die Bretagne, bis er einen Exilhof um sich geschart hatte. In England herrschte derweilen solche Unzufriedenheit, daß rebellische Untertanen Vater aufforderten, zu kommen und Anspruch auf den Thron zu erheben.
Das erstemal versuchte er es 1484; doch das Schicksal war gegen ihn, und Richard nahm seinen wichtigsten Gefolgsmann, den Herzog von Buckingham, gefangen und ließ ihn hinrichten. Im nächsten Jahr war die Zeit von neuem reif, und Vater wagte nicht, noch länger zu warten, sollte seine Anhängerschaft nicht von ihm abfallen. So stach er in See und landete in Wales mit einer Armee von nur zweitausend Mann, während Richard III., wie man wußte, zehntausend befehligte.
Was trieb ihn dazu? Die Geschichte kenne ich gut, aber ich kenne auch Vater: vorsichtig bis zur Tatenlosigkeit, mißtrauisch, langsam in seinen Entschlüssen. Trotzdem riskierte er mit achtundzwanzig Jahren alles – auch sein Leben – für ein anscheinend hoffnungsloses Unterfangen. Zweitausend Mann gegen zehntausend.
In Wales wurde er überschwänglich empfangen, und die Leute strömten ihm in Scharen zu; bald waren seine Truppen auf fünftausend Mann angewachsen, aber immer noch nur halb so groß wie Richards Streitmacht. Dennoch stürmte er voran durch augustgelbe Felder, bis sie wenige Meilen vor Leicester auf einem Feld namens Bosworth zusammentrafen.
Ein wilder Kampf entbrannte, und schließlich zogen sich einige von Richards Mannen zurück. Ohne sie aber war die Schlacht verloren. Richard wurde erschlagen und von seinen eigenen abgefallenen Anhängern dutzendfach zerhauen, als er versuchte, Vater selbst anzugreifen.
Man erzählt, in der Hitze des Gefechtes sei Richard die Krone vom Kopf geflogen und in einem Ginsterbusch gelandet; Vater habe sie dort aufgehoben und sich selbst auf den Kopf gesetzt, und ringsumher habe man »König Heinrich! König Heinrich!« gerufen. Ich bezweifle, daß es so war, aber es ist eine Geschichte von der Art, wie man sie gern glaubt. Die Leute mögen simple Geschichten, und sie pflegen auch das Profunde in eine schlichte, beruhigende Form zu biegen. Es gefällt ihnen, zu glauben, man werde König durch ein Zeichen, nicht durch etwas so Undurchschaubares und Verwirrendes wie eine Schlacht.
Tatsächlich war es ganz und gar nicht so simpel. Trotz Schlacht und Krone im von Gotteshand platzierten Busch blieb so mancher Aufsässige, der einfach nicht bereit war, Heinrich Tudor als König zu akzeptieren. Wohl wahr, in seinen Adern strömte königliches Blut, und er hatte die Tochter des letzten Yorkistenkönigs zur Frau genommen, aber so leicht waren hartgesottene Yorkisten nicht zu besänftigen. Sie wollten einen echten Yorkisten auf dem Thron sehen oder gar keinen. Und so begann verräterisches Treiben.
Yorkisten waren keine mehr da, aber die Verräter versuchten, die erstickten Söhne Edwards IV. wiederauferstehen zu lassen (die Brüder meiner Mutter). Den Ältesten, Edward, zu »entdecken«, das wagten sie nicht, so kühn waren nicht einmal sie. So fiel ihre Wahl auf Richard, den jüngeren der beiden. Und jede dieser verräterischen Sippschaften fand bereitwillige blondhaarige Knaben in hinreichender Zahl, die willens waren, sich als diesen ausgeben zu lassen.
Der erste war Lambert Simnel. Die Iren krönten ihn als Richard IV. Vater nahm es belustigt hin. Nachdem er den Aufstand 1487 in der Schlacht von Stoke niedergeschlagen hatte, ernannte er den vormaligen »König« zum Koch in der königlichen Küche. Die Arbeit an den heißen Herden ließ dessen königliche Haltung rasch dahinschmelzen.
Mit dem nächsten, Perkin Warbeck, ging es weniger amüsant. Die Schotten riefen ihn zum König aus und gaben ihm wohl auch ein adeliges Mädchen zum Weibe. Vater ließ ihn hinrichten.
Und doch war der Aufstände kein Ende. Wie aus einem nie versiegenden Quell strömten Verräter und Unzufriedene. Was Vater auch tat, es gab immer irgendwo welche, denen es nicht recht war und die sich zu seinem Umsturz verschworen.
Es ließ ihn schließlich bitter werden. Jetzt sehe ich es, und ich verstehe es auch. Sie hatten ihm seine Jugend genommen (»Seit ich fünf Jahre alt war, bin ich entweder auf der Flucht oder in Gefangenschaft gewesen«, hat er einmal gesagt), und selbst als man hätte meinen sollen, daß er sich sein Anrecht auf Frieden nun erworben habe, ließen sie ihn nicht in Ruhe. Sie waren entschlossen, ihn vom Thron zu vertreiben oder ins Grab zu schicken.