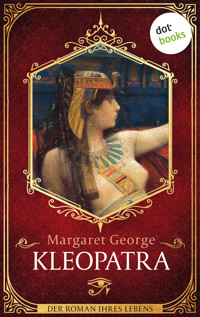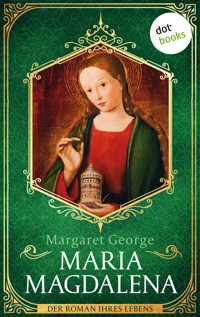0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Frau im Sturm der Geschichte: Die bewegende Romanbiografie »Maria Stuart« von Margaret George jetzt als eBook bei dotbooks. Ihr wurde eine glänzende Zukunft vorhergesagt – doch nur zwei Jahre, nachdem sie den französischen Thron bestiegen hat, verliert Maria Stuart gleichzeitig Mann und Krone. Vertrieben und in Trauer kehrt die junge Königin der Schotten in ihre geliebte Heimat zurück, in der Hoffnung, von ihren Landsleuten mit offenen Armen empfangen zu werden. Aber viele im Volk stehen ihr feindlich gegenüber: Die einen verehren sie als Heilige, die anderen beschimpfen sie als Hure. Und auch am Hof weiß Maria nicht, wem sie wirklich trauen kann. In der Hoffnung auf Unterstützung wendet sie sich an ihre Cousine Elisabeth von England – und entfacht damit ein Feuer aus Intrigen, Eifersucht und politischen Spielen, das sich immer mehr auszubreiten droht … »Absolut überwältigend«, sagt Bestsellerautorin Barbara Taylor Bradford »Margaret George hat einen fesselnden Roman geschrieben. Sie macht Maria zu einer überaus realen und unvergesslichen Heldin.« Publishers Weekly Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der historische Roman »Maria Stuart« von New-York-Times-Bestsellerautorin Margaret George. So fesselnd wie ein Roman von Rebecca Gablé, so gut recherchiert wie die Bestseller von Hilary Mantel. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 2130
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ihr wurde eine glänzende Zukunft vorhergesagt – doch nur zwei Jahre, nachdem sie den französischen Thron bestiegen hat, verliert Maria Stuart gleichzeitig Mann und Krone. Vertrieben und in Trauer kehrt die junge Königin der Schotten in ihre geliebte Heimat zurück, in der Hoffnung, von ihren Landsleuten mit offenen Armen empfangen zu werden. Aber viele im Volk stehen ihr feindlich gegenüber: Die einen verehren sie als Heilige, die anderen beschimpfen sie als Hure. Und auch am Hof weiß Maria nicht, wem sie wirklich trauen kann. In der Hoffnung auf Unterstützung wendet sie sich an ihre Cousine Elisabeth von England – und entfacht damit ein Feuer aus Intrigen, Eifersucht und politischen Spielen, das sich immer mehr auszubreiten droht …
»Absolut überwältigend«, urteilt Bestsellerautorin Barbara Taylor Bradford
Über die Autorin:
Margaret George verbrachte als Tochter eines amerikanischen Diplomaten einen Großteil ihrer Kindheit auf Reisen nach Tel Aviv, Ägypten, Taiwan u.a. So wurde erstmals ihre Leidenschaft für die Geschichte fremder Kulturen geweckt. George studierte englische Literatur und Biologie in Massachusetts, sowie Ökologie in Stanford und arbeitete schließlich als Wissenschaftsautorin. Ihre Liebe zur Geschichte hat sie jedoch nie losgelassen, weshalb sie 1986 ihren ersten historischen Roman »Henry VIII« veröffentlichte. Bis heute schreibt Margaret George Romanbiografien über faszinierende Persönlichkeiten der Vergangenheit, mit welchen sie immer wieder auf der Bestsellerliste der New York Times steht. Sie lebt heute mit ihrem Mann in Wisconsin.
Die Website der Autorin: margaretgeorge.com/
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin die historischen Romane »Maria Stuart – Der Roman ihres Lebens«, »Kleopatra – Der Roman ihres Lebens«, »Maria Magdalena – Der Roman ihres Lebens«, und »Ich, Helena von Troja«.
***
eBook-Neuausgabe Oktober 2022
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1995 unter dem Originaltitel »Mary Queen of Scotland and the Isles« bei St. Martin’s Press, New York.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1992 by Margaret George
Copyright © der deutschen Erstausgabe by Gustav Lübbe Verlag GmbH, Bergisch Gladbach
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Roberto Castillo, Nimaxs und eines Gemäldes von Francois Clouet „Mary“
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98690-529-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Maria Stuart« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Margaret George
Maria Stuart
Der Roman ihres Lebens
Aus dem Amerikanischen von Rainer Schmidt
dotbooks.
Für Scott George
1920 – 1989
Geliebter Vater, Freund und Lehrer
Die Finsternisse von Sonne und Mond, die Gefangenschaft wilder Elefanten und Schlangen und die Armut der Weisen zu sehen, dies zeigt, daß das Schicksal immer obsiegt.
Indisches Sprichwort
Prolog
IN MEINEM ENDE IST MEIN ANFANG
ENGLAND 1587
In der Stunde der tiefsten Nacht, als alle Kerzen bis auf eine ausgelöscht waren und alles still ruhte, ging die Frau leise hinüber zu ihrem Schreibpult und setzte sich. Sie stellte die eine Kerze zu ihrer Rechten und strich ein Stück Papier auf der Tischplatte glatt, so langsam wie möglich, um kein Geräusch zu machen. Die linke Seite hielt sie mit der Hand nieder – einer weißen Hand mit langen, schlanken Fingern, die der französische Dichter Ronsard einmal als einen »Baum mit ungleichen Ästen« beschrieben hatte. Die Hand sah jung aus, wie die eines fünfzehnjährigen Mädchens. Von der anderen Seite des Zimmers betrachtet, beleuchtet nur von der einzelnen Kerze, erschien das Gesicht der Frau ebenso jung. Bei näherem Hinsehen indessen waren die Umrisse der Schönheit zwar noch vorhanden, doch im Gerüst des alten Liebreizes fanden sich Falten und Dellen und schlaffes Gewebe. Die Haut spannte sich nicht mehr straff über die hohen Wangenknochen, die lange, gebieterische Nase, die mandelförmigen Augen, sondern sie lag weich darüber, zeichnete jede Aushöhlung nach und offenbarte sie so.
Mit dieser überraschend schlanken, elegant beringten Hand rieb sie sich die Augen; die Lider waren schwer, und Spuren der Erschöpfung zeigten sich darunter. Seufzend tauchte sie die Feder in die Tinte und begann zu schreiben.
An Heinrich III., den Allerchristlichsten König von Frankreich
8. Februar 1587
Monsieur mon beau frère, estant per la permission de Dieu –
Königlicher Bruder, nachdem ich mich nach Gottes Willen für meine Sünden, wie ich glaube, in die Macht der Königin, meiner Cousine, gegeben habe, von deren Hand ich seit fast zwanzig Jahren manches gelitten, bin ich nun von ihr und ihren Ständen endgültig zum Tode verurteilt worden. Ich habe um meine Papiere gebeten, die mir weggenommen wurden, damit ich mein Vermächtnis aufsetzen kann, doch ich habe nichts zurückerhalten können, was irgendwie brauchbar für mich wäre; auch habe ich nicht die Erlaubnis erhalten, mein Testament nach meinem Belieben zu verfassen oder meinen Leib nach dem Tode, wie ich es wünschen möchte, in Dein Königreich überführen zu lassen, in dem ich die Ehre hatte, Königin zu sein, Deine Schwester und alte Verbündete.
Heute nach dem Abendessen hat man mich von meinem Urteil in Kenntnis gesetzt: Ich soll hingerichtet werden wie eine Verbrecherin um acht Uhr in der Frühe. Ich habe nicht die Zeit gehabt, Dir einen umfassenden Bericht über alles, was geschehen ist, zukommen zu lassen, aber wenn du meinem Arzt und meinen anderen unglücklichen Bediensteten zuhörst, wirst Du die Wahrheit erfahren und auch, wie ich, Dank sei Gott, den Tod geringachte und ihm unschuldig jeglicher Verbrechen entgegentrete, gleich als wäre ich ihnen untertan. Der katholische Glaube und das Bestehen auf meinem gottgegebenen Recht auf den englischen Thron, dieser beiden Dinge wegen bin ich verurteilt.
Sie hielt inne und starrte vor sich hin, als habe ihr Geist plötzlich aufgehört, Worte zu bilden, oder als seien sie ihr ausgegangen. Die französische Sprache war besänftigend, einlullend. Selbst grausige Dinge klangen auf Französisch nicht so scheußlich. Ihr Geist vermochte, wagte es nicht, sie auf Schottisch zu formulieren.
»Cé porteur & sa compaignie la pluspart de vos subiectz ...
Der Überbringer dieses Briefes und seine Begleiter, die meisten davon Deine Untertanen, werden Zeugnis ablegen davon, wie ich mich in meiner letzten Stunde gezeigt habe. Mir bleibt nur, Deine Allerchristlichste Majestät, meinen Schwager und alten Verbündeten, der Du immer Deine Liebe zu mir beteuert hast, zu bitten, Deine Güte nunmehr in allem folgenden unter Beweis zu stellen: Erstens durch Mildtätigkeit, indem Du meinen unglückseligen Bediensteten die Löhne auszahlst, die ihnen noch zustehen – es ist dies eine Last auf meinem Gewissen, die nur Du mir nehmen kannst; und überdies, indem Du zu Gott betest für eine Königin, die den Titel Allerchristlichste Königin von Frankreich getragen hat und die als Katholikin stirbt, all ihrer Habe beraubt.
Ich habe mir die Freiheit genommen, Dir zwei kostbare Steine zu senden, Talismane gegen Krankheit, in der Hoffnung, daß Du Dich guter Gesundheit und eines langen und glücklichen Lebens erfreuen mögest. Nimm sie von Deiner liebenden Schwägerin in Empfang, die Dir, da sie stirbt, ihr herzliches Gefühl für Dich bezeugt. Verfüge, so es Dir gefällt, daß um meiner Seele willen ein Teil dessen, was Du mir schuldest, ausgezahlt werde und daß mir um Jesu Christi willen genug übrigbleibe, eine Messe in meinem Gedenken zu feiern und die üblichen Almosen zu verteilen.
Mittwoch, um zwei Uhr morgens.
Deine Dich über die Maßen liebende und treue Schwester,
Königin von Schottland
Sie legte die Feder hin, tat einen Lidschlag. Dann schob sie sorgfältig zwei kleine Bücher auf das Papier, um es niederzuhalten. Jede Bewegung war zierlich, aber müde. Die feinen, schlanken Finger streckten sich einmal und ruhten dann. Sie blies die Kerze aus.
Langsam ging sie zum Bett auf der anderen Seite des Zimmers und legte sich ausgestreckt und bekleidet hin. Sie schloß die Augen.
Es ist vollbracht, dachte sie. Das Leben, das auf dem Tiefpunkt der Geschicke Schottlands begann, ist jenem Schicksal gefolgt, und jetzt ist es am Ende.
Ein kleines Lächeln spielte um ihre Lippen. Nein. Ich bin am Ende. Oder, besser gesagt, ich wünschte, ich wäre es. O Jesu, laß mich jetzt nicht versagen!
Buch IKönigin von Frankreich
1542 – 1560
Kapitel 1
Im rauchig blauen Dunst war nichts zu sehen außer immer noch mehr Dunst. Die Sonne, verschleiert und gedämpft, umgab sich mit einem diffusen Lichtkranz, und sie war das einzige, das die Männer erkennen konnten, als sie versuchten zu kämpfen. Aber wenn sie den Feind nicht sehen konnten, wie sollten sie sich da verteidigen?
Der Dunst wehte und wirbelte, strich tief über grünen Morast und schlammigen Boden, umschmiegte das nasse Gelände und trieb seinen Schabernack mit den Männern, wenn sie versuchten, sich aus dem tückischen Sumpf zu befreien. Er war kalt und feucht, mitleidslos wie die Hand des Todes, mit dem er Arm in Arm daherkam.
Oberhalb des Sumpfes standen ein paar einsame Bäume, deren Äste von den Herbststürmen schon kahlgefegt waren; nackt und verloren ragten sie über das Schlachtfeld. Männer mühten sich ihren grauen, runzligen Stämmen entgegen, weil sie hofften, sich kletternd in Sicherheit zu bringen. Tausende von Füßen hatten den Boden rund um die Bäume zu einem quallenden Feld zertrampelt. Der Nebel lag wie eine Decke über allem.
Als der Nebel am nächsten Tag verflog, aufs Meer hinauswehte und die letzten Spuren der Verwirrung mitnahm, offenbarte sich ganz Solway Moss als ein jammervoller Schlachtplatz. Sumpf, Schilf und glitschiges Gras in den Mäandern des Flusses Esk zeigten, daß Solway Moss, das Moor von Solway, seinen Namen zu Recht trug. Dort in der südwestlichen Ecke der Gegend, wo England und Schottland zusammenstießen, hatten die beiden uralten Feinde miteinander gerungen wie zwei Hirsche, taumelnd im Schlamm. Aber der englische Hirsch hatte über seinen Gegner triumphiert, und der Sumpf war übersät von Lederschilden, weggeworfen von den Schotten, die sich in der Falle gesehen hatten. Dort würden sie verrotten, denn trocknen würde die Sonne sie nie.
Einer der englischen Soldaten, der seine Gefangenen davonführte, warf noch einmal einen Blick auf das Gelände, das grün und ruhig in den schrägen Strahlen der Herbstsonne lag. »Gott sei Schottland gnädig«, sagte er leise. »Niemand sonst wird es sein.«
Draußen begann es zu schneien – sanft erst, wie ein leises Seufzen, und dann immer heftiger, als habe jemand ein riesiges Kissen aufgerissen. Der Himmel war ganz weiß, und bald war es auch die Erde; der Wind trieb den Schnee beinahe waagerecht vor sich her, so daß er die Flanken von Bäumen und Häusern überzog und die ganze Welt in weniger als einer Stunde erbleichte. Die großen runden Türme von Falkland Palace erhoben sich wie riesige Schneemänner, die den Eingang bewachten.
Drinnen schaute der König blicklos aus dem Fenster.
»Eure Majestät?« fragte ein banger Diener. »Bitte, was wünscht Ihr?«
»Hitze. Hitze. Zu kalt hier«, murmelte er, schüttelte den Kopf hin und her und schloß die Augen.
Der Diener legte noch mehr Holz auf das Feuer und fächelte es an, um die Flammen um die neuen Scheite zu locken. Es war wirklich kalt; niemand konnte sich erinnern, daß es so früh in dieser Jahreszeit schon so kalt gewesen war. Schon waren die Schiffe in den Häfen festgefroren, und die öden Felder waren eisenhart.
In diesem Augenblick erschienen ein paar der königlichen Feldsoldaten und spähten vorsichtig in den Raum. Er schien sie zu sehen, obwohl seine Augen geschlossen waren.
»Die Schlacht?« fragte er. »Bringt ihr Nachricht von der Schlacht?«
Sie kamen herein, die Kleider in Fetzen, und knieten vor ihm nieder. Schließlich sagte der Ranghöchste unter ihnen: »Ja. Wir wurden angegriffen und gründlich geschlagen. Viele ertranken beim Rückzug im Esk. Viele andere gerieten in Gefangenschaft – zwölftausend Gefangene im Gewahrsam des englischen Feldherrn.«
»Lösegeld?« Die Stimme des Königs war ein Flüstern.
»Kein Wort davon. Es heißt ... vielleicht werden sie alle als Gefangene nach England gebracht.«
Jäh stemmte der König sich von seinem Stuhl, und starr stand er da. Er ballte die Fäuste und löste sie wieder, und ein leiser Laut von grenzenlosem Schmerz entfuhr ihm. Wild schaute er in die Runde der Soldaten. »Wir sind geschlagen?« fragte er. Als sie nickten, rief er: »Alles ist verloren!«
Er wandte sich ab und stolperte zur Tür; dann sackte er am Türrahmen zusammen, als habe ein Speer ihn durchbohrt. Seine Hand krallte sich in seine Seite, und er taumelte in seine Privatgemächer, in die sie ihm nicht folgen konnten. Sein Kammerdiener lief ihm nach.
Der König suchte sein Bett; er warf sich hinein, lag stöhnend da und hielt sich die Seite. »Alles ist verloren!« murmelte er immer wieder.
Einer der Bediensteten schickte nach dem Arzt, ein anderer sprach mit den Soldaten.
»Ist es wirklich so schlimm, wie Ihr berichtet?« fragte er.
»Ja – und schlimmer«, antwortete einer der Soldaten. »Wir sind nicht nur geschlagen wie in Flodden, sondern entehrt noch dazu. Unser König war nicht bei uns; unser König hatte uns alleingelassen, um trübsinnig den Kopf hängen zu lassen, allein und fern vom Schlachtfeld – wie eine gezierte Jungfrau.«
»Sschh!« Der Diener sah sich um, ob etwa jemand zuhörte. Als er sicher war, daß es unmöglich war, sagte er: »Der König ist krank. Er war krank, bevor diese Nachricht kam; der Schmerz über den Verlust seiner Erben, der kleinen Prinzen, hat ihn gebrochen.«
»Es ist die Pflicht eines Königs, solche Verluste zu tragen.«
»Der Verlust seiner beiden Erben wenige Tage nacheinander hat ihn davon überzeugt, daß sein Glück ihn verlassen habe. Und wenn einer davon erst überzeugt ist, dann ist es schwer, noch mit Autorität zu führen.«
»Ja, wie ein weichlicher Pfaffe oder ein Knabe, der an Fallsucht leidet!« rief ein anderer Soldat. »Wir brauchen einen Kriegsmann, der uns führt, kein Weib!«
»Ja, ja. Er wird genesen. Er wird wieder zu sich kommen. Wenn der Schmerz sich gelegt hat.« Der Diener zuckte die Achseln. »Höchstwahrscheinlich hat der König inzwischen einen neuen Erben. Seine Königin sollte jeden Augenblick ins Kindbett gebracht werden.«
Der Soldat schüttelte den Kopf. »Schade bloß, daß er so viele Bastarde hat und daß keiner von denen als Thronfolger zu gebrauchen ist.«
Der König weigerte sich, von seinem Bett aufzustehen; schlaff lag er da wie in Trance. Ein paar seiner Edlen kamen zu ihm und standen um sein Bett. Der Earl von Arran, das vierschrötige Oberhaupt des Hauses Hamilton und in der Erbfolge der nächste Thronanwärter nach den leiblichen Kindern des Königs, schaute fürsorglich zu. Kardinal Beaton, der Staatssekretär, lauerte wie einer, der die letzte Beichte abzunehmen gekommen war. Die Vettern Stewart, lauter mächtige Clanführer von eigenen Gnaden, standen diskret im Gemach. Alle trugen schwere Wollsachen unter ihren leuchtenden Festgewändern; es war noch immer bitterkalt. In anderen Gemächern verharrten die Mätressen des Königs, frühere und derzeitige, in Sorge um ihre Kinder. Würde der König geruhen, sich an sie zu erinnern?
Der König sah sie an; sie schillerten und gerannen vor seinen Augen, und manchmal schienen sie ganz zu zerfließen. Diese Gesichter ... aber keines von ihnen war ihm teuer, nein, kein einziges.
Schottland war geschlagen; das war sein einziger Gedanke, wenn der Schmerz ihn stechend durchfuhr.
»Die Königin«, flüsterte jemand. »Denkt an Eure Königin. Ihre Stunde ist nahe. Denkt an Euren Prinzen.«
Aber die Prinzen waren tot, die hübschen kleinen Knaben, gestorben nur wenige Stunden nacheinander, der eine in Stirling, der andere in St. Andrews. Orte des Todes. Keine Hoffnung. Alles dahin. Sinnlos, noch Hoffnung zu hegen; das Schicksal war stärker.
Dann ein neues Gesicht vor ihm. Jemand schaute ihm aufmerksam in die Augen, versuchte in ihnen zu lesen. Jemand Neues, forsch und unberührt.
»Sire, Eure Königin hat wohlbehalten entbunden.«
Der König mühte sich, die Worte hervorzubringen. Seltsam, wie schwer das Sprechen fiel. Früher war er von sich aus wortkarg gewesen, aber jetzt zeigte sein Körper sich verschlossen, obwohl sein Geist sich mitzuteilen wünschte. Seine Kehle versagte den Dienst. »Ist es ein Knabe oder ein Mädchen?« zwang er Zunge und Lippen schließlich zu sagen.
»Eine schöne Tochter, Sire.«
Tochter! Also auch die letzte Schlacht verloren.
»Auch das noch? So hol’s der Teufel! Adieu, lebt wohl. Die Stewarts sind gekommen mit einer Maid, und sie werden gehen mit einer Maid«, murmelte er.
Das waren die letzten Worte, die er sprach, auch wenn der Arzt, als er sah, daß es mit ihm zu Ende ging, ihn ermahnte: »Gebt ihr Euren Segen! Gebt Eurer Tochter Euren Segen, um des lieben Gottes willen! Scheidet nicht, ohne Eurer Erbin diese Gnade und Sicherheit zu hinterlassen.«
Aber der König lachte nur leise und lächelte dann, küßte seine Hand und reichte sie all seinen Lords ringsum; und kurz danach wandte er den Kopf von seinem Gefolge ab zur Wand und starb.
»Was hat er mit seinen Worten gemeint?« flüsterte einer der anwesenden Lords.
»Die Krone von Schottland«, antwortete einer. »Sie kam über Marjorie Bruce auf die Stewarts, und er fürchtet, sie werde von ihnen gehen durch ... wie heißt die Prinzessin?«
»Prinzessin Maria.«
»Nein«, sagte der andere, als er sah, wie die Ärzte den toten König langsam umdrehten und ihm die Hände falteten, damit der Priester ihn salben konnte. »Königin Maria. Maria, Königin der Schotten.«
Seine Frau, die Königinwitwe, bemühte sich, nach der Geburt möglichst schnell wieder zu Kräften zu kommen. Für sie gab es keine mähliche Genesung im Wochenbett, nicht das Empfangen von Besuchern mit ihren Geschenken, denen zum Lohn für ihre guten Wünsche das Kind zur Besichtigung präsentiert wurde, umhüllt von weißer Spitze und Taft und eingewickelt in viele Ellen vom weichsten Samt in der vergoldeten königlichen Wiege.
Nein, Marie de Guise, die Hinterbliebene – welch wunderliche Bezeichnung, dachte sie – Seiner Majestät James’ V. von Schottland, mußte sich aufrichten und darauf gefaßt sein, ihr Kind zu verteidigen wie eine Wolfsmutter in einem harten Winter. Und es war ein sehr harter Winter, nicht nur, was Schneestürme und vereiste Straßen anging, sondern für Schottland insgesamt.
Im rötlichen Schein der Feuer, die sie beständig in Gang hielt, konnte sie sich fast vorstellen, daß die Zähne der Edlen eher wie die Reißzähne von Hunden aussahen. Einer nach dem andern begaben sie sich nach Linlithgow Palace, dem goldenen Palast an einem langgestreckten, schmalen See – einem »Loch« – gleich westlich von Edinburgh, und verneigten sich vor dem Kind – ihrer neuen Königin. Sie kamen in schwere Pelze gehüllt, die gestiefelten Füße mit Tierhäuten umwickelt, und es war schwer, ihre eisverkrusteten Bärte von den Pelzen zu unterscheiden, die ihre Gesichter umgaben. Sie knieten nieder und murmelten sich etwas über ihre Gefolgschaftstreue in den Bart, aber ihre Augen glänzten übernatürlich hell.
Da waren all die Clans, die kamen, um sicherzustellen, daß kein anderer Clan ihnen den Weg zur Macht versperrte; denn dies war die größte aller Gelegenheiten – dem Tod eines Hirsches gleich, der die Aasfresser des Waldes in Scharen herbeilockte. Ein Säugling war ihre Monarchin, ein hilfloses Kind, beschützt nur von einer ausländischen Mutter, einer Französin, die von den Gebräuchen hier nichts wußte und fern ihrer Heimat lebte.
Der Earl von Arran, James Hamilton, war da; wäre dieses Kind nicht zur Welt gekommen, dann wäre er jetzt König gewesen. Wohlwollend lächelte er dem Säugling zu. »Ich wünsche ihr ein langes Leben«, sagte er.
Der Earl von Lennox, Matthew Stuart, der behauptete, nicht Arran, sondern er sei der wahre Thronerbe, kam gleich darauf und schaute sehnsuchtsvoll auf das Baby herab. »Möge sie alle Gaben der Anmut und der Schönheit besitzen«, sagte er.
Patrick Hepburn, der »schöne Earl« von Bothwell, trat vor und drückte einen längeren Kuß auf die Hand der Königinmutter. »Möge sie die Macht haben, jeden, der sie anschaut, dazu zu bringen, daß er sie liebt«, sagte er und hob den Blick zu Marie.
Der rotgesichtige, stämmige Earl von Huntly stapfte an der Wiege vorbei und verbeugte sich. »Möge sie stets ruhig unter Freunden weilen und niemals in die Hände ihrer Feinde fallen«, sagte er.
»Mylord«, wandte Marie de Guise ein, »warum von Feinden sprechen? Warum in dieser Stunde auch nur an sie denken? Ihr verbindet Eure guten Wünsche mit etwas Unheimlichem. Ich bitte Euch, verbessert Eure Worte.«
»Ich kann sie verbessern, aber niemals ungesagt machen. Einmal gesprochen, sind sie in ein anderes Reich entfleucht. Aber gut: Mögen ihre Feinde verflucht sein und in Verwirrung stürzen.«
»Dieses Wort gefällt mir nicht.«
»Ich kann aber nicht versprechen, daß sie keine Feinde haben wird«, antwortete er störrisch. »Es wäre auch kein guter Wunsch. Es sind die Feinde, die einen Menschen machen und formen. Nur ein Nichts hat keine Feinde.«
Als die Lords gegangen waren, saß Marie de Guise an der Wiege und bewegte sie sanft hin und her. Das Kind schlief. Der Feuerschein malte die eine Hälfte des Gesichtes rosig an, und das Baby krümmte und streckte die dicken, von Grübchen gezierten Fingerchen.
Meine erste Tochter, dachte Marie, und sie sieht anders aus. Ist es meine Phantasie? Nein, ich glaube, sie ist von echter Weiblichkeit. Die Schotten würden sagen, ein Mädel ist immer anders als ein Bub, schon von Anfang an. Diese Tochter hat eine Haut wie Mandelmilch. Und ihr Haar – sanft schob sie die Haube des Kindes zurück –, welche Farbe wird es wohl bekommen, bei dieser Haut? Es ist noch zu früh, um es zu erkennen; der Flaum hat die gleiche Farbe wie bei allen Säuglingen.
Maria. Nach mir selbst habe ich sie getauft, und nach der Heiligen Jungfrau; schließlich ist sie am Tag der Heiligen Jungfrau geboren, am Tag der Unbefleckten Empfängnis, und vielleicht wird die Jungfrau sie schützen und sie in ihre besondere Obhut nehmen.
Maria, Königin Schottlands und Herrin der Inseln. Meine Tochter ist schon eine Königin – sechs Tage alt, und dann wurde sie Königin.
Bei diesem Gedanken regte sich ein leises Schuldgefühl in ihr.
Der König, mein Herr und Gemahl, ist gestorben, und so ist meine Tochter vor der Zeit Königin geworden. Brennenden Schmerz sollte ich fühlen. Den König sollte ich betrauern, mein Schicksal beklagen, anstatt staunend meine Tochter anzuschauen, die Kindkönigin.
Das Kind wird schön werden, dachte sie, als sie die Gesichtszüge betrachtete. Schon jetzt kann ich sehen, daß sie die Augen ihres Vaters hat, diese Stewart-Augen, schräg und mit schweren Lidern. Seine Augen, die so viel verhießen, die so beruhigend und doch so verschlossen waren und ihre eigenen Tiefen verbargen.
»Meine teure Königin.« Hinter sich hörte sie eine vertraute Stimme: Kardinal Beaton. Er war nicht mit den anderen gegangen; aber er fühlte sich auch zu Hause hier, und das jetzt mehr denn je, nachdem der König für immer gegangen war. »Betrachtet Ihr Euer Werk? Seht Euch vor, sonst verliebt Ihr Euch noch in Eure eigene Schöpfung.«
Sie richtete sich auf und drehte sich um. »Es ist schwer, sie nicht mit ehrfürchtigem Staunen zu betrachten. Sie ist schön, und sie ist eine Königin. Meine Familie in Frankreich wird außer sich sein. Endlich können sich die Guise einer Monarchin rühmen.«
»Ihr Familienname ist nicht Guise, sondern Stewart«, erinnerte sie der beleibte Kirchenmann. »Nicht ihr französisches Blut bringt sie auf den Thron, sondern ihr schottisches.« Er gestattete sich eine Verbeugung und streichelte dem Kind die Wange. »Nun, was werdet Ihr tun?«
»Den Thron für sie halten, so gut ich kann«, sagte Marie.
»Dann werdet Ihr in Schottland bleiben müssen.« Er richtete sich auf und ging zu einer Silberschale mit Süßigkeiten und Nüssen. Er nahm ein Stück und steckte es in den Mund.
»Das weiß ich!« Sie war empört.
»Keine Pläne für die Flucht nach Frankreich?« Er lachte scherzhaft. »Aus Sevilla-Orangen gemacht«, bemerkte er und lutschte an dem süßen Brocken. »Kürzlich habe ich von einer kandierten Rinde aus Indien gekostet. Viel süßer.«
»Nein. Wenn dieses Kind nicht gekommen wäre, wenn ich eine kinderlose Witwe wäre, dann würde ich gewiß nicht länger hier verweilen. Aber jetzt habe ich eine Aufgabe, und zwar eine, der ich mich nicht entziehen kann.« Es fröstelte sie. »Sofern ich hier nicht erfriere oder die Schwindsucht bekomme.«
Draußen schneite es wieder. Sie ging durch das Zimmer zum Steinbogen des Kamins, wo auf ihren Befehl hin ein großes Feuer loderte. Das Gemach des Kindes mußte warmgehalten werden, mochte das bitterkalte Wetter in Schottland noch so wild toben.
»Ach, David«, sagte sie, und ihr Lächeln verging, »was wird aus Schottland werden? Die Schlacht ...«
»Wenn es nach den Engländern geht, wird es ein Teil Englands werden. Sie werden versuchen, es auf diese oder jene Art an sich zu raffen, höchstwahrscheinlich durch eine Heirat. Als Sieger von Solway Moss, mit tausend hochrangigen Gefangenen in ihrer Gewalt, werden sie die Bedingungen diktieren. Wahrscheinlich werden sie Maria zwingen, ihren Prinzen Edward zu heiraten.«
»Niemals! Das lasse ich nicht zu«, rief Marie.
»Sie muß jemanden heiraten«, erinnerte sie der Kardinal. »Das ist es ja, was der König meinte, als er sagte: Sie werden gehen mit einem Mädchen. Wenn sie heiratet, geht die Krone auf ihren Ehemann über. Und einen französischen Prinzen, der in Frage käme, gibt es nicht. Die Erben König Franz’, Heinrich von Valois und Katharina von Medici, sind unfruchtbar. Wenn die kleine Maria versucht, einen Schotten zu heiraten, einen ihrer eigenen Untertanen, werden die übrigen sich voller Eifersucht erheben. Wen also, wenn nicht einen Engländer?«
»Keinen englischen Prinzen«, wiederholte Marie immer wieder. »Keinen englischen Prinzen. Es sind lauter Ketzer dort unten.«
»Und was gedenkt Ihr mit den Bastarden des Königs anzufangen?« fragte der Kardinal leise.
»Ich werde sie alle zusammenführen und hier großziehen, im Palast.«
»Ihr seid verrückt. Führt sie lieber alle zusammen und beseitigt sie.«
»Wie ein Sultan?« Marie mußte lachen. »Nein, das ist keine christliche Handlung. Ich werde ihnen Barmherzigkeit zuteil werden lassen und ein Heim schenken.«
»Und sie mit Eurer eigenen Tochter großziehen, der rechtmäßigen Königin? Das ist nicht christlich, sondern fahrlässig. Ihr werdet vielleicht noch erleben, wie Eure Tochter die bösen Früchte dieser irregeleiteten Güte erntet. Hütet Euch, daß Ihr keine Schlangen nährt, die sie später beißen könnten, wenn Ihr nicht mehr seid.« Das fette, faltenlose Gesicht des Kardinals zeigte echte Besorgnis. »Wie viele sind es?«
»Oh, etwa neun, glaube ich.« Sie lachte und verspürte dann auch deshalb Gewissensbisse.
Ich sollte die Untreue des Königs mit Mißfallen betrachten, dachte sie. Aber das tue ich nicht. Warum nicht? Ich habe ihn wohl nicht geliebt. Denn sonst wäre ich über diese Weiber hergefallen und hätte ihnen die Augen ausgekratzt.
»Es sind lauter Jungen; nur ein Mädchen ist dabei: Jean. Sein Lieblingsbankert war der, der seinen Namen trug: James Stewart. Der ist jetzt neun Jahre alt und lebt mit seiner Mutter im Schloß zu Lochleven. Es heißt, er sei schlau«, sagte Marie.
»Daran zweifle ich nicht. Niemand ist schlauer als ein königlicher Bastard. Sie hegen ungebührliche Hoffnungen. Zwingt ihn in die Kirche und bindet ihn dort, wenn Euch die Sicherheit der kleinen Königin am Herzen liegt.«
»Nein, am besten holt man ihn in den Palast und läßt ihn lernen, seine Schwester zu lieben.«
»Seine Halbschwester.«
»Meine Güte, seid Ihr verstockt. Ich weiß Eure Warnungen zu schätzen, aber ich werde die Augen schon offenhalten.«
»Und was ist mit den Adeligen? Ihr könnt doch keinem von ihnen vertrauen, oder?«
»Doch. Ich vertraue denen, die die Mädchen geheiratet haben, die ich aus Frankreich mitgebracht habe. Lord George Seton, der meine Zofe Marie Pieris geheiratet hat. Lord Robert Beaton, der mit Joan de la Reynville vermählt ist. Lord Alexander Livingston, den Gatten von Jeanne de Pedefer.«
»Aber die größeren Edelleute sind nicht auf dieser Liste.«
»Nein.«
In diesem Augenblick fing die kleine Königin an zu schreien, und die Mutter nahm sie auf. Der winzige Mund war zitternd verzogen, und die großen Augen schwammen in Tränen.
»Schon wieder hungrig«, sagte Marie. »Ich werde die Amme rufen.«
»Sie ist eine Schönheit«, sagte der Kardinal. »Es ist schwer vorstellbar, daß jemand ihr Böses wünschen könnte.« Er kitzelte das Baby unterm Kinn. »Ich grüße Euch, Eure Majestät.«
»Jedermann beklagte, daß das Reich ohne einen männlichen Erben geblieben war«, schrieb ein junger Priester namens John Knox langsam und nachdenklich. Er blickte auf zu seinem Kruzifix, das über seinen Pult hing, als er die Feder in das Tintenfaß tauchte.
Warum hast Du Deine Hand von uns genommen, beschwor er stumm das Kreuz.
Warum, o Herr, hast Du Schottland verlassen?
Kapitel 2
Das Septemberwetter hatte den ganzen Tag Schabernack gespielt. Erst hatte es einen Wolkenbruch gegeben, mit starkem, böigem Wind, der hoch oben bei den zweihundertfünfzig Fuß hohen Türmen von Stirling Castle noch heftiger geweht hatte. Dann hatten sich die Wolken verzogen, nach Osten, in Richtung Edinburgh, und einen gleißend blauen Himmel und ein bitteres Gefühl von Sauberkeit zurückgelassen. Jetzt drängte wieder schwarzes Gewölk heran, aber Marie de Guise stand noch in der Sonne, und sie erkannte in der Ferne einen Regenbogen über den abziehenden Gewitterwolken, die einen Dunstschleier hinter sich herschleppten, welcher bis zur Erde reichte.
Ob das ein Omen war? Es war verzeihlich, daß die Königinmutter heute von banger Unruhe erfüllt war: Es war der Krönungstag ihrer Tochter.
Die Zeremonie war in aller Hast arrangiert worden; es war ein Akt tollkühnen Trotzes gegen England, der nichtsdestoweniger von allen Schotten unterstützt wurde. Bis auf den letzten Mann hatten sie die bald anmaßende, bald herablassende Behandlung durch Heinrich VIII. unerträglich und ungenießbar gefunden. Seine selbstgefälligen Forderungen und seine kindischen Drohungen, seine absolute Unfähigkeit zu begreifen, daß Schottland eine Nation war, nicht etwa ein Sack Korn, den man kaufen und verkaufen konnte, die kühle Selbstverständlichkeit, mit der er annahm, daß er alle Macht habe und daher immer seinen Willen bekommen müsse – all das überzeugte die Schotten davon, daß sie sich bis zum Äußersten widersetzen mußten und widersetzen würden.
Zuerst mußte Marias Zwangsverlobung mit Edward aufgelöst werden, eine Verlobung, die zur Bedingung hatte, daß Maria nach England geschickt und dort erzogen werde. Als dies verwehrt worden war, hatte König Heinrich sie in die Obhut eines englischen Haushalts in Schottland geben und ihre Mutter aus ihrer Nähe verbannen wollen. Es war sein Wille, daß sie sich ständig in englischer Hand befinden solle; mit anderen Worten, sie sollte von ihrem eigenen Volk ferngehalten und englisch, nicht schottisch erzogen werden – damit sie die Interessen ihres Volkes später um so leichter verraten würde, so dachte er.
Heinrichs »verpflichtete Lords«, die Gefangenen von Solway Moss, hatten das Banner gewechselt und der englischen Politik widersagt, sobald das möglich gewesen war, und jetzt betrieb man mit Eile den zweiten Akt des Trotzes: Maria würde heute nachmittag zur Königin von Schottland gekrönt werden, um die Tatsache zu bekräftigen, daß Schottland eine unabhängige Nation mit einem eigenen Souverän war, auch wenn dieser Souverän erst neun Monate zählte.
Das auserwählte Datum war höchst unglückselig, dachte die Königinmutter: Der 9. September, der Jahrestag der furchtbaren Schlacht von Flodden Field, wo vor genau dreißig Jahren Marias Großvater sein Ende gefunden hatte, niedergemetzelt von den Engländern.
Gleichwohl lag auch hierin eine gewisse trotzige Regung, als werde nicht nur Heinrich VIII. herausgefordert, sondern das Schicksal selbst.
Sie blickte hinauf zum Himmel, der nun wieder dunkler wurde, und eilte dann über den Hof zum Palast. Jetzt war keine Zeit, die französischen Arbeiten zu bewundern, die ihr Gemahl bei der Ausschmückung des grauen Steinpalastes so verschwenderisch hatte anbringen lassen, bis hin zu den wunderlichen Steinstatuen, die er überall an der Fassade aufgestellt hatte. Sogar von ihr war eine darunter, die jetzt auf ihr lebendes Vorbild herunterschaute, das raschen Schritts auf den Eingang des Schlosses zuging.
Ihre Tochter war bereit; sie trug schwere königliche Gewänder in Miniaturausführung. Ein karminroter Samtmantel mit hermelingefütterter Schleppe war an ihrem kleinen Hals befestigt, und ein juwelenbesetztes Kleid aus Atlasseide mit langen, weiten Ärmeln umhüllte das Kind, das schon sitzen, aber noch nicht laufen konnte. Die Mutter strich der Kleinen über den Kopf – der nun bald die Krone tragen sollte –, betete stumm für sie und übergab sie mit ernster Miene an Lord Alexander Livingston, ihren Hüter, der sie in feierlicher Prozession über den Hof zur Königlichen Kapelle tragen würde. Als sie draußen vorüberzogen, sah die Königinmutter, daß die Sonne geflohen war; der Himmel war schwarz. Aber noch hatte es nicht angefangen zu regnen, und das Kind gelangte in seinen Zeremoniengewändern trocken in die Kapelle, gefolgt von einer Prozession von Staatsbeamten.
Nicht viele waren in der Kirche. Der englische Botschafter, Sir Ralph Sadler, der hier die Pläne seines Herrn zunichtegemacht sah, stand düster da und wünschte der Zeremonie und allen Beteiligten Unglück. D’Oysell, dem französischen Gesandten, war es ein Greuel, überhaupt anwesend zu sein, denn durch seine Anwesenheit schien er dieser Sache seine Billigung zu geben. Aber König Franz würde über alle Einzelheiten informiert werden müssen, oder er würde seinen Botschafter wegen seiner Unkenntnis furchtbar bestrafen. Die übrigen Vormünder der kleinen Königin waren in einer Zuschauerreihe angetreten. Kardinal Beaton stand bereit, die Zeremonie zu vollziehen; er wartete vor dem Thron.
Die Krönung selbst war kein prunkvoller, nicht einmal ein komplizierter Akt, wie dergleichen in England gewesen wäre. Die Schotten wollten es hinter sich bringen, und so trug Livingston, der Hüter, Maria auf schlichteste Weise nach vorn zum Altar und setzte sie behutsam auf den dort aufgestellten Thron. Dann blieb er daneben stehen und hielt sie fest, damit sie nicht herunterpurzelte.
Rasch sprach Kardinal Beaton ihr den Krönungseid vor, den der Hüter als ihr Pate für sie nachsprach; mit seiner Stimme gelobte sie, Schottland zu schützen und zu lenken und ihm eine treue Königin zu sein, im Namen des Allmächtigen Gottes, der sie dazu auserkoren hatte. Sogleich nahm der Kardinal ihr daraufhin die schweren Gewänder ab und machte sich daran, sie auf Rücken, Brust und Handflächen mit heiligem Öl zu salben. Als die kalte Luft sie berührte, fing sie an zu weinen; sie jammerte und schluchzte.
Der Kardinal hielt inne. Sicher, sie war nur ein Baby und weinte, wie alle Babys weinten, unerwartet und bestürzend. Aber in der Stille der steinernen Kirche, wo die Nerven ohnehin angespannt waren ob der unerlaubten, rebellischen Natur dieser ganzen Zeremonie, klangen diese Laute niederschmetternd. Das Kind weinte wie über den Fall des Menschen, wie im Grauen vor der ewigen Verdammnis.
»Psst, pst«, murmelte er. Aber die kleine Königin ließ sich nicht beruhigen; sie heulte, bis der Earl von Lennox das Zepter brachte, einen langen Stab aus vergoldetem Silber, mit Kristall und schottischen Perlen besetzt. Er legte es dem Kind in die Hand, und die Kleine umfaßte den schweren Schaft mit ihren dicken Fingerchen. Ihr Weinen verebbte. Dann wurde ihr vom Earl von Argyll das prachtvoll vergoldete Staatsschwert präsentiert, und der Kardinal umgürtete den kleinen runden Leib feierlich mit dem drei Fuß langen Schwert.
Dann trug der Earl von Arran die Krone herbei, einen schweren Traum aus Gold und Edelsteinen, in den goldenen Reifen geschmiegt, den Robert Bruce in der Schlacht von Bannockburn, in der Nähe von Stirling, auf seinem Helm getragen hatte. Der Kardinal nahm die Krone behutsam und ließ sie auf den Kopf des Kindes sinken, wo sie auf einem Rundhäubchen aus Samt ruhte. Unter der Krone, schwer vom Leid ihrer Vorfahren, spähten Marias Augen hervor. Der Kardinal stützte die Krone, und Lord Livingston hielt das Kind aufrecht, als die Earls von Lennox und Arran ihr zum Zeichen ihrer Gefolgschaftstreue die Wange küßten, gefolgt von den übrigen Edelleuten und Prälaten, die vor ihr niederknieten, die Hand auf die Krone legten und ihr Treue schworen.
Kapitel 3
Heinrich VIII. entfesselte die ganze Wucht seiner Wut gegen die Schotten. Ein Heer wurde zum Sturm auf Stirling Castle ausgesandt; man sollte Maria gefangennehmen und die ganze Umgebung ausplündern und in Brand stecken, Männer, Frauen und Kinder durch das Schwert niedermachen, Edinburgh zerstören, Holyrood dem Erdboden gleichmachen, die Klöster im Grenzland niederreißen und die Ernte, die schon eingebracht war, in Flammen aufgehen lassen.
Die englischen Soldaten zogen metzelnd und mordend nach Edinburgh. Sie kamen durch das Canongate und zu den Türen von Holyrood Abbey, und sie drangen in das Heiligtum ein. Sie suchten die Gräber der Stewarts, fanden das große, geschlossene Monument auf der rechten Seite der Abteikirche, nicht weit vom Altar, brachen es auf und entweihten die königlichen Grabstätten. Sie öffneten das Grab, in dem Marias Vater lag, und schleiften seinen Sarg hinaus ins Tageslicht, wo sie ihn verhöhnten und dann liegenließen, einsam und verloren im Mittelgang.
Schottland weinte und wehklagte. Schottland war verwundet und schrie, aber niemand war da, der ihm half. Tote stanken zum Himmel, Kinder gingen hungrig ins Bett, aufgenommen von Verwandten, die überlebt hatten, und die verwüsteten Straßen von Edinburgh waren voller Rauch. Das schottische Volk sah die zerstörten Klöster und die verlassenen Kirchen und suchte die einzige Hilfe, die ihm noch blieb, die göttliche, auf ganz neue Art. Obgleich alle protestantische Literatur mit einem Bann belegt war, fanden jetzt eingeschmuggelte protestantische Übersetzungen der Heiligen Schrift – William Tyndales Fassung und sogar Kopien der englischen Großen Bibel von 1539 – den Weg nach Schottland. Wo die ketzerischen Prediger sich nicht verstecken konnten, ließ sich eine Bibel verbergen; wo Gott zu schweigen schien, statt durch seine bisherige Kirche, die Kirche Roms, zu sprechen, da sprach Er nun unmittelbar durch Sein Wort, wie es sich in der Schrift offenbarte. Prediger streiften durch das ganze Land; sie waren ausgebildet in Genf, in Holland, in Deutschland. Die Leute lauschten ihren Predigten und fanden Trost darin, wie Gott ihnen seine Hand entgegenstreckte. Er bot ihnen Seine Hand, und sie ergriffen sie.
In Stirling Castle waren die Königinmutter und ihre Tochter wohlverwahrt. Die alte Burg auf dem hohen Felsen, der weithin über die Ebene ragte, hielt allen Unbillen stand und war für die Engländer uneinnehmbar. Hinter den Mauern des Schlosses schuf Marie de Guise ein Heim für ihre Tochter, mit Spielkameraden, Lehrern und Haustieren. Es war eine Welt für sich, hoch über dem Tal des Forth; hier schaute man hinunter auf die Stirling Bridge und das Tor zum Hochland, wo man spurlos verschwinden und sich in Sicherheit bringen konnte vor allen ausländischen Feinden, die einen bedrohten. Selten gab es auch Gelegenheit zur Beiz und zur Jagd oder auch, sich das Land anzuschauen, ehe man sich rasch wieder in die Sicherheit der Felsenfestung zurückzog.
Es gab Wolkendunst. Und heulende Winde und eisbedeckte Hügel, auf denen die Kinder manchmal Schlitten fuhren; auf Kuhschädeln sausten sie den Hang hinter der Burg herunter. Es gab kleine, struppige Pferde, auf denen die kleine Maria und ihre Spielkameradinnen – die alle ebenfalls Maria hießen, was so lustig war – das Reiten lernten. Es gab Nebel und Heide, grüne Täler – die Glens – und einen unermeßlichen Himmel, über den die Wolken dahinjagten wie Banditen.
Oben in der Burg gab es einen Raum in den königlichen Gemächern – leer jetzt – mit runden Medaillons an der Decke. Zuweilen wanderte das Kind in diesen Raum und betrachtete im Zwielicht, das durch die verrammelten Fenster fiel, die holzgeschnitzten Köpfe. Eine der Figuren hatte Hände, die den Rand des Rundteils umklammerten – als wolle sie herausspringen und in die wirkliche Welt entfliehen. Aber sie bewegte sich nie, sondern verharrte für alle Zeit an der Grenze zu einer neuen Welt, die sie nicht betreten konnte, und starrte von der Decke zu ihr herunter.
Ihrer Mutter gefiel es nicht, wenn sie hier war. Meistens kam sie Maria suchen und brachte sie zurück in die Gemächer der Königin, wo sie wohnte und ihren Unterricht bekam, in denen es Kissen gab und einen Kamin und ein Gewimmel von Menschen.
Irgendwann im Dunst der frühen Kindheit lernte sie ihre Halbgeschwister kennen. Ihre Mutter hatte in seltsamer Mildherzigkeit – oder war es politischer Scharfsinn – vier der unehelichen Nachkommen ihres verstorbenen Gemahls versammelt und sie nach Stirling Castle gebracht. Maria liebte sie alle; sie liebte es, einer großen Familie anzugehören, und da ihre Mutter anscheinend keinen Anstoß daran nahm, daß sie Bastarde waren, nahm sie auch keinen.
James Stewart war ernst und würdevoll, aber weil er der älteste war, schien ihnen sein Urteil das weiseste zu sein, und sie beugten sich ihm. Wenn er sagte, sie sollten nicht noch einmal den Berg hinunterschlittern, ehe das Tageslicht verblaßte, so war seine Einschätzung, wie Maria lernte, immer richtig, und wenn sie ihm nicht gehorchte, würde sie sich, unten angekommen, plötzlich im Dunkeln wiederfinden.
Bevor sie Marias Halbgeschwister für eine Weile nach Stirling geholt hatte, hatte Marie schon eine andere kleine Familie für ihre Tochter zusammengestellt, vier Töchter von Freunden, die alle Mary hießen und alle gleich alt waren: Mary Fleming, Mary Beaton, Mary Livingston und Mary Seton.
Mary Fleming war reine Schottin und hatte auch Stewart-Blut in den Adern; es war allerdings schon etwas älter und kam von der falschen Seite der Bettdecke: Sie war die Enkelin James’ IV. Mary Flemings Mutter Janet besaß die Familieneigenschaften der Stewarts, Schönheit und einen frohen Mut, und sie diente als Gouvernante der fünf kleinen Marien. Von frühester Jugend an war Mary Fleming – ihr Spitzname war La Flamina – die einzige, die Marias Herausforderungen annahm und sie an Keckheit noch übertraf.
Die anderen drei Marys hatten zwar echte schottische Namen und schottische Väter, aber ihre Mütter waren Französinnen: Kammerfrauen, die mit Marie de Guise herübergekommen waren. Daß ihre Töchter allesamt mit Maria befreundet waren, bereitete der Königinmutter große Genugtuung und das Gefühl, in dieser Festung in einem fremden Land zu Hause zu sein. Zwar sprachen die Mütter Französisch miteinander, aber die Töchter waren anscheinend entweder nicht interessiert oder nicht imstande, es selbst auch zu lernen, auch wenn sie vermutlich ein paar Worte verstanden. Wenn die Mütter heimlich über die Mädchen reden wollten, konnten sie es jederzeit unbeschadet auf Französisch tun.
Um sie voneinander zu unterscheiden, wurde Mary Livingston, robust und sportlich, von den anderen Lusty genannt; Mary Seton, groß und reserviert, rief man bei ihrem vornehmen Familiennamen; Mary Beaton, rundlich, hübsch und zu Tagträumen neigend, hieß Beaton, weil sich das auf Seton reimte und die beiden so ein Paar bildeten. Mary Fleming trug den Spitznamen La Flamina wegen ihrer überschwenglichen Persönlichkeit. Einzig Maria war immer nur Maria, die Maria.
Die acht kleineren Kinder tollten, prügelten sich, hatten Geheimbünde, Cliquen und eigene Sprachen. Sie hielten Haustiere, spielten Karten und sagten einander die Zukunft weis; sie zankten miteinander und schworen sich am nächsten Tag ewige Freundschaft. Der neunte, James Stewart, hatte den Vorsitz über ihre kleine Welt, und er tat es mit fünfzehnjährigem Ernst, auf halber Höhe zwischen der Welt der Erwachsenen und der Welt der Kinder, ohne zu einer der beiden wirklich ganz zu gehören. Beide wandten sich an ihn, wenn die eine Seite wegen der anderen einen Rat brauchte.
Maria war erst sechs Monate alt, als sie nach Stirling kam, um dort zu leben, und für sie war die ganze Welt in dieser Bergfestung enthalten. Hier wurde sie gekrönt; hier tat sie ihre ersten stolpernden Schritte; ihre Lehrer erteilten ihr hier, im Vorzimmer zu den Gemächern der Königin, den ersten Unterricht. Als sie gerade drei Jahre alt war, bekam sie ein winziges Pony von den Inseln im höchsten Norden Schottlands geschenkt, und so lernte sie hier auch das Reiten. Lusty fand natürlich genauso schnell wie sie Gefallen an den Ponys, derweil Seton und Beaton einem ruhigeren Zeitvertreib im Hause den Vorzug gaben. Flamina konnte ganz gut reiten, aber sie zog die Abenteuer mit Menschen solchen mit Tieren vor.
Maria blickte zu James auf und folgte ihm eifrig umher. Als sie sehr klein war, klebte sie an ihm und bedrängte ihn ständig, mit ihr zu spielen. Als sie älter wurde, erkannte sie, daß es ihm mißfiel, wenn sie ihn anfaßte und hierhin und dorthin zerrte, und daß solches Benehmen gerade die entgegengesetzte Wirkung auf ihn hatte. Wenn sie wollte, daß er ihr seine Aufmerksamkeit zuwandte, mußte sie woanders hinschauen und mit anderen sprechen. Dann lockte die Neugier ihn an.
Einmal, als sie vier Jahre alt war, wanderte sie vom oberen Hof, wo die Kinder zwischen der Großen Halle und der königlichen Kapelle Ball spielten, davon und schlich sich in die verbotenen königlichen Gemächer. Hier waren stets alle Fensterläden geschlossen, und es war dunkel, aber die Räume zogen sie an. Die großen, runden Medaillons an der Decke erfüllten den Raum mit ihrer brütenden Gegenwart, als hüteten sie ein Geheimnis. Sie stellte sich immer vor, wenn sie nur in jede Ecke schaute und eifrig genug suchte, würde sie ihren Vater hier finden. Er hätte sich dann nur versteckt, um ihnen einen Streich zu spielen. Und wie glücklich ihre Mutter sein würde, wenn sie ihn herausholte!
Mit laut pochendem Herzen durchquerte sie eilig die Wachstube. Sie wußte schon, daß hier nichts war. Der Raum war kahl, und es gab nichts, wo ein König sich hätte verstecken können. Der nächste Raum, das Audienzzimmer, war gleichfalls leer. Aber es gab mehrere kleine, verborgene Kammern, die an das Schlafgemach des Königs grenzten. Sie wußte, daß sie da waren; sie hatte sie auf einem Plan gesehen. Und dort war vermutlich das Versteck des Königs – falls er sich überhaupt versteckte.
Aber sie waren am entlegensten – und sehr dunkel. Noch nie hatte sie gewagt, dort hineinzugehen. Einmal war sie bis an die Tür des königlichen Schlafgemachs gekommen, und dort hatte sie den dunklen Eingang zu einer Kammer gesehen. Aber der Mut hatte sie verlassen, und sie war umgekehrt.
Heute würde sie hineingehen. Halb wünschte sie, sie hätte Flamina mitgebracht. Aber sie wußte, daß ihr Vater nicht erscheinen würde, wenn noch jemand bei ihr wäre. Sie mußte allein gehen.
Gleichzeitig wußte sie, daß es nur ein Spiel war. Er war ja nicht wirklich da; es war nur eine Mutprobe, die sie sich selber stellte. Sie schlich durch das halbdunkle Zimmer auf das Schlafgemach zu. Ihre Augen hatten sich an die Dunkelheit gewöhnt, und sie konnte schon viel besser sehen. Dann hatte sie die Tür zum Schlafgemach erreicht und spähte hinein.
Es stand immer noch ein Bett dort, und sogar die Vorhänge waren noch erhalten. Sie fragte sich, ob sie den Mut hatte, sich auf Hände und Knie sinken zu lassen und unter ihnen hindurchzulugen. Sie tat es und zitterte dabei so sehr, daß sie fast in Ohnmacht gefallen wäre. Aber da war nichts hinter den Bettvorhängen – nur Staub und Stille.
Jetzt mußte sie es tun: Sie mußte in die angrenzende Kammer gehen. Kein Laut war zu hören außer ihrem eigenen Atem. Sie wollte umkehren, und sie wollte es doch nicht. Sie hielt den Atem an und huschte auf leisen Sohlen in den Raum.
Es war schrecklich finster. Irgend etwas schien hier anwesend zu sein, und wohlwollend war es nicht. Sie zwang sich, den Umfang der Kammer abzuschreiten; sie berührte die Wände, aber als sie die Hälfte des Weges hinter sich hatte, war ihr beinahe schlecht vor lauter Angst. Die Knie fingen an zu zittern, und sie ließ sich auf alle viere fallen und kroch zur Tür.
Aber dann fand sie sich in einem noch dunkleren Zimmer. Der Raum mußte zwei Türen gehabt haben, vielleicht sogar drei. Wie sollte sie hinauskommen? Das Grauen übermannte sie, und alle logischen Gedanken flogen davon. Sie kauerte sich auf den Boden und zitterte im Gefühl ihrer Hilflosigkeit.
Dann hörte sie ein Geräusch. Der Geist! Der Geist ihres Vaters. Er kam, um die Verabredung einzuhalten, und plötzlich wollte sie ihn nicht mehr sehen. Vor allem wollte sie keinen Geist sehen!
»Aber Maria«, sagte eine ruhige Stimme. »Hast du dich verlaufen?«
Sie sprang auf. Wer sprach da? »Ja. Ich möchte in den Hof zurück.« Sie bemühte sich, würdevoll zu klingen. Aber ihre Knie wollten nicht aufhören zu zittern.
»Warum bist du hergekommen?« Die Stimme überging ihren Wunsch.
»Ich wollte ein wenig auskundschaften«, sagte sie großartig. Es gab keinen Grund, von dem Geist zu reden – oder von der Möglichkeit eines Geistes.
»Und jetzt hast du dich verlaufen.« In der Stimme klang die spöttische Parodie des Mitgefühls. »Wie schade.« Sie schwieg einen Moment. »Weißt du, wo du bist?«
»Nein ... nicht genau.«
»Ich könnte dich hinausführen.«
»Wer bist du?« Sie kannte die Stimme; sie wußte es.
Eine Gestalt trat auf sie zu und nahm sie bei der Hand. »Aber ich bin James, dein Bruder.«
»Oh! Gott sei Dank! Laß uns zusammen hinausgehen.«
»Ich habe gesagt, ich könnte dich hinausführen.« Ein Widerhaken lag in seinem Ton. »Und das würde ich mit dem größten Vergnügen tun, aber dafür möchte ich, daß du auch etwas für mich tust.«
»Was denn?« Das war sonderbar. Wieso benahm er sich so merkwürdig?
»Ich möchte eine Belohnung haben. Ich möchte die Miniatur deines Vaters, die du hast – die du in diesem Augenblick trägst.«
Sie hatte sie an diesem Morgen an ihr Mieder gesteckt, als würde das helfen, ihn heraufzubeschwören. Sie liebte die Miniatur; sie war eine der greifbaren Erinnerungen an ihn, die sie besaß. Gern studierte sie sein Gesicht, das gestreckte Oval mit der schmalen Nase und den wohlgeformten Lippen. Insgeheim fragte sie sich, ob sie aussah wie er oder ob sie später einmal so aussehen würde. Sie wußte, mit ihrer Mutter hatte sie keine Ähnlichkeit außer in der Größe.
»Nein«, sagte sie. »Such dir etwas anderes aus.«
»Ich will nichts anderes.«
»Ich kann sie dir nicht geben. Sie ist mir kostbar.«
»Dann kann ich dir nicht helfen. Sieh selbst zu, wie du hinausfindest.« Flink zog er seine Hand weg und lief zur Tür.
Sie hörte, wie seine Schritte verklangen, und stand allein im Dunkeln.
»James!« rief sie. »James, komm zurück!«
Er lachte im äußeren Gemach.
»James, ich befehle es dir!« kreischte sie. »Komm sofort her! Ich bin die Königin!«
Sein Lachen brach ab, und einen Augenblick später stand er wieder neben ihr.
»Du kannst mir befehlen, zurückzukommen«, sagte er verstockt. »Aber du kannst mir nicht befehlen, dich hinauszuführen, wenn ich beschließe, mit dir hierzubleiben. Ich werde einfach so tun, als hätte ich mich ebenfalls verirrt. Also. Gib mir die Miniatur, und ich führe dich hinaus. Andernfalls bleiben wir hier sitzen und haben uns zusammen verirrt, bis eine Wache kommt und uns findet.«
Sie wartete; ihre Unterlippe bebte. Schließlich sagte sie: »Also gut. Nimm die Miniatur.« Sie weigerte sich, die Nadel selbst zu öffnen; mochte James sich doch dabei in die Finger stechen.
Geschickt löste er den Verschluß; er mußte sie schon lange Zeit beäugt haben, wenn er sie sogar im Dunkeln öffnen konnte, dachte sie. »So«, sagte er. »Du vergißt, daß er auch mein Vater ist. Ich möchte etwas von ihm haben. Ich verspreche dir, sie zu hüten, damit sie niemals zu Schaden kommt.
»Bitte führe mich hinaus«, sagte sie. Der Verlust der Brosche war so schmerzlich, daß sie so schnell wie möglich wieder in die Sonne hinaus wollte, als könne das Sonnenlicht sie ihr auf irgendeine geheimnisvolle Weise zurückbringen.
Sie bemühte sich, die ganze Sache zu vergessen, und mit der Zeit gelang es ihr fast, sich einzureden, sie hätte die Brosche in den dunklen Gemächern verloren, sie ihrem Vater als Geschenk überlassen. Sie war froh, als James für mehrere Monate zu seiner Mutter nach Lochleven zog. Als er zurückkam, hatte sie keine klare Erinnerung mehr an die Miniatur.
Kapitel 4
Der Wind peitschte die kahlen, schneebestäubten Felder, während die kleine Schar voranstapfte. Sie waren unterwegs von Longniddry zu der größeren Stadt Haddington; dort würde George Wishart predigen, wie der Heilige Geist es ihm eingab, der Warnung zum Trotz, die der Lord der Gegend, Patrick Hepburn, Earl von Bothwell, ihm hatte zukommen lassen. Während sie durch den grauen Januarnachmittag wanderten, hielten sie wachsam Ausschau nach verdächtigen Bewegungen. Es konnten die freundlichen Lords sein, die versprochen hatten, sich hier mit ihnen zu treffen – aber es konnten auch ihre Feinde sein.
Vorn an der Spitze der Gruppe ging eine schlanke, aufrechte Gestalt, deren Blicke die Straße absuchten und deren Fäuste ein zweihändiges Schwert umklammerten. Es war ein junger Mann von etwa dreißig Jahren, der bei Sir Hugh Douglas von Longniddry als Hauslehrer für dessen beide kleinen Söhne in Dienst stand und überdies als Notar des Bezirks tätig war. Sein Name war John Knox, und er kniete nicht mehr vor Kruzifixen oder flehte Gott an, ihm zu offenbaren, weshalb Er Schottland verlassen habe. Er hatte die Antwort bekommen, und zwar durch George Wishart: Schottland war es gewesen, das sich von Gott abgewendet hatte, in die Irre gelaufen im »Pfuhl der Papisterei«. Knox hatte daraufhin seinerseits seinen Priesterberuf aufgegeben und sich dem reformierten Glauben zugewandt. Es war eine gefährliche Entscheidung.
Vor den Mauern der eigenständigen Burg auf dem Stirling Rock, wo die Königin residierte, und jenseits der nicht minder eigenständigen Burg zu St. Andrews, wo Kardinal Beaton wohnte, huschten Reformatoren von Haus zu Haus mit ihren geschmuggelten Bibeln und ihren verbotenen Botschaften. Sicher vor den wachsamen Augen der Königin und des Kardinals taten sie ihre Bekehrungsarbeit in einer Bevölkerung, die es zwar nicht gerade »hungerte und dürstete nach der Gerechtigkeit«, die aber doch wenigstens darauf brannte, neue Wege zu Gott zu finden. Dieses Gefühl lag in der Luft, in der ganzen Christenheit, wie eine leise Strömung, ein Sirenengesang: Kommt und trinkt vom Wasser dieses Brunnens. Und die Leute kamen und tranken, aus all den Gründen, die Leute zu verbotenen Wassern treiben – manche aus echtem Durst, andere aus Neugier, wieder andere aus Wagemut und Aufsässigkeit. Das trojanische Pferd Heinrichs VIII. waren nicht die bestochenen und eingeschüchterten Adeligen, die er in den Norden zurückgeschickt hatte, sondern die Reformatoren, die ihnen in eigener Mission auf dem Fuße folgten.
George Wishart, durchglüht vom neuen Gebräu der Protestantischen Theologie aus Europa, lehrte und predigte laut genug, um die Ohren des Kardinals zu erreichen, und dieser – wie ein Jagdhund, der einen Otter erspäht hat – suchte ihn zur Strecke zu bringen. Wishart predigte weiter kühn vor großen Versammlungen und konnte dem Kardinal eine Zeitlang entgehen. Jetzt war sein Ziel eine Gegend in der Nähe von Edinburgh, obwohl die Gläubigen ihn gewarnt hatten, daß die Königin und ihr Scherge, der Earl von Bothwell, darauf vorbereitet waren, ihn festzunehmen.
Zumindest, baten ihn seine Anhänger, tritt nicht so öffentlich auf.
»Was denn – soll ich mich in den Ecken herumdrücken wie ein Gentleman, der sich seiner Geschäfte schämt?« hatte der Missionar erwidert. »Ich werde es wagen, zu predigen, solange andere es wagen, mir zuzuhören!«
Nun zogen sie also über die Felder von Lothian, um ihre Anhänger aus dem westlichen Teil Schottlands zu treffen. Zu diesem Zweck hatten sie das sichere Fife verlassen, wo die größte Zahl von Konvertiten lebte.
John Knox zog den rauhen Wollkragen seines Mantels hoch und spähte über das Land. Bei Gott, mochten die Feinde nur erscheinen: Er würde sie niedermähen! Er faßte sein Schwert fester.
Geistliche sollten keine Waffen tragen, das wußte er. Aber bin ich noch ein Geistlicher, fragte er sich. Nein, beim Blute Christi! Dieser Hohn von einer Zeremonie, der ich mich in meiner Unwissenheit unterzogen habe und in der ich zum Priester geweiht wurde, war nichts, war schlimmer als nichts! Nein, solange ich nicht den klaren Ruf aus dem Munde Gottes höre, bin ich kein Geistlicher.
Wishart predigte zweimal in Haddington, in der größten Kirche der Gegend. Nur wenige erschienen, um ihn zu hören – nach den Tausenden, die anderswo zu all seinen Predigten drängten.
»Das macht der Earl von Bothwell«, sagte Wishart nachher, als sie bei einem kleinen Abendessen im Hause des John Cockburn von Ormiston saßen. »Er ist der Lord hier; er muß die Menschen davor gewarnt haben, zu kommen.« Sorgfältig kaute er sein braunes Brot. Er hatte es gesegnet und dem Herrn dafür gedankt, und jetzt schmeckte es anders. »Wie ist er eigentlich, dieser Bothwell?« Er blickte über den Tisch in die Runde der Männer, die dort versammelt waren: Douglas von Longniddry, Cockburn von Ormiston, der Laird von Brunstane, Sandilands von Calder. Wishart war nicht sehr vertraut mit den schottischen Edlen der Gegend von Lothian.
»Ein Lump«, sagte Cockburn. »Ein Mann, der jeden betrügt. Sein Wort ist wertlos. Und ehrgeizig ist er. Er würde seine Seele und auch seine Mutter verkaufen, wenn es ihn voranbrächte.«
»Seine Frau hat er schon verkauft!« sagte Brunstane. »Er hat sich gerade von ihr scheiden lassen – eine feine Lady, eine geborene Sinclair –, weil er die Hoffnung hegte, sich bei der Königinmutter einzuschmeicheln.«
»Er hoffte, in ihr Bett zu gelangen«, ergänzte Cockburn unverblümt. »Rechtmäßig, meine ich.«
»Soll das heißen, er maßt sich an, um die französische Königin zu werben?« Wishart war schockiert.
»Ja. Und er hat seine Werbung noch nicht aufgegeben.«
John Knox überlegte, ob er das Wort ergreifen sollte. Er aß noch ein paar Bissen vom Hammeleintopf, bevor er sagte: »Meine Familie kennt die Hepburns seit Generationen. Wir haben in vielen Kriegen unter ihrem Banner gekämpft. Sie sind ein tapferer Haufen, und meistens loyal. Dieser ›schöne Earl‹ ist eine Ausnahme; aber wir sollten in dieser Verbindung keinen Makel für den Rest der Familie sehen. Eines seiner Schlösser steht nur wenige Meilen flußabwärts: Hailes Castle am Tyne. Wahrscheinlich ist er jetzt gerade dort.«
»Ist er ... fromm?« fragte Wishart.
Knox lachte wider Willen. »Der einzige Altar, vor dem er betet, ist sein Spiegel.«
Draußen war es dunkel geworden, und der Wind wehte. Den Männern wurde unbehaglich, auch wenn sie versuchten, sich nichts anmerken zu lassen. Normalerweise – in anderer Gesellschaft – hätten sie ihre Unruhe mit ein paar Gläsern Wein übertüncht. Aber jetzt blinzelten sie einander nur an und warteten. Schließlich erhob sich Wishart und sagte: »Lasset uns in der Schrift lesen und beten.«
Sie versammelten sich am anderen Ende des kleinen Raumes, wo in einem steinernen Kamin ein mageres Feuerchen brannte. Wishart zog seine abgenutzte Bibel hervor, und auf eine kleine Gebärde seiner Hände öffneten sich gehorsam die Seiten. Er las aus dem achten Kapitel des Römerbriefs und betete dann vor.
Unmittelbar nach dem Amen teilte Douglas ihm mit, er werde noch am selben Abend nach Longniddry zurückkehren.
Wishart lächelte; er hatte gewußt, daß es so kommen würde, und es war zum Wohle aller. Er wandte sich an Knox. »Dann mußt du deinen Herrn begleiten.«
Knox protestierte. »Nein, ich muß hierbleiben, um dich zu beschützen. Ich werde zuschlagen wie Petrus im Garten Gethsemane, und mit großem Genuß werde ich dem Diener des Hohenpriesters das Ohr abschlagen.«
»Gib mir das Schwert, John«, sagte Wishart.
Widerstrebend, aber bedingungslos gehorsam, reichte Knox ihm die Waffe.
»Jetzt mußt du zu deinen Kindern zurückkehren, und Gott segne dich. Einer genügt als Opfer.«
Später, als es wirklich Nacht geworden war und die meisten Menschen schliefen, saß Wishart noch da und wartete. Cockburn saß bei ihm; es wäre eine Nachlässigkeit gewesen, ins Bett zu gehen und seinen Gast alleinzulassen.
Fürsorglich legte Cockburn neues Holz auf das Feuer und brachte dem Prediger heißes Ale. Aber Wishart starrte nur in die Flammen, als sei er in Trance. Endlich fing er an zu sprechen.
»Armes Schottland. Es wird eine schwere Geburt werden, wenn der Reformierte Glaube an die Öffentlichkeit kommt. Aber nur der Glaube kann es retten.«
»Irgendeinen Glauben haben sie schon seit tausend Jahren.«
»Aber offensichtlich keinen, der sie tragen kann. Seht Euch Schottland an. Es steht im Begriff, seine Unabhängigkeit zu verlieren. Die Engländer bekriegen es von außen, die Franzosen gängeln es von innen. Die Königinmutter und ihr Bundesgenosse, der Kardinal, haben Franzosen in alle führenden Stellungen gebracht. Und die kleine Königin ist erst vier Jahre alt, eine Marionette.«
Cockburn zog sich eine Decke um die Schultern. »Ich kann bloß nicht erkennen, was der Reformierte Glaube daran ändern soll.«
»Oh, er gibt den Menschen Hoffnung – die Hoffnung, daß sie von Gott auserwählt sind. Und wer die erst fühlt, ist niemandes Sklave – weder der Engländer, noch der Franzosen, noch der Königin. Dann werden die Schotten sich erheben und ihr Geschick selbst in die Hand nehmen.«
Es klopfte laut an der Tür. Cockburn schrak hoch, Wishart indessen nicht. Cockburn schlurfte zur Tür, öffnete und schaute in das Gesicht des »schönen Earl« von Bothwell persönlich.
»Ah, da ist Wishart!« sagte der Earl und nickte ihm zu. »Wohlgetroffen, Sir.«
Draußen hinter dem Earl sah und hörte Cockburn eine große Anzahl von Männern. Auch ein Jüngling war dabei, im Alter irgendwo an der Grenze zwischen Knabe und Mann.