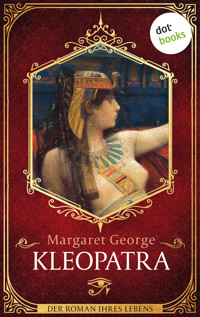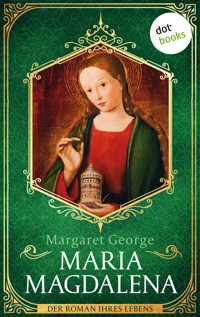
0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwischen Liebe und Glauben: Die Romanbiografie »Maria Magdalena« von Margaret George jetzt als eBook bei dotbooks. Sie war die »Apostelin der Apostel« … Als Tochter eines Fischers ist ihr ein einfaches Leben vorherbestimmt – doch bereits als Kind ahnt Maria Magdalena, dass Gott andere Pläne für sie hat. Als sie Jahre später auf den jungen Jesus von Nazareth trifft und seine Lehren hört, weiß Maria, dass es ihre Bestimmung ist, ihm zu folgen: Gegen den Willen ihrer Familie schließt sie sich ihm und seinen Jüngern auf der Reise durch Galiläa an und nimmt dafür sogar die schmerzvolle Trennung von ihrer eigenen Tochter in Kauf. Nach und nach wird Maria zur engsten Vertrauten des Mannes, in dem viele den Sohn Gottes sehen – doch der Weg zum Ziel seiner Bestimmung ist hart und entbehrungsreich – und je weiter sie ziehen, desto mehr beginnt Maria zu ahnen, welches Schicksal der Messias wirklich für sie vorgesehen hat … »Eine Meisterleistung«, sagt Bestsellerautorin Barbara Taylor Bradford »Eine mitreißende und brillante Erzählung, die eine der bedeutendsten Frauen des Christentums würdigt.« Kirkus Review Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der ergreifende historische Roman »Maria Magdalena« von New-York-Times-Bestsellerautorin Margaret George. So fesselnd wie ein Roman von Rebecca Gablé, so gut recherchiert wie die Bestseller von Hilary Mantel. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1293
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Sie war die »Apostelin der Apostel« … Als Tochter eines Fischers ist ihr ein einfaches Leben vorherbestimmt – doch bereits als Kind ahnt Maria Magdalena, dass Gott andere Pläne für sie hat. Als sie Jahre später auf den jungen Jesus von Nazareth trifft und seine Lehren hört, weiß Maria, dass es ihre Bestimmung ist, ihm zu folgen: Gegen den Willen ihrer Familie schließt sie sich ihm und seinen Jüngern auf der Reise durch Galiläa an und nimmt dafür sogar die schmerzvolle Trennung von ihrer eigenen Tochter in Kauf. Nach und nach wird Maria zur engsten Vertrauten des Mannes, in dem viele den Sohn Gottes sehen – doch der Weg zum Ziel seiner Bestimmung ist hart und entbehrungsreich – und je weiter sie ziehen, desto mehr beginnt Maria zu ahnen, welches Schicksal der Messias wirklich für sie vorgesehen hat …
»Eine Meisterleistung«, sagt Bestsellerautorin Barbara Taylor Bradford
Über die Autorin:
Margaret George verbrachte als Tochter eines amerikanischen Diplomaten einen Großteil ihrer Kindheit auf Reisen nach Tel Aviv, Ägypten, Taiwan u.a. So wurde erstmals ihre Leidenschaft für die Geschichte fremder Kulturen geweckt. George studierte englische Literatur und Biologie in Massachusetts, sowie Ökologie in Stanford und arbeitete schließlich als Wissenschaftsautorin. Ihre Liebe zur Geschichte hat sie jedoch nie losgelassen, weshalb sie 1986 ihren ersten historischen Roman »Henry VIII« veröffentlichte. Bis heute schreibt Margaret George Romanbiografien über faszinierende Persönlichkeiten der Vergangenheit, mit welchen sie immer wieder auf der Bestsellerliste der New York Times steht. Sie lebt heute mit ihrem Mann in Wisconsin.
Die Website der Autorin: margaretgeorge.com/
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin die historischen Romane »Maria Stuart – Der Roman ihres Lebens«, »Kleopatra – Der Roman ihres Lebens«, »Maria Magdalena – Der Roman ihres Lebens«, und »Ich, Helena von Troja«.
***
eBook-Neuausgabe Oktober 2022
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2003 unter dem Originaltitel »Mary, called Magdalene« bei Penguin Putnam Inc. (The Penguin Group), New York.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2002 by Margaret George
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2003 by Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Roberto Castillo, Niemals und AdobeStock/jorisvo
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98690-530-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Maria Magdalena« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Margaret George
Maria Magdalena
Der Roman ihres Lebens
Aus dem Amerikanischen von Rainer Schmidt
dotbooks.
»Spricht Pilatus zu ihm:
Was ist Wahrheit?«
Joh. 18, 38
»Und darum schreibe ich die Geschichte dessen, was von diesem Augenblick an mit uns geschehen ist.
So viele werden nach uns kommen, und keiner wird es gesehen haben; also müssen wir sie dessen versichern, was wir gesehen haben.«
Das Testament
der Maria von Magdala,
genannt Magdalena
»Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.«
Joh. 8, 32
Erster Teil
Die Dämonen
Kapitel I
Man trug sie an einen Ort, an dem sie noch nie gewesen war. Er war sehr viel klarer als in einem Traum, er hatte Tiefe und Farbe und feine Details, die ihn realer erscheinen ließen als die Zeit mit ihrer Mutter im Hof, realer auch als die verträumten Stunden, die sie manchmal damit zubrachte, auf den großen See von Magdala hinauszuschauen, der so großartig war, dass man ihn auch Meer nannte: das Galiläische Meer.
Sie wurde in die Höhe gehoben, auf eine hohe Säule oder eine Plattform gestellt – sie konnte nicht erkennen, was es war. Überall um sie herum waren Menschen, die sich unten versammelten und zu ihr heraufschauten. Sie wandte den Kopf zur Seite und erblickte andere Säulen mit anderen Leuten, eine ganze Reihe, die sich so weit erstreckte, wie das Auge reichte. Der Himmel war gelblich, eine Farbe, die sie nur einmal gesehen hatte, in einem Sandsturm. Die Sonne war verhüllt, aber es gab noch Licht, ein diffuses, goldenes Licht.
Dann kam jemand zu ihr – konnten sie fliegen, waren es Engel, wie kamen sie hierher? –, nahm ihre Hand und sagte: »Willst du kommen? Willst du mit uns kommen?«
Sie fühlte die Hand, die ihre festhielt, sie war glatt wie ein Stück Marmor, nicht kalt, nicht heiß, nicht schweißfeucht, sondern vollkommen. Sie wollte sie drücken, aber sie wagte es nicht.
»Ja«, sagte sie schließlich.
Und die Gestalt – sie wusste immer noch nicht, wer es war, und wagte nicht, ihr ins Gesicht zu schauen, höchstens auf die Füße in den goldenen Sandalen – hob sie auf und trug sie davon; die Reise war so Schwindel erregend, dass sie das Gleichgewicht verlor und zu fallen begann, senkrecht und immer schneller, und unter ihr war es sehr dunkel.
Mit einem Ruck setzte sie sich auf. Die Öllampe war ausgebrannt. Draußen hörte sie die sanften Geräusche des großen Sees, nicht weit vor ihrem Fenster, wo die Wellen ans Ufer plätscherten.
Sie hob die Hand vor die Augen, befühlte sie. Sie war feucht. Hatte das Wesen sie deshalb losgelassen, sie fallen lassen? Sie rieb die Hand heftig.
Nein, lass mich meine Hand säubern!, rief sie lautlos. Lass mich nicht allein! Ich kann sie abwischen!
»Komm zurück«, flüsterte sie.
Aber sie hörte nur die Stille des Zimmers und das Plätschern des Wassers.
Sie stürzte in das Zimmer ihrer Eltern. Die beiden schliefen fest; sie brauchten keine Lampe, sie schliefen im Dunkeln.
»Mutter!«, schrie sie und packte sie bei der Schulter. »Mutter!« Ohne auf Erlaubnis zu warten, kletterte sie in das Bett und schmiegte sich unter der warmen Decke an ihre Mutter.
»Was ... was ist?« Ihre Mutter brachte die Worte nur mühsam hervor. »Maria?«
»Ich hatte einen so merkwürdigen Traum«, wimmerte sie. »Ich wurde emporgetragen ... in irgendeinen Himmel, ich weiß nicht, wohin, ich weiß nur, es war nicht auf dieser Welt, es gab Engel dort, glaube ich, oder ... ich weiß nicht, was ...« Sie hielt inne und rang nach Atem. »Ich glaube, ich wurde ... ich wurde gerufen. Wurde zu ihnen gerufen, sollte zu ihnen gehören ...« Aber es war beängstigend gewesen, und sie war nicht sicher gewesen, dass sie zu ihnen hatte gehören wollen.
Ihr Vater richtete sich auf. »Was war das?«, fragte er. »Ein Traum? Ein Traum, in dem du gerufen wirst?«
»Nathan ...« Marias Mutter streckte die Hand aus und berührte seine Schulter, um ihn zurückzuhalten.
»Ich weiß nicht, ob ich gerufen wurde«, sagte Maria mit dünner Stimme. »Aber es war ein Traum mit Menschen auf erhöhten Orten und ...«
»Auf erhöhten Orten!«, rief ihr Vater. »Dort standen die alten heidnischen Götzen. Auf erhöhten Orten!«
»Aber nicht auf Säulen«, sagte Maria. »Dies war anders. Die Menschen, die geehrt wurden, standen darauf, und es waren Menschen, keine Statuen.«
»Und du glaubst, du wurdest gerufen?«, fragte ihr Vater. »Warum denn?«
»Sie haben mich gefragt, ob ich mich zu ihnen gesellen will. Sie fragten: ›Willst du mit uns kommen?‹« Noch beim Erzählen hörte sie die wohlklingenden Stimmen.
»Du musst wissen, Tochter, dass alles Prophezeien aufgehört hat in unserem Land«, sagte ihr Vater schließlich. »Seit Maleachi hat kein Prophet mehr ein Wort geäußert, und das ist vierhundert Jahre her. Gott spricht nicht mehr auf diese Weise zu uns. Er spricht nur durch sein heiliges Gesetz. Und das genügt uns.«
Doch Maria wusste, was sie gesehen hatte, in all seiner transzendenten Glorie und Wärme. »Aber Vater«, sagte sie, »die Botschaft und die Einladung – sie waren so klar.« Sie achtete darauf, weiter leise und respektvoll zu sprechen. Aber sie zitterte immer noch.
»Liebe Tochter, du bist in die Irre gegangen. Es war ein Traum, hervorgerufen durch unsere Vorbereitungen für Jerusalem. Gott würde dich nicht rufen. Geh jetzt wieder in dein eigenes Bett.«
Sie klammerte sich an ihre Mutter, aber die stieß sie beiseite. »Tu, was dein Vater sagt!«, befahl sie.
Maria kehrte in ihr Zimmer zurück, immer noch umfangen von der Erhabenheit ihres Traums. Es war Wirklichkeit gewesen. Sie wusste, dass es Wirklichkeit gewesen war.
Und wenn es Wirklichkeit gewesen war, dann hatte ihr Vater Unrecht.
In den Stunden, kurz bevor der Himmel hell werden würde, hatte sich der Haushalt auf die Wallfahrt nach Jerusalem zum Wochenfest vorbereitet. Maria war aufgeregt gewesen, weil alle Erwachsenen die Reise so ungeduldig erwarteten und sich doch alle Juden nach Jerusalem sehnen sollten. Aber am meisten hatte sie sich auf die Reise an sich gefreut, denn die Siebenjährige war noch nie aus Magdala hinausgekommen; unterwegs würden sie sicher Abenteuer erleben. Ihr Vater hatte ihr eine entsprechende Andeutung gemacht: »Wir werden auf dem kurzen Wege nach Jerusalem reisen, durch Samaria; so brauchen wir nur drei und nicht vier Tage. Aber es ist gefährlich. Es hat Überfälle auf Jerusalem-Pilger gegeben.« Er schüttelte den Kopf. »Die Samariter haben sogar noch Götzenbilder, habe ich gehört. Oh, nicht mehr in aller Öffentlichkeit, nicht am Straßenrand, aber ...«
»Was für Götzenbilder? Ich habe noch nie ein Götzenbild gesehen«, fragte sie eifrig.
»Bete darum, dass es auch nie geschieht.«
»Aber wie soll ich ein Götzenbild erkennen, wenn ich es sehe?«
»Du wirst es erkennen«, sagte ihr Vater. »Und du musst dich davon fern halten.«
»Aber ...«
»Genug jetzt!«
Maria erinnerte sich an all die Neugier, die sie zuvor für Jerusalem gefühlt hatte, doch nun verblasste sie angesichts des Traums, der ihr in der Dunkelheit noch immer lebendig vor Augen stand.
Marias Mutter Zebida, die mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt war, hörte plötzlich auf, Korn in die Reisesäcke abzumessen, und beugte sich zu ihrer Tochter hinunter. Den Traum sprach sie nicht an. Stattdessen sagte sie: »Was diese Reise betrifft, so darfst du dich nicht mit irgendjemandem aus den anderen Familien gemein machen, die mit uns kommen, mit Ausnahme der wenigen, von denen ich dir sage, dass sie hinnehmbar sind. So viele Leute halten sich nicht an das Gesetz und gehen nur nach Jerusalem – sogar in den Tempel! –, weil es eine Art Urlaub für sie ist. Bleib bei den anderen, den frommen Familien. Hast du verstanden?« Sie schaute Maria eindringlich an, und in diesem Augenblick sah ihr hübsches Gesicht nicht hübsch, sondern bedrohlich aus.
»Ja, Mutter«, sagte Maria.
»Wir halten uns mit Eifer an das Gesetz, und so muss es auch sein«, fuhr ihre Mutter fort. »Lass die anderen ... Missetäter nur für sich selber sorgen. Es ist nicht unsere Pflicht, sie vor ihrer Nachlässigkeit zu bewahren. Der Umgang mit ihnen wird uns verunreinigen.«
»Wie wenn man Milch und Fleisch zusammenbringt?«, fragte Maria. Sie wusste, dass das verboten war, so sehr, dass alles, was mit dem einen oder anderen zu tun hatte, getrennt aufbewahrt werden musste.
»Genau so«, sagte ihre Mutter. »Und noch schlimmer, denn ihr Einfluss vergeht nicht nach einem oder zwei Tagen, wie es bei Milch und Fleisch der Fall ist. Er bleibt bei dir und verdirbt dich mehr und mehr.«
Sie waren reisefertig. Die sechs Familien, die gemeinsam auf die Reise gingen, warteten mit ihren beladenen Eseln, die Bündel über die Schultern geworfen, an der Straße oberhalb von Magdala auf die größeren Gruppen aus den Nachbarstädten, um sich ihnen zur Wallfahrt nach Jerusalem anzuschließen. Zu Beginn würde Maria auf einem Esel reiten; sie war die jüngste Pilgerin der Familie und hatte nicht die nötige Ausdauer, um lange Strecken zu Fuß zu gehen. Vielleicht würde sie auf dem Rückweg so abgehärtet sein, dass sie gar nicht mehr zu reiten brauchte. Das war ihre Hoffnung.
Die Trockenzeit hatte angefangen. Schon brannte die Sonne ihr heiß ins Gesicht. Grell stand sie über dem Galiläischen Meer, nachdem sie hinter den Bergen aufgegangen war. In der Morgendämmerung hatten die Berge auf der anderen Seite des Sees die Farbe zarter Trauben gehabt, aber jetzt zeigten sie ihr wahres Gesicht aus Staub und Stein. Sie waren kahl, und Maria fand, dass sie bösartig aussahen. Doch das lag vielleicht daran, dass das Land der alten Ammoniter als Israels Erzfeind einen sehr schlechten Ruf besaß.
Was hatten die Ammoniter nur Schlimmes getan? König David hatte Ärger mit ihnen gehabt. Aber er hatte mit allen Ärger gehabt. Und dann war da noch dieser böse Gott, den sie anbeteten; Maria konnte sich nicht gleich an seinen Namen erinnern. Er zwang die Ammoniter, ihm ihre Kinder zu opfern, sie ins Feuer zu werfen. Mo ... Mol ... Moloch. Ja, so hieß er.
Sie hob die Hand über die Augen und spähte über den See. Von hier aus konnte sie jedenfalls keinen Moloch-Tempel sehen.
Es schauderte sie trotz der warmen Sonne. Ich werde jetzt nicht mehr an Moloch denken, nahm sie sich streng vor. Der See, der in der Sonne funkelte, schien ihr zuzustimmen. Sein blaues Wasser war zu schön, als dass man es mit dem Gedanken an einen bluttriefenden Gott besudeln durfte; wahrscheinlich war es der schönste Ort in ganz Israel. Maria war fest davon überzeugt. Was immer man von Jerusalem behauptete – was konnte schöner sein als dieses ovale Gewässer, leuchtend blau und umgeben von schützenden Bergen?
Draußen auf dem Wasser konnte sie Fischerboote erkennen; es waren viele. Für den Fisch war ihre Heimatstadt Magdala berühmt – hier wurde er eingesalzen, gedörrt, verkauft und in die ganze Welt verschickt. Fisch aus Magdala fand man selbst auf den Tafeln in Damaskus und Alexandria. Und bei Maria zu Hause, denn ihr Vater, Nathan, war ein führender Verarbeiter der Fische. Sie wurden in sein Lagerhaus gebracht, und Marias ältester Bruder Samuel – der sich aus Geschäftszwecken lieber Silvanus nannte – leitete die Geschäfte. Er verhandelte mit Einheimischen und Ausländern, um den Verkauf zu organisieren. Daher war das große Mosaik mit dem Fisch und dem Boot, das den Fußboden im Eingangsflur ihres Hauses zierte, ein Zeichen für den Ursprung ihres Reichtums. Jeden Tag, wenn sie darüber hinweggingen, konnten sie sich daran erinnern und Dank sagen für ihr Glück und für die Fischschwärme Gottes in ihrem Meer.
Der Ostwind strich über das Wasser des Sees und ließ die Oberfläche erzittern; Maria beobachtete das Kräuseln der Wellen, die wirklich aussahen wie Harfensaiten. Der alte poetische Name des Sees war See Kinneret, der Harfensee – wegen seiner Form, aber auch wegen des Musters, das der Wind auf dem Wasser hervorbrachte. Fast hörte Maria den feinen Klang gezupfter Saiten, die zu ihr herübersangen.
»Da kommen sie!« Marias Vater bedeutete ihr mit einem Wink, den Esel zu den anderen zurückzutreiben. Weit unten auf der staubigen Straße näherte sich eine sehr große Karawane; sogar ein oder zwei Kamele waren unter den Eseln und Scharen von Fußgängern.
»Sie haben gestern sicher zu lange Sabbat gefeiert«, sagte ihre Mutter spitz. Sie runzelte die Stirn; der späte Aufbruch ärgerte sie. Was hatte es nur für einen Sinn, mit dem Aufbruch bis nach dem Sabbat zu warten, wenn sie sowieso einen halben Tag verlieren sollten? Niemand begann eine Reise einen Tag vor dem Sabbat, nicht einmal zwei Tage davor, wenn es eine weite Reise war. Das rabbinische Gesetz, das es verbot, am Sabbat mehr als eine römische Meile weit zu gehen, bedeutete, dass sie einen Tag vergeuden würden – was die Reise anging.
»Der Sabbat ist ein Vorwand zur Zeitverschwendung«, sagte Marias Bruder Silvanus laut. »Dieses Beharren auf der strikten Einhaltung des Sabbat behindert uns im Außenhandel; die Griechen und Phönizier nehmen nicht alle sieben Tage einen Tag frei!«
»Ja, wir kennen deine heidnischen Neigungen, Samuel«, sagte Marias anderer älterer Bruder Eli. »Vermutlich wirst du als Nächstes mit all deinen griechischen Freunden nackt über den Sportplatz rennen.«
Silvanus – alias Samuel – funkelte ihn an. »Dazu habe ich keine Zeit«, sagte er eisig. »Ich bin viel zu sehr damit beschäftigt, Vater im Geschäft zu helfen. Du bist derjenige, du mit deiner vielen freien Zeit zum Studium der Schrift und zur Beratung mit den Rabbinern, der die Muße hätte, zum Sportplatz oder zu anderen Vergnügungsstätten zu gehen.«
Eli wurde wütend, wie Silvanus es vorhergesehen hatte. Der junge Mann hatte ein hitziges Temperament, trotz all seiner Bemühungen, das Wie und Warum Jahwes zu studieren. Mit seinem feinen Profil, seiner geraden Nase und seiner edlen Haltung könnte er für einen Griechen durchgehen, dachte Silvanus. Während er selbst – fast hätte er gelacht – eher aussah wie die kleinen Gelehrten, die sich im Bet Ha-Midrasch, im Lernhaus, immer über die Thora beugten. Jahwe musste einen gewaltigen Sinn für Humor haben.
»Das Studium der Thora ist das Wichtigste, was ein Mensch betreiben kann«, erklärte Eli steif. »Es übertrifft jede andere Tätigkeit an moralischem Wert.«
»Ja, und in deinem Fall schließt es jede andere Tätigkeit aus.«
Eli schnaubte und wandte sich ab, und dabei zog er seinen Esel mit sich, sodass das Tier Silvanus sein Hinterteil zuwandte; aber der lachte nur.
Maria war an diese Wortwechsel gewöhnt, die sich ihre beiden Brüder, der achtzehn- und der einundzwanzigjährige, in unterschiedlicher Form lieferten. Eine Einigung gab es nie, nicht einmal eine Annäherung. Marias Familie war tief gläubig und befolgte alle Rituale und religiösen Vorschriften; nur Silvanus war unstet in der Beachtung dessen, was ihr Vater als das »vollkommene Gesetz des Herrn« bezeichnete.
Maria wünschte, sie könnte die kleine Schule ihrer Synagoge, das Bet Ha-Sefer, besuchen und dieses Gesetz selbst studieren, um sich ein eigenes Bild davon zu machen. Oder sie könnte das Wissen stehlen, das Silvanus, dem anscheinend nichts daran lag, in der Thora-Schule erworben hatte. Aber Mädchen durften nicht zur Schule gehen, weil sie offiziell keinen Platz in der Religion hatten. Ihr Vater beharrte streng auf dem rabbinischen Diktum: »Besser sähe man die Thora verbrannt, als dass man ihre Worte von den Lippen eines Weibes vernähme.«
»Du solltest Griechisch lernen; dann könntest du die Ilias lesen«, hatte Silvanus ihr einmal vorgeschlagen und dabei gelacht. Selbstverständlich hatte Eli mit einem empörten Donnerwetter darauf geantwortet. Aber Silvanus hatte erwidert: »Wenn jemand durch dumme Vorschriften von seiner eigenen Literatur und Wissenschaft ausgeschlossen ist, ist er dann nicht gezwungen, sich einer anderen zuzuwenden?«
Silvanus hatte nicht Unrecht; die Griechen hießen andere in ihrer Kultur willkommen, während die Juden die ihre hüteten, als wäre sie ein Geheimnis. Beides wurzelte in der Überzeugung, dass die eigene Kultur die überlegene sei; die Griechen glaubten, dass jeder, der eine Kostprobe von der ihren bekäme, sogleich dafür zu gewinnen sei, während die Juden ihre Kultur für so kostbar hielten, dass es eine Entweihung wäre, sie jedem Beliebigen anzubieten, der gerade daherkam. Natürlich war Maria umso neugieriger, und zwar auf beide. Sie nahm sich vor, lesen zu lernen, dann könnte sie sich die Magie und die Mysterien der heiligen Schriften selbst erschließen.
Die beiden Pilgergruppen trafen und vereinten sich an der Gabelung der Straße oberhalb von Magdala – es waren jetzt ungefähr fünfundzwanzig Familien, die gemeinsam reisten. Viele waren zumindest entfernt miteinander verwandt, und so trafen sich Vettern dritten, vierten, fünften und sechsten Grades unterwegs, die miteinander spielen könnten. Marias Familie achtete darauf, nur mit anderen frommen Familien zu reisen. Als sie ihren Platz im Pilgerzug einnahmen, konnte Eli sich eine Randbemerkung nicht verkneifen. »Ich weiß nicht, warum du diese Reise überhaupt mitmachst«, sagte er zu Silvanus. »Du hast doch nichts übrig für unsere Überzeugungen. Warum also nach Jerusalem wandern?«
Statt in scharfem Ton zu antworten, sagte Silvanus nachdenklich: »Wegen der Geschichte, Eli. Wegen der Geschichte. Ich liebe die Steine von Jerusalem; jeder von ihnen hat etwas zu erzählen, und er erzählt es klarer und feiner als alle Worte in den Schriftrollen.«
Eli ignorierte den Ernst seines Bruders. »Aber diese Geschichten würdest du gar nicht kennen, wenn sie nicht in den Schriften aufgezeichnet wären, von denen du so verächtlich redest! Nicht die Steine reden und erzählen uns ihre Geschichten, die Schreiber sind es, die das alles für die Nachwelt aufzeichnen.«
»Es tut mir Leid, dass du nur dir selbst ein feineres Empfinden zubilligst«, sagte Silvanus schließlich. Er blieb stehen und ließ sich von einer anderen Gruppe einholen; auf dieser Reise würde er nicht in der Nähe seines Bruders bleiben.
Maria wusste nicht, bei wem sie bleiben sollte, und so schloss sie sich ihren Eltern an. Sie schritten entschlossen voran, die Gesichter nach Jerusalem gewandt. Die Sonne brannte vom Himmel, und in dem grellen Licht mussten sie blinzeln und sich die Augen beschirmen.
Staubwolken wehten über das Land. Das helle Grün des galiläischen Frühlingsgrases war verblasst und hatte sich in eine braune Matte verwandelt, und die Blumen, die wie bunte Edelsteine auf den Hängen gefunkelt hatten, waren verwelkt. Bis zum nächsten Frühling würde die Landschaft immer trockener werden, und die prachtvoll aufblühenden Grüße der Natur wären nur noch eine Erinnerung. Dabei war Galiläa der üppigste Teil des Landes und kam in ganz Israel einem persischen Paradiesgarten noch am nächsten.
Die Äste der Obstbäume bogen sich unter der Last der neuen Äpfel und Granatäpfel, und die hellgrünen jungen Feigen lugten unter dem Laub hervor. Die Leute ernteten sie schon; neue Feigen blieben nie lange an den Bäumen. Schwerfällig bewegte sich der Pilgerzug über den Kamm der Hügel, die den See umgaben, und Maria konnte noch einen letzten Blick auf das Gewässer werfen, ehe es den Blicken entschwand.
Auf Wiedersehen, Harfensee!, sang sie bei sich. Sie verspürte keinen Abschiedsschmerz, nur freudige Erwartung dessen, was vor ihr lag. Sie waren unterwegs, die Landstraße rief sie, und bald würden alle Berge, die Maria schon seit frühester Kindheit kannte, verschwunden sein, und an ihre Stelle würden Dinge treten, die sie noch nie gesehen hatte. Wie wundervoll das sein würde – wie ein außergewöhnliches Geschenk, eine Schachtel mit glitzernden neuen Dingen!
Bald kamen sie auf die breite Straße, die Via Maris – eine der wichtigen Hauptstraßen, die das Land seit Urzeiten durchzogen. Hier war viel Verkehr; jüdische Händler drängten sich zwischen hageren, falkenäugigen Nabatäern auf ihren Kamelen, und man sah babylonische Geschäftsleute in seidenen Gewändern und mit goldenen Ohrringen, die in Marias Augen schmerzhaft schwer aussahen. Zahlreiche Griechen mischten sich unter die Pilger auf dem Weg nach Süden. Aber es gab eine Sorte von Reisenden, zu denen alle anderen großen Abstand hielten: Römer.
Maria erkannte die Soldaten an ihren Uniformen mit diesen seltsamen, mit Lederstreifen besetzten Röcken, die die stämmigen, behaarten Beine frei ließen. Gewöhnliche Römer waren schwerer zu erkennen. Aber die Erwachsenen hatten keine Mühe, sie zu identifizieren.
»Ein Römer!«, zischte ihr Vater und winkte sie hinter sich, als ihnen ein unauffälliger Mann entgegenkam. Obwohl auf der Straße großes Gedränge herrschte, sah Maria, dass niemand ihn anstieß. Im Vorbeigehen war es, als drehe er den Kopf und schaue sie beinahe neugierig an. Sie lächelte sanft zurück.
»Woher weißt du, dass es ein Römer war?«, fragte sie dann eifrig.
»Es sind die Haare«, erklärte ihr Vater. »Und dass er so glatt rasiert ist. Ich gebe allerdings zu, der Mantel und die Sandalen könnten auch einem Griechen oder einem anderen Ausländer gehören.«
»Es ist der Ausdruck in ihrem Blick«, sagte ihre Mutter plötzlich. »Der Blick eines Menschen, dem alles gehört, was er sieht.«
Sie gelangten auf eine verlockende, weite Ebene. Vereinzelte Bäume warfen Schattentümpel, die Kühlung versprachen; die Sonne stand jetzt fast senkrecht am Himmel. Zu beiden Seiten der Straße ragten einzelne Berge empor: links der Berg Tabor, rechts der Berg More.
Als sie sich den Flanken des Berges More näherten, erschien Silvanus plötzlich neben ihr und deutete unbestimmt hinüber. »Hüte dich vor der Hexe!«, neckte er sie. »Vor der Hexe von Endor.«
Als Maria ihn verständnislos anschaute, sagte er in vertraulichem Ton: »Die Hexe, zu der König Saul ging, um Samuels Geist heraufzubeschwören. Dort hat sie gewohnt. Man sagt, es spukt hier immer noch. Ja, wenn du uns verlässt und dich dort unter einen Baum setzt und wartest ... wer weiß, was für ein Geist da heraufbeschworen werden könnte?«
»Ist das wahr?«, fragte Maria. »Sag’s mir, und mach dich nicht über mich lustig.« Es war eine ehrfurchterregende Vorstellung, dass jemand Geister heraufbeschwören konnte, vor allem die Geister von Leuten, die schon gestorben waren.
Sein Lächeln verblasste. »Ich weiß nicht, ob es wirklich wahr ist«, gab er zu. »Es steht in den heiligen Schriften, aber ...« Er zuckte die Achseln. »Da steht auch, dass Samson tausend Mann mit einem Eselskiefer erschlagen hat.«
»Woran würde ich einen Geist denn erkennen?« Maria ließ sich von dem Eselskiefer nicht ablenken.
»Es heißt, du erkennst ihn an der Angst, die er dir einflößt«, sagte Silvanus. »Im Ernst, wenn du je einen siehst, würde ich dir raten, in die entgegengesetzte Richtung davonzulaufen. Das Einzige, was alle wissen, ist, dass sie gefährlich sind. Sie wollen uns in die Irre führen und zerstören. Vermutlich hat Mose deshalb jeden Umgang mit ihnen verboten.« Erneut gab er sich skeptisch. »Falls er das wirklich getan hat.«
»Warum sagst du das immer wieder? Glaubst du nicht, dass es wahr ist?«
»Oh ...« Er zögerte. »Doch, ich glaube, dass es wahr ist. Und wenn es auch streng genommen nicht stimmt, dass Mose es gesagt hat, so ist es doch ein guter Gedanke. Das meiste von dem, was Mose gesagt hat, ist ein guter Gedanke.«
Maria lachte. »Manchmal hörst du dich an wie ein Grieche.«
»Wenn Grieche zu sein bedeutet, sorgfältig über die Dinge nachzudenken, dann wäre ich stolz, so genannt zu werden.« Jetzt lachte auch er.
Und weiter ging es, an anderen Bergen vorbei, deren Ruhm beträchtlicher war als ihre eigentliche Größe. Der Gilboa zur Linken, wo Saul seine letzte Schlacht schlug und im Kampf gegen die Philister unterging. Und weit zur Rechten, jenseits der Ebene: Meggido, das aufragte wie ein Turm, und dort würde die Schlacht am Ende der Welt stattfinden.
Der Berg Gilboa lag nicht weit hinter ihnen, als sie die Grenze nach Samaria überschritten. Samaria! Maria umklammerte die Zügel ihres Esels und presste die Schenkel an seine Flanken. Gefahr! Gefahr! War es hier wirklich gefährlich? Wachsam schaute sie sich um, aber die Landschaft sah genauso aus wie die, aus der sie gerade kamen – die gleichen steinigen Höhen, die staubigen Ebenen, die einsamen Bäume. Man hatte ihr erzählt, es gebe Banditen und Rebellen, die sich in den Höhlen in der Nähe von Magdala versteckten, aber in der Nähe ihres Hauses hatte sie noch nie einen gesehen. Aber jetzt hoffte sie, wenigstens irgendetwas zu sehen, denn sie wagten sich doch auf feindliches Gebiet.
Lange brauchten sie nicht zu warten. Sie waren nicht weit gekommen, als eine Schar johlender Halbwüchsiger am Straßenrand sie mit Steinen bewarf und mit tiefen, gutturalen Stimmen endlose Schmähungen ausstieß. »Hunde ... Dreck von Galiläa ... Verdreher der heiligen Bücher Mosis ...« Ein paar von ihnen spuckten. Marias Eltern schauten entschlossen geradeaus und taten, als sähen und hörten sie nichts, was die Jungen noch provozierte.
»Seid ihr taub? Dann nehmt das!« Und sie bliesen markerschütternde Fanfaren mit einem Widderhorn und gaben schrille, unmenschlich klingende Pfiffe von sich. Ihr Hass hing bebend in der Luft. Dennoch schauten die Galiläer sie nicht an und erwiderten auch die Beschimpfungen nicht. Maria saß zitternd auf ihrem Esel, als sie einmal fast auf Armeslänge an eine Gruppe von Schreiern herankam. Aber zum Glück waren sie schließlich an ihnen vorbei; die Halbwüchsigen gerieten außer Sichtweite, und dann konnte man sie auch nicht mehr hören.
»Das war ja schrecklich!«, rief Maria, als sie wieder gefahrlos einen Laut von sich geben konnte. »Warum hassen sie uns so sehr?«
»Das ist eine uralte Fehde«, sagte ihr Vater. »Zu unseren Lebzeiten wird sich daran wahrscheinlich auch nichts mehr ändern.«
»Aber warum? Wie ist es denn dazu gekommen?« Maria blieb hartnäckig.
»Das ist eine lange Geschichte«, sagte ihr Vater müde.
»Ich werde sie dir erzählen«, versprach Silvanus und ging mit schnellen Schritten neben dem Esel her. »Du kennst doch König David, oder? Und König Salomo?«
»Aber natürlich«, sagte sie stolz. »Der eine war der größte Soldatenkönig, den wir je hatten, und der andere der weiseste.«
»Er war nicht weise genug, um einen besonders weisen Sohn zu haben«, antwortete Silvanus. »Sein Sohn machte seine Untertanen so zornig, dass zehn der zwölf Stämme Israels sich vom Königreich lösten und im Norden ihr eigenes Reich begründeten. Sie erwählten sich einen General zum König – Jerobeam.«
Jerobeam. Von dem hatte sie gehört, und was es auch gewesen war, es war nichts Gutes.
»Da die Menschen im Nordreich den Tempel von Jerusalem nicht mehr aufsuchen konnten, ließ Jerobeam neue Altäre für sie errichten und goldene Kälber darauf stellen, die sie anbeten sollten. Gott gefiel das nicht, und so bestrafte er sie, indem er die Assyrer sandte, damit sie ihr Land zerstörten und sie in die Gefangenschaft führten. Und das war das Ende von zehn der zwölf Stämme Israels. Sie verschwanden einfach in Assyrien und kamen nie zurück. Leb wohl, Ruben; leb wohl, Simeon, lebt wohl, Dan und Ascher ...«
»Aber Samaria ist doch jetzt nicht leer«, sagte Maria. »Wer sind die abscheulichen Leute, die uns angeschrien haben?«
»Die Assyrer haben Heiden hergebracht, die sich hier ansiedeln sollten!«, rief Eli, der das Gespräch mitgehört hatte. »Sie haben sich mit den paar Juden vermischt, die zurückgeblieben waren, und brachten diese grässliche Mischung aus dem wahren Glauben Mosis und ihrem Heidentum zustande. Ein Gräuel!« Sein Gesicht verzog sich vor Abscheu. »Und sag mir nicht, sie hatten keine Wahl!«
Maria zog den Kopf ein. Sie hatte nicht vorgehabt, ihm dergleichen zu sagen.
»Jeder Mensch hat eine Wahl«, fuhr er fort. »Etliche Angehörige dieser zehn Stämme waren loyal gegen Jerusalem. Deshalb wurden sie nicht bestraft und nach Assyrien verschleppt. So war es mit unserer Familie. Wir waren – wir sind! – vom Stamme Naphtali. Aber wir haben unseren Glauben bewahrt!« Seine Stimme war schrecklich laut geworden, und er schien wütend zu sein. »Und diesen Glauben müssen wir hüten!«
»Ja, Eli«, sagte sie folgsam. Und sie fragte sich, wie sie das anstellen würde.
»Dort hinten« – er deutete nach Süden –, »auf ihrem besonderen Berg Garizim, da vollziehen sie ihre ketzerischen Riten!«
Ihre Frage war immer noch nicht beantwortet, und so stellte sie sie noch einmal. »Aber warum hassen sie uns?«
Silvanus deutete mit dem Kopf auf seinen Bruder. »Weil wir sie hassen und weil wir es so offensichtlich tun.«
Der Rest des Tages verlief ruhig. Wenn sie an Feldern und kleinen Dörfern vorbeikamen, stellten die Leute sich an den Straßenrand und starrten sie an, ohne sie indessen zu beschimpfen oder zu versuchen, ihnen den Weg zu versperren.
Die Sonne wanderte an Marias linker Schulter vorbei und begann ihren Abstieg. Die kleinen Schattenkreise unter den Bäumen am Wegrand, mittags bescheidene kleine Röcke, erstreckten sich jetzt wie die Schleppe eines Prinzengewandes weit über die Stämme hinaus.
Vor ihnen wurde die Karawane langsamer; man hielt Ausschau nach einem Lagerplatz für die Nacht. Sie brauchten genug Tageslicht, um eine sichere Stelle zu finden, und mit dem Wasser würde es wahrscheinlich schwierig werden.
Brunnen waren immer ein Problem; zunächst einmal war es schwer, einen zu finden, der groß genug war, um einer so zahlreichen Reisegesellschaft genug Wasser zu bieten, und dann musste man mit der Feindseligkeit der Eigentümer rechnen. Bei Brunnenstreitigkeiten kamen Leute zu Tode. Es war kaum wahrscheinlich, dass die Samariter die Reisenden an ihren Brunnen willkommen heißen und ihnen Eimer reichen würden: »Trinkt, so viel wie ihr wollt, und lasst auch eure Tiere saufen.«
Die Führer der Karawane hatten eine weite, ebene Fläche abseits der Straße ausgesucht, wo es mehrere Brunnen gab. Es war ein idealer Platz – vorausgesetzt, sie durften ihn in Frieden genießen. Im Augenblick waren nur wenige Leute dort, und die Galiläer konnten ungehindert ihre Zelte aufschlagen, ihre Packtiere tränken und Wasser für den eigenen Gebrauch holen. Als alle sich niedergelassen hatten, wurden ringsum Wachen aufgestellt.
Das Lagerfeuer knisterte und spuckte, wie Maria es gern hatte. Es bedeutete, dass das Feuer eine Persönlichkeit hatte und mit ihnen zu sprechen versuchte. Zumindest hatte sie es sich so immer vorgestellt. Das große Zelt aus Ziegenhaar bot Platz für sie alle, und auch das hatte sie gern. Es war schön, um das Feuer herum zu sitzen und zu wissen, dass alle im selben Kreis waren.
Als sie sie jetzt anschaute – ihren hübschen Bruder Eli und ihren weniger hübschen, aber faszinierenden Bruder Silvanus –, überkam sie plötzlich die Befürchtung, dass einer von ihnen im nächsten Jahr verheiratet sein und vielleicht sogar ein Kind haben könne. Dann würde er nicht mehr im Familienzelt, sondern in seinem eigenen sitzen. Das gefiel ihr nicht. Sie wollte, dass alles blieb, wie es war, dass sie alle zusammenblieben, für immer und ewig, und einander beschützten. Diese kleine Familie, diese kleine Gemeinschaft, so stark und so tröstlich, musste für alle Zeit bestehen bleiben. Und im kühlenden Dämmerlicht des samaritischen Frühlings fühlte es sich an, als könnte es so sein.
Dunkle Nacht. Maria hatte, wie ihr schien, lange Zeit geschlafen, eine dicke Decke unter sich, ihren warmen Mantel über sich. Das geräumige Zelt beschützte sie alle, und draußen vor der Zeltklappe glomm die Glut eines kleinen Wachfeuers langsam und sacht wie der Atem eines Drachens. Dann plötzlich war sie hellwach, und es war eine eigentümliche Art Wachheit, wie ein sehr deutlicher Traum. Sie hob langsam den Kopf und sah sich um; alles war undeutlich im matten Licht, aber sie hörte die anderen neben sich atmen. Sie hatte Herzklopfen, aber sie konnte sich nicht erinnern, schlecht geträumt zu haben. Warum war sie so aufgeregt?
Schlaf weiter!, sagte sie sich. Schlaf weiter! Schau doch, draußen ist es noch ganz dunkel. Man kann alle Sterne sehen.
Aber sie war hellwach und zittrig. Sie warf sich hin und her und versuchte eine bequeme Lage zu finden; sie drehte sich auf der Decke um und verschob das zusammengerollte Tuch, das ihr als Kopfkissen diente. Und während sie noch mit der Decke kämpfte, um sie glatt zu ziehen, stießen ihre Hände auf eine Unebenheit unter ihrem Kissen. Sie spürte scharfe Kanten. Neugierig betastete sie den Gegenstand. Er fühlte sich nicht an wie ein Stein; er war kleiner und feiner, aber es war keine Pfeilspitze oder eine Sichel oder sonst etwas Metallenes. Sie scharrte ein bisschen mit den Fingern und spürte Kanten. Neugieriger geworden, benutzte sie das harte Ende ihres Sandalenriemens als Schaufel, um den Gegenstand auszugraben. Als sie ihn schließlich aus dem Boden gewühlt hatte, sah sie, dass es etwas Geschnitztes war. Hell und zu leicht für einen Stein. Sie hielt es in die Höhe und drehte es hin und her, aber sie konnte nicht erkennen, was es war. Sie würde bis zum Morgen warten müssen.
Und plötzlich, beinahe wie durch ein Wunder, schlief sie fest ein.
Das Tageslicht flutete über den Himmel im Osten, und Maria erwachte blinzelnd. Ihre Familie war schon auf den Beinen und faltete Decken und Zelt zusammen. Sie fühlte sich so zerschlagen, als hätte sie überhaupt nicht geschlafen. Als sie ihren Mantel zurückschlug, merkte sie, dass sie etwas in der Hand hatte. Einen Moment lang war sie verwirrt; sie hielt es sich vors Gesicht und machte schmale Augen.
Es war noch ein wenig mit Erde bedeckt – wie eine schöne Frau, deren Nacktheit durch einen Schleier verhüllt ist. Aber durch diese stumpfe Schicht schimmerte ein Gesicht, ein Gesicht von erlesener Schönheit.
Ein Götzenbild!
Und wie ihr Vater gesagt hatte: Sie erkannte es, ohne je zuvor eines gesehen zu haben.
»Und du musst ihm aus dem Weg gehen«, hatte er gemahnt.
Aber sie konnte den Blick nicht abwenden. Das Ding zog sie an, zwang sie hinzuschauen. Die verträumten Augen, halb geschlossen, die vollen, sinnlichen Lippen, im Lächeln leicht geschwungen, das dichte Haar zurückgebunden, sodass es einen schlanken Hals entblößte, fein wie ein Zepter aus Elfenbein ...
Elfenbein. Ja, das war es, woraus dieses ... Idol ... geschnitzt war. Es war vergilbt und hatte sogar ein paar braune Flecken, aber es war Elfenbein, sahnehell und beinahe durchscheinend. Deshalb war es so leicht und zart, und selbst die harten Kanten waren nicht scharf.
Wer bist du?, fragte Maria und schaute in die Augen des Bildnisses. Wie lange warst du hier vergraben?
Ihr Vater stieg über die Satteltaschen neben ihr, und hastig verbarg sie die Hand unter der Decke.
»Zeit zum Aufbruch«, sagte er munter und beugte sich über sie. Maria öffnete die Augen wieder und tat, als sei sie eben aufgewacht.
Während sie neben dem Esel einherstapfte – heute ritt ihre Mutter ihn –, betastete Maria immer wieder ihren neuen Schatz. Sie hatte die Figur in den langen Tuchstreifen geschoben, den sie als Gürtel um den Leib geschlungen hatte. Sie wusste, sie hätte das Schnitzwerk auf der Stelle ihrem Vater zeigen sollen, aber das wollte sie nicht. Sie wollte es behalten und wusste, dass er sie zwingen würde, es wegzuwerfen, wahrscheinlich mit einem Fluch.
Sie hatte das Gefühl, dass sie es beschützen musste.
Diesmal mussten sie zur Mittagsstunde, als die Sonne am heißesten brannte, einen Umweg um einen von Samaritern bewachten Brunnen machen. Wieder kam es zu Drohungen und Verhöhnungen, und die Pilger waren bemüht, sie zu ignorieren. Es war gut, dass sie dort, wo sie übernachtet hatten, freien Zugang zu den Wasserstellen gehabt hatten. Nur noch eine Nacht mussten sie in Samaria verbringen, nur noch einmal einen Brunnen finden.
»Wenn man bedenkt, dass unsere Vorfahren diese Brunnen gegraben haben – und jetzt dürfen wir nicht einmal daraus trinken!«, murrte Eli. »Das ganze Land ist übersät von Brunnen, die mit Fug und Recht uns gehören.«
»Sei friedlich, Eli!«, sagte Nathan. »Eines Tages wird das alles vielleicht seinen rechtmäßigen Eigentümern zurückgegeben werden. Oder die Samariter werden zum wahren Glauben zurückkehren.«
Eli machte ein angewidertes Gesicht. »Ich weiß von keiner Schrift, die das prophezeit.«
»Oh, ich bin sicher, irgendwo wird es sich finden«, sagte Silvanus, der sich heute Morgen in der Nähe seiner Familie hielt. »Anscheinend findet sich ja alles. Verheißungen gibt es in reicher Fülle, vom Messias bis zu den Wasserverhältnissen. Das Problem liegt nur in ihrer Deutung. Mir scheint, Jahwe wollte nicht, dass seine Botschaften für die Gläubigen allzu leicht verständlich sind.«
Eli holte zu einer Erwiderung aus, aber plötzlich kam vorn Unruhe auf, und die Karawane hielt an. Nathan wandte sich ab und eilte nach vorn. Aber es sprach sich schneller herum, was geschehen war, als er gehen konnte.
Götzenbilder! Ein ganzes Lager von Götzenbildern!
Im Handumdrehen verwandelte sich die Karawane in eine wimmelnde Menge, denn alles strömte nach vorn, um sie zu sehen. Die Leute waren in höchster Aufregung – denn wer unter ihnen hatte schon ein solches altes Götzenbild tatsächlich gesehen? Es gab natürlich die modernen römischen, aber nur in heidnischen Städten wie Sepphoris in Galiläa, in die sich nur wenige der Pilger je gewagt hatten.
Aber alte Götzen! Die aus der Legende, gegen die die Propheten gewettert hatten und die erst das Nordreich Israels und nachher das Schwesterreich Juda in den Untergang und ins Exil geführt hatten. Schon ihre Namen riefen Furcht hervor: Baal. Astarte. Moloch. Melkart. Baal-Sebul.
Ein Rabbi aus Betsaida stand vor einem Felsen, der am Straßenrand aus der Erde wuchs. Zwei seiner Gehilfen wühlten in einem schmalen Spalt und zerrten eingewickelte Bündel heraus. Etliche davon lagen bereits auf dem Boden, aufgereiht wie tote Krieger.
»Der Verschluss war nicht zu übersehen!«, rief der Rabbi und deutete auf den Stein, der vor der kleinen Höhlenöffnung gelegen hatte.
Warum glaubte er das Recht zu haben, ihn wegzunehmen?, fragte Maria sich.
»Ich wusste, es war etwas Böses!«, verkündete er und beantwortete damit ihre unausgesprochene Frage. »Sie müssen vor langer Zeit versteckt worden sein, in der Hoffnung, dass ihre Anhänger eines Tages zurückkehren und sie an ihre ... ihre hohen Stätten, oder wo immer man ihnen diente und sie anbetete, zurückbringen würden. Aber wahrscheinlich sind sie in Assyrien zugrunde gegangen, und das war nur recht so! Wickelt sie aus!«, befahl er seinen Gehilfen unvermittelt. »Wickelt sie aus, damit wir sie zerschlagen und vernichten können! Anstößiges! Götzenbilder! Das Anstößige muss vollständig vernichtet werden!«
Der vergilbte alte Stoff, in den die Idole wie in einen Verband eingewickelt waren, war so mürbe, dass es schwierig war, ihn abzulösen; deshalb zerschnitten der Rabbi und die anderen ihn mit dem Messer. Kleine Tonfiguren kamen zum Vorschein, plumpe Gestalten mit vorquellenden Augen und stockartigen Armen und Beinen.
Maria umklammerte den eigenen Schatz unter dem Gürtel. Ihre Figur war nicht hässlich wie diese dort, sondern schön.
Als der Rabbi einen Knüppel schwang und anfing, die Figuren zu zerschlagen, fragte Maria sich, ob sie ihre nicht auch auf den Haufen werfen sollte. Aber der Gedanke, dass dieses wunderbare Gesicht zerschmettert werden sollte, war zu schmerzlich. Also blieb sie stehen und beobachtete, wie die Trümmer der wehrlosen Götzenbilder ringsum wie ein Regenschauer niederprasselten. Ein winziger abgebrochener Arm landete auf ihrem Ärmel, und sie nahm ihn in die Hand und schaute ihn an. Wie ein winziges Hühnerbein. Es schien sogar Krallen zu haben.
Ohne nachzudenken steckte sie auch das Ärmchen unter ihren Gürtel.
»Wer mögen sie wohl gewesen sein?«, fragte Silvanus obenhin. »Vielleicht waren es kanaanitische Götter. Möglich ist alles.« Wieder prasselten die Splitter der Götzen auf sie herab. »Aber was immer sie waren, sie sind es nicht mehr. Puff – sie sind verschwunden.«
Aber konnte ein Gott verschwinden? Konnte man einen Gott zerstören?, fragte Maria sich.
»›Weh dem, der zum Holz spricht: Wache auf! Und zum stummen Steine: Stehe auf!‹«, rief der Rabbi und schlug in einem letzten meisterlichen Hieb auf die Idole ein. »›Wie sollte es lehren? Siehe, es ist mit Gold und Silber überzogen, und ist kein Odem in ihm.‹« Er hielt inne, ließ seinen Knüppel sinken und nickte befriedigt. Dann deutete er in die Richtung, in der Jerusalem lag, und seine Stimme überschlug sich vor Frohlocken, als er die nächsten Verse des Propheten Habakuk zitierte. »›Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei vor ihm still alle Welt!‹« Er hob seinen Knüppel. »Morgen, meine Freunde! Morgen werden wir den heiligen Tempel erblicken! Dank sei Gott, dem Einen und Ewigen Jahwe!«
Und er spuckte auf das, was von den Götzenbildern übrig war.
Kapitel II
Noch ein Sonnenuntergang, noch ein Nachtlager bis Jerusalem. Als sie sich für die Nacht niederließen, spürte Maria, wie aufgeregt die Erwachsenen waren, weil die Stadt so nah war.
Diesmal war der Boden unter ihrem Lager fest und eben, und nichts deutete darauf hin, dass sich etwas darin verbarg. Sie war ein wenig enttäuscht, als habe sie erwartet, bei jedem Halt in dieser fremdartigen Landschaft etwas Exotisches und Verbotenes zu finden. Vorsichtig hatte sie den Gürtel mit dem Götzenbild losgebunden und bewahrte ihn zusammengerollt unter ihrem Kopf. Sie wagte nicht, die Figur herauszunehmen, wenn so viele Leute dabei waren. Und der kleine abgebrochene Götzenarm blieb auch in seinem Versteck. Aber ihre Gegenwart war ihr die ganze Zeit bewusst, als riefen sie sie und zögen sie zu sich.
Sie kämpfte gegen den Schlaf und fragte sich, was sie im Tempel erwarten mochte. Am Küchenfeuer hatte Eli gesagt: »Wahrscheinlich wird man unsere ganze Karawane durchsuchen, nur weil wir Galiläer sind.«
»Ja, und vermutlich werden zusätzliche Wachen im Tempel sein«, sagte Nathan. »Und zwar viele.«
Anscheinend hatte es dort kürzlich Unruhe gegeben wegen irgendeines Rebellen aus Galiläa.
»Judas, der Galiläer, und seine Banditen!«, sagte Silvanus. »Was wollte er nur mit seiner Rebellion erreichen? Wir stehen unter der Knute der Römer, und wenn sie beschließen, uns zu besteuern, dann können wir nichts dagegen tun. Er und sein lächerlicher Widerstand machen die Lage für uns Übrige nur noch schwerer.«
»Dennoch ..« Eli kaute gemächlich, bevor er seinen Gedanken zu Ende führte. »Manchmal kann das Gefühl von Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit überwältigend werden, und dann kann es notwendig sein, irgendetwas zu unternehmen, sei es auch vergebens.«
»Während des Festes wird es in Jerusalem ruhig bleiben«, meinte Silvanus. »O ja. Dafür werden die Römer schon sorgen.« Er schwieg kurz. »Du bist froh, dass wir unseren netten jungen König Herodes Antipas haben, der im guten alten Galiläa über uns wacht, nicht wahr?«
Eli schnaubte.
»Na, Jude ist er ja«, sagte Silvanus, aber sein Ton verriet Maria, dass er das Gegenteil meinte.
»Die schlechte Imitation eines Juden, wie sein Vater!« Eli hatte den Köder geschluckt. »Der Sohn einer Samariterin und eines Indumäers! Ein Nachkomme Esaus! Wenn man sich vorstellt, dass wir gezwungen sind, so zu tun, als wäre ...«
»Still«, warnte Nathan. »Sprich nicht so laut außerhalb der Mauern unseres eigenen Hauses.« Er lachte, um einen Scherz aus der Sache zu machen. »Aber wie kannst du sagen, sein Vater war kein guter Jude? Hat er uns nicht einen prächtigen Tempel gebaut?«
»Das war gar nicht nötig«, fauchte Eli. »Der alte war gut genug.«
»Für Gott vielleicht«, sagte Nathan zustimmend. »Aber die Menschen wollen, dass ihre Götter ebenso prachtvoll hausen wie ihre Könige. Gott will sowohl mehr als auch weniger, als wir ihm für gewöhnlich zu geben bereit sind.«
Tiefe Stille senkte sich herab, als allen klar wurde, wie viel Wahrheit in dieser beiläufigen Bemerkung steckte.
»Maria, sag uns, was es mit dem Wochenfest auf sich hat«, befahl Eli und brach das Schweigen. »Um es zu feiern, gehen wir schließlich nach Jerusalem.«
Dass er die Aufmerksamkeit auf diese Weise auf sie lenkte, brachte sie in Bedrängnis. Jeder andere hätte die Frage besser beantworten können als sie. »Es ist ... es ist eins der drei großen Feste, die unser Volk begeht«, sagte sie.
»Ja, aber was für ein Fest ist es?« Eli ließ nicht locker und schaute sie an wie ein Prüfer.
Ja, was für ein Fest war es? Es ging darum, dass das Korn reif war und dass soundso viele Tage seit dem Passahfest vergangen waren ... »Es ist fünfzig Tage nach Passah«, sagte Maria und versuchte sich zu erinnern. »Und es hat etwas damit zu tun, dass das Getreide reif ist.«
»Welche Sorte Getreide?«
»Eli, hör auf«, sagte Silvanus. »Das hättest selbst du mit sieben noch nicht gewusst.«
»Gerste ... oder Weizen, glaube ich.« Maria musste raten.
»Weizen! Und wir opfern Gott die erste Ernte«, sagte Eli. »Darum geht es. Die Opfergaben werden im Tempel vor ihm aufgehäuft.«
»Und was macht er damit?« Maria stellte sich vor, wie ein großes, alles verschlingendes Feuer ausbrach und Gott die Gaben damit verzehrte.
»Nach dem Ritual werden sie den Gläubigen zurückgegeben.«
Oh. Wie enttäuschend. Sie machten diese weite Reise also nur, um ein bisschen Getreide in den Tempel zu legen, das ihnen nachher unberührt zurückgegeben werden würde? »Aha«, sagte sie schließlich. »Aber wir bauen kein Getreide an«, gab sie zu bedenken. »Vielleicht hätten wir Fisch mitbringen sollen? Den Fisch, den wir einsalzen?«
»Es ist ein Symbol«, sagte Eli knapp.
»Der Tempel«, sagte Silvanus. »Vielleicht ist es besser, wenn wir uns darüber unterhalten. Es ist einfacher.«
Und während die Sonne verschwand und ihre warmen Strahlen von ihren Schultern nahm, sprachen sie über den Tempel. Wie wichtig er für das jüdische Volk war. Dass es der dritte war, den man dort errichtet hatte, nachdem die beiden ersten zerstört worden waren. Ja, er war so wichtig, dass er das Erste war, was die Menschen nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft fünfhundert Jahre zuvor erbaut hatten.
»Das Volk ist der Tempel, und der Tempel ist das Volk«, sagte Nathan. »Ohne ihn können wir als Volk nicht existieren.«
Was für ein erschreckender Gedanke: dass es ein Gebäude geben musste, damit die Juden existieren konnten. Maria lief ein Schauer über den Rücken. Was würde geschehen, wenn er zerstört würde? Aber das würde gewiss niemals passieren. Gott würde es nicht zulassen.
»Unser Vorfahr Huram war ein Arbeiter in Salomos Tempel«, erzählte Nathan. Er nestelte an seinem Hals, zog einen kleinen Granatapfel aus Messing an einer Kordel hervor und nahm ihn ab. »Den hat er gemacht«, sagte er und reichte ihn Silvanus, der ihn mit nachdenklicher Miene betrachtete, bevor er ihn an Eli weitergab.
»Oh, er hat noch viele andere Dinge gemacht, große Dinge – bronzene Säulen und Kapitelle, die er in riesigen Tonformen goss –, aber das hier hat er für seine Ehefrau gemacht. Vor tausend Jahren. Wir haben es seitdem gehütet und einander weitergereicht. Wir haben es sogar mit nach Babylon genommen und wieder zurückgebracht.«
Als der Granatapfel bei Maria angelangt war, hielt sie ihn ehrfurchtsvoll in der Hand. Er erschien ihr wie etwas unermesslich Heiliges, schon weil er so alt war.
Mein Ur-ur-ur ... mein vielfacher Urgroßvater hat das gemacht, mit seinen eigenen Händen, dachte sie. Seine Hände, die jetzt Staub waren.
Sie hielt ihn hoch, ließ ihn langsam an der Kordel kreisen. Das schwindende Licht spielte auf seiner Oberfläche, auf dem runden Körper der Frucht und an den vier gegabelten Vorwölbungen an der Spitze, die den Stiel darstellten. Er hatte die Gestalt des Granatapfels eingefangen und sie gleichzeitig in ihrer perfekten Form wiedergegeben, symmetrisch und ideal.
Sie wagte nicht, in seiner Gegenwart zu atmen, und so reichte sie ihn ihrem Vater zurück. Er hängte ihn sich wieder um den Hals und barg ihn an seiner Brust.
»Ihr seht also, unsere Pilgerreise ist keine Kleinigkeit«, sagte er schließlich und klopfte mit der flachen Hand auf sein Gewand, unter dem der Talisman ruhte. »Wir unternehmen sie im Namen Hurams und der letzten tausend Jahre.«
Früh im Morgengrauen wurden die Nachbarzelte abgerissen, die Packtiere beladen, und Mütter riefen nach ihren Kindern. Als Maria aufwachte, hatte sie das merkwürdige Gefühl, als sei sie tatsächlich schon im Tempel gewesen, und sie glaubte sich an Reihen von Statuen zu erinnern, an Göttinnen ... in einem Hain mit hohen Bäumen, deren dunkelgrüne Wipfel sich sanft im Wind wiegten. Der Tempel rief sie, aber das Rascheln des Windes im Zypressenhain tat es auch.
Bald waren sie wieder unterwegs. Die Karawane bewegte sich kraftvoll voran, als seien sie eben erst aufgebrochen und nicht schon seit drei Tagen unterwegs. Jerusalem zog sie in seinen Bann.
Am späten Nachmittag hatten sie eine der Anhöhen erreicht, die einen Blick auf die Heilige Stadt eröffneten, und die ganze Karawane hielt an, um hinunterzuschauen. Dort unten lag Jerusalem, und seine Steine leuchteten braun und golden in der Abendsonne. Von Mauern umschlossen, hob und senkte sich die Stadt mit dem Land, auf dem sie stand. Hier und dort sah man weiße Flecken, wo Marmorpaläste inmitten der Kalksteinhäuser standen, und auf einem flachen Plateau erhob sich in gold-weißer Pracht der Tempel mit seinen Bauten.
Andächtiges Schweigen senkte sich herab. Maria war zu klein, um den Rausch der religiösen Ehrfurcht zu verspüren, der die Älteren erfasst hatte; sie sah nur das reine Weiß des Tempels und das goldene Licht, das mit langen Fingern vom Himmel herab nach der Stadt griff, anders als alles, was sie je gesehen hatte.
Weitere Gruppen versammelten sich auf der Anhöhe. Auch ein paar geschmückte Karren mit den symbolischen Opfern der ersten Früchte aus Städten, die in diesem Jahr keine Pilger schicken konnten, standen dort beieinander. Sie waren beladen, wie die Überlieferung es befahl: Zuunterst lag Gerste, darüber Weizen und Datteln, darauf Granatäpfel, dann Feigen und Oliven, und das Ganze war von Weintrauben gekrönt. Schon bald würden sie rumpelnd nach Jerusalem hineinrollen und den Priestern übergeben werden.
»Ein Lied! Ein Lied!«, rief jemand. »Lasst uns singen vor Freude, dass wir zu Gott und seinem heiligen Tempel kommen dürfen!«
Und sogleich stimmten tausend Stimmen die Psalmen an, die sie so gut kannten, die Psalmen, die den Gang nach Jerusalem priesen:
»Unsre Füße stehen in deinen Toren, Jerusalem.
Jerusalem ist gebaut, dass es eine Stadt sei, da man zusammenkommen soll,
Da die Stämme hinaufgehen, die Stämme des Herrn, wie geboten ist dem Volk Israel, zu danken dem Namen des Herrn.
Wünschet Jerusalem Glück! Es möge wohlgehen denen, die dich lieben!
Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen!«
Eifrig Palmwedel schwenkend, stiegen sie den letzten Hang hinunter, auf Jerusalem zu. Die Mauern und das Tor, durch das sie eintreten würden, ragten vor ihnen auf.
Der Tumult schien sich zu vervielfachen, als die einzelnen Gruppen sich der Stadt näherten; die Reihen schwollen an, und die Menschen wurden dichter zusammengedrängt. Es war eine glückliche, heitere Menge, vorangetrieben von einer Mischung aus Ehrfurcht und Inbrunst. Vor ihnen holperten Karren den Berg hinunter, und Wallfahrtsgesänge stiegen empor, von klingenden Zimbeln und dröhnenden Tamburins begleitet. Das große Nordtor stand offen. Bettler und Aussätzige drängten sich dort und jammerten und heulten nach Almosen, aber die heranflutenden Massen erdrückten sie fast.
Maria sah ein paar römische Reitersoldaten, die abseits standen und alles wachsam beobachteten, jederzeit auf Unruhe gefasst. Ihre Helmbüsche sahen wild aus vor dem strahlend blauen Himmel.
Der Pilgerzug kroch nur noch wie eine Schildkröte voran, als er am Tor anlangte. Die Mutter hielt Maria dicht bei sich, als das Gedränge immer heftiger wurde. Es wurde ungeheuer eng – und dann hatten sie das Tor hinter sich und waren in Jerusalem. Aber sie hatten keine Zeit, stehen zu bleiben und bewundernd umherzuschauen, denn die nachfolgenden Massen schoben sie weiter.
»Aah«, seufzten die Menschen um sie herum, von Staunen erfasst.
In dieser Nacht lagerten sie vor den Stadtmauern, zusammen mit Tausenden von anderen Pilgern, die wie eine zweite Mauer fast die ganze Stadt umgaben. So war es an allen großen Festtagen; manchmal drängte eine halbe Million Wallfahrer in die Stadt, die unmöglich allen Herberge bieten konnte. Und so wuchs ringsherum ein zweites Jerusalem aus dem Boden.
Aufgeregtes Lachen, Gesang und Stimmengewirr hallte von anderen Zelten und Lagerfeuern herüber. Die Leute besuchten einander und hielten Ausschau nach Verwandten oder Freunden aus anderen Dörfern. Die Juden aus dem Ausland, die weite Reisen gemacht hatten, um im Tempel zu beten, kamen aus ihren fremdartigen Zelten hervor: aus Kuppelzelten, seidenen Pavillons und solchen mit Fransen über dem Eingang. Einige von ihnen lebten schon seit zehn Generationen nicht mehr im Land ihrer Vorfahren, und dennoch betrachteten sie den Tempel als ihre geistige Heimat.
Maria schloss die Augen und versuchte zu schlafen. Aber das war nicht so leicht, wenn ringsum ein großes Fest im Gange war.
Statt von Jerusalem träumte sie wiederum von dem geheimnisvollen Hain mit den Bäumen und den Statuen darin. Das Weiß der Statuen auf ihren Marmorsockeln war sichtbar im Mondschein ihres Traums, schwebte wie Schaum auf einer Meereswelle. Das Raunen der Bäume, die Pracht des mondbeschienenen Marmors, die Verheißung verlorener Geheimnisse – das alles kreiste durch ihren Schlaf.
Es war noch dunkel, als sie aufstanden und sich anschickten, wieder in die Stadt zurückzukehren, diesmal, um den Festtag zu begehen. Maria war so neugierig auf den Tempel, dass sie beinahe zitterte.
Heute, am eigentlichen Tag des Festes, war das Gedränge noch dichter. Ströme von Menschen verstopften die Straßen und drückten so machtvoll gegen die Mauern der Häuser, dass es fast schien, als könnten sie die Steine beiseite schieben. Und es waren so wunderlich aussehende Pilger darunter: Leute aus Phrygien, die unter ihren schweren Ziegenwollmänteln schwitzten, andere aus Persien in goldbrokatverzierter Seide, Phönizier in Tunika und gestreifter Hose, Babylonier in ihren düsteren schwarzen Gewändern. Zwar drängten alle eifrig dem Tempel zu, aber sie machten weniger einen frommen als vielmehr einen gierigen Eindruck – als gäbe es dort oben etwas, das sie verschlingen wollten.
Zugleich mischten sich die widerstreitenden Geräusche der Stadt miteinander. Die Rufe der Wasserverkäufer – die jetzt sicher sein konnten, gute Geschäfte zu machen –, der Gesang der Pilger, das Geschrei der Straßenhändler, die billigen Schmuck und Kopfbedeckungen feilboten, und vor allem das Blöken der Opfertiere, die in Herden zum Tempel getrieben wurden, das alles verschmolz zu einem beinahe schmerzhaften Getöse. Irgendwo in der Ferne ertönte die Fanfare der silbernen Tempeltrompeten, die den Beginn des Festes verkündeten.
»Bleib bei uns!«, warnte Marias Vater sie. Ihre Mutter ergriff ihre Hand und zog sie dicht an sich. Beinahe ineinander verflochten, schlurften sie durch die Straßen, vorbei an der gewaltigen römischen Festung Antonia, die wie ein Wachhund vor der Tempelanlage lauerte. Römische Soldaten in voller Rüstung standen dort reihenweise auf den Stufen, die Lanzen einsatzbereit, und beobachteten ungerührt, wie sie vorüberzogen.
Ein solches Fest bedeutete Alarmzustand für die Armee; jegliche Unruhe oder der irregeleitete Versuch irgendeines selbst ernannten Messias, einen Aufstand zu entfachen, war im Keim zu ersticken. Die Schlüsselregionen von Judäa, Samaria und Idumäa unterstanden unmittelbar der römischen Herrschaft. Dazu gehörte Jerusalem, die größte Trophäe von allen. Der römische Prokurator, der sonst am Meer in Cäsarea wohnte, begab sich zu den großen Pilgerfesten widerstrebend hierher.
So kam es, dass der Tempel durch eine römische Festung gesichert wurde und Heiden auf das Heiligtum herabblickten.
Vom Strom der Pilger erfasst, bewegte Marias Familie sich immer schneller voran und wurde bald zum eigentlichen Tempel hinaufgeschwemmt. Hoch erhob sich die heiligste Stätte des Judentums in den Himmel und rief die Gläubigen zu sich. Eine mächtige Mauer aus weißem Marmor umgab das Plateau und die Gebäude, blendend weiß im Licht der Morgensonne. Die Brustwehr an der Ecke, wo die Trompeter standen, galt als höchster Punkt Jerusalems.
»Hier entlang!« Eli riss am Zaumzeug des Esels, und sie wandten sich der großen Treppe zu, die sie auf die Höhe des Tempels führen würde.
Und dann in den heiligen Tempelbezirk, an den strahlenden Ort.
Das ebene Tempelgelände war riesig, und es wäre wohl noch riesiger erschienen, hätten sich die Pilger hier nicht dicht an dicht gedrängt. Herodes der Große hatte das Areal auf das Doppelte seiner natürlichen Größe ausgedehnt, indem er eine gewaltige Stützmauer bauen ließ, als könne er damit die Pracht des Ortes – und des eigenen Namens – verdoppeln. Aber die Abmessungen des Tempels selbst, in dem das Allerheiligste zu Hause war, hatte er unverändert so gelassen, wie Salomo sie festgelegt hatte, sodass der Tempel nun klein wirkte auf der großen Plattform des Herodes.
An Schmuck hatte Herodes nicht gespart – das Gebäude war ein Juwel architektonischen Überschwangs. Goldene Strahlen ragten aus dem Dach und spiegelten das Sonnenlicht wider. Das prunkvolle Bauwerk stand erhöht, sodass die Gläubigen eine Treppe hinaufsteigen mussten, um es zu betreten. Den großen äußeren Hof der Heiden durfte jedermann betreten. Dann kam ein Bereich, der nur Juden offen stand, und an der nächsten Barriere mussten auch die jüdischen Frauen zurückbleiben. Nur männliche Israeliten durften weitergehen. Zum Altar und zu den Opferstätten durften schließlich nur noch Priester emporsteigen, und das eigentliche Heiligtum stand nur denjenigen Priestern offen, die in dieser Woche Dienst taten. Zum Allerheiligsten hatte nur der Hohepriester einmal im Jahr Zutritt. Wenn dort Ausbesserungsarbeiten nötig waren, wurden die Handwerker von oben in einem Käfig hinabgelassen, der verhinderte, dass sie dort irgendetwas erblicken konnten. Das Allerheiligste, der Ort, wo der Geist Gottes in Leere und Einsamkeit wohnte, eine geschlossene Kammer im Herzen des Tempels, in die kein Lichtschimmer drang, fensterlos und mit einem dicken Vorhang verhüllt.
Aber Maria sah nur die endlose Weite der Anlage und das Meer von Leuten, das sie umflutete. Sie stand im äußeren Vorhof, im Hof der Heiden, den auch Ungläubige betreten durften. Große Herden von Opfertieren – Rinder, Ziegen, Schafe – blökten und brüllten in einer Ecke, und das Gurren und Zwitschern aus den Käfigen mit den billigeren Opfervögeln verlieh dem Lärm eine liebliche Note. Händler brüllten in den überdachten Säulengängen, die sich um das Tempelgelände zogen, und versuchten gestikulierend Kundschaft anzulocken.
»Geldwechsler! Geldwechsler!«, schrie einer. »Kein ungültiges Geld darf in den Tempel gebracht werden! Wechselt hier! Wechselt hier!«
»Verflucht sei der, der verbotenes Geld hereinbringt! Meine Wechselkurse sind besser!«, behauptete ein anderer.
»Bringt sie doch zum Schweigen!«, knurrte Eli und presste sich die Hände an die Ohren. »Gibt es denn keine Möglichkeit, sie zum Schweigen zu bringen? Sie entweihen den Tempel!«
Auf dem Weg zum Tor sah Maria in regelmäßigen Abständen Schrifttafeln in Griechisch und Latein zu beiden Seiten. Wenn sie doch nur lesen könnte! So musste sie Silvanus am Saum zupfen und ihn fragen, was auf den Tafeln stand.
»›Jeder, der hier gefasst wird, wird getötet werden, und er allein wird für seinen Tod verantwortlich sein‹«, übersetzte er. »Es ist für alle Nichtjuden strengstens verboten, dieses Tor zu durchschreiten.«
Waren wirklich Menschen getötet worden, weil sie es versucht hatten? Der Tod als Strafe für Neugier, das kam ihr doch übertrieben vor.