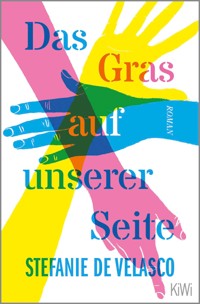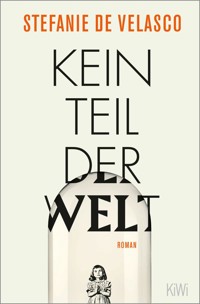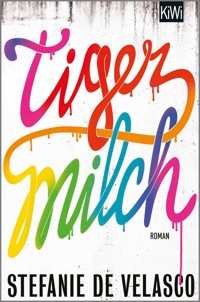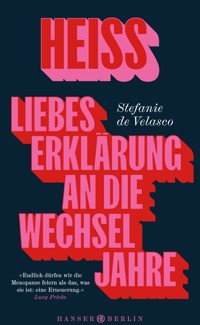
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Stefanie de Velasco verpasst unserem Bild von den Wechseljahren ein dringend fälliges Makeover und bringt die vielleicht beste Zeit des Lebens zum Glänzen.
Die grauen Haare waren ein Schock, dann kam der Schlafentzug und diese unkontrollierte Wut auf alles und jeden, aber Wechseljahre? – das ist doch übertrieben, dachte Stefanie de Velasco und fühlte sich radikal verunsichert.
Die meisten erwischt es kalt, wenn die erste Hitzewallung kommt. Niemand bereitet Frauen auf diese Phase vor. Sie ist gesellschaftlich derart negativ konnotiert, dass man sie lieber totschweigt.
In Heiß erzählt Stefanie de Velasco auf sehr persönliche Weise von einem der größten Tabus unserer Gesellschaft: der Menopause – mit all ihren Schrecken, aber auch ihrer Verheißung. Denn was wäre, wenn diese Zeit nicht das Ende des Frauseins und den Anfang der Unsichtbarkeit markierte, sondern eine lebendige Neuorientierung, den Aufbruch in eine neue, kraftvolle, wirklich unabhängige Identität?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Stefanie de Velasco verpasst unserem Bild von den Wechseljahren ein dringend fälliges Makeover und bringt die vielleicht beste Zeit des Lebens zum Glänzen.Die grauen Haare waren ein Schock, dann kam der Schlafentzug und diese unkontrollierte Wut auf alles und jeden, aber Wechseljahre? — das ist doch übertrieben, dachte Stefanie de Velasco und fühlte sich radikal verunsichert.Die meisten erwischt es kalt, wenn die erste Hitzewallung kommt. Niemand bereitet Frauen auf diese Phase vor. Sie ist gesellschaftlich derart negativ konnotiert, dass man sie lieber totschweigt.In Heiß erzählt Stefanie de Velasco auf sehr persönliche Weise von einem der größten Tabus unserer Gesellschaft: der Menopause — mit all ihren Schrecken, aber auch ihrer Verheißung. Denn was wäre, wenn diese Zeit nicht das Ende des Frauseins und den Anfang der Unsichtbarkeit markierte, sondern eine lebendige Neuorientierung, den Aufbruch in eine neue, kraftvolle, wirklich unabhängige Identität?
Stefanie de Velasco
HEISS
Liebeserklärung an die Wechseljahre
Hanser Berlin
1
Wenn ich genau überlege, beginnt alles mit diesem einen grauen Haar auf meinem Kopf. Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, wie ich vor ein paar Jahren aus der Dusche stieg und mich in ein Handtuch wickelte. Morgenluft drang durch das geöffnete Fenster und ließ mich leicht frösteln. Ich trat in das warme Licht der Lavalampe, wischte über den beschlagenen Spiegel, kämmte mir die Haare, erstarrte. Da. Weiß zeichnete sich das Haar vom dunklen Rest ab, alarmierend deutlich. Ohne zu überlegen, riss ich es mir aus, genauso reflexhaft, wie ich einen störenden Faden von einer Jeans abriss. Zugegeben, es war nicht das erste graue Haar auf meinem Kopf. Da waren noch andere, aber die schmiegten sich unauffällig und vereinzelt an meine Kopfhaut und tarnten sich unter der Haarfarbe, die ich alle paar Monate auftrug.
Ich kannte diese Routinen von meiner Mutter, die ein Leben lang ihre Haare gefärbt hat. Oft hatte ich sie in meiner Kindheit und Jugend unter Alufolie oder Alditüten in der Küche stehen und Tortilla backen sehen. Als ich zwölf war — ich saß auf dem Klodeckel im Bad, während meine Mutter vor dem Spiegel Strähne um Strähne ihres Haars mit Farbe bearbeitete —, fragte sie mich zum ersten Mal: Willst du auch Farbe in die Haare? Ich nickte. Sie holte aus dem Schrank unterm Waschbecken einen kleinen Karton heraus und lächelte mich an. Aubergine hieß die Tönung. Ich liebte den Lilastich in meinen Haaren und die kleinen Plastiktuben mit der Spezialspülung, die die Haare nach dem Färben besonders glänzen ließen. Denn ich verstand, auch wenn ich es damals noch nicht so hätte ausdrücken können: Die Haarfarbe symbolisierte die goldene Zeit des Erwachsenseins, und mit ihrem Angebot gab meine Mutter die Tür dahin frei.
Meine Schulfreundinnen beneideten mich — um die Haarfarbe und um meine entspannte Mutter, die mich offenbar schneller erwachsen werden ließ als ihre liberalen Hippieeltern, die ihnen nicht einmal erlaubten, den Labello Rosé zu benutzen. Das war ein bisschen absurd, denn meine Mutter war weder liberal noch entspannt. Sie konnte sehr autoritär sein und schnell jähzornig werden, nicht aber, wenn sie mir die Haare färbte. Dass ich langsam eine Frau wurde, schweißte uns am Anfang zusammen, unser Badezimmer wurde beim Färben zu einem weiblichen Safe Space, und vielleicht war das Haarefärben auch deswegen ein Leben lang für mich mit einer Art Wellnessfaktor verbunden. Ich hatte seitdem immer getönt, eher aus einer Selfcarelaune heraus, mal Aubergine, mal Mahagoni und später meine schwarze Naturfarbe, auch um die kleinen grauen Haare zu überdecken.
Dieses eine weiße Haar an diesem einen Morgen jedoch war anders. Hastig schloss ich das Fenster und beugte mich über das Waschbecken, betrachtete das Haar wie unterm Mikroskop. Noch heute kann ich es zwischen den Fingern spüren. Es hatte nicht nur eine andere Farbe, sondern auch eine völlig andere Textur als mein restliches Haar: rau und hart wie Draht, seltsam im Zickzack gebogen, wie eine Antenne, die noch nicht richtig weiß, in welche Richtung sie sich aufstellen soll.
Ein ungutes Gefühl überfiel mich. Das Haar war ein Vorbote, der Überbringer einer schlechten Nachricht. Ich fühlte mich unversehens beschädigt, musste an die Puppen und Barbies meiner Kindheit denken, vielleicht, weil sich das weiße Zickzack-Haar genauso künstlich anfühlte wie ihre Plastikhaare. Viele meiner Barbies hatte ich aus einer Stimmung heraus eigenmächtig entstellt. Ich schnitt ihnen die langen Haare ab, malte ihnen mit dem geklauten Edding meines Bruders Schnurrbärte — einer biss ich sogar die Nase ab. Oft erwachte ich aus einer solchen Verunstaltungsorgie wie aus einem Rausch und verstand erst danach, was ich der Puppe angetan hatte. Im antiken Griechenland wurden Verräter, Verbrecher oder Versklavte mit einem Mal versehen, man verletzte diese Menschen bewusst, damit das Stigma für alle sichtbar wurde. Dieses eine weiße Haar stigmatisierte auch mich — als alternde Frau, und zum ersten Mal wurde mir die eigene Vergänglichkeit als konkrete Bedrohung bewusst.
In kürzester Zeit wuchsen mir — wie in dem Sprichwort — für jedes ausgerissene Haar mindestens sieben weiße Haare nach. Ich begann professionell zu färben, da die Tönungen aus dem Drogeriemarkt gegen die Antennenhaare nicht ankamen. Alle sechs Wochen lief ich inzwischen zum Friseur, saß dort Stunden im bauschigen Umhang herum, das Haar akribisch abgeteilt in Alufolienquader verpackt, als würde dort irgendetwas Lebenswichtiges wie Dialyse durchgeführt, aber ich dachte: Das ist es wert. Niemand sollte sehen, dass etwas Monströses in mir schlummerte, ein Virus, das nur noch nicht ausgebrochen ist. Niemand sollte sehen, dass ich befallen war — vom Alter.
Zur gleichen Zeit ungefähr wurde meine Mutter sehr plötzlich krank. Die Krankheit überfiel sie so heftig, dass sie innerhalb weniger Monate nicht mehr ohne Rollator laufen konnte. Sie musste in ein Pflegeheim umziehen, und das war ihr auch ganz recht so. Es lag gleich gegenüber ihrer Wohnung. Schon viele Jahre zuvor hatte sie sich dort auf die Warteliste setzen lassen. Ich hatte das damals irgendwie vage gut gefunden, aber auch übertrieben, niemals wäre ich auf die Idee gekommen, dass sie diesen Platz so früh in Anspruch würde nehmen müssen. Fast schon triumphierend empfing sie mich an ihrem ersten Tag im Seniorenheim und ermahnte mich nach einer knappen Begrüßung, mir in Sachen Vorsorge ein Beispiel an ihr zu nehmen, mich früh genug um einen Heimplatz und am besten auch gleich um die eigene Bestattung zu kümmern, so wie sie es getan habe.
Schon immer hatte meine Mutter die Gabe besessen, Schicksalsschläge so aussehen zu lassen, als sei am Ende sie die Gewinnerin — selbst bei einer Erkrankung, die sie in den kommenden Jahren umbringen würde. Bis dahin war sie kerngesund gewesen, immer sehr auf ihr Äußeres bedacht. Morgens verbrachte sie viel Zeit im Bad, trug dick Make-up auf, roten Lippenstift — das komplette Programm —, und natürlich färbte sie sich noch immer regelmäßig ihre Haare pechschwarz. Nun aber erlebte ich wie im Zeitraffer die Verwandlung meiner Mutter von einer resoluten, herzlichen und zupackenden Person, die aussah wie die Joan Collins meiner Heimatkleinstadt, in eine schwerstkranke Frau. Urplötzlich war sie alt. Natürlich war sie das mit Anfang siebzig auch schon vorher gewesen, doch im Pflegeheim hörte sie mit dem Haarefärben auf. Vielleicht ließ ihre Erkrankung es nicht mehr zu. Meine Mutter war inzwischen motorisch sehr eingeschränkt. Vielleicht war sie auch einfach ermüdet von den jahrelang eingeübten Verjüngungsroutinen, jedenfalls ließ sie es sein. Schneeweiß wuchs ihr der Haaransatz heraus, wie mit dem Lineal gezogen. Das Weiß schien zu fluoreszieren, so stark war die Kontur zur schwarzen Haarfarbe, und mit jedem weiteren weißen Zentimeter schien sich in meinen Augen ihr körperlicher Verfall zu manifestieren. Wieder musste ich an meine Puppen denken, meine Mutter — sie litt wie eine meiner entstellten Barbies. Und auch wenn nicht ich es war, die sie verunstaltet hatte, verhielt sie sich in dieser ersten Zeit verschlossen und beschämt mir gegenüber. Weiterhin bemühte sie sich, vor mir so zu tun, als mache ihr das alles nichts aus, schließlich hatte sie so wunderbar vorgesorgt. Aber sie brauchte doch eine ganze Weile, um zu verstehen, dass sie nie wieder nach Hause zurückkehren würde, dass sie ab jetzt ein Pflegefall war. Es war eine schmerzhafte Zeit. Ich konnte spüren, wie meine Mutter mit ihrem Selbstverständnis rang, auch mir gegenüber. Ich war erwachsen und selbstständig, aber für meine Mutter war ich immer noch ihre Tochter, im Guten wie im Schlechten blieb ich in dieser Rolle gefangen. Doch jetzt war sie abhängig, nicht nur von mir, sondern vom Pflegepersonal, von staatlichen Strukturen. Wir hatten beide Schwierigkeiten, uns in diesen neuen Rollen einzurichten. Meine Mutter wurde still, und ich wusste nicht, wie ich ihr helfen konnte.
Eines Tages waren die gefärbten Haare weg. Meine Mutter hatte sich im Friseursalon die Haare schneiden lassen, sich radikal vom schwarzen Rest befreit. Schneeweiß auf dem Kopf war sie, und ihre Erleichterung übertrug sich auf mich. Fröhlich begrüßte sie meinen Hund Pinsel, von dem sie sonst nie groß Notiz nahm. Hier im Heim verschaffte der Hund ihr jedoch einen besonderen Status, weil seine Anwesenheit den Bewohnenden so guttat und das Pflegepersonal mich gebeten hatte, ihn doch öfter mitzubringen. Gut gelaunt rollte sie neben Pinsel in den Garten des Pflegeheims. Ich konnte mich kaum auf unsere Unterhaltung konzentrieren, ständig starrte ich ihr auf die Haare. Es war faszinierend: Sie sah gut aus, aber wirkte doch schlagartig viel älter, einfach nur, weil sie das Alter so lange camoufliert hatte. Und dies war der ausschlaggebende Impuls, der Anlass, dass auch ich mit dem Färben aufhörte. Ich wollte diesen Altersschock nicht erleben. Ich wollte zwar auch nicht alt aussehen, aber zumindest versuchen, der Endlichkeit in diesem Punkt ein bisschen direkter ins Auge zu sehen als meine Mutter. Ich hatte eh schon viel zu viele weiße Haare. Es waren inzwischen lächerlich viele geworden.
Ich kaufte mir ein Baseballcap und ließ die Farbe rauswachsen. Krass sah es aus, schlimm, fand ich. Da war nicht nur eins, sondern inzwischen Hunderte solcher Antennenhaare auf meinem Kopf. Sie standen in alle Richtungen ab. An anderen Kopfpartien waren meine Haare weich und dünn, sie bildeten kleine Nester und erinnerten mich an die Dekospinnweben, die an Halloween zusammen mit Totenköpfen in den Schaufenstern hingen. Meine Friseurin erklärte mir so empathisch wie möglich, dass die Haare nicht nur ihre Farbe, sondern auch ihre Struktur änderten, was bislang nur durch die künstliche Haarfarbe aufgehalten worden sei, und schnitt mir nach einigen Monaten die restliche Farbe raus. Es war trotz allem ein Schock. Einerseits war ich froh, die künstliche Farbe endlich los zu sein, andererseits war der Anblick so gewöhnungsbedürftig, dass ich sofort wieder mein Basecap aufsetzte. Die Friseurin empfahl mir wöchentlich eine Silberglanzspülung gegen den schnell entstehenden Gelbstich und monatlich eine Keratinbehandlung. Keratin? Das hatte ich schon oft auf Shampooflaschen gelesen und mich immer gewundert, weil ich den Begriff sonst nur aus Hundebüchern kannte, die ich in Massen gelesen hatte, als ich Pinsel adoptierte. Fell, Nägel, Federn, Hörner, Hufe und Geweihe bestehen aus Keratin — die Krallen meines Hundes und die Haut der Pfoten. Was hatte das eine mit dem anderen zu tun, wurde ich jetzt zum Tier? Meine Friseurin versuchte mich zu beruhigen. Ich solle mir etwas Zeit geben, mich an die neue Situation zu gewöhnen, und färben könne ich ja jederzeit wieder. Sie könne mir aus dem Stegreif auch nicht sagen, woher das Wort Keratin komme, aber Keratinspülungen machten die Haare weicher, sie arbeiteten gegen die drahtige Struktur der weißen Haare. Ich nickte stumm und kaufte eine große Flasche.
In der Nacht schlief ich schlecht. Ich fühlte mich aufgekratzt und aufgeschwemmt. Ständig musste ich auf die Toilette, am Abend hatte ich, wie so oft, die schlechte Idee gehabt, mich mit einer Schüssel salzigem Popcorn vor den Fernseher zu setzen und zu bingewatchen. Mein Hals war trocken, die Mundwinkel rissig. Der Mond schien durch das kleine Fenster, und ich traute mich, im Halbdunkel einen verstohlenen Blick in den Spiegel zu werfen. Ich sah einen Werwolf in einem alten Dirty-Dancing-T-Shirt und mit rotgeränderten Augen. Meine kurzen Haare standen drahtig in alle Richtungen ab. »Pfeffer-und-Salz-Look« hatte meine Friseurin es genannt — mich erinnerte mein grau-weiß geschecktes Haupt eher an sich wieder ansiedelnde Wölfe in und um Brandenburg. Schon oft hatte ich sie im Fernsehen gesehen, wenn sie an getarnten Wildtierkameras vorbeiliefen, mit leuchtenden Augen, das Maul leicht geöffnet. Eine Frau im Wolfspelz, der im Mondlicht schimmert — so sah ich aus. Gierig trank ich ein Glas Wasser, meine Lippen und Handrücken waren rau wie Sandpapier. Mir war zum Jaulen zumute. Anders als meine Friseurin wusste ich inzwischen, was Keratin war. Keratin (von griechisch κέρας, kéras, »Horn«) war ein Sammelbegriff für Faserproteine, die von Tieren gebildet werden. Sie sind der Hauptbestandteil von Säugetierhaaren, Finger- und Zehennägeln, Krallen, Klauen, Hufen, Hörnern, Stacheln, Barten, Schnäbeln und Federn der Vögel, Hornschuppen und Panzerbedeckung von Reptilien, und wie ich da vor dem Spiegel im Mondschein meinen Durst stillte, stellte ich mir vor, was wäre, wenn mir wie in einem Horrorfilm all diese Features wachsen würden: Hörner auf der Stirn und Krallen an den Händen, Klauen und ein langer Bart mit Haaren so dick wie die meines Hundes, Federn am Rücken, die zu großen Flügeln wurden. Ich schwöre, es wäre mir in dem Moment kein bisschen seltsam erschienen, und ich sah mich schon als Hund durch das kleine Fenster meines Badezimmers hechten und raus in die Nacht laufen — ein bisschen wie die Protagonistin aus Rachel Yoders Roman Nightbitch, und kurz überlegte ich, mich anzuziehen, einfach rauszugehen, dem Mond entgegen. Aber ich tupfte nur ein bisschen Pflege auf meine Mundwinkel und legte mich wieder hin. Ich schlief lange nicht ein, und auch in den Wochen darauf fand ich mich nachts viel zu oft vorm Badezimmerspiegel wieder und kämpfte mit meinem neuen grauen Ich.
Färben könne ich jederzeit wieder, der Satz meiner Friseurin — oft nahm er mir den Druck, bis ich mich mit der Zeit an mein neues Aussehen gewöhnte. Und mehr: Langsam, ganz langsam begann ich, so etwas wie eine leise Befreiung zu spüren, so als hätte ich etwas viel zu lange hinausgezögert, meinen Körper jahrelang ausgebremst und ihm unnötige Strapazen zugemutet. Eine Mischung aus Kraft und Leichtigkeit erfasste mich. Ich war kein Werwolf und sah, bei Tageslicht betrachtet, auch nicht so aus. Nichts Monströses in mir übernahm. Ich gefiel mir sogar ein bisschen, ich sah erwachsener aus, ernst zu nehmend, geradezu distinguiert — ich überlegte, ob ich mir eine neue Brille zulegen sollte, die das unterstrich.
Auch meine Mutter war begeistert. »Sieht toll aus«, sagte sie bei meinem nächsten Besuch, überhaupt frage sie sich, warum sie so lange gefärbt habe. Sie gefalle sich jetzt viel besser, einfach ihrem Alter angemessener. Und während wir Tortilla und gegrillte Paprika aßen, hielt sie mir einen langen Vortrag darüber, was für ein Glück ich hätte, jetzt und nicht vierzig Jahre zuvor erwachsen zu sein. Heute würde sie alles anders machen, aber das sei damals keine Option gewesen. Der Druck auf Frauen sei immens gewesen, das könne ich mir gar nicht vorstellen, auf das Aussehen, auf das Verhalten, auf alles — in Spanien noch viel stärker als in Deutschland. Im Laufe des Gesprächs wurde mir manches klar, worüber ich noch nie bewusst nachgedacht hatte. Ihr übertrieben gepflegtes Äußeres, für das ich mich als Kind zum Teil schämte, war ihre Strategie, den Alltagsrassismus, dem sie in Deutschland permanent ausgesetzt war, zu kompensieren. Meine Mutter war klein, braun, dunkelhaarig und zierlich — und spätestens wenn sie den Mund aufmachte, wurde sie als Ausländerin »erkannt«, sodass sie alles daransetzte, durch ein Top-Äußeres zu punkten, um nicht die volle Breitseite der Diskriminierung als schlampige, faule Südländerin zu erfahren.
»Selbst Kinder würde ich heute vielleicht gar nicht mehr bekommen«, gestand sie mir, »auch wenn ich dich über alles liebe, aber das weißt du ja — findest du’s schlimm, dass ich das sage?« »Quatsch«, sagte ich, und sie redete weiter, als hätte sie sich vorgenommen, heute alles loszuwerden, wie schwierig es gewesen sei, damals allein mit zwei kleinen Kindern in einem fremden Land, mit einem ständig abwesenden Mann, ohne Führerschein und mit miserablen Sprachkenntnissen. »Weißt du«, sagte sie, »ich habe mit allem aufgehört, was mir wichtig war. Lesen, auf Konzerte gehen, ins Kino. Die permanente Sorge um euch Kinder, das hat mich oft zermürbt und gelähmt«, sagte sie und fragte wieder: »Findest du es wirklich nicht schlimm, dass ich das so sage?«
Ich empfand es als befreiend und sah es eher als Liebesbeweis, dass sie mir gegenüber so offen war. Ich konnte mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal ein so intimes Gespräch geführt hatten. Warum gelang uns das jetzt als Grauköpfe? Die künstliche Farbe hatte bei uns offenbar nicht nur graue Haare abgedeckt.
Ich fragte sie, ob sie noch wisse, wie sie mir das erste Mal die Haare in Aubergine getönt hatte, aber wie so oft entschied meine Mutter, wann sie sich offen zeigte und wann nicht, woran sie sich erinnerte und woran nicht, und so ahnte ich bereits, welche Antwort ich bekommen würde: »Du weißt doch«, sagte sie und schob sich ein Stück Tortilla in den Mund, »ich kann mich an kaum etwas erinnern. Im Alter brauchst du ein schwaches Gedächtnis und ein starkes Herz.«
Auch meinen Freundinnen, ja, selbst der Gassi-Nachbarschaft gefielen meine neuen Haare, aber wenn ich ehrlich war, misstraute ich diesen Komplimenten. Vielleicht waren sie nur getarntes Mitleid. Ich war fünfundvierzig Jahre alt und komplett grau auf dem Kopf, so sah ich mich an den weniger guten Tagen. Wenn ich mit dem Hund Gassi ging, betrachtete ich mich in den reflektierenden Scheiben der Autos am Straßenrand und musste mir eingestehen, dass ich mein Selbstbild noch nicht mit diesem Spiegelbild in Einklang bringen konnte. Ich sah so radikal anders aus, so — ja, wie eigentlich? Nicht mehr süß. Ein Leben lang war ich prall, weich und süß gewesen und hatte auch alles dafür getan, um als prall, weich und süß zu gelten. Ich scrollte mich auf dem Telefon durch meine Fotomediathek. Vor einiger Zeit hatte ich alle meine analogen Fotos digitalisiert und mit Jahreszahlen versehen — unzählige Bilder aus den späten achtziger und neunziger Jahren. Ich konnte Bilder von mir im Schnelldurchlauf durch die Jahre sliden lassen und dabei zusehen, wie ich morphte, vom Kind in eine Teenagerin in eine junge Erwachsene bis heute.
Dabei stieß ich auf ein Bild, das der Algorithmus auf Basis der Gesichtserkennung keiner Jahreszahl zuordnen konnte, sodass es sich im Slide immer wieder wie ein kurzer Hänger anfühlte. Darauf waren vier verschiedene Versionen von mir in verschiedenen Altersstadien zu sehen. Ich hatte es irgendwann mit einer FaceApp aufgenommen, als die trendeten. Damals alarmierte mich dieses Foto, weil ich mich so hässlich fand als alternde Frau. Jetzt fiel mir auf, wie albern dieser hochgerechnete Blick in die Zukunft war. Diese Knitterfalten würde ich vermutlich nie bekommen, dafür war ich in der Realität viel grauer. Ich hatte das Foto damals ganz bewusst für die FaceApp aufgenommen, und so sah ich nicht nur mein Gesicht, sondern vor allem den prüfenden Blick, mit dem ich in die Kamera blickte. Aus ihm sprach die Angst — vor dem Altern, aber auch Hoffnung: Bitte, lass mich jetzt nicht alt aussehen! Es tat mir leid, dieses so viel attraktivere, jüngere Ich, am liebsten hätte ich es in den Arm genommen. Eine banale Erkenntnis: Es ging nicht darum, wie ich aussah, sondern darum, wie ich mich damit fühlte. Ich war vor Jahren vielleicht schöner, aber auch unsicherer, unerfahrener und darum unglücklicher als heute — viel damit beschäftigt, wie andere mich fanden.
Frauen um die fünfzig waren für mich Wesen, die ich auf der Straße oder in der U-Bahn nicht einmal wirklich wahrnahm, außer sie tauchten in Gruppen auf, mit ihren Nordic-Walking-Stöcken und Goretex-Jacken, Hasenbrote mümmelnd. Plötzlich kehrte sich die Situation um, und ich stellte fest, dass ich aus meiner jetzigen Perspektive Mitleid mit den jungen Frauen hatte, wenn sie in der Bahn vor ihren Kameras Augenaufschläge oder Schmollmünder übten, wenn ich sah, wie unwohl sie sich fühlten neben den breitbeinig sitzenden Männern. Gern hätte ich ihnen dann einfach gesagt, dass sich der Aufwand nicht lohnt, dass es alles verschwendete Energie und kein Mensch es wert ist, sich seinetwegen so viel um sein Äußeres zu kümmern. Gleichzeitig stellte ich mir vor, wie stereotyp dahingesagt mir das vorgekommen wäre, wenn mir damals, als junge Frau, eines dieser unsichtbaren, scheintoten alten Weiber diese Weisheit zugeraunt hätte. Mir fielen die Beobachtungen der amerikanischen Schriftstellerin Cynthia Rich ein, die bereits in den achtziger Jahren feststellte, dass wir sehr früh lernen, »stolz auf unseren Abstand — unsere Überlegenheit — gegenüber alten Frauen zu sein«,1 und ich fühlte mich gleichermaßen ertappt und betroffen: Nun war ich selbst eine von ihnen.