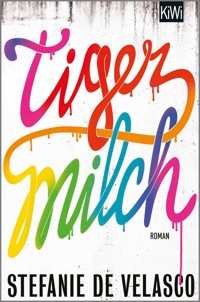13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kjona Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Radikale Hoffnung bedeutet, sich der Gegenwart und der Bedrohung mit all ihren Konsequenzen bewusst zu werden und sich trotzdem eine Vorstellung davon zu machen, wie wir sie überwinden können.« Von Kindesbeinen an wird Stefanie de Velasco darauf vorbereitet, irgendwann Mutter zu werden und »in der Wahrheit« der Zeugen Jehovas zu leben. Mit 14 schafft sie noch als Jugendliche den Absprung. Um sich vollends dem Schreiben zu widmen, treibt sie als Erwachsene ihr ungeborenes Kind ab, dem sie trotzdem einen Namen gibt: Stella. Sie wäre heute ebenfalls 14 Jahre alt. Wie ihre Mutter würde auch sie mit der Erzählung vom Ende der Welt aufwachsen. Nur wäre Stellas Erzählung – der Klimakollaps – wissenschaftlich fundiert. Wie wächst man auf mit der Aussicht, dass die Welt zuende geht? Was wünscht man sich für die Zukunft? In ihrem berührenden Brief plädiert Stefanie de Velasco für ein Trotz-alledem, einen Widerstand in Form produktiven Scheiterns, ein Prinzip der Radikalen Hoffnung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 69
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
STEFANIE DE VELASCO
Liebe Stella oder Radikal hoffnungsvoll in die Zukunft
Briefe an die kommenden Generationen
BAND 4
»Ein neues Lied, ein besseres Lied,O Freunde, will ich Euch dichten!Wir wollen hier auf Erden schonDas Himmelreich errichten.«
Heinrich Heine
Liebe Stella –
ich weiß noch, wie ich dich zum ersten Mal vor mir sah – die Ankündigung, dass du bald kommen würdest, zwei blassrosa Streifen auf einer wattierten Fläche. Seit der Pandemie kennen auch Männer dieses bange Warten aus erster Hand, vor einem Teststreifen hockend, hoffend, dass kein zweiter auftaucht. Auf eine mögliche Schwangerschaft war ich ehrlich gesagt viel zu spät gekommen, weil ich immer penibel verhütet habe, also hatte ich geduldig auf meine Menstruation gewartet, ohne zu wissen, dass sie längst überfällig war.
Eines Tages war mir seltsam schlecht geworden. Ich saß an der Bushaltestelle und fuhr, wie jeden Morgen in dieser Zeit, in die Staatsbibliothek am Potsdamer Platz in Berlin. Ende des Monats musste ich meine Magisterarbeit abgeben. Als um zehn der dm in den Potsdamer Platz Arkaden öffnete, lungerte ich schon eine Weile vorm Eingang rum, ich betrat als Erste den Laden und kaufte einen Schwangerschaftstest.
Ich weiß noch, wie ich einen von diesen Pappbechern mitnahm, die dort am Wasserspender hingen, damit ich etwas zum Reinpinkeln hatte.
Es war Mai 2009 und es sollte wieder einer dieser »heißesten Sommer des Jahrhunderts« werden, verglichen mit heute eine eher moderate Trocken- und Hitzeperiode. Ich schrieb an meiner Magisterarbeit über Klimawandel in urbanen Kulturen. Darin ging ich der Frage nach, ob die Klimakrise unser Verständnis von Natur veränderte, und wenn, in welcher Weise. Ich wollte herausfinden, welchen kulturellen Strategien wir als Gesellschaft folgten, um den Klimawandel zu verarbeiten, und inwiefern sich der Klimawandel von einem Begriff zur Projektion für Erfahrungen und Ängste entwickelte. Seit Monaten beschäftigte ich mich mit den Zahlen des IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), mit steigenden Temperaturen und der Frage, warum all diese apokalyptischen Nachrichten nirgends auf der Welt Alarm auslösten.
Währenddessen hattest du dich in meinem Inneren eingenistet.
Ich hockte auf dem Klo in der Staatsbibliothek und starrte ungläubig auf zwei zartrosa Streifen. Das zu große, karierte Hemd, das ich trug, hatte ich deinem Vater abgezogen, und an der Klotür saß eine Abortfliege, wie ich sie schon oft auf öffentlichen Toiletten gesehen hatte. Ich holte meine Sachen aus dem Lesesaal und stand eine Weile ein bisschen dumm vor der Bibliothek herum, dann nahm ich den M26 nach Neukölln und überlegte auf dem Nachhauseweg, wie es weitergehen würde.
Mir fiel die Entscheidung dann relativ leicht. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, Mutter zu werden, der Gedanke allein fühlte sich surreal an, ich musste immerzu an die schmelzenden Uhren von Dalí denken, die da in meinem Uterus vor sich hin tickten. Die Vorstellung, ein Kind zur Welt zu bringen, war mir unangenehm. Kurz darauf ging ich zum Arzt, die Schwangerschaft wurde bestätigt, und ich sah dich auf dem Bildschirm herumschwimmen: ein betrunkenes Seepferdchen. Bisschen niedlich, bisschen eklig. Als ich sagte, dass ich kein Kind bekommen will, zerriss die Gynäkologin das Ultraschallbild. Sie sprach von einem Schwangerschaftsabbruch, vermutlich, um nicht Abtreibung sagen zu müssen, dabei mochte und mag ich Abtreibung lieber, in meinen Ohren klingt es leicht und schwerelos.
Dein Vater begleitete mich in die Klinik nach Kreuzberg. Ich trug ein T-Shirt von ihm, auf dem der Name einer Urlaubsinsel stand, Cuba oder Greece. Ich erinnere mich, wie ich in nichts außer dicken Socken und dem T-Shirt auf den Gynäkologenstuhl stieg, wie die Anästhesistin zu mir sagte: »Jetzt schicke ich Sie auf Ihre Insel«, und ich zuerst nicht verstand, was sie meinte. Auf Inseln schickten meine Freundinnen und ich Kerle, die sich irgendwann als Arschlöcher entpuppten. »Der kommt auf die Insel«, sagten wir, wenn wir mal wieder an so einen geraten waren. Auch deinen Vater schickte ich kurz nach der Abtreibung auf die Insel.
Aber wo bist du?
Du treibst immer mal wieder durch mein Leben. Manchmal sehe ich dich in Gedanken als Kleinkind durch meine Wohnung flitzen, mal als die Teenagerin, die du inzwischen wärst. Vielleicht hätte ich dir dieses Jahr mit vierzehn deinen ersten Tampon gegeben. Ich hätte dir erklärt, was das für dein Leben bedeuten würde, wie es sich ab jetzt veränderte. Vielleicht hättest du es nicht glauben können oder wollen, dass du ab sofort jeden Monat ein paar Tage bluten solltest und dass diese ambivalente Superkraft ab jetzt dein Leben mitbestimmen würde.
Wenn ich daran denke, werde ich wehmütig, aber es ist eine schöne Wehmut, keine Trauer um etwas, das unwiederbringlich verloren gegangen ist. Anders als in den gängigen Erzählungen um das Thema Abtreibung war da bei mir nie ein Gefühl von Reue. Zu wissen, ich will keine Kinder, war eine friedliche Erkenntnis, und auch heute bin ich froh, diese Entscheidung getroffen zu haben, dich nicht in diese Welt zu setzen.
An ruhigen Nachmittagen schaue ich manchmal aus dem Fenster und spüre diese friedliche Gewissheit, als hätte ich in einer entscheidenden Sache vorgesorgt: Mutterschaft hätte mich überfordert. Ich hätte nicht nur Sorgearbeit leisten, sondern dir auch angesichts einer ungewissen Zukunft beiseitestehen müssen. Schon damals war mir klar, in was für eine Misere wir als Menschheit geraten würden, wenn wir nicht sofort etwas änderten. Vierzehn Jahre später nur sind wir nun genau an dem Punkt angekommen, den Klimaforscher:innen bereits seit Jahrzehnten prophezeien: Millionen Menschen fliehen aus ihren von Krieg, Ausbeutung und Dürre zerstörten Heimatländern, Europa wird zu einer Festung ausgebaut und rechtsextreme Parteien sind auf dem Vormarsch. Die Erzählung vom Wohlstand für alle, von universalen Werten wie Freiheit, Gleichheit und Solidarität, von einem Europa, in dem soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte im Zentrum des Zusammenlebens stehen, gerät immer stärker ins Wanken und muss für deine Generation längst unglaubwürdig, vielleicht sogar zynisch erscheinen.
Wir Erwachsenen haben Angst vor der Zukunft. Und wenn das für uns schon gilt, wie muss es sich dann für euch Kinder anfühlen? Wenn ich dran denke, was du mit deinen vierzehn Lebensjahren schon alles erlebt hättest: Fukushima, Syrienkrieg, brennende Wälder, die vielen Toten im Mittelmeer, Hass im Netz, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, einen Krieg in Nahost mit neuer Eskalationsstufe und nicht zuletzt die Coronapandemie. Vor allem die Pandemie hätte dich und dein Leben extrem geprägt, die Vorstellung, in deinem Alter nicht in die Schule gehen zu können, löst bei mir Beklemmung aus. Als ich so alt war wie du, war ich gerade dabei, für mich einen Ausweg aus der religiösen Gemeinschaft der Zeugen Jehovas zu finden, in der ich aufgewachsen bin. Die Schule war für mich viel mehr als nur ein Ort des Lernens, sie war eine Zuflucht, fünf Tage die Woche gewährte sie mir für eine gewisse Zeit Asyl. Dort konnte ich die Kraft tanken, die ich brauchte, um mich anschließend gegen das Leben zu stellen, das ich im Begriff war, hinter mir zu lassen. Für mich ging diese schwierige Zeit letztlich gut aus, aber deine Generation scheint seit der Pandemie nicht mehr zur Ruhe kommen zu können.
Manchmal habe ich das Gefühl, als wäre die ganze Welt in einem Endlevel von Tetris gefangen. Immer schneller regnen Konflikte, Krisen, Kriege auf uns herab, wir geraten im Großen wie im Kleinen immer stärker in Bedrängnis, haben immer weniger Zeit, Geschehnisse einzuordnen, weil von oben schon die nächsten Probleme runterrasen, so als seien wir dem Level einfach nicht gewachsen. Vielleicht herrscht deswegen auf der Welt ein Überangebot an dystopischen Filmen, Büchern und Politiken, weil einige sich nach dem erlösenden GAME OVER sehnen. »Apokalypsie« nennt Douglas Rushkoff diesen Zustand – die Sehnsucht nach einem Ende angesichts einer alles dominierenden, nicht enden wollenden Gegenwart. Nur leider ist das alles hier kein Spiel und die Erde ist kein Gameboy, egal, wie viel Weltuntergang die Streamingdienste bieten. Wie soll man bitte angesichts all dessen Hoffnung haben, ja sogar radikal hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, fragst du dich sicher spätestens jetzt, oder?