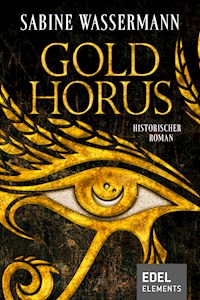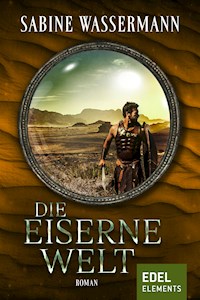Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Pharaonin und Priesterin der Löwengöttin im Kampf um die Macht über das Ägyptische Reich – das aufregende Schicksal einer Frau, die eiskalte Herrscherin und leidenschaftlich Liebende zugleich ist. Ägypten um 2200 vor Christus: Nach dem Tod des Pharaos Pepi erringt dessen Neben-Sohn Merenre mit Hilfe fremdländischer Truppen die Macht. Zu seiner Frau macht er Neith, eine Tochter des Pharao und Priesterin der Löwengöttin Sachmet. Ihre leidenschaftliche Liebe steht unter keinem glücklichen Stern: Neith kann keine Kinder bekommen, und Merenre wird nach nur einem Jahr der Herrschaft von seinen einstigen Verbündeten ermordet. Neith reißt den Thron an sich und regiert gemeinsam mit ihrem Wesir und Geliebten Ankhmahor das gewaltige Nil-Reich. Doch die Fürsten Ägyptens dulden keine Frau auf dem Pharaonenthron. Als Verrat droht, bereitet Neith einen Racheplan vor, wie ihn nur die Priesterin der Löwengöttin ersinnen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 623
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurzbeschreibung
Die Pharaonin und Priesterin der Löwengöttin im Kampf um die Macht über das Ägyptische Reich – das aufregende Schicksal einer Frau, die eiskalte Herrscherin und leidenschaftlich Liebende zugleich ist.
Ägypten um 2200 vor Christus: Nach dem Tod des Pharaos Pepi erringt dessen Neben-Sohn Merenre mit Hilfe fremdländischer Truppen die Macht. Zu seiner Frau macht er Neith, eine Tochter des Pharao und Priesterin der Löwengöttin Sachmet. Ihre leidenschaftliche Liebe steht unter keinem glücklichen Stern: Neith kann keine Kinder bekommen, und Merenre wird nach nur einem Jahr der Herrschaft von seinen einstigen Verbündeten ermordet. Neith reißt den Thron an sich und regiert gemeinsam mit ihrem Wesir und Geliebten Ankhmahor das gewaltige Nil-Reich. Doch die Fürsten Ägyptens dulden keine Frau auf dem Pharaonenthron. Als Verrat droht, bereitet Neith einen Racheplan vor, wie ihn nur die Priesterin der Löwengöttin ersinnen kann.
Sabine Wassermann
Herrin zweier Länder
Historischer Roman
Edel Elements
Edel ElementsEin Verlag der Edel Germany GmbH
© 2018 Edel Germany GmbHNeumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2003 Jahreszahl by Sabine Wassermann
Covergestaltung: Designomicon, Anke Koopmann, München.
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-169-0
www.facebook.com/EdelElements/
www.edelelements.de/
Inhalt
I. DIE PRIESTERIN
Kapitel 1.
Kapitel 2.
Kapitel 3.
Kapitel 4.
Kapitel 5.
II. DIE KÖNIGIN
Kapitel 1.
Kapitel 2.
Kapitel 3.
Kapitel 4.
Kapitel 5.
Kapitel 6.
III. DIE PHARAONIN
Kapitel 1.
Kapitel 2.
Kapitel 3.
Kapitel 4.
Kapitel 5.
Kapitel 6.
Kapitel 7.
IV. DIE HOHEPRIESTERIN
Kapitel 1.
Kapitel 2.
Kapitel 3.
Kapitel 4.
Glossar
I.DIE PRIESTERIN
1.
Als die Pyramide vor vielen Jahren fertiggestellt worden war, hatte niemand daran gedacht, dass der Wasserstand des Nils einmal so niedrig sein könnte. Zwischen den beiden Rampen des Taltempels und dem Wasser war ein breiter Streifen nackten, feuchten Bodens, den die Tempeldiener mit Bastmatten belegt hatten, damit sich die Begleiter des verstorbenen Pharaos nicht die Füße beschmutzten. Zehn Männer trugen die Kultbarke mit dem hölzernen Sarkophag hinauf in den Tempel. Dahinter folgten die Priester und die königliche Familie. In ihrer Mitte schritt der zukünftige Herrscher, ein zehnjähriger Junge mit erhaben gerecktem Kinn und verkrampften Schultern. Neith, seine um neun Jahre ältere Schwester, schickte ihm ein aufmunterndes Lächeln, das er hilflos erwiderte. Er hat Angst, dachte sie, aber das sollte er nicht. Wie gerne wäre ich an seiner Stelle.
Die Rampe war schmal, und so musste sie sich ein Stück zurückfallen lassen, um den ranghöheren Mitgliedern der Königsfamilie Platz zu machen. Ihr kleiner Bruder betrat die Halle des Tempels, aus dem der Weihrauch stieg und sich mit dem Morgennebel mischte. In der Ferne, verborgen vom Dunst, erhob sich die Pyramide Neferkare ist standhaft im Leben. Mit ihrer Höhe von hundert Königsellen hatte sie nichts gemein mit den drei Pyramiden weiter nördlich, diesen herrlichen weißen Sternen, die zu einer längst vergangenen, einer für Ägypten weitaus glücklicheren Zeit gehörten.
Ob ihr kleiner Bruder fähig sein würde, den beiden Ländern wieder jene Gunst zu verschaffen, welche die Götter ihnen seit vielen Jahren verweigerten? Neith glaubte es nicht. Neferkare-Tereru wurde nicht aufgrund seiner Befähigung Pharao. Sondern weil es niemand anderen gab.
Ein leiser Ruf erklang. Unten am schlammigen Ufer hatte zwischen den Schiffen ein winziges Papyrusboot festgemacht. Ein Mann sprang heraus und zog es ein Stück herauf. Neith blieb auf dem untersten Stein der Rampe stehen, während die königliche Familie bereits über die Terrasse schritt und in den Totentempel drängte. Niemand hatte bemerkt, dass sie zurückblieb. Der Mann hastete mit schlammverschmierten Füßen über die Bastmatten und blieb vor ihr stehen.
»Warum bist du hier?« Atemlos wischte er sich den Schweiß von der Stirn.
»Weil mein Vater, der göttliche Neferkare-Pepi, zu Grabe getragen wird«, antwortete sie ungeduldig. »Sollte ich, seine Tochter, nicht dabei sein?«
Er war nicht weniger ungeduldig. »Du bist die Tochter irgendeiner seiner Nebenfrauen; du hast ihn in deinem Leben drei oder viermal zu Gesicht bekommen. Niemand wird dich vermissen, wenn du jetzt mit mir gehst.« Er deutete auf den Nachen. »Wir könnten nach Iunu fahren. In den Häusern der Sonnenpriester wird man uns aufnehmen.«
Zweifelnd betrachtete Neith das schmale Gefährt. Iunu, die heilige Stadt des Sonnengottes Re, war nicht weit, aber in diesen armseligen Nachen würde sie keinen Fuß setzen. Überhaupt begriff sie nicht ganz, wovon Ipui sprach. O ja, von der Bedrohung durch die Aamu, ein Volk von Nomaden jenseits des Türkislandes, das brandschatzend durch die Lande zog, das wusste sie durchaus. Aber war es nötig, augenblicklich in dieses Boot zu steigen?
»Ach, Ipui.« Sie legte eine Hand auf seine schweißglänzende Brust. »Mein Vater war der Lebende Horus auf Erden, und er wird jetzt zum Sternbild des Osiris geschickt, um ihm gleich zu sein. Ich kann doch nicht einfach weglaufen.«
Ipui hielt ihre Hand fest. »Aber das ist dumm!«, beharrte er. Sie runzelte die Stirn und wollte ihm die Hand entziehen, aber er hielt sie entschlossen fest. »Wenn fünftausend aamuritische Krieger auf die Stadt zumarschieren, ist es einfach nur dumm, hierzubleiben. Wundere dich nicht, wenn fremde Eindringlinge den Palast besetzt haben, wenn du und die königliche Familie zurückkehren.«
Er sprach in letzter Zeit ständig von der Bedrohung durch die Aamu. Angeblich redeten die Leute in den Straßen der Stadt von nichts anderem. Ipui hatte damit sogar den Wesir belästigen wollen. Aber er war nun einmal nur ein Tempeldiener, der zu einem solch hohen Mann nicht vordringen konnte, und so war Neith die einzige aus dem Hofstaat, der er seine Warnung vor den Aamu ins Ohr träufeln konnte. Aber allmählich hatte sie genug davon.
»Das ist doch nur eine Bande von Sandbewohnern«, sagte sie ärgerlich. »Sie sind bestimmt keine Krieger, und sie werden niemals die Stadt bedrohen können.«
»Wirklich nicht? Immerhin haben sie vor zehn Tagen die größte unserer Grenzfestungen mitsamt ihren fünfhundert Soldaten einfach überrannt. Überrannt! Fast alle ägyptischen Soldaten sind getötet worden, so sagt man.« Plötzlich packte er Neith so fest an den Schultern, dass sie erschrocken den Atem anhielt. »Sie sind schon fast hier! Begreifst du das nicht?«
Sein Griff schmerzte, und das machte sie wütend. Sie versuchte ihn zu ohrfeigen, aber ihre Fingerspitzen streiften nur sein Kinn. Er machte einen Schritt zurück und ließ die Arme hängen. Seine Sorge um sie hatte etwas Rührendes. Ipui war ein aufrichtiger Mensch, der es nicht verdient hatte, von so hoffnungsloser Liebe erfüllt zu sein.
»Wer könnte Ta-Meri, unserem geliebten Land, gefährlich werden?« Sie machte einen Schritt die Rampe hinauf. Die königliche Familie befand sich sicher schon im überdachten Aufweg, der den Taltempel mit dem Totentempel am Fuß der Pyramide verband. »Es hat sicherlich Neider. Aber keine Feinde. Es hat noch nie Feinde gehabt. Warum vertraust du nicht der Macht des Pharaos?«
»Weil es derzeit keinen gibt! Bitte, Neith, so höre mir doch zu. Die Aamu haben in ihren Reihen einen Mann, der behauptet, Anspruch auf die Doppelkrone zu haben …«
»Ein Aamu?«, rief sie verächtlich.
»Er soll ein Ägypter sein.« Seine Stimme wurde so eindringlich, dass sie schwieg und abwartend in seine dunklen Augen blickte. »Er behauptet, ein Sohn des Pharaos zu sein. Ich weiß«, er hob rasch die Hand, obwohl sie nichts hatte einwenden wollen, »er dürfte nur ein Lügner sein, der versucht, die Gunst der Stunde zu nutzen. Aber er ist auf dem Weg hierher — hierher, verstehst du?«
Ja, allmählich verstand sie. Ein wenig hilflos blickte sie zum Taltempel hinauf. Die Pyramide war von hier aus nicht zu sehen, aber sie war trotz ihrer geringen Größe mächtig und Ehrfurcht gebietend. Dort in ihrem Totentempel würde das Ritual durchgeführt werden, das dem Ka des verstorbenen Herrschers den Weg zu den Sternen ermöglichte, um auf ewig auf die Welt herabzublicken. Niemand anderer als der Thronfolger sollte dieses Ritual, die Mundöffnung, durchführen.
»Du meinst«, sagte sie langsam, »dass dieser Fremde zur Pyramide kommen wird, weil er den Mund von Osiris Neferkare eigenhändig öffnen will?«
Ipui stieß hart den Atem aus. »Ja. Ich weiß nicht, ob er wirklich ein Ägypter ist oder doch nur ein Aamu. Aber eines ist gewiss: dass er ein Barbar ist, der nicht sanft mit der Trauergesellschaft umspringen wird. Und auch nicht mit dir.«
»Ich bin eine Tochter von Osiris Neferkare-Pepi!«
»Vor allem bist du eine Frau! Neith, du bringst dich nur unnötig in Gefahr, wenn du jetzt bleibst. Was, glaubst du, werden diese aamuritischen Sandbewohner mit dir tun?«
Sie wollte sich nicht von seiner Besorgnis anstecken lassen, doch unwillkürlich verspürte sie Furcht. Nein, dachte sie, das darf ich nicht.
»Wenn es wirklich so ist«, sagte sie zögernd, »dann darfst du nicht nur mich warnen. Ich bin nicht allein hier.« Sowie sie es ausgesprochen hatte, wusste sie, dass es sinnlos wäre. Niemals würden die Priester und die königliche Familie den Totentempel verlassen, nur weil irgendein Diener aus dem Tempel des Gottes Ptah auf seinem schmutzigen Nachen dahergerudert kam. Sie würden ihm erst gar nicht zu sprechen gestatten. Und auch ihr würden sie nicht glauben.
Ipui schüttelte den Kopf und nahm ihre Hand. Noch sträubte sie sich, aber da deutete er flussabwärts. »Ihre Schiffe, die sie auf ihrem Plünderzug gestohlen haben, könnten schon hinter der nächsten Flussbiegung sein oder im Morgendunst verborgen.«
Neiths Blick folgte seinem Fingerzeig. Die aufgehende Sonne hatte den Nebel, der über dem Fluss hing, noch nicht vertrieben. Nichts war zu sehen. Ihre Gedanken huschten zu Neferkare-Tereru. Der Aufweg war lang, aber die Familie dürfte den Totentempel am Fuß der Pyramide jetzt erreichen. Hier im Taltempel brannte noch immer der Weihrauch; der Duft hing in der Luft und vermischte sich mit dem erdigen Geruch des Flusses. Am anderen Ufer standen nur drei, vier neugierige Bauern und schauten herüber. Früher, überlegte Neith, hatte das Volk die beiden Ufer gesäumt, um Zeuge der Nachtfahrt des Osiris zu werden. Heute hockten die Menschen in ihren Hütten und beklagten ihre Armut.
»Damals, noch zu Beginn der Herrschaft meines Vaters, hätte so etwas nicht geschehen können«, sagte sie mit aufwallender Verzweiflung. »Damals besaß Ägypten eine starke Armee, und die Sandbewohner waren nichts als hungrige Nomaden, die sich nur auf Sichtweite an die Grenzfestungen heranwagten.«
»Ich weiß. Aber du musst dich jetzt entscheiden.«
Neith fühlte unbändigen Zorn, so heftig, dass Tränen in ihre Augen traten. Sie wischte sie mit einer ärgerlichen Geste fort. Ihr war der Gedanke unerträglich, vor diesen Aamu einfach fortzulaufen. Aber die Vernunft riet ihr, Ipui zu folgen. Zögernd verließ sie die Rampe, und Ipui hob eine Hand, um ihr über die verschmutzten Matten zu helfen, als Schritte auf der Terrasse erklangen. Neith wandte sich um und erblickte einen der Priester, der die Rampe herunterhastete, die Arme kreuzte und eine rasche Verbeugung andeutete.
»Herrin Neith! Ich glaubte schon, du seist fort. Verzeih mir, Herrin, Priesterin der Sachmet, du musst kommen, sonst kann das Ritual nicht durchgeführt werden!«
Ipuis Griff um ihren Arm wurde drängender. »Was hat Neith mit dem Mundöffnungsritual zu tun?«
Der Priester antwortete, ohne ihm einen Blick zu widmen. »Die Göttin Hathor muss zugegen sein, um den Verstorbenen mit Speise und Milch zu versorgen. Teti – jene Frau, die die Göttin darstellt – kann es nicht mehr tun. Es ist etwas Schlimmes geschehen.«
Neith riss sich los, stieß den Priester beiseite und eilte hinauf. Auf der Terrasse drehte sie sich noch einmal um: »Du musst ohne mich nach Iunu fliehen, Ipui.«
Er schüttelte den Kopf, sodass seine schwarzen Haare flogen. »Niemals. Dann bleibe ich hier und kämpfe. Ich habe im Boot eine Streitaxt.«
Sie stieß einen ärgerlichen Laut aus. Ipui war nur ein Tempeldiener, kein Kämpfer. Er war klug, aber seine Zuneigung zu ihr war manchmal als stärker als seine Vernunft. Sie warf einen letzten Blick den Fluss hinunter. Wie lange würden die Eroberer brauchen, um hier anzulegen? Vielleicht würde die Zeit genügen, die erforderlichen Rituale durchzuführen, die der tote Pharao benötigte, damit sein Ka zu den Sternen gelang. Doch was war mit Teti geschehen?
Neith rannte durch den dunklen Taltempel, und dann lag der Aufweg vor ihr. Die Reliefs an den Wänden wurden vom Licht der aufgehenden Sonne erhellt, das durch die regelmäßigen Durchbrüche in der Decke fiel. Neith sah ihren Vater, wie er Gefangene tötete, die Feinde Ägyptens, doch es war keine Zeit zum Schauen. Mit gerafftem Kleid hastete sie durch den Korridor, das Tappen der priesterlichen Sandalen stets im Ohr. Endlich lag der Totentempel vor ihr; Licht schimmerte durch den Eingang, und leise Stimmen waren zu hören. Doch sowie sie den Vorraum betreten hatte, hielt sie der Priester zurück.
»Dorthin«, sagte er leise und schob sie in eine kleine Seitenkammer, wo Teti auf dem Boden hockte, das Gesicht in den Knien vergraben. Zwei Muu-Tänzer standen neugierig über sie gebeugt. Der Priester rüttelte an ihrer Schulter, und Teti blickte auf. Tränen hatten ihre Augenschminke verwischt.
Neith trat zu ihr. »Was, um Res willen, ist mit dir?«
Teti schniefte so laut auf, dass Neith befürchtete, es müsse in der Säulenhalle zu hören sein. »Sieh doch«, jammerte Teti und hob ihr Kleid. Ein großer dunkler Fleck prangte auf dem weißen Stoff. »Ich habe meine Mondblutung bekommen. Zwei Tage zu früh! Jetzt wird der Ka des großen Horus im Wüstenwind zerschlagen, und ich ende in Schande.«
Unwillkürlich erschauderte Neith, und sie legte die Hände auf die Arme. Vielleicht, dachte sie, enden wir wegen der Aamu alle in Schande. »Es gibt weitaus Schlimmeres«, murmelte sie.
»Was sollte das wohl sein?«
»Zum Beispiel der Feind vor den Toren der Stadt.«
»Jetzt fängst du auch davon an.« Teti schnaufte verächtlich. »Getuschel von Bauern, weiter nichts. Ipui hat dich sicher mit diesem Unsinn angesteckt. Sag mir, was soll ich jetzt tun? Ich habe nichts bei mir, um mich zu reinigen, und Zeit haben wir auch nicht!«
Neith blickte den Priester fragend an, der sich nach einem riesigen Kopfschmuck bückte, den Teti offenbar achtlos auf den Boden gelegt hatte.
»Du musst die Göttin Hathor darstellen, die den Pharao mit Milch besprengt und in den Westen geleitet.« Er hielt ihr die wuchtige Perücke hin, auf der das Kuhgehörn und die Sonnenscheibe der Göttin befestigt waren. Im fahlen Morgenlicht glänzte die vergoldete Scheibe wie ein gefangener Sonnenstrahl. Neith wollte abwehren, aber sie begriff, dass es keine andere Möglichkeit gab. Sie blickte an sich hinunter und zupfte an ihrem Trägerkleid. Es schien sauber zu sein, nur an ihren Sandalen klebte ein wenig Nilschlamm. Neith streifte sie ab, während der Priester ihr die Perücke auf den kurzen Haarschopf setzte und mit Klammern befestigte. Vorsichtig bewegte Neith den Kopf, aber das schwere Gebilde über ihr geriet nicht ins Rutschen.
»Weißt du denn, was du tun musst?«, fragte Teti mit weinerlicher Stimme. Ihre Enttäuschung war deutlich herauszuhören. Die Göttin darzustellen, noch dazu in einem so wichtigen Ritual, war eine Ehre, die ihr vermutlich nie mehr widerfahren würde. Neith erinnerte sich an das Wenige, das Teti ihr erzählt hatte. Sie musste die Mumie mit Milch aus einem Krug besprengen, und was noch?
»Schlimme Zeiten wie diese erfordern die Kraft der Götter«, sagte der Priester. »Es ist der Wille Hathors, in Gestalt einer Frau zugegen zu sein; das haben die Re-Priester in Iunu im Stand der Sterne gelesen. Pharao war ein alter Mann, so alt, wie sonst kein Mensch wird, und er wollte nicht sterben. Und er hat für seine Pyramide einen schlechten Namen gewählt, denn sie bindet seinen Ka an die Erde. Hathor wird ihn mit deinen Händen lösen.« Er tippte an seine Schläfe. »Dein Kohelstrich ist nicht ganz sauber. Aber daran lässt sich jetzt nichts mehr ändern. Komm.«
Er führte sie durch den Vorraum zum Säulenhof, wo sich die Familie und die Würdenträger an den Pfeilern drängten. Hier war es bereits heller; der Morgendunst lichtete sich, und die ersten Sonnenstrahlen brachen herein. Neben dem Eingang zur Kapelle stand der Sarkophag in seiner Barke, daneben die Schlitten mit den Kanopen und dem Tekenu-Priester, der unter seinem Stierfell kauerte. Und in der Mitte des Hofes stand die Bahre mit der Mumie. Ein Priester ordnete die Mundöffnungswerkzeuge am Kopfende der Bahre. Ein zweiter hielt ein Weihrauchpfännchen in den erhobenen Händen. Ein dritter rief nach den Muu, und die Tänzer huschten an Neith vorbei und begannen ihren Tanz. Ihre Kronen aus Papyrusstängeln knisterten in der Stille der Halle. Neith achtete weder auf den Tanz noch auf die anschließende Reinigung und Räucherung. Tausend Gedanken jagten durch ihr Herz: die sich nähernden Aamu; Ipui, der draußen auf sie wartete und nutzlos sein Leben wagte; ihre Furcht, als Hathor zu versagen. Als einer der Priester sie herbeiwinkte und ihr eine Tonkanne in die Hände drückte, atmete sie tief durch und schritt in die Halle.
Von den Zuschauern schien allein Neferkare-Tereru zu bemerken, wer sie war. Er lächelte verstohlen, beinahe frech, als ahnte er, wie unwohl sie sich fühlte. Die Königswitwe Ipwet umkrampfte die Hand ihres Sohnes, mit der anderen tupfte sie sich den Schweiß von den Lippen. Sie war nicht mehr jung, auch nicht mehr schlank, und das lange Stehen machte ihr zu schaffen. Neben ihr stand der feiste Wesir Biu und starrte gelangweilt zu Boden.
»Hathor, Herrin des Westens, nähre den Ka des Königs …«, sprach der Priester. Der Schmuck um seine Handgelenke klirrte, während er die Weihrauchpfanne hob. Als er, für Neith völlig unvermittelt, schwieg und auf die Mumie deutete, erschrak sie so sehr, dass das Gehörn auf ihrem Kopf wackelte. Langsam ging sie zur Bahre und hob die Milchkanne. Eine bunte hölzerne Maske lag auf dem Kopf der Mumie. Ihr Glied war gesondert gewickelt, sodass es steil nach oben zeigte. Neith entschied sich, einen Tropfen der Milch auf den Mund der Mumie zu gießen. Der Priester nickte unmerklich, griff nach einem der Instrumente, der vergoldeten Deichsel, und wandte sich zu Neferkare-Tereru um. Der Prinz trat vor. Mit zittriger Hand nahm er die Deichsel entgegen. Noch andere Dinge lagen hinter dem Kopf der Mumie: die Netjeri-Klinge, das Fischbeinmesser und der Unterschenkel eines Ochsen.
Neferkare-Tereru starrte auf die Deichsel in seiner Hand. Er musste jetzt die Ritualworte sprechen; seine Lippen bewegten sich vorsichtig, als müsse er sich mühsam auf die Worte besinnen. Da erklangen schwere Schritte und das Klirren von Waffen vom Aufweg her. Alle starrten zum Eingang, und plötzlich quollen zehn oder zwölf wild aussehende Männer in den Hof. Aufschreiend drängten sich die Tänzer und die königliche Familie hinter die Pfeiler, nur die Priester rührten sich nicht. Neith ließ den Krug fallen. Neferkare-Tereru stand wie erstarrt neben der Bahre.
»Aamu!«, schrie entsetzt ein Priester. Einer der Eindringlinge hob seine Lanze und schlug ihm den Schaft gegen die Stirn, sodass er die Hände auf das Gesicht presste und rückwärts stolperte. Die anderen Aamu verteilten sich mit erhobenen Lanzen; einer von ihnen stieß Teti in den Hof. Dabei warfen sie sich in ihrer Sprache Worte zu, die so seltsam barbarisch waren wie ihr Aussehen. Sie hatten die Haare zu mehreren ölglänzenden Zöpfen geflochten. Ihre Körper steckten in knielangen Lederhemden, und die bloßen Füße waren bis zu den Knöcheln hinauf verdreckt.
Ipui hatte recht, dachte Neith. Ob er noch am Leben war?
Aber sie war die Göttin Hathor, und sie war hier, um ihren Vater zu schützen. Sie raffte ihr Kleid und warf sich auf die Mumie; den Kopf hielt sie in den Nacken gepresst, damit das Kuhgehörn nicht hinunterfiel. Die trockenen, vom Harz gehärteten Binden des Gliedes drückten unangenehm gegen ihren Bauch. Schweiß rann ihr den Rücken hinunter. Noch hatten diese Männer ihr keine Beachtung geschenkt. Zuletzt trat ein Mann ein, den sie für den von Ipui erwähnten Ägypter hielt. Er unterschied sich in nichts von seinen Leuten, besaß aber eindeutig ägyptische Züge.
Neith starrte ihn an. Er war schön. Sein Gesicht wirkte makellos, jung, obwohl in seinen Augen Härte lag. Es wollte nicht recht zu seinem wuchtigen Körper passen. Er besaß schmale Hüften und muskulöse Schultern, und seine Arme sahen aus, als könnten sie mühelos das Genick eines Menschen brechen. Wie alt mochte er sein? Fünfundzwanzig Jahre vielleicht.
Er blickte sich rasch um und trat zu der Bahre. Zuerst betrachtete er die Totenmaske, dann wanderte sein Blick zu Neith. Es war ihm unschwer anzusehen, dass ihn das, was er da sah, verwirrte. Unwillkürlich richtete sie den Oberkörper auf; ihre Brust hob und senkte sich heftig.
Einer der Aamu sagte etwas und deutete auf den Prinzen. Die Hand des Fremden schoss vor und umklammerte Neferkare-Tererus Jugendlocke.
»Ich bin Merenre, der zukünftige Herrscher Ägyptens«, erklärte er mit dunkler, heiserer Stimme. »Und wer bist du?«
Neferkare-Tereru blickte furchterfüllt zu ihm hoch. Tränen glitzerten in seinen Augenwinkeln. »Pharao Neferkare-Tereru.«
»Wie?« Der Fremde hob die Hand, sodass der Prinz nur noch auf den Zehen stehen konnte. Neferkare-Tereru begann zu weinen, und Neith sah, wie sein Stolz mit seiner Angst kämpfte. »Ich bin Pharao Neferkare-Tereru!«, stieß er aufschluchzend hervor.
Der Mann, der sich Merenre nannte, entwand ihm mit der freien Hand die Deichsel und stieß ihn zurück. Neferkare-Tereru machte einen Satz nach hinten und rieb sich den Haaransatz seines Jugendzopfes. Merenre wandte sich mit der Deichsel der Totenmaske zu, aber er schien nicht zu wissen, was er damit tun sollte. Schließlich nahm er die Maske herunter und legte sie auf die Brust des Toten. Einer der Priester machte einen entschlossenen Schritt vorwärts.
»Wer bist du?«, fragte er; seine Lippen bebten vor Furcht. »Wie kommst du dazu, das Ritual zu stören?«
Merenre drehte das Werkzeug zwischen den Fingern. »Weißt du es wirklich nicht? Ich bin ein Sohn von Osiris Neferkare-Pepi.«
»Selbst wenn … wenn das wahr ist, so bist du doch nicht der Thronfolger.«
Die Menschen hielten den Atem an, sogar die Aamu. Kein Laut war zu hören, nur das verhaltene Schluchzen Neferkare-Tererus. Der Priester deutete auf ihn. »Er ist der zukünftige Pharao.«
»Ja«, erwiderte Merenre sichtlich ungeduldig, »das hat er mir eben gesagt. Besaß Neferkare-Pepi keine erwachsenen Söhne, sodass er sein Reich einem Kind anvertrauen muss?«
Was war daran so befremdlich?, fragte sich Neith. Der Priester dachte wohl ähnlich, denn er erinnerte den Fremden mit zitternder Stimme daran, dass Osiris Neferkare bereits mit sechs Jahren die Doppelkrone getragen und bekanntermaßen sechsundneunzig Jahre geherrscht hatte.
Merenre warf den Kopf zurück, und seine schwarzen, nach Art der Aamu geflochtenen Zöpfe flogen. Seine dick mit Kohel umrahmten Augen funkelten gefährlich. Neith musste sich eingestehen, dass sie ihn auf eine seltsame Art anziehend fand.
»Ja, fast ein Jahrhundert!«, dröhnte er zur Antwort. »Er hatte Zeit genug, Ägypten zu Boden zu ringen, es von einer geschlossenen Allmacht, die in aller Welt gefürchtet und geachtet war, zu einem zerrissenen Land zu machen, in dem jeder winzige Gaufürst die Macht eines Herrschers anstrebt. Ägyptens Feinden läuft der Geifer aus dem Maul; sie zögern nur deshalb, es zu verschlingen, weil sie misstrauisch auf ihre Nachbarn schielen, die ihnen die fettesten Brocken wegschnappen könnten.«
»Aber die Aamu …«
»Die Aamu sind Ägyptens Freunde. Sie sind gekommen, um diesem elenden Zustand ein Ende zu bereiten. Ich bin gekommen.« Merenre legte die Deichsel beiseite und betrachtete die anderen Werkzeuge. Aber er schien tatsächlich nicht zu wissen, wie sie zu gebrauchen waren. Endlich griff er sich das Fischbeinmesser und setzte die Spitze auf die Binden, dort wo sich der Mund der Mumie befand. Und plötzlich, mit einer jähen Bewegung, stieß er zu. Die Kieferknochen knackten, und der Griff des Messers ragte in die Höhe wie eine überlange Zunge.
»Hier hast du dein zweites Leben, Vater.« Er trat einen Schritt zurück. »Dein Sohn, Pharao Merenre, der zurückgekehrt ist, hat es dir gegeben. Du weißt, nur ich bin fähig, Ägypten aus der Gosse zu holen. Und nicht irgendein Bengel oder sonst einer deiner Söhne, falls es noch welche geben sollte. Ich habe lange Jahre im Fremdland zugebracht, aber stets ein sorgenvolles Auge auf Ägypten geworfen. Merenre hat es nicht vergessen. Pharao Merenre.«
Er wandte sich dem Priester zu, dem wie allen anderen der Mund offenstand. »Nun, worauf wartet ihr? Bringt die Opfergaben und die Grabgegenstände, und geleitet den Sarg in sein steinernes Grab. Und du«, er wandte sich an Neith. »Mach, dass du da herunterkommst.«
Neith machte sich unwillkürlich steif, da sie befürchtete, er werde sie hinunterstoßen. Neferkare-Tereru wischte sich die Augen trocken und sah erst zu ihr, dann zu Merenre. Ihr entging nicht der trotzige Ärger in seinem Blick.
»Hörst du nicht? Du sollst herunterkommen!«
Neith bemerkte, wie Neferkare-Tereru die Hände sinken ließ und einen langsamen Schritt nach vorne machte. Ein Schreck durchfuhr sie, als sie sah, dass er den Blick auf das Messer geheftet hielt. Tu das nicht, dachte sie. Tu das nicht! Warnend versuchte sie den Kopf zu schütteln, und das Kuhgehörn auf ihrem Kopf folgte schwerfällig der Bewegung. Da sprang der Junge vor und packte mit beiden Händen den Griff des Messers. Er schob es hin und her, und mit einem wilden Aufschrei gelang es ihm, es zu lösen.
Merenre wirbelte zu ihm herum, aber er schien nicht beeindruckt. Seine mächtige Hand schoss vor und packte den Jungen an der Kehle, die andere entwand ihm das Messer. Er presste ihn an sich und drückte das Messer an seinen Hals. Neferkare-Tereru brüllte vor Entsetzen. Merenre bewegte die Klinge schnell. Dass er Neferkare-Tereru tötete, begriff Neith erst, als der Junge am Boden lag. Aus der Kehle schoss ein Blutstrahl; Neferkare-Tererus Füße zuckten wild, dann lag er still. Ipwets Augen drehten sich nach innen, und sie sank in sich zusammen.
Der Mörder streckte die Hand aus, jemand aus seinem Gefolge reichte ihm ein Tuch. Er säuberte das Messer und schob es zurück in den Mund der Mumie. Dann schickte er einen drohenden Blick in die Runde. Alle waren schreckensbleich geworden, nur nicht die wilden Aamu-Krieger. »Du«, sagte er wieder und deutete auf Neith, »warum sitzt du immer noch da oben?«
»Weil ich Hathor bin!«, rief Neith mit aufflackernder Verzweiflung. Sie gab dem Drang nicht nach, rasch von der Mumie herunterzugleiten und sich in Sicherheit zu bringen.
»Dummes Geschwätz. Wer bist du wirklich?«
Diese Frage empörte sie. »Du dringst hier ein und tötest den Prinzen und fragst mich, wer ich bin? Wer bist du?«
»Habe ich das nicht gesagt?« Grob umfasste er ihren Arm. Der Druck seiner Finger schmerzte. »Ich bin Neferkare-Pepis Sohn!«
»Und welche seiner Frauen ist deine Mutter? Und wer ist deine Königin?«
Merenre schnappte nach Luft. Er holte aus und klatschte mit dem Handrücken auf ihr Gesicht, sodass ihr für einen Augenblick schwarz vor Augen wurde. Dieser Mann besaß unbändige Kraft. Sie konnte kaum glauben, dass sie noch immer aufrecht saß. Gütige Hathor, dachte sie, es ist dein Wille, dass ich dies hier zu Ende bringe.
»Komm herunter!«, schrie er.
»Ich denke nicht daran!«
Er presste die Lippen aufeinander. Eine steile Zornesfalte erschien auf seiner Stirn. Würde er sie jetzt töten? Doch sein Blick wanderte nur langsam über ihren schweißglänzenden Körper. Wie konnte ein Mann dermaßen schamlos starren, und wie kam es, dass es ihr nicht unangenehm war? Er beobachtete ausgiebig, wie sich ihre Brust hob und senkte; so lange, bis das Gold ihres Halskragens auf der Haut zu glühen schien. Plötzlich drehte er sich um und stapfte zu den Mitgliedern der Familie.
»Welche Frau war für Neferkare-Tereru vorgesehen?« Er stieß Ipwet mit dem Fuß an, schob zwei weitere Frauen – Klagefrauen – beiseite. Ein Mann trat vor; seine blaue Kappe wies ihn als Hohenpriester des Ptah aus. Er antwortete mit ruhiger Stimme.
»Seine Schwester: Itriri, die Tochter Ipwets.«
Merenre ging zurück zur Bahre und stieg über Neferkare-Tererus leblosen Körper. »Wo ist sie? Ich sehe sie nicht.«
»Sie ist nicht hier«, erwiderte der Hohepriester ruhig. Merenre stieß ein höhnisches Lachen hervor.
»Vermutlich ist sie ein junges Gör, nicht älter als ihr Bruder. Wie auch immer, darum werde ich mich kümmern, wenn Zeit dazu ist.« Er wandte sich wieder Neith zu und starrte sie an. Aber er schien sich entschieden zu haben, zu warten. Schweiß lief ihm unter dem Lederzeug hervor, während er mit den Händen an den Seiten dastand. Ipwet lag keuchend in ihrer Ecke; niemand wagte es, sie zu beachten. Die Aamu-Krieger rührten keinen Muskel. Die Höflinge standen schweigend, und ihre Augen huschten zwischen dem selbsternannten Pharao und Neferkare-Tererus Leichnam hin und her. Endlich erhob sich Neith vorsichtig; das Kleid rutschte an ihren Beinen hinunter. Dann stand sie auf der Bahre, die Beine über der Mumie gespreizt, den Kopf mit den Kuhhörnern und der Sonnenscheibe hoch erhoben. Sie blickte auf Merenre hinab, und er zu ihr herauf. Sie ahnte, dass sie ein beeindruckendes Bild bot; dennoch dachte sie: Ich bin eine Tochter Pharaos. Gütige Hathor, geliebte Sachmet, ich bete darum, dass er es nicht weiß.
2.
Die Priester hatten Neferkare-Tereru in ein Tuch gewickelt, noch immer lag er im Pfeilerhof des Totentempels. Die Rituale der Opferung und Grablegung waren in ungebührlicher Hast vollzogen worden. Neith hatte das Kuhgehörn mit der Sonnenscheibe auf den Boden gelegt und den Tempel verlassen, mit einem letzten Blick auf ihren toten Bruder.
»Gütige Sachmet«, murmelte Teti, während sie hinter der Trauergesellschaft den Aufweg hinuntereilten. Merenre und seine Aamu-Krieger waren bereits fort, unten am Fluss. »Ich hätte niemals gewagt, diesem Mann solche Worte an den Kopf zu werfen. Du hast ihn beeindruckt. Ist dir klar, dass er dein Bruder ist?«
»Ja. Und er hat Neferkare-Tereru getötet.« Die Worte schmeckten schal. Neith hatte ihren zehnjährigen Bruder gemocht, aber wirklich vertraut war er ihr nie gewesen. Neferkare-Tereru hatte sie wegen ihres Könnens im Bogenschießen bewundert, aber er war ein Kind des Palastes gewesen; und wenn er in den Tempel gekommen war, dann hatte sie mit ihm nur wenige Blicke gewechselt, nicht anders als heute.
»Ich weiß, ich sah es ja. Wie es scheint, hast du einen Bruder verloren und einen anderen gewonnen.«
Was er getan hat, dachte Neith, war abscheulich, und die Götter werden es nicht vergessen. Ihres Segens dürfte er sich nicht sicher sein.
Der Taltempel war bereits leer, der Weihrauchduft verflogen. Auf der Terrasse hielt sie nach Ipui Ausschau, aber er war nicht mehr da. Hatten die Aamu ihn getötet und in den Fluss geworfen? Vielleicht war er ja doch geflohen, obwohl sie das nicht glaubte. Unwillkürlich ärgerte sie sich über seine Anhänglichkeit. Aber sie mochte ihn, und der Gedanke, er könne jetzt ebenfalls tot sein, schmerzte sie zutiefst.
Soeben wurde die Königin Ipwet in ihrer Sänfte auf die königliche Barke getragen. Der feiste Wesir Biu stolperte hinter ihr über die Laufplanke und suchte sich mit noch immer bleichem Gesicht einen Platz. Neith war froh, dass sie mit der Barke gekommen war, die dem Hohenpriester des Ptah gehörte. Er schritt sehr viel würdiger über das Deck und verschwand in seiner kleinen Kajüte. Auf dem Schiff des fremden Eroberers saßen Ägypter an den Rudern. Also war Merenre zuvor, ohne dass sie alle es gemerkt hatten, in der Stadt gewesen und hatte den Palast im Handstreich genommen. Hatten diese Ruderer sich ihm und den Aamu vorbehaltlos unterworfen?
Dies war nicht mehr das Ägypten der alten ruhmreichen Pharaonen. Es war ein geschundenes Land, das glaubte, einem aus dem Nichts erschienenen Retter huldigen zu müssen.
Sie bestieg die Tempelbarke, Teti dicht hinter ihr. Während sie über die Laufplanke schritt, spürte sie Merenres Blick auf sich. Er stand an der Bordwand seines Schiffes, das gerade ablegte und sich den anderen drei, die in der Flussmitte gewartet hatten, anschloss. Er hatte die Hände auf den Handlauf gestützt; seine eingeölten Zöpfe bewegten sich im einsetzenden Fahrtwind. Einen Bart nach aamuritischer Art trug er nicht. Jetzt, da er entspannt dastand, wirkte sein hübsches, glattes Gesicht so unerfahren wie das eines Kindes, und es passte nicht zu seinen muskelbepackten Schultern.
Als ihre Augen sich trafen, lächelte er. Neith zuckte zurück und schlüpfte in die Kajüte. Das war ungehörig, denn die Kajüte gehörte allein dem Hohenpriester, aber sie konnte Merenres besitzergreifenden Blick nicht ertragen. Sabu-Tjeti, der auf einem Sessel ruhte, lächelte wissend.
»Bleib nur hier und setz dich zu mir, Herrin Neith«, sagte er. »Eigentlich sollten wir jetzt alle beisammensitzen, das Leichenmahl einnehmen und von den Taten des Verstorbenen erzählen. Aber jeder will nur so schnell wie möglich in sein Haus. Das alles ist demütigend, aber wir können nichts dagegen tun.«
»Wirklich nicht?« Sie warf einen verstohlenen Blick durch den Spalt des Vorhangs, aber sie sah nur Teti, die eher neugierig als ängstlich zu dem fremden Schiff hinüberstarrte. Neith setzte sich auf den Boden. Die ruhige Gegenwart des Priesters flößte ihr ein wenig Zuversicht ein. Er langte nach einem Weinkelch auf einem Tischchen und reichte ihn ihr. Sie trank hastig und stellte den leeren Kelch zurück. »Ob er die Wahrheit gesprochen hat?«, fragte sie schließlich. »In seinem aamuritischen Lederzeug sieht er aus wie ein Barbar. Und diese Zöpfe! Sie rochen ranzig.«
»Als eine Tochter des Pharaos hast du dich stets für die Geschehnisse der beiden Länder interessiert«, sagte er freundlich, obwohl sie ahnte, dass ein Tadel folgen würde. »Aber du hast wie jeder Ägypter verächtlich auf das herabgeblickt, was sich jenseits der Grenzen tat. Du hast nicht zugehört, wenn Reisende den Tempel besuchten und Nachrichten brachten.«
»Doch, ich habe Ipui zugehört.«
»Ipui? Ach ja, du meinst diesen Tempeldiener, der es liebt, dir hinterherzulaufen, und der es anscheinend niemals zu einem höheren Priesterrang bringen wird. Dabei scheint er mir gar nicht so dumm zu sein. Wahrscheinlich fehlt ihm nur der Ehrgeiz.«
Neith wollte einwenden, dass Ipui vermutlich tot war, aber sie schwieg und wartete. Sabu-Tjeti lehnte sich zurück und legte die Hände auf die Armlehnen. Der Vorhang blähte sich im Fahrtwind und schickte einen erfrischenden Lufthauch. Sie erhaschte einen Blick auf Teti, die sich auf einer Matte ausgestreckt hatte und von den beiden Muu-Tänzern, die neben ihr knieten, bedienen ließ. Teti, die den üppigen und sinnlichen Körper einer Tempeltänzerin besaß, fand immer jemanden, der nur darauf lauerte, ihr jeden Wunsch von den Augen abzulesen. In der Ferne war Merenres Barke zu sehen.
»Hm, Merenre …« Der Hohepriester stützte das Kinn auf die Faust. »Sein eigentlicher Name ist das nicht. Er heißt Nemtiemsaf. Merenre – der von Re Geliebte – ist vermutlich sein zukünftiger Thronname, in Anlehnung an Osiris Merenre, der vor hundert Jahren herrschte und ebenfalls Nemtiemsaf hieß. Würde Merenre seinen Geburtsnamen gebrauchen, könnten sich am Hof wohl einige an ihn erinnern. Sein Vater, der auch dein Vater war, schickte ihn vor vielen Jahren ins südliche Syrien, in das Land der Aamu, damit er bei einigen Grenzscharmützeln das Kriegshandwerk lernte. Damals war er fast noch ein Kind. Ich hörte früher davon, dass es ihm nicht gefiel, in der Sonne zu schwitzen, ledriges Fleisch zu essen und auf dem Boden zu schlafen. Aber er soll mit der Streitaxt und der Lanze einer der Besten sein.«
»Mir scheint, er ist im Innern das Kind geblieben, das über die harte Behandlung zornig war. Aber weshalb ist er in Syrien geblieben? Warum ist er bei den Sandbewohnern untergekrochen?«
»Sich mit den Aamu zu verbünden, schien ihm vermutlich der leichtere Weg. Aber er war und blieb Ägypter, und das wussten wohl auch die fleischfressenden Blutsauger, die sich an ihn klammerten, weil sie ahnten, dass er sich eines Tages an seine Bestimmung erinnern und zurückkehren würde, zurück hinter die weiße Mauer der Residenz. Ihnen geht es nur um Macht und Gold. Sie sind wie Jagdhunde, die ihrem Herrn das Wild anschleppen, um dann hechelnd unterm Tisch auf ein paar Brocken zu warten. Was gibt es denn schon in der syrischen Wüste, weswegen sie dort bleiben sollten? Ägypten leidet unter dieser furchtbaren Trockenheit, die schon seit Jahren anhält, aber im Vergleich zu jenem Landstrich ist es immer noch reich und schön.«
Jetzt sprach Sabu-Tjeti so verächtlich, wie es jeder Ägypter tun würde. Neith musste lächeln. »Und woher weißt du das alles?«
»Osiris Neferkare-Pepi sprach manchmal von ihm.« Er nahm seine blaue Kappe ab und strich sich den Schweiß von der Stirn. »Er sprach auch manchmal über dich.«
»Über mich?«, rief sie erstaunt. Sie war überzeugt davon, dass ihr Vater, der bei ihrer Geburt vor neunzehn Jahren bereits ein alter Mann gewesen war, ihr Leben im Tempel kaum wahrgenommen hatte.
»Ja. Er sagte, wärest du nicht eine Frau, so hätte er dich zum Thronfolger ernannt, nicht diesen unbedarften Jungen, den einzigen Überlebenden seiner in langen Jahren gezeugten Söhne.«
Neith war verwirrt. Osiris Neferkare-Pepi hatte während seiner langen Herrschaft nicht viele Kinder gezeugt, und die wenigen waren allesamt gestorben: an Krankheiten, in den immerwährenden Kämpfen an den Grenzen … oder aber mit einem zum Ritual der Mundöffnung bestimmten Fischbeinmesser. Mit der ständig wechselnden Rangfolge der Thronanwärter hatte sie nichts zu tun, nicht nur wegen ihres Geschlechts, sondern auch, weil ihre Mutter nur eine unbedeutende Nebenfrau gewesen war.
Sabu-Tjeti schloss aufseufzend die Augen. »Herrin Neith, bitte lass mich jetzt allein. Ich möchte ein wenig ruhen.«
Sie sprang auf, kreuzte die Arme vor der Brust und verneigte sich.
»Du weißt, dass du als eine Tochter des Pharaos den Kopf nicht vor mir beugen musst.«
»Aber du bist der Erste Gottesdiener des Ptah, der Herr des Tempels, und du hast dich noch niemals darüber beklagt.«
Er lächelte. »Ja. Ich habe deine Huldigung stets genossen, aber ich will nicht mehr, dass du das tust, hörst du?«
Neith runzelte die Stirn. Jetzt erst fiel ihr auf, dass er sie Herrin genannt hatte. Warum besann er sich mit einem Mal auf ihre Herkunft? Sie war doch zuallererst eine Priesterin im Tempel des Ptah, die in der Kapelle der Löwengöttin Sachmet diente. Sie trat hinaus in die beginnende Hitze des Vormittags. Die Barke hielt sich in der Flussmitte, und der Lotse am Bug beobachtete das braune Wasser. Es versprach ein heißer Frühlingstag zu werden. Noch zwei Monate, dann würde der Sepdet-Stern erscheinen und die neue Überschwemmung ankündigen, die sicherlich so schwach ausfallen würde wie all die Jahre zuvor. Merenres Schiff war inzwischen weit voraus.
Sie sehnte sich nach der Kühle des Tempels. Dort lungerten sicher auch keine Aamu herum. Wie viele mochten es sein? Ipui hatte von fünftausend gesprochen. Die weißen Mauern der Residenz flimmerten in weiter Entfernung. Sie sah Männer in den Gärten und am Flussufer herumstreifen, aber sie waren zu weit entfernt, als dass sie hätte erkennen können, ob es Aamu waren. Mit unerträglicher Langsamkeit glitt die Barke am königlichen Hafen vorbei. Die Schiffe der Aamu hatten am Kai festgemacht, ebenso Merenres Schiff. Aber er war nicht mehr zu sehen.
»Was willst du jetzt tun?«, rief Teti ihr zu. »Dich im Tempel vor diesem Emporkömmling verstecken?«
Neith drehte sich zu ihr um. »Verstecken? Warum sollte ich das tun?«
Teti entblößte die weißen Zähne zu einem anzüglichen Grinsen. »Er hat ein Auge auf dich geworfen, das war nicht zu übersehen. Bereitet dir der Gedanke Furcht?«
Neith verschränkte empört die Arme. Die Barke näherte sich dem Kanal Re ist schön, der zum Tempel führte. Viele Jahre lag es zurück, dass die Barken diesen Weg zum Tempel benutzen konnten. Heute war der Kanal nur noch ein Rinnsal, und die Schiffe mussten an seiner Einmündung anlegen. Ein kleiner Kai war errichtet worden, zu dem ein hölzerner Steg führte. Neith und Teti schritten als erste über die Laufplanke.
»Ich habe keine Furcht«, sagte sie schließlich zu Teti, die missmutig den sandigen Weg musterte, der zum Tempel führte. »Er hat mich längst vergessen. Ein Eroberer und selbsternannter Herrscher muss sich doch jetzt um tausend andere Dinge kümmern als um eine Priesterin, von der er nicht einmal weiß, dass sie eine Tochter seines Vaters ist. Komm, lass uns den Weg hinter uns bringen.« Sie hob einen Schal über den Kopf, um die gröbste Hitze abzuhalten. Den Trägern mit ihren Sänften, die erschienen waren, um die ranghöchsten Priester abzuholen, warf sie einen sehnsüchtigen Blick zu. Ihrem königlichen Rang entsprechend hätte sie sich ebenfalls eine Sänfte herbestellen können, aber sie hatte es vergessen.
Eine der Sänften, von vier kräftigen Nubiern getragen, blieb vor ihr stehen. »Bist du die Hathor?«, fragte einer der Träger. »Jene Frau, die die Göttin darstellte? Unser Herr sagte, du musst eine Priesterin sein, also schickte er uns hierher.«
»Ja, ich bin Priesterin der Göttin Sachmet und eine Hofdame«, sagte Neith verwirrt. »Wer ist denn dein Herr?«
»Pharao Merenre. Er sagt, du hast es verdient, dich auf dem Rückweg auszuruhen.«
Teti kicherte. Neith warf ihr einen scharfen Blick zu. Sollte sie sich über dieses unverhoffte Geschenk nun freuen oder ärgern? Die Nubier setzten die Sänfte ab, damit sie einsteigen konnte.
Es war eine prunkvolle Sänfte, goldfarben bemalt und mit Kissen belegt. Ein Sonnendach spendete Schatten. Ihre eigene Sänfte, die irgendwo im Tempelhof herumstand, war nicht annähernd so prunkvoll. Kaum saß sie, wurde sie in die Höhe gehoben, und die Nubier marschierten los. »Wohin geht ihr denn?«, rief sie und blickte Teti nach, die lachend hinterherwinkte.
»Zum Pharao, in den Palast«, war die Antwort. Neith unterdrückte einen Aufschrei.
»Ich will aber nicht. Vom Rückweg in den Tempel war die Rede, also bringt mich dorthin.«
»Aber der Horusfalke …«, sagte der Kuschit verwirrt. Offenbar konnte er nicht glauben, dass jemand dem Ruf des Horus nicht folgen wollte.
»Er mag sich schon so nennen, aber noch ist er es nicht. Außerdem bin ich müde und hungrig. Und habe obendrein schmutzige Füße. Und überhaupt bin ich allein meiner Göttin Rechenschaft schuldig. Hast du verstanden?«
»Ja, Herrin.«
Das würde dem armen Kerl ein paar Stockhiebe einbringen. Aber weshalb soll ich eilen, nur weil irgendein Störenfried, an dem noch Aamu-Zöpfe hängen, mit den Fingern schnippt?, dachte sie erbost. Ich denke nicht daran!
Ein Gefühl bemächtigte sich ihrer, von dem sie nicht wusste, ob es freudige Erregung oder Angst war. Seufzend lehnte sie sich zurück.
Das Gewimmel um sie herum nahm sie nicht wahr, auch nicht die gleichförmigen Schritte ihrer Träger, die die Sänfte zielsicher in Richtung des Hut-Ka-Ptah, der großen Tempelanlage des Stadtgottes, lenkten. Sie mochte das Gewimmel der Stadt nicht – sie war laut und stank. Man nannte sie Men-nefer – ewig und schön war ein edler Name für den Ort, wo der Pharao residierte. Ihr eigentlicher Name war allmählich in Vergessenheit geraten, seitdem Osiris Neferkare-Pepi der Erste seine Pyramide ewig und schön ist Neferkare genannt hatte. Für ihre Bewohner war sie jedoch nur »die Stadt«, und angesichts ihres Ausmaßes verblasste jede andere Stadt zu einem bedeutungslosen Dorf. Neith war sie beinahe so fremd wie eine der Küstenstädte Syriens.
Erst als sie die Umfassungsmauer des Tempels erblickte, dahinter die wuchtige Pfeilerhalle mit den riesigen Statuen ihres Vaters und des Gottes Ptah vor dem Eingang, richtete sie sich auf. Die Träger setzten sie in der kleinen Säulenhalle hinter dem Eingang ab, und sie ging zunächst zum heiligen See nördlich des Tempels, um sich darin zu reinigen. Dann huldigte sie ihrer Göttin, indem sie sich vor dem verhüllten Standbild in der Kapelle zu Boden warf. Sachmet, die mächtige Löwengöttin, das Auge des Re, geliebt von Ptah, besaß nur diese Kapelle, einen kleinen Bau an der westlichen Umfassungsmauer des großen Ptah-Tempels. Auch von Hathor gab es eine solche Kapelle an der südlichen Mauer. Außer ihr und Teti diente hier nur noch eine weitere Sachmet-Priesterin: Merit-Sachmet, die Erste Gottesdienerin. Noch hatte Neith sie nicht gesehen; wahrscheinlich verschlief sie die Mittagshitze in ihrer Kammer. Neith tauschte ihr verschwitztes Kleid gegen ein frisches und beschloss, ihre aufgewühlten Gedanken mit ein wenig Bogenschießen zu beruhigen. Andererseits brannte sie auf das, was die anderen Priester über die Ereignisse in der Stadt und der Residenz zu berichten wussten. Der Hof war fast verlassen; viele waren jetzt sicher in der Stadt, um sich um ihre Angehörigen und Wohnungen zu kümmern. Einige wenige lebten hier im Tempel in eigens für Priester errichteten Häusern und hatten sich anscheinend darin verkrochen.
Sie schnallte sich einen ledernen Schutz um die Hände und holte einen der Ritualbogen aus den Lagerhäusern, dazu einen gefüllten Köcher, den sie um die Mitte gürtete. An die Hofmauer lehnte sie eine hölzerne Platte und schritt zurück, bis sie sechzig Ellen zählte. In guter Verfassung traf sie das Ziel über eine Entfernung von weit über hundert Ellen. Teti war die bessere Tänzerin, sie jedoch die bessere Bogenschützin; aber in ihrer jetzigen Aufgewühltheit gelangen ihr nur wenige gute Schüsse. Enttäuscht ließ sie den Bogen sinken.
»Neith?«
Sie sah auf. Merit-Sachmets nackte Füße knirschten im Sand. Die Hohepriesterin war eine alte Frau von über sechzig Jahren, klein, aber noch ungebeugt. Unter dem schlichten Tuch, das ihren Kopf vor der Sonne schützte, sah sie eher wie eine Tempeldienerin aus. »Du bist mit einer dieser teuren Sänften für Höflinge in den Tempel geschwebt, so berichtete man mir«, sagte sie leicht spöttisch. »So junge Beine und schon so müde.«
»Herrin, du vergisst, dass ich eine Hofdame bin«, entgegnete Neith lächelnd und verneigte sich. »Meine Herkunft hat mich dazu gemacht. Hätte ich das Geschenk des neuen Pharaos zurückweisen sollen?«
»Gütige Göttin!«, rief Merit-Sachmet und hob in gespielter Empörung die Hände. »Wurdest du auch so rasch davon angesteckt, vor diesem Mann zu kuschen und ihn Pharao zu nennen, kaum dass er seinen Namen genannt und den Anspruch auf die Doppelkrone ausgesprochen hat?«
»Aber ich kusche nicht vor ihm!«
Merit-Sachmet berührte beschwichtigend ihre Schulter. »Nein, das weiß ich doch. Sabu-Tjeti suchte mich auf und berichtete mir. Ich konnte ohnehin nicht schlafen, denn es herrscht Unruhe, und ständig rannte jemand vor meiner Kammer hin und her. Du hast klug gehandelt. Und wer weiß, vielleicht wollte die Göttin ja, dass du Tetis Platz einnahmst.«
Neith stützte sich auf den Bogen. Diese Möglichkeit hatte sie noch nicht bedacht. Aber einen Sinn vermochte sie dahinter nicht zu erkennen. Gäbe es im Tempel noch weitere weibliche Priester, wäre Teti erst gar nicht ausgewählt worden. All die anderen Tänzerinnen waren Frauen aus der Stadt, die nur zu den Festen erschienen, keine Priesterinnen. Da sah sie Teti quer über den Hof rennen, in Richtung der Pfeilerhalle. Drei, vier Aamu-Krieger stapften durch das Westtor, wobei sie die Priester und Tempeldiener mit flachen Klingen beiseite drängten. Sie sahen sich um; einer der Männer deutete auf Neith.
»Wäre es möglich, dass diese Männer deinetwegen kommen?«, fragte Merit-Sachmet ruhig.
»Ich fürchte, ja.« Neith unterdrückte den Wunsch, ebenfalls in die dunklen Flure des Tempels zu flüchten. Die Männer blieben vor Merit-Sachmet stehen, die ihnen entschlossen entgegentrat.
»Du«, sagte einer der Aamu mit seinem fremdartigen Akzent und deutete auf Neith. »Der König schickt uns nach dir. Du hast ihn beleidigt, da du seine Einladung nicht angenommen hast.«
»Sie ist deinem Herrn, der sich König nennt, nichts schuldig«, sagte Merit-Sachmet. »Geh und störe nicht das Haus des Gottes.«
Der Aamu warf ihr einen verächtlichen Blick zu. »Deine Götter kümmern mich nicht. Sieh zu, dass du mir aus dem Weg gehst.« Er legte die Hand auf die Schulter der alten Frau, um sie beiseite zu stoßen. Neith hob sofort den Bogen und spannte ihn. Ihre Hände bewegten sich fast ohne ihr Zutun, und sie konnte sich nicht erinnern, den Pfeil aus dem Köcher gezogen zu haben.
»Berühre sie nicht«, sagte sie mit fester Stimme. »Du bist es, der gehen wird, mitsamt deinen Leuten. Richte deinem Herrn aus, dass sich eine Sachmet-Priesterin keinem Mann aufzwingen lassen wird.«
Der Aamu lachte unsicher. »Ich hatte geglaubt, du würdest vor Ehrfurcht erstarren, da dich dein König, der sich Gott nennt, zu sich ruft. Bete zu deiner Göttin, dass sie dich vor seinem Zorn schützt.« Er machte mitsamt seinen Männern kehrt. Erleichtert stieß Neith den Atem aus.
»Geht es dir gut, Herrin?«
»Aber ja. Da sind ja wirklich einige sehr interessante Dinge vorgefallen, nicht wahr? Aber komm, begleite mich zurück in die Kühle meiner Kammer. Vielleicht finde ich jetzt etwas Schlaf.«
»O Merit-Sachmet, wie glaubst du, jetzt schlafen zu können?«
»Nun, es ist doch jetzt ruhig hier.«
Neith winkte einem Tempeldiener, der aus sicherer Entfernung zugesehen hatte, und gab ihm Köcher und Bogen. Sie trat an Merit-Sachmets Seite, um ihr den Arm zu bieten. Im Schatten der Mauer wanderten sie zum Haus der Priester. Merit-Sachmet besaß nur eine einfache Kammer am Ende des langgestreckten Gebäudes. An einem Anwesen in der Stadt, wie Sabu-Tjeti eines besaß, lag ihr nichts. Meine Göttin haust inmitten dieses Tempels in einer unscheinbaren Kapelle, pflegte sie zu sagen, weshalb sollte ich besser wohnen als sie? »Es ist schwach und krank geworden«, sagte die alte Priesterin unvermittelt, »schwach und krank, unser geliebtes Ägypten. Ich wollte es nicht wahrhaben.«
Wir alle wollten es nicht wahrhaben, dachte Neith.
»Doch wären es nicht die Aamu«, sprach Merit-Sachmet weiter, »so kämen andere, vielleicht aus den fruchtbaren Gegenden Syriens oder aus den Ländern jenseits des verkehrt fließenden Flusses im Osten. Schlimme Dinge geschehen. Die Bauern hungern, die Gaufürsten errichten sich prachtvolle Landhäuser und ahmen die Residenz des Herrschers nach. Sie streben nicht mehr nach Grabstätten in Sakkara, um dem Pharao nahe zu sein, sondern lassen in ihren Gauen Gräber in die Felsen schlagen. Sie drängen unter den Fittichen des Horus hervor, um ihm die Federn auszureißen.«
Sprach die Hohepriesterin von Osiris Neferkare-Pepi oder von Merenre? »Hast du all das im heiligen Auge der Göttin gesehen?«, fragte Neith beeindruckt, aber Merit-Sachmet antwortete nicht, denn sie hatten die Tür zu ihrer Kammer erreicht. Neith öffnete ihr und ging zum Fenster, um die Binsenmatte herunterzulassen, denn Merit-Sachmet mochte kein Sonnenlicht in ihrer Kammer. Hier gab es nur ein Bett, dazu einige verschlossene Truhen und ein kleiner Schrein der Sachmet. Er war sehr kostbar, mit Goldfolie beschlagen und von goldenen, löwenköpfigen Göttinnen flankiert. In einer Ecke lehnte Merit-Sachmets Götterstab mit dem Löwinnenkopf, in einer anderen ein Straußenfedernfächer. Neith half ihr, sich hinzulegen, nahm dann den Fächer und stellte sich neben dem Bett auf, um ihr Luft zuzufächeln. Sie hätte dafür einen Tempeldiener holen können, aber sie wollte noch nicht gehen.
Merit-Sachmet schien bereits einzuschlafen. Aber die Frage brannte unter Neiths Fingern.
»Herrin? Denkst du, ich sollte mich nicht mit Merenre einlassen? Wie es scheint, findet er Gefallen an mir.«
Merit-Sachmet blinzelte, als müsse sie erst den Sinn dieser Frage erkunden. Sie schob einen Arm unter ihren Kopf und sah Neith an. »Du machtest soeben nicht den Eindruck, als fändest du Gefallen an ihm. Willst du die Nebenfrau oder vielleicht auch nur die Geliebte eines Mannes werden …«
»Eines Gottes.«
»Schön, eines Gottes. Falls das so richtig ist. Die wenigsten Herrscher haben sich bereits vor ihrem Ableben als göttlich erwiesen. Aber ist das dein Ziel?«
»Nein, natürlich nicht. Aber vielleicht …« Neith unterbrach sich, denn Merit-Sachmet ahnte sicherlich ihre Gedanken.
»Du bist eine königliche Tochter. Du denkst an den Goldreif der Königin, nicht wahr? Ich hatte nicht vergessen, wessen Tochter du bist, als ich dich damals zur Priesterin machte. Deine Liebe zur Göttin war als junges Mädchen schon stark, und es gab seinerzeit keinen Prinzen oder ausländischen Gesandten, dem du hättest zur Frau gegeben werden können.« Merit-Sachmet gähnte. »Dort in der Truhe an der Wand liegen Papyri. Bring mir das unterste Bündel.«
Neith öffnete die Truhe und brachte die gewünschten Rollen. Abwartend sah sie zu, wie Merit-Sachmet einen der Papyri entrollte, über ihren Kopf hielt und angestrengt las. Neith sah, dass es ein Traumbuch war, eine Liste von möglichen Deutungen für Träume oder andere, ungewöhnliche Begebenheiten. Nach einer Weile ließ die Hohepriesterin die Arme aufs Bett sinken. Der Papyrus rollte sich zusammen und fiel hinunter.
»Ich habe dich noch nie ins Auge der Göttin blicken lassen«, murmelte sie leise, »aber vielleicht … ist es … an der Zeit.«
Merit-Sachmet war eingeschlafen. Neith verließ leise das Zimmer und trat hinaus ins Freie. Ihre eigene Kammer war nicht weit entfernt. Einer der Tempelwächter stand wie stets neben der Tür; seine Anwesenheit war ein Zugeständnis an ihre königliche Herkunft. Während sie auf ihn zuging, erinnerte sie sich an Ipui, und plötzlich ärgerte sie sich maßlos. »Warum bist du hier und bewachst meine leere Kammer?«, fuhr sie den Priester an. »Weshalb bist du nicht im Palast und kämpfst gegen die aamuritischen Eindringlinge?« Er blickte erschrocken, sagte aber kein Wort. Neith riss die Tür auf und betrat ihr Gemach. Es war die größte der Priesterkammern; auch das hatte sie dem Umstand zu verdanken, dass sie eine Tochter des Pharaos war. Eine junge Frau, die in Kleidertruhen kramte, richtete sich überrascht auf.
»Herrin!«, rief sie, eilte auf sie zu und verneigte sich. »Ich bin so froh, dich zu sehen. Draußen hörte ich die schlimmsten Dinge, sodass ich schon glaubte, du seist verschleppt oder gar tot. Aber du scheinst wohlauf zu sein. Geht es deiner Freundin Teti auch gut?«
»Ja, danke, Taket.« Neith schritt durch das Zimmer und betrachtete die geöffneten Truhen, aus denen die Stoffe quollen. Der Tisch war mit Schmuck, Schminktiegelchen, einigen Perücken und anderem Kleinkram übersät. Taket war ein freundliches, stets hilfsbereites Mädchen, dem es Freude machte, ihrer Herrin zu dienen, aber ordentlich war es nicht. Neith ließ die Träger ihres Kleides über die Schultern gleiten, sodass es sich zu ihren Füßen zusammenbauschte. Augenblicklich löste die Dienerin die staubbedeckten Sandalen und brachte eine Waschschüssel und zwei Leintücher. Neith seufzte wohlig auf, als sie das Natron und die tropfnassen Tücher auf ihrer Haut spürte.
Sowie sie wieder getrocknet war, ließ sie sich auf dem Bett nieder. Taket kniete neben ihr, um ihr die Haare zu kämmen. Die dicken, schwarzen Strähnen reichten nur bis zum Kinn, die Spitzen drehten sich in Richtung Nase – da half alles Kämmen nichts. Neith mochte es, die Haare kurz zu tragen, denn sie fand, dass es zu ihrem kriegerischen Namen passte. Schließlich streckte sie sich auf dem Bett aus, und nun war es Taket, die nach einem Federnfächer griff, um ihr Kühlung zuzufächeln. Neith angelte nach einem Tonkrug mit Wasser und trank ihn aus. Dann drehte sie ihn nachdenklich in den Händen. Abrupt setzte sie sich auf, beugte sich zu einer Truhe am Kopfende des Bettes und wühlte darin herum. Wo war ihre Schreibpalette? Auf dem Boden lag ein Kohlestück. Sie hob es auf.
Ich lasse mich nicht von dir vereinnahmen, dachte sie in einem Anflug von Zorn und malte die Sonnenscheibe, den Grabstock, den Mund und die Wasserlinie auf den Tonkrug. Merit-Sachmet hatte ihr erzählt, dass dies eine einigermaßen erfolgversprechende Maßnahme war, einen bösen Umstand zu beseitigen: Man schrieb das Wort auf ein Gefäß und zerbrach es. Doch ob dies auch auf Menschen anwendbar war, wusste Neith nicht. Nun hatte sie Merenres Namenshieroglyphe auf den Tonkrug geschrieben. Aber war sie wirklich fähig, ihn zu zerbrechen?
»War jemand hier?«, fragte sie schließlich. »Irgendein Bote aus dem Palast?«
»Aus dem Palast?« Die Dienerin schüttelte den Kopf. »Nein. Ich sprach nur mit einem der Tempeldiener, der … O gütige Göttin!« Sie fiel auf die Knie. »Das habe ich in all der Aufregung ganz vergessen. Einer der Tempeldiener berichtete, was mit Ipui geschehen ist. Er soll im Palastgefängnis sitzen, gemeinsam mit einigen wenigen Palastwächtern, die es wagten, sich den Eindringlingen zu widersetzen.«
»Gütige Sachmet! Aber dann lebt er wenigstens.« Neith betrachtete das Gefäß in ihrer Hand. Warum war die Welt plötzlich so launenhaft und füllte sich mit Schwierigkeiten? Sie hob den Krug über den Kopf und betete zu Thot, dass der Zauber gelingen möge. Dann schleuderte sie ihn zu Boden, sodass er in tausend Stücke zersprang.
Es würde Abend werden, bis die Mauer des Innenhofes, an der die aufständischen Soldaten angekettet waren, Schatten warf. Sie hingen an Kupferringen, die Gesichter der heißen Ziegelwand zugewandt. Wer groß genug war, konnte auf den Zehenspitzen stehen, ansonsten galt es, zu hängen. Und diejenigen, deren Zehen nicht mehr den Sandboden berührten, waren bewusstlos. Neith zählte zehn Männer, die ihre unglückliche Lage offenbar der Tatsache zu verdanken hatten, nicht wie die anderen Palastsoldaten zu den fremdländischen Eroberern übergelaufen zu sein, kaum dass jene ihren Fuß in den Palastbezirk gesetzt hatten. Aamuritische Krieger machten in der Mitte des Hofes ihre Kampfübungen.
Wir Ägypter sind kein kriegerisches Volk, dachte Neith. Ägypter bearbeiteten ihren nilschlammbedeckten Boden und verehrten die Götter, genossen die Sonne und dachten über das Leben und den Tod nach.
Andernfalls hätten nicht fünftausend Aamu genügt, um das Land einzunehmen. Aber das Land, das war ja lediglich der Palast, so wie der Pharao Ägypten selbst war. Was kümmerte die Bauern auf dem Feld, wer die Doppelkrone trug? Sie hatten andere Sorgen. Und der neue Pharao würde seine fremdländischen Söldner bezahlen und sie in ihre Heimat zurückschicken. Neith schwang die Beine aus der Sänfte in die Sonnenglut und ging mit geschultertem Sonnenschirm an zwei aamuritischen Kämpfern vorbei, ohne sie eines Blickes zu würdigen. Einer der Gefangenen drehte mühsam den Kopf nach ihr. Der Anblick von Ipuis geschundenem Leib entsetzte sie.
»Was suchst du hier, edle Dame?«, krächzte er. »Wenn du einen Diener erwerben willst, bist du hier falsch. Hier werden nur die königstreuen Ägypter gebacken, als Mahl für einen dämonischen aamuritischen Gott.«
»Ipui, du lebst, Re sei Dank.« Neith berührte seine schweißbedeckte Schulter. »Aber du bist kein Palastsoldat und wärest nicht in diese missliche Lage geraten, wenn du mich nicht hättest beeindrucken wollen.«
Er leckte seine aufgesprungenen Lippen. »Hast du mich also durchschaut. Na schön, und womit willst du jetzt vor mir Eindruck schinden? Mit deiner edelsteinverzierten Schönheit? Oder willst du dem Hauptmann der Aamu gefallen, damit er mich freilässt?«
»Genug jetzt!«, schrie jemand hinter ihr, und sie fuhr herum. Einer der beiden Aamu sprang zurück und senkte seine Streitaxt. Er schien es ebenso zu ihr wie zu seinem Kampfpartner gerufen zu haben. Mit der blitzenden Klinge in der Hand stapfte er auf sie zu. »Ah, die stolze Priesterin, die es wagte, dem neuen Horus nicht zu gehorchen und meine Leute zu bedrohen. Wo hast du denn deinen Bogen gelassen, schöne Frau? Deine Finger sind viel zu fein für eine Waffe.« Sein Ägyptisch war fließend, beinahe vollkommen. »Merenre erzählte von dir; er beschrieb dich recht anschaulich. Dass du einen Bauerntrottel zum Liebhaber hast, der mit einer Waffe kaum etwas anzufangen weiß, wusste er sicherlich nicht.«
»Und von dir, Barbarentölpel«, erwiderte Neith, »wusste ich nicht, dass Merenre sich überhaupt mit dir abgibt. Nenn deinen Namen, bevor du ein Mitglied der königlichen Familie ansprichst!«
Der Aamu lachte dröhnend, schob seine Axt in den Gürtel und verschränkte die muskelstrotzenden Arme vor der Brust. Er war groß und in seiner schwarzen Lederrüstung auf barbarische Art beeindruckend. Die geflochtenen Haare hingen ihm lang und schwarz über die Schultern, und ein kurzer Bart bedeckte seine untere Gesichtshälfte. »Haikta-Ummar. Ergebenster Diener des Horusfalken und Anführer der aamuritischen Streitmacht, dem es gelang, die größte Grenzfestung des Reiches wegzuwischen wie einen Brotkrümel, bevor er die Menschen in der Residenz das Zittern lehrte. Genügt dir das?«
Unwillkürlich fragte sie sich, ob Merenre von diesem Mann gelernt hatte, wehrlose Kinder abzuschlachten. Langsam und schamlos ließ er seinen Blick über ihren Körper wandern und weckte das Begreifen in ihr, dass er eine Bedrohung für ihr Leben war. Nur mit Mühe hielt sie seinem Blick stand.
»Du da«, rief er seinem Übungspartner zu, der noch immer etwas abseits stand und Neith anstarrte. »Bring mir die Flusspferdpeitsche!«
Der Aamu setzte sich in Bewegung und kehrte mit einer geflochtenen Lederpeitsche zurück. Neiths Körper spannte sich an. Doch Haikta-Ummar ließ die Peitsche auf Ipui niedersausen, der vor Überraschung und Schmerz aufschrie. Zwei, drei Peitschenhiebe knallten, bevor sie ihre Verwirrung überwand.
»Ich nehme an, dass du mich beeindrucken willst«, stieß sie hervor. »Nun, das ist dir gelungen, du kannst also aufhören. Ich will diesen Mann mitnehmen.«
Haikta-Ummar ließ die Peitsche mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck sinken. »Was kümmert es mich, was du willst? Dieser Mann wird hier in der Sonne verrotten wie alle anderen. Aber was hast du da vorhin gesagt? Du gehörst zur königlichen Familie?«
»Allerdings. Ich bin eine Tochter von Osiris Neferkare-Pepi.«
Seine Augen blitzten erstaunt, und dann warf er die geflochtenen Zöpfe zurück und lachte lauthals. Er hatte große weiße Zähne. Alles an ihm war groß, üppig: die Nase, die Lippen. Jung war er nicht mehr; unterhalb seiner Augen verliefen Falten. Oder waren es Narben? Neith blinzelte, um sich dem Bann seines Blicks zu entziehen, als er plötzlich dicht vor ihr stand und ihr Kinn mit einer Hand packte.
Jetzt lachte er nicht mehr. »Eine Prinzessin, wer hätte das gedacht?« Seine Finger bohrten sich schmerzhaft in ihre Wangen und bogen ihren Kopf zurück. Sie bemühte sich, nicht zu schlucken, und hoffte, dass er ihr heftig schlagendes Herz nicht spürte.