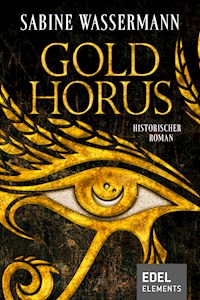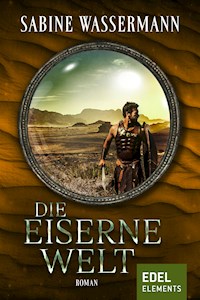Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ketzer, Huren und Verschwörer Konstanz 1415: Mit seinen ketzerischen Thesen ist Johannes Hus zur Gefahr für die Kirche geworden. Auf dem Konzil in der Stadt am Bodensee soll er sich rechtfertigen; ihm droht der Tod auf dem Scheiterhaufen. Zwei Brüder machen sich auf den Weg in die überfüllte Stadt: Martin, ein raubeiniger Söldner, und der Mönch Alban, ein heimlicher Anhänger von Hus. Während sich Martin im Hurenviertel herumtreibt, versucht Alban, dem eingekerkerten Reformator zu helfen. Dann geraten beide in Lebensgefahr. Doch ein düsteres Geheimnis hindert sie, einander beizustehen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 709
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Ketzer, Huren und Verschwörer
Konstanz 1415: Mit seinen ketzerischen Thesen ist Johannes Hus zur Gefahr für die Kirche geworden. Auf dem Konzil in der Stadt am Bodensee soll er sich rechtfertigen; ihm droht der Tod auf dem Scheiterhaufen. Zwei Brüder machen sich auf den Weg in die überfüllte Stadt: Martin, ein raubeiniger Söldner, und der Mönch Alban, ein heimlicher Anhänger von Hus. Während sich Martin im Hurenviertel herumtreibt, versucht Alban, dem eingekerkerten Reformator zu helfen. Dann geraten beide in Lebensgefahr. Doch ein düsteres Geheimnis hindert sie, einander beizustehen.
Sabine Wassermann
Das Zeichen des Ketzers
Historischer Roman
Edel Elements
Edel Elements Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2018 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2008 by Sabine Wassermann
Dieses Werk wurde vermittelt durch die ABC.
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-165-2
www.facebook.com/EdelElements/
www.edelelements.de/
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
NACHWORT
LATEINISCHES UND ITALIENISCHES
Ketzer, Huren und Verschwörer
Konstanz 1415: Mit seinen ketzerischen Thesen ist Jan Hus zur Gefahr für die Kirche geworden. Auf dem Konzil in der Stadt am Bodensee soll er sich rechtfertigen; ihm droht der Tod auf dem Scheiterhaufen. Zwei Brüder machen sich auf den Weg in die überfüllte Stadt: Martin, ein raubeiniger Söldner, und der Mönch Alban, ein heimlicher Anhänger von Hus. Während sich Martin im Hurenviertel herumtreibt, versucht Alban, dem eingekerkerten Reformator zu helfen. Dann geraten beide in Lebensgefahr. Doch ein düsteres Geheimnis hindert sie, einander beizustehen.
Anima nostra quasi avis erepta est de laqueo venantium laqueus contritus est et nos liberati sumus. Unsere Seele ist entronnen wie ein Vogel dem Vogelfänger; der Strick ist zerrissen, wir sind frei.
KAPITEL 1
Die Frau gefiel ihm. Sie war hübsch mit ihren schweren, dunkelbraunen Zöpfen, die beim Gehen ihre Brüste streichelten. Mit geschäftiger Miene trug sie Holzbretter voller Wein- und Bierkrüge an die Tische, schenkte den Reisenden ein, kassierte die Heller und rief ihren Vater, den Wirt, wenn etwas von dem großen Schweinsbraten, der am Feuer briet, gewünscht wurde. Keinem Gast gelang es, ihr ein Lächeln zu entlocken, obwohl viele es versuchten.
Martin winkte sie heran. Sie war erst vor kurzem in der Gaststube erschienen, hatte sich eilends eine Schürze umgebunden und mit der Arbeit begonnen. Er verfluchte sich dafür, dass er nicht später mit dem Trinken angefangen hatte, denn dann hätte er noch oft Grund gehabt, sie herbeizurufen. Doch nun waren sein Bauch und seine Blase bereits zum Platzen gefüllt.
Er hoffte nur, dass sie sich nicht an seinem Geruch störte. Wann kam ein Reisender schon dazu, sich zu waschen? Der strähnige Pilgerbart, den zu scheren er noch keine Zeit gefunden hatte, war nicht gerade eine Augenweide und der Überwurf mit dem aufgemalten Kreuz auf der Brust kaum mehr als ein Lumpen. Es war nicht ganz die passende Aufmachung, um ein zartes Frauenherz für sich zu gewinnen. Aber das, so hoffte er, machten seine breiten Schultern, die ansehnlichen Gesichtszüge und das blonde Haar wett. Und das Kurzschwert an seiner Seite. Bislang hatte sich noch jede Frau von seinem Schwert beeindrucken lassen.
Sie kam heran. »Gottes Segen, Pilger. Was möchtet Ihr?«
»Einen großen Krug Einbecker Starkbier«, sagte er in gewichtigem Ton, als sei dies ein äußerst ungewöhnlicher Wunsch.
Mit einem knappen Nicken entfernte sie sich. Hier in der hintersten Ecke hatte er den Raum, erhellt von einem mit Talgkerzen bestückten Wagenrad, das von der verrußten Decke hing, gut im Blick. Die Wirtstochter verschwand durch eine Tür und kehrte kurz darauf mit einem großen Krug zurück. Mit kräftigen Fingernägeln löste sie das Wachs vom Verschluss und füllte seinen Becher.
»Danke.« Er lächelte breit und klopfte neben sich auf die Bank. »Leiste mir ein wenig Gesellschaft.«
»Dazu fehlt mir die Zeit, Herr.«
»Aber, aber! Du plagst dich schon so lange, da wirst du sicherlich ein wenig ausruhen dürfen?«
»Ich bin doch gerade erst gekommen«, meinte sie, aber nach kurzem Zögern setzte sie sich dennoch. Als er dicht an sie heranrückte, machte sie sich steif.
»Mein Aussehen ist mir wirklich unangenehm«, sagte er zerknirscht. »Aber vielleicht gibt es hier ja eine Badestube, und dann ist das Problem schnell gelöst.« Leise lachend zupfte er an seinem Bart. »Ich verspreche dir, wenn ich aus der Wanne steige und dieses Gewächs los bin, hast du einen ansehnlichen Kerl vor dir. Du musst wissen, ich komme gerade von einer Pilgerreise zurück.« Er klopfte auf den Beutel, den er vor sich auf den Tisch gelegt hatte, prall gefüllt mit wertvollen Reliquien. »Ich war im Heiligen Land.«
Noch immer hielt sie Abstand, doch er hatte eindeutig ihr Interesse gewonnen. Er konnte sich ein triumphierendes Lächeln nicht verkneifen. Welche Frau hörte nicht gerne aufregende Erzählungen aus fremden Ländern?
»Ihr wart im Gelobten Land?«, fragte sie. »In Jerusalem?«
»So ist es. Ich könnte dir Geschichten erzählen, so viele, dass es für die ganze Nacht reicht.« Er beschloss, geradewegs anzufangen und dabei nicht zu dick aufzutragen. »Es ist wahrhaftig eine große Herausforderung! Allein die Reise nach Venedig ist voller Gefahren und doch harmlos im Vergleich zu dem, was einen danach erwartet. Zwei Monate dauerte die Überfahrt, durch Stürme, Piratenschiffe und Seeungeheuer hindurch. Aber auch das ist nichts gegen die Gefahren im Land der Türken. Für alles wollen sie dort Geld, selbst dafür, dass sie einen nur ansehen, und kann man nicht zahlen, hat man einen Dolch im Bauch oder findet sich gefesselt irgendwo wieder und muss hoffen, dass jemand Lösegeld zahlt. Aber wer sollte das tun? Verloren und verkauft bist du dort unten, und hast du doch endlich glücklich Jerusalem betreten und stehst in der Grabeskirche Jesu, bist du ein armer, geschlagener und gedemütigter Mann, und du hast keine Ahnung, wie du jemals wieder lebend nach Hause zurückkehren sollst.«
Martin beendete seine Erzählung, von der er sicher war, dass sie ihre Wirkung auch diesmal entfalten würde, doch die Wirtstochter schien unschlüssig: »So recht mag ich Euch nicht glauben.«
»Nicht?« Vielleicht hätte er die Seeungeheuer nicht erwähnen sollen, denn die hatte er nicht gesehen, aber ansonsten entsprach seine Schilderung der Wahrheit. Er versuchte es anders. »Wie heißt du?«
»Gunthild.«
»Gunthild«, wiederholte er genüsslich. »Ich bin Ritter Martin von Thiersreuth.«
»Ihr wollt von Adel sein?«, fragte sie zweifelnd.
»Würde ich sonst ein Schwert tragen?«
»Das besagt doch gar nichts. Könnt Ihr es überhaupt benutzen? Mit dieser Hand?«
Martin folgte ihrem neugierigen Blick. Sie hatte es also bemerkt. An seiner rechten Hand fehlten die beiden äußeren Finger, nur die Stümpfe bis zum ersten Knöchel waren ihm geblieben. Er hasste es, darauf angesprochen zu werden, und natürlich stellte Gunthild die unvermeidliche Frage: »Wie ist das passiert?«
Er seufzte schwer. Nun, wenn er ihr mit jener Geschichte endlich das erhoffte Lächeln abrang, sollte es so sein. Er nahm einen tiefen Schluck aus dem Krug. Dann zog er mit der Fußspitze den Hocker heran, der unter dem Tisch stand, stützte den Fuß darauf und legte die gesunde Hand aufs Knie, während er die versehrte unter den Pilgerumhang schob. »Das war so ...«
»Gunthild!«, donnerte es durch die Gaststube.
Gunthild fuhr zusammen. »Ich muss weitermachen. Mein Vater sieht es nicht gern, wenn ich bei Gästen sitze«, murmelte sie und wollte aufstehen, doch ihm missfiel es, so kurz vor dem Ziel aufgeben zu müssen. Er legte eine Hand an ihre Hüfte und die andere auf ihren Arm.
»So warte doch, schöne Frau. Versprich mir erst, dass du dich mit mir triffst. Gewähre einem Pilger, der ein Jahr lang nichts als Frömmigkeit im Sinn hatte, einen netten Abend. Ich spiele dir etwas auf der Laute vor und singe dir ein Liebeslied.«
»So lasst mich gehen«, bat sie und versuchte, sich aus seinem Griff zu lösen, doch in ihren Augen lag ein ihm wohlvertrauter Glanz. »Mein Vater wird gleich schimpfen.«
Einige der Gäste hatten inzwischen die Köpfe gehoben. Große Burschen waren darunter, die offensichtlich gewillt waren, einer vermeintlich in Bedrängnis geratenen Frau zu helfen. Finster gab Martin die Blicke zurück, bevor er sich wieder Gunthild zuwandte, doch plötzlich drehte sie sich in seinem Griff, sodass er ihr einen unfreiwilligen Kuss auf die Ohrmuschel gab. Sie stieß einen Schrei aus. Da sah er aus dem Augenwinkel eine Bewegung. Hart traf eine Faust sein Gesicht. Drei Kerle standen hinter dem Tisch, Bauern oder Knechte, jeder Einzelne eine bullige Erscheinung. Über ihm erhob sich der Wirt; er war es, der die Faust geschwungen hatte. Er beugte sich vor, um den Pilgerüberwurf beiseitezuziehen und Martin die kleine, allzu schlaffe Geldkatze vom Gürtel zu reißen.
»He!«, rief Martin empört, während er sich die schmerzende Wange rieb. »Da ist mehr drin, als ich dir schulde!«
»Du schuldest mir vor allem dies.« Erneut schlug ihm der Wirt ins Gesicht, diesmal gegen die Schläfe. Martin stöhnte benommen; fast wäre er von der Bank gerutscht. Das verdammte Bier hatte ihn schwach gemacht. Der Wirt trat zurück. »Werft ihn hinaus.«
Martin biss die Zähne zusammen, stemmte den Fuß gegen den Tisch und stieß ihn um. Krüge, Humpen und eine halbgeleerte Schale mit Grütze fielen polternd zu Boden. Die Männer wichen zurück; er sprang an ihnen vorbei und drehte sich um. Hinter sich hörte er die anderen Gäste aufschreien und Stühle über den Boden kratzen, als sie sich in Sicherheit brachten.
»Wage es ja nicht, dein Schwert zu ziehen!«, rief einer der Männer, wohl der Knecht des Wirts, denn er trug über dem fleckigen Kittel einen Gürtel, in dem ein mit Fleischsaft verklebtes Beil steckte.
»Wie komme ich dazu, deinetwegen Blut zu vergießen?«, höhnte Martin, stürzte vorwärts und hob eine Faust, um den Hieb zu vergelten. Doch bevor ihm das gelang, spürte er einen Schlag im Bauch; ein weiterer Hieb, diesmal von einem der anderen Kerle, traf ihn im Gesicht und ließ ihn herumwirbeln, auf Gunthild zu. Er konnte gerade noch verhindern, auf sie zu fallen, indem er sich auf der Bank abstützte. Ihre Augen schwebten nur eine Handbreit vor seinen.
»Und dabei hatte ich heute Abend gar nicht vor, mich um ein Mädchen zu prügeln.« Er strich sich die Haare aus der Stirn und zwinkerte ihr zu. »Aber du bist es wert, mein Täubchen. Ah!«
Eine Hand hatte sich in seine Haare gekrallt und zog ihn zurück. Er rammte seinen Ellbogen in den Angreifer und taumelte weiter, gegen einen anderen Tisch, der krachend umfiel.
»Schafft das versoffene Schwein endlich hinaus!«, brüllte der Wirt. »Der schlägt ja alles zu Bruch!«
Als Martin herumwirbelte, sah er sich dem gezückten Beil gegenüber. »Wollten wir nicht auf Blutvergießen verzichten? Aber ich passe mich gern an.« Er zerrte den lästigen Überwurf beiseite und zog blank. Der Knecht starrte auf das Schwert, ließ das Beil aber nicht sinken. Martin hob das Schwert, jedoch nur, um das Wagenrad zu sich heranzuziehen. Heißes Kerzenfett tropfte auf den Knecht, der fluchend einen Schritt zurücktrat und sich durch die Haare fuhr. Schnell stieß Martin die Klinge zurück in die Scheide, sprang vor und schlug ihm das Beil aus der Hand. Dann ließ er die Faust vorschnellen, doch wegen seiner fehlenden Finger schrammte sie nur am Kinn entlang; er taumelte dem Schlag hinterher und stieß gegen den nächsten Tisch. Schmerzhaft schlug die Kante gegen seine gefüllte Blase. Er krümmte sich. Zwei kräftige Pranken rissen ihn zurück. Ein erneuter Schlag traf seine Schläfe, und ihm wurde schwarz vor Augen.
Er fand sich auf den Knien wieder, die Arme vor dem Bauch verschränkt, da er fürchtete, die vielen Humpen Bier erbrechen zu müssen. Verloren!, dachte er und sah sich nach Gunthild um. Sie hatte sich in eine Ecke zurückgezogen und kaute am Daumennagel. »Mädchen, sieh mich nicht so enttäuscht an«, stöhnte er. »Wäre ich nicht so betrunken, hätte ich dir einen besseren Kampf gezeigt. Wirklich – viel besser.«
Über ihr Gesicht huschte ein Lächeln.
Zwei Männer packten ihn und zerrten ihn auf die Füße. Erstaunt stellte er fest, dass ihm das Stehen schwerfiel. Der Boden der Gaststube schien zu schwanken. »Auf die Straße?«, fragte der Knecht.
»Wie sähe das denn aus, wenn dieser Dreckskerl vor meiner Tür liegt«, antwortete der Wirt. »Nein, schafft ihn in den Pferdestall, der hat sich für solche Fälle stets bewährt. Da kann er seinen Rausch ausschlafen. Die Pferde wird er ja wohl nicht belästigen, obwohl die vom Geruch her besser zu ihm passen.«
Darauf folgte Gelächter, das Martin in den Ohren dröhnte. Harte Finger bohrten sich in seine Arme und zerrten ihn zur Tür. Die eiskalte Abendluft klärte seinen Kopf nur unwesentlich. Immerhin nahm er wahr, wohin ihn die Männer brachten, über einen schlammigen Platz hinweg zum Stall. Das Tor schwang auf, Gestank von Pferdekot und Stroh schlug ihm ins Gesicht. Sie stießen ihn in eine Ecke, wo er bäuchlings ins Stroh fiel. All das war zu viel für ihn, er übergab sich. Danach war er froh, sich im Stroh ausstrecken zu können. Und obwohl es so kalt war, dass sein Atem zu weißen Wölkchen gefror und seine Finger klamm wurden, galt sein letzter Gedanke der Tochter des Wirts. So viel lieber als mit den Resten seines Bieres hätte er mit ihr das Strohbett geteilt.
Leises Schnauben, Wiehern und Rascheln begleiteten seinen unruhigen Schlaf. Ab und zu hörte er jemanden ein Pferd aus einem Verschlag holen oder ein anderes einstellen. Gegen Morgen weckten ihn Stimmen, die offensichtlich ihm galten.
»Das ist er? Grundgütiger! Das muss ein Irrtum sein.«
»Ich fürchte nicht. Der Wirt hat gesagt, dass wir ihn hier finden.«
»Bruder Johannes, mir ist unwohl hier drinnen, lass uns zurückgehen. Er ist es bestimmt nicht.«
Zwei Kuttenträger, dachte Martin verächtlich. Was wollten die von ihm?
Schritte raschelten im Stroh, dann rief einer der Mönche: »So schau doch, seine Hand! Genau wie Pater Alban sie beschrieben hat.«
Alban? Martins Kopf begann sich zu klären. Er setzte sich auf, wobei er ein Stöhnen nicht unterdrücken konnte. Hatte man ihm den Schädel eingeschlagen? Um sich zu vergewissern, dass es nicht so war, griff er sich an die pochende Stirn. Wenigstens konnte er dem schmerzhaften Druck in seiner Blase abhelfen. Er hob Überwurf und Hemd, band seine Bruche auf und erleichterte sich ins Stroh. Angewidert hielten die Mönche den Atem an.
Langsam drehte er den Kopf nach ihnen. Es waren zwei schwarzgewandete Benediktiner. Ängstlich beobachteten sie jede seiner Bewegungen, als könne er jederzeit aufspringen und sie mit seinem Kurzschwert erschlagen. Besaß er es überhaupt noch? Martin tastete nach seinem Gürtel, es hing daran. Auch der Beutel mit den wertvollen Reliquien war da; achtlos hatte ihn jemand ins Stroh geworfen.
»Nicht!«, rief einer der Mönche. »Es ist nicht nötig, das Schwert gegen uns zu ziehen. Wir wurden geschickt, dir ein Angebot zu unterbreiten. Im Namen Pater Albans aus dem Kloster Steinreuth.«
Martin verschnürte seine Bruche und rieb sich Augen und Schläfen, um dem Kopfschmerz Einhalt zu gebieten. Es half wenig. »Ein Angebot?«
»Ja. Du sollst ... Du mögest bitte mit uns ins Kloster kommen, damit alles besprochen werden kann.«
Allein der Gedanke, jetzt aufzustehen, machte ihn wieder müde. »Euer feiner Pater Alban kann gefälligst herkommen«, brummte er und streckte sich im Stroh aus. Bevor der Schlaf sich erneut über ihn senkte, hörte er noch, wie sie erregt miteinander flüsterten. Was immer sein Bruder von ihm wollte, es konnte nichts Gutes sein.
***
»Bist du wach?«
Ruckartig fuhr Martin hoch, als er die vertraute Stimme vernahm. Wahrhaftig, dort am Tor stand Alban; er hatte die Hände in die Ärmel seiner Kukulle geschoben und maß ihn mit ausdruckslosem Blick. Alban, sein vier Jahre jüngerer Bruder, ihm so unähnlich, wie es nur möglich war. Seine Gesichtszüge waren hager, die Lippen schmal, die Augen dunkel und hochmütig dreinblickend. Seine Haare glänzten fast schwarz, im Gegensatz zu Martins blondem, ungebändigtem Schopf, und man mochte kaum glauben, dass sie nicht nur von derselben Mutter, sondern auch demselben Vater stammten. Diese Gedanken gingen Martin jedes Mal durch den Kopf, wenn er ihn sah, was selten der Fall war. Ihrer beider Leben überschnitten sich kaum.
»Ich bin wach. Jedenfalls bemühe ich mich darum.« Martin blieb im Stroh sitzen, zog die Knie an und legte die Arme darauf. »Wie hast du mich gefunden?«
Alban zog eine Hand aus dem Ärmel und machte eine unbestimmte Geste. »Das war nicht weiter schwierig. Man hat deine Rückkehr aus dem Heiligen Land beobachtet, also schickte ich jemanden auf deine Burg. Der fand dort deinen treuen Hund Sandro, der mir sagte, du würdest die Gaststätten der Gegend unsicher machen. Dass es diese ist, erfuhr ich von einem Ordensbruder, der Zeuge wurde, wie du das Innere der Gaststube zu Kleinholz geschlagen hast.«
»Schön. Und was willst du von mir?«
»Ich?« Alban verdrehte die Augen. »Gott möge mich davor bewahren, dass ich jemals in die Lage komme, etwas von dir zu wollen. Der ehrwürdige Abt benötigt einen Söldnertrupp, der ihn nach Konstanz begleitet.«
»Was, Konstanz?« Noch immer ermattet, rieb sich Martin die Augen.
»Das ist eine Bischofs- und Reichsstadt im Süden, an einem großen See gelegen.«
»Das weiß ich!« Martin funkelte ihn wütend an. »Für wie ungebildet hältst du mich eigentlich?«
Darauf ging Alban nicht ein, was Martin Antwort genug war. »Dort tagt seit einigen Monaten das Konzilium der Heiligen Mutter Kirche, von dem selbst du gehört haben müsstest, denn die ganze Christenheit redet von nichts anderem. Sigismund, der künftige Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, hat es einberufen, um das unerträgliche Schisma zu beenden, das die Kirche in ihren Grundfesten erschüttert.«
Martin stieß ein verächtliches Schnauben aus. Natürlich hatte er während seiner Reise davon gehört. Er wusste auch, dass es zwei Päpste gab, einen in Rom, einen im französischen Avignon. Solange er lebte, war das schon so. Gab es seit einigen Jahren nicht sogar drei? »Und dafür hast du mich deinem Abt empfohlen? Das kann ich kaum glauben.«
»Ich habe ihm empfohlen, sich wie jeder reisende Mönch allein dem Schutz Gottes anzuvertrauen. Die Wehr des Mönches ist das Wort, aber er besteht auf einer bewaffneten Begleitung. Leider bist du weit und breit der Einzige, von dem ich weiß, dass er dazu taugt. Im Übrigen habe ich ihm nicht gesagt, dass du mein Bruder bist, und es wäre mir recht, wenn du das ebenfalls verschweigen würdest.«
»Wie du willst«, knurrte Martin. Am liebsten hätte er das Angebot seines tugendhaften, gelehrten Bruders, der ihn sogar verleugnete, abgelehnt. Aber er brauchte das Geld. Ohne ein weiteres Wort stemmte er sich hoch und ging zu dem Verschlag hinüber, in dem sein Schecke stand. Er führte ihn heraus, sattelte ihn und schwang sich noch im Stall hinauf. Alban würdigte er keines Blickes, als er an ihm vorbeiritt und das Pferd in Richtung der Abtei lenkte. Hinter sich hörte er Albans Gewand rascheln. Sein Bruder musste schnell gehen, um Schritt zu halten, und das tat er klaglos.
»Wer wird denn reisen?«, fragte Martin, als das nahegelegene Klostergebäude vor ihnen auftauchte. »Nur der Abt?«
»Er und ich als sein Schreiber.«
»Du auch?« Martin lachte, dass seine Stimme bis zur Klosterpforte hallte. »Ein hochnäsiger Mönch und ein gestrenger Abt, welche Freude!«
In den Schenken der Umgebung sprach man von jenem Abt als einem unangenehmen Menschen, streng und aufbrausend. Er schien genau die Sorte von Auftraggeber zu sein, mit der Martin leicht in Streit geriet. Und der Weg nach Konstanz war weit. Er sah zu Alban hinunter. Sein Bruder schaute unter zusammengeschobenen Brauen besorgt drein, als sei er sich dieser Gefahr nur allzu bewusst.
KAPITEL 2
An der Klosterpforte ließ Martin seinen Schecken in den Händen eines Knechts zurück und folgte Alban durch kahle Gärten. Sein Bruder führte ihn jedoch nicht zur Abtei, sondern zu einer Hütte, in deren Nähe ein Brunnen stand. In ihrem Inneren befand sich ein großer Waschzuber.
»Was soll der Unsinn?«, grollte Martin.
»So kannst du nicht vor den Abt treten.« Alban streckte eine Hand in den Zuber, bevor er sie wieder in den Ärmeln seiner Kukulle verschwinden ließ. »Ich hatte darum gebeten, den Zuber zu füllen. Das Wasser ist sogar ein wenig wärmer geworden. Wenn es frisch aus dem Brunnen geschöpft wird, ist es wirklich unangenehm kalt. Eigentlich wäre es jetzt meine Aufgabe, dir die Füße zu waschen, immerhin bist du so etwas wie ein Gast. Aber da du ja ohnehin baden wirst, können wir wohl auf dieses Ritual verzichten.«
»Das ist in meinem Sinne.« Martin schob ihn hinaus und warf die Tür zu.
»Da liegt auch Seife«, rief Alban. In der Tat, ein kleines, bröckeliges und fast schwarzes Stück Seife lag auf einem Hocker, dazu ein Leinensäckchen mit Zahnpulver und ein ordentlich zusammengefaltetes Tuch. Martin entledigte sich seiner Kleidung und stieg in den Zuber. Um der Kälte Herr zu werden, musste er die Zähne zusammenbeißen. Er streckte sich nach der Seife. Nötig hatte er dieses Bad ohne Zweifel. Auch ein Rasiermesser fand sich auf dem Hocker. Er rieb sich die Zähne ab und entledigte sich des Pilgerbarts, bis er zufrieden über sein geglättetes Gesicht strich. Vielleicht sollte er heute Abend ins Gasthaus zurückkehren, um noch einmal nach der Tochter des Wirts zu schauen. So hätte sich das Baden wenigstens gelohnt, denn ob er dem Abt schmutzig oder sauber gegenübertrat, war ihm gleich.
Angekleidet trat er ins Freie, nur den Pilgerüberwurf ließ er in der Hütte zurück, denn seine Reise war schließlich vorbei. Alban stand im Garten, offenbar ins Gebet vertieft. Als Martins Schritte auf dem steinigen Weg erklangen, drehte er sich um.
»Gut«, sagte er nur und ging voraus. »Der Abt erwartet dich. Tu uns beiden um Gottes willen den Gefallen und benimm dich.«
»Und du halte dich mit deinen Maßregelungen zurück«, gab Martin grimmig zurück.
Er kannte die Benediktinerabtei Steinreuth, denn sie befand sich nur einen Tagesritt von seiner Burg entfernt. Als sein Bruder als zehnjähriger Novize hier eingetreten war, was nun zwölf Jahre zurücklag, hatte er ihn begleitet und die Gelegenheit genutzt, durch Gänge und Kammern zu streifen. Das Innere war so düster, wie er es in Erinnerung hatte. Schweigend und tief ins Gebet versunken, schritten Mönche und Laienbrüder vorüber. Alban führte ihn durch den Kreuzgang, blieb vor einer Tür stehen und klopfte leise. Es kam keine Antwort. Als Martin gerade überlegte, ob er einfach die Tür aufstoßen sollte, gestattete ihnen endlich eine Stimme, einzutreten.
Der Abt saß an einem wuchtigen Schreibtisch, vor sich ein Pergament, in dessen Lektüre er versunken war. Zwei Spitzbogenfenster ließen das Licht über seine Schultern auf den Tisch strömen. Er nickte ihnen zu, ohne aufzusehen, und las weiter. Alban bedeutete Martin, in der Mitte des Raumes stehenzubleiben. Noch immer beachtete der Abt sie nicht. Martin ärgerte sich über dieses geringschätzige Verhalten, nutzte aber die Gelegenheit, seinen Auftraggeber genauer in Augenschein zu nehmen. Er hatte schon von vielen Menschen Sold empfangen und konnte seine Herren zumeist gut einschätzen. Dieser hier – er nannte sich nach dem heiligen Rogatus – machte keine Ausnahme, er schien seinem schlechten Ruf zu entsprechen. Martin schätzte ihn auf vierzig oder fünfundvierzig Jahre, sein Haarkranz war von dunklem Braun, seine Gestalt schmal. Nach den Tintenspritzern auf seinen Händen zu urteilen, las und schrieb er viel.
Das Warten wurde Martin lästig; breitbeinig baute er sich vor dem Schreibtisch auf. Schließlich legte der Abt das Schriftstück beiseite und hob den Kopf, um ihn seinerseits zu mustern. Dann erhob er sich und nahm Alban beiseite. »Etwas ungehobelt, oder? Er scheint sich gar nicht für sein Benehmen im Gasthaus zu schämen.«
»Schämen?«, erwiderte Alban mit hörbarem Unbehagen. »Ich bezweifle, dass er weiß, was das ist.«
Endlich wandte sich Rogatus an Martin. »Pater Alban hat mir gesagt, du seist ein Ritter und dir gehöre die Burg Thiersreuth. Ich wusste gar nicht, dass es hier in der Gegend so eine Burg gibt, das scheint ja ein rechtes Vogelnest zu sein. Du hast das Geld wohl dringend nötig?«
»Welcher Ritter hat das nicht«, erwiderte Martin, ohne recht zu wissen, ob er sich ärgern sollte, dass der Abt ihm die ehrenvolle Anrede, die einem Ritter gebührte, verweigerte.
»Er hat auch erwähnt, dass du um des Geldes willen zweimal im Heiligen Land warst – als Berufspilger, der die Mühsal der Reise an anderer Leute statt auf sich nimmt. Auch wenn diese Vorgehensweise üblich sein mag, ich finde sie beschämend.«
Martin schämte sich dessen nicht im Mindesten. Den Erlös dieser Fahrten hatte er dringend nötig gehabt, da er sein letztes Geld beim Kartenspiel verloren hatte. Wer reich war, konnte sich den Weg in den Himmel erkaufen, und wer es nicht war, musste die eigenen Füße bemühen. So war es eben.
»Was sagst du dazu?«, drängte Rogatus.
»Was soll ich dazu sagen?«
»Dir fällt nichts ein? Auch nicht, dass Berufspilger als Rabauken gelten? Dass du auch so einer bist, hast du ja bewiesen. Soll ich wirklich einen wie dich anheuern?«
»Wollt Ihr wissen, ob ich unterwegs eine Herberge zerschlage? Ich habe nicht die Absicht, aber man weiß ja nie!«
Der Abt tat einen tiefen Atemzug, als wolle er alle Geduld bemühen, deren er fähig war. »Was ist mit deiner Hand? Behindert dich diese Verstümmelung irgendwie?«
»Nein«, erwiderte Martin, in einem Ton, der keinen Zweifel duldete.
»Wie ist das passiert?«
Schwer atmete Martin ein und aus. Wieder die verhasste Frage. »Vor fünf Jahren kämpfte ich in der Schlacht bei Grünwald ...«
Der Abt unterbrach ihn mit einem angewiderten Schnauben. »Das genügt, mir steht nicht der Sinn nach blutigen Rittergeschichten. Es sieht jedenfalls nicht danach aus, als könntest du uns damit vor Wegelagerern schützen.«
Martins Augen verengten sich vor unterdrücktem Zorn. »Ich kann es. Und falls es Euch beruhigt, so bin ich ja nicht allein. Oder wollt Ihr darauf verzichten, dass ich eine Lanze mit mir führe?«
»Eine Lanze? Du meinst einen Trupp Männer?« Rogatus rieb sich die Nase, als erschöpfe ihn das Gespräch. »Natürlich, natürlich. Wie lange wird es dauern, die anzuwerben? Wir wollen in einer Woche aufbrechen.«
Martin zwang sich, ruhig zu antworten. »Eine Woche genügt. Ich werde zum Markt Redwitz reiten, dort finden sich immer brauchbare Männer. Sie halbwegs in Zucht und Ordnung zu bringen muss dann unterwegs geschehen.«
»Zucht und Ordnung? Diese Worte passen nicht zu dir. Alban, ich bin mir wirklich nicht sicher, ob ich deiner Empfehlung trauen soll.«
»Ich traue ihr selber kaum«, sagte Alban. »Aber es gibt keinen anderen. Entweder Ihr vertraut Euch ihm an, oder wir müssen allein reisen.«
»Verbürgst du dich für ihn?«
»Was? Ich? Ah ...«, Alban schaute entsetzt drein. »Verbürgen? Für ihn?.«
»Ja! Was soll denn diese Begriffsstutzigkeit? Ich will wissen, ob ich ihm mein Leben anvertrauen kann. Er und seine Truppe könnten uns auch niederschlagen, ausrauben und mitten im Wald aussetzen!«
»Das ... das wird er bestimmt nicht tun.«
Martin lachte. »Aber ganz sicher bist du dir da nicht, wie?«
Alban räusperte sich. »Nein, Vater Abt, das ist nicht zu befürchten.«
Rogatus seufzte tief auf und wandte sich wieder an Martin. »Gut, gut, beruhigen wir uns. Ich werde mich Gott anempfehlen, dass er über mich wacht, während ich mich in deine Hand begebe. Wir reisen in einem geschlossenen Wagen, den einer der Klosterknechte lenkt. Zunächst bis Ingolstadt, von dort folgen wir der Donau. Ob wir ein Schiff besteigen, hängt davon ab, was dafür verlangt wird. Ich rechne damit, dass wir Mitte des nächsten Monats in Konstanz ankommen, wo wir uns der causa fidei widmen werden.«
Martin hob die Schultern. »Das heißt?«
»Ach, das sagt dir natürlich nichts. Also gut, hör zu. Es gibt drei Themen, derentwegen sich das Konzil versammelt. Das erste ist die causa unionis, die Überwindung des Schismas. Dass derzeit drei Päpste Anspruch auf das Erbe Petri erheben, dürfte dir bekannt sein. Nur einer soll das Konzil als Papst verlassen. Das zweite Thema ist die besagte causa fidei, die Bekämpfung der falschen Lehren des englischen Ketzers Wyclif, der zwar längst tot ist, dessen Lehren aber nach Prag gelangten und seitdem von dem böhmischen Magister Johannes Hus verbreitet werden. Dabei schert Hus sich weder um den Bann, den die Kirche über ihn verhängte, noch um sonstige Verbote. Bleibt als drittes Ziel die causa reformationis, eine gemäßigte Reform der Kirche. Bis dieses dritte Ziel erreicht ist, dürften wir jedoch längst wieder zurück sein. Kannst du meinen Ausführungen folgen?«
»Ja.« Martin bedauerte es zutiefst, nachgefragt zu haben.
»Voriges Jahr wurde Johannes Hus nach Konstanz gerufen, um sich für seine schändlichen Ansichten zu verantworten. Und da seine Lehre auch hier in dieser Gegend Auswirkungen zeigt, reise ich zum Konzil, um darüber auszusagen. Pater Alban und ein Geleitbrief des Rex Romanorum Sigismund werden mich begleiten.« Der Abt deutete auf den Schreibtisch, auf dem Dutzende von Schriftstücken lagen. »Hast du je von Hus gehört?«
Martin nahm an, dass er nun Rechenschaft über seine Gesinnung ablegen sollte. Er warf Alban einen bohrenden Blick zu, der sofort die Augen senkte. Sein Bruder, so viel wusste Martin, war diesen häretischen Lehren heimlich zugetan. »Das habe ich, halte aber nichts von seinem Geschwätz. Ich glaube, was die Kirche sagt, und denke nicht weiter darüber nach.«
»Ein Mann der Tat, nicht des Wortes.« Rogatus’ Nicken wirkte beinahe anerkennend. »Diese Lehren entstanden in einer Universität, und so lesen sie sich auch. Jemand wie du kann sie gar nicht verstehen.«
Martin hatte keine richtige Vorstellung davon, was eine Universität war, auch nicht, was genau diese ketzerischen Lehren besagten. Aber was er gehört hatte, konnte er nicht glauben, zu ungeheuerlich klang es: Das Wort der Bibel habe mehr Gewicht als das des Papstes; es sei ein Dienst an Christus, einem fehlgeleiteten Papst nicht zu gehorchen. Angeblich lehrte Hus sogar, der Abendmahlskelch stehe jedem Gläubigen zu, nicht nur den Priestern. Wer sollte derart unsinnigen Predigten Glauben schenken, außer natürlich sein versponnener Bruder, der seine Nase schon immer viel zu tief in Schriftstücke gesteckt und irgendwann einmal eines dieses Ketzers erwischt hatte.
»Gut«, sagte Rogatus. »Ich zahle dir für jeden Monat, den du in meinem Dienst stehen wirst, zwanzig ungarische Rotgulden. Davon wirst du alles selbst bestreiten, den Sold für deine Männer und die Kosten eures Aufenthaltes. Zehn Söldner, keiner mehr, keiner weniger, und kein Lumpenpack, ist das klar? Du bekommst den Lohn für die ersten zwei Monate nach unserer Ankunft in Konstanz, den Rest nach unserer Rückkehr.«
»Vierzig Rotgulden«, warf Martin ein. »Mit dem Rest bin ich einverstanden.«
»Vierzig?«, fauchte Rogatus. »Wofür hältst du dich? Für den heiligen Martin von Tours? Fünfundzwanzig! Und nun kein Wort mehr!«
Martin deutete ein Nicken an und machte auf dem Stiefelabsatz kehrt. Ein zufriedenes Lächeln huschte über sein Gesicht. Die letzte Pilgerfahrt hatte seine Schulden getilgt, und dank des neuen Auftrages würde er in den nächsten Monaten keine allzu drückenden Geldsorgen haben. Und wenn es stimmte, was man sich erzählte, war Konstanz in diesen Tagen genau die Stadt, in der er sein wollte. Hinterher würde er vermutlich wieder arm sein, aber das war er ohnehin fast immer. Und wo ließ sich der Sold besser unter die Leute bringen als in der Stadt, die derzeit der Mittelpunkt der Christenheit war, in der es in jeder Schenke hoch herging, ein Dutzend Sprachen durch die Gassen schwirrte und auf jeden Pfaffen eine Hure kam?
***
Es schneite; unsicher glitten die Pferdehufe über den schlammigen Weg. Martin zog sich die Kapuze seines Mantels tief in die Stirn. Noch ein Monat, zwei vielleicht, voller Kälte, Nässe und Schnee. »Dort unten wird es wärmer sein«, sagte er zu Sandro, der neben ihm ritt. »Dort blühen die Bäume einen Monat früher als hier.«
»Hoffentlich.« Sandros Blick wurde finster, als er zum bedeckten Himmel blickte. »Das Fichtelgebirge ist eine hübsche Gegend, aber manchmal vermisse ich die Zypressen meiner Heimat.«
»Du wirst dich doch nicht nach Italien absetzen?« Martin wollte ihm auf die Schulter klopfen, doch die Kälte hielt ihn von jeder überflüssigen Bewegung ab.
»Das habe ich nicht vor, allerdings ist es sowieso sinnlos, zu weit vorauszudenken. Wer weiß, was uns in Konstanco widerfährt? Aber was auch immer, es wird wundervoll werden, dico bene? Hier wurde mir ja schon der Hintern steif vor lauter Nichtstun. Du pilgerst ins Gelobte Land, und was tue ich? Auf deine kleine Burg aufpassen, ah, welch eine langweilige Aufgabe das doch war! Ich will reisen und Abenteuer erleben.«
Martin brummte zustimmend. Er hatte Sandro in Venedig kennengelernt, auf seiner ersten Pilgerfahrt. Während der gemeinsamen Weiterreise waren sie zu Freunden geworden. Und da Sandro ebenfalls keine Familie besaß, war er Martin nach Thiersreuth gefolgt. Gemeinsam hatten sie Söldnertrupps in Schlachten und Scharmützeln befehligt; bis weit ins böhmische Land hatte sie ihr Weg geführt. Nur bei der zweiten Pilgerfahrt war Sandro nicht dabei gewesen, denn er hatte keinen Auftraggeber gefunden. Martin war froh, ihn diesmal wieder an seiner Seite zu wissen.
»Willige Frauen, prall gefüllte Gasthäuser, Musikanten und Gaukler!«, rief Sandro und schüttelte den Schnee aus seinen schwarzen Locken. »Ich hatte ohnehin darauf gehofft, dass uns irgendjemand wegen dieses Konzils anheuert. Die ganze Welt reist ja nach Konstanco, scheint es. Nur, warum müssen wir ausgerechnet Mönche begleiten? Dein Bruder wirkte auch alles andere als glücklich, dass er sich ausgerechnet dir anvertrauen muss.«
»Oh, fast hätte ich es vergessen: Alban will nicht, dass jemand erfährt, dass wir Brüder sind, und hat sich Schweigen ausbedungen. Das gilt dann auch für dich.«
»Was? Und darauf hast du dich eingelassen?«
»Ja. Ach, vergiss ihn. Mein Bruder war schon immer wunderlich.« Martin setzte die ernsteste Miene auf, deren er fähig war. »Jedenfalls kommt einiges auf uns zu.«
»Was meinst du damit?« Geradezu ängstlich sah Sandro herüber. »Kein Fluchen, kein Streiten, Gebetszeiten einhalten und so weiter – meinst du das?«
Martin lachte. »Si!«
Entsetzt rollte Sandro die Augen. »Tremendo! Aber wenn du das kannst, dann ich wohl auch, mio amico. Allerdings würde ich jede Wette eingehen, dass du es nicht schaffst. Wir sind da.« Sie zügelten ihre Pferde vor einer kleinen Pfarrkirche, die sich inmitten einer unscheinbaren Ansammlung von Katen erhob. Auf dem Feld wanderte ein Mann umher, dicht an der Rosslin, die sich schäumend gegen das eisbewehrte Ufer drückte. Kopf und Schultern des Mannes waren weiß vom Schnee. Er war tief ins Gebet versunken und bemerkte die beiden Reiter erst, als er dicht vor ihnen stand. Er hob den Kopf. »Konstanz«, sagte er mit einem Blick zum Packpferd. »Richtig?«
»Ja«, erwiderte Martin. »Pater Albrecht, ich erbitte Euren Segen für unsere Reise.«
»Kommt.« Der Pater ging zu einer der Katen hinter der Kirche; hier banden sie ihre Pferde unter dem Vordach fest. Die Tür quietschte in den Zapfen, als er sie öffnete. Es war ein bescheidenes Pfarrhäuschen, dunkel und kalt, trotz des Feuers, das in der Herdstelle prasselte. Ohne die Mäntel abzulegen, setzten sich Martin und Sandro an einen Tisch dicht neben dem Herd. Albrecht rieb sich die Hände über der Glut, bevor er sich daranmachte, Wein zu würzen und in einem Krug zu erwärmen. Dann erst nahm er den nassen Umhang ab und warf ihn über eine Leine, die quer durch den Raum gespannt war.
»Konstanz«, wiederholte er, als er sich mit dem Wein zu ihnen setzte. Er reichte Martin den Krug. »Wohin auch sonst? Ich hätte mir denken können, dass du eine Möglichkeit finden würdest, wieder auf Reisen zu gehen. Schließlich kenne ich dich, seit ich dir vor zwölf Jahren den Segen gab, als Knappe mit einem Ritter zu ziehen. Du warst schon damals ein rastloser Kerl und bist es geblieben.«
Langsam nickte Martin, dann trank er und gab Sandro den Krug. Pater Albrecht kannte ihn gut, vielleicht besser als jeder andere Mensch, daher wollte er seinen Segen haben, auch wenn er dafür eine stattliche Anzahl von Mahnungen über sich ergehen lassen musste. Dennoch überraschte ihn der eindringliche Ton des Paters, als er sagte: »Mir wäre es lieber, wenn du nicht gehst. Es könnte dort unten gefährlich für dich werden.«
»Weshalb denn das? Gefahrlos ist so eine Reise nicht, aber ...«
»Nicht die Reise! Die Stadt meine ich. Die Stadt!«
»Was ist mit der Stadt?«, fragte Sandro.
»Sie ist ein Sündenbabel. Sie ist das Sündenbabel. Die Geistlichkeit findet sich dort zusammen, angeblich um die Kirche zu reformieren; sie nennen es die causa reformationis. Aber es wird sich nichts ändern. Sie werden weiter das Geld der armen Leute scheffeln und kleine Pfarren wie diese verkommen lassen. Und gleichzeitig berauschen sie sich auf Maskenbällen und Tanzvergnügen, während ihnen das Geld aus allen Taschen fällt. Es ist eine Schande, und jeder, der daran teilhat, gefährdet sein Seelenheil.«
»Also, ich habe davor keine Angst. Ein wenig Vergnügen hat noch niemandem geschadet«, sagte Sandro grinsend und trank weiter. Martin ahnte jedoch, dass Pater Albrecht noch anderes beschäftigte als nur die Sünden des Fleisches, denen er und Sandro selbstverständlich verfallen würden.
»Gefährlicher als Palästina kann doch dieses kleine Konstanz nicht sein«, wiegelte er ab. Pater Albrecht rieb sich die Wange, sein Blick ruhte auf Sandro.
»Lass uns bitte allein«, sagte er. Sandro klemmte sich den Krug unter den Arm und trat ins Freie, wobei er mit übertriebener Geste den Mantel fest um sich schlang und zum Himmel hinaufsah, aus dem nach wie vor dicke Flocken fielen. Albrecht schloss die Tür und kehrte zu Martin zurück.
»Immer wenn du fortgehst, dreht sich mir vor Sorge der Magen um.«
»Reisen sind nun einmal abenteuerlich.« Martin verschränkte die Arme, sodass seine verstümmelte Hand in der Achsel verborgen war. Das tat er immer, wenn er das Gefühl hatte, durchschaut zu werden. Er hasste diese Geste, konnte sie sich aber nicht abgewöhnen.
»Ja, gewiss. Oh, ich habe natürlich gehört, dass du ein Gasthaus zu Kleinholz geschlagen hast.«
»Wie, jetzt ist es schon ein ganzes Gasthaus? Davon weiß ja nicht einmal ich.«
»Lass die Scherze. Wie lange willst du dich noch in Wirtshäusern um irgendwelche Frauen prügeln, die du sowieso nach einer Nacht vergessen hast? Ist es das, wonach du für den Rest deines Lebens strebst – dieses Söldnerdasein, die Pilgerreisen für fremde Leute? Du könntest es mit einer friedlicheren Arbeit versuchen, statt mit dem Schwert durch die Lande zu reiten und irgendwelche Konzilteilnehmer zu schützen.«
»Und was sollte das sein?«
»Ach, Martin ...« Pater Albrecht klopfte ihm auf die Schulter. »Ich hoffe für dich, dass du irgendwann den Wunsch verspürst, zu heiraten und sesshaft zu werden. Warst du in den letzten fünf Jahren eigentlich länger als eine Woche daheim auf deiner Burg? Nimm dir eine Frau, und Gott wird dir offenbaren, was zählt im Leben. Mit deinen sechsundzwanzig Jahren wird es höchste Zeit. Aber wahrscheinlich werdet ihr euch in Konstanz in wollüstigen Abenteuern zu übertreffen suchen. Und dafür willst du meinen Segen?«
Nun lächelte Martin. »Ich bitte Euch inständig darum, Pater.«
»Na schön. Jetzt gleich? Ihr könnt gerne hier übernachten, wenn ihr mögt.«
»Nein, wir wollen nach Thiersheim, um dort die Männer einzusammeln, die ich angeworben habe.« Sie gingen nach draußen, wo Sandro gelangweilt auf und ab stapfte. Albrecht winkte ihn heran, und gemeinsam beugten sie die Knie.
Benedicat tibi Dominus et custodiat te ...
Martin spürte die warme Hand des Paters auf seiner Schulter. Er verstand kein Latein, erkannte nur hin und wieder einige Wörter und Sprüche. Doch er musste nicht verstehen, was Pater Albrecht sagte. Die ruhige, gleichmäßige Stimme genügte, ihm den Segen zu vermitteln. Was immer ihn auf dieser Reise erwartete, er wollte nicht glauben, dass es allzu bedrohlich war. Und sein zielloses Dasein? Mochten ihn auch die mahnenden Worte nicht unbeeindruckt gelassen haben, so verspürte er wenig Lust, darüber nachzudenken. Was nach dieser Reise kam? Da hielt er es mit Sandro: Zu weit vorauszudenken war sinnlos.
Nachdem sie sich erhoben hatten, drückte Pater Albrecht ihre Hände. »Vergesst das Beten und Almosengeben nicht, und besucht auch ab und zu die Messe, ja? Ach, eigentlich hätte ich euch die Beichte abnehmen sollen, aber dann säßen wir ja morgen noch hier.«
Martin band seinen Schecken los, saß auf und ergriff die Zügel, Sandro tat es ihm gleich. Martins Blick fiel auf den Weg zurück, den sie gekommen waren. Der Schneeschauer hatte aufgehört, und jetzt konnte er in der Ferne auf einer Anhöhe die fahlen Umrisse des Wohnturms sehen, der zu seiner kleinen Burg gehörte. Sie war seinem Vater als Lehen gegeben worden; der Name Thiersreuth und das Wappen mit dem Reh und der Tanne hatten einst etwas gegolten in dieser Gegend. Als Jörg von Thiersreuth gestorben war, hatte Martin das Lehen geerbt und in wenigen Jahren verkommen lassen. Jetzt lebten nur noch fünf Bedienstete innerhalb der Mauern. Martin schaffte es gerade so, die paar Knechte und Mägde zu bezahlen, und ihr Bleiben verdankte er nur der Tatsache, dass sie ihn von Kindesbeinen an kannten. Heute galt der Name derer von Thiersreuth nur noch wenig.
»Na, schon Heimweh?«, riss Sandro ihn aus seinen Gedanken.
»Gott bewahre. Ich bin froh, wenn wir endlich unterwegs sind.«
»Wer ist eigentlich der Konzilsreisende, der dich angeheuert hat?«, fragte Albrecht.
»Rogatus von Steinreuth.«
»Oh.« Der Pater verzog das Gesicht, als könne er sich nicht entscheiden, ob er lachen oder aufstöhnen sollte. »Dafür ist wohl dein Bruder verantwortlich? Ich hätte ihn für klüger gehalten. Aber vielleicht ist das ja eine Prüfung Gottes. Es ist nicht schwierig, sich auszumalen, dass du mit Rogatus aneinandergerätst. Falls das nicht bereits geschehen ist.«
Martin winkte ab. »Ist es nicht. Wir haben lediglich festgestellt, dass wir uns nicht mögen.«
Albrecht trat dicht an den Schecken heran, berührte die Nüstern und blickte eindringlich zu Martin herauf. »Hast du deinen Anhänger auch nicht vergessen?«
Mit dem Daumen griff Martin in den Ausschnitt seines Hemdes, um das silberne Kettchen zu zeigen. Er konnte den Anhänger nicht vergessen, denn er trug ihn immer.
»Gut.« Albrecht schlug ein Kreuz und murmelte, wie zu sich selbst: »Es ist eine Prüfung Gottes. Es muss so sein ...« Er nickte ihnen zu und stapfte zurück zu seiner Kate. Seufzend stieß Martin seinem Schecken die Sporen in die Flanken.
KAPITEL 3
Alban wartete jeden Tag auf einen Zwischenfall, doch in den ersten beiden Wochen verlief die Reise friedlich. Immer wieder stießen sie auf Spuren von Wegelagerern, aber Martins Söldnertrupp zeigte die nötige abschreckende Wirkung. In den Städten und Dörfern waren sie dank des Geleitbriefes des Königs keiner Gefahr ausgesetzt, und des Nachts fanden sich Klöster oder Herbergen, die sie aufnahmen. Die Wege waren in erbärmlichem Zustand und der Wagen langsam, sodass Alban oft ausstieg und ein Stück nebenherlief. Rogatus hingegen ließ sich selten außerhalb des Wagens blicken, und dann auch nur, um sich diskret in die Büsche zu schlagen. Die Söldner machten darum kein solches Aufheben, sie schlugen ihr Wasser mitten auf dem Weg ab, was Rogatus zu peinlich berührtem Kopfschütteln veranlasste.
»Ich freue mich, bald wieder zivilisierte Menschen um mich zu haben«, verkündete er. Sie befanden sich geschätzte zwanzig Meilen von Konstanz entfernt und hatten inzwischen andere Reisegruppen gesichtet. Zu einem Zusammenschluss war es nicht gekommen, denn der Abt drängte zur Eile. Selbst das täglich vorgeschriebene Lesen des Missales vernachlässigte er.
Während Rogatus meistens nur vor sich hin starrte, schaute Alban aus dem Wagenfenster, beobachtete die langsam an ihnen vorbeiziehende Landschaft oder las in seiner Bibel, seinem Messbuch oder in den Lehrbüchern alter Kirchenväter. Auch sein Kräuterbüchlein hatte er bei sich, ebenso einen kleinen Vorrat getrockneten Heilkrauts. Ihm oblag es, während der Reise auftretende Beschwerden zu behandeln, und er bedauerte es, dass sie im März stattfand, wo es wenig zu sammeln gab. Doch je weiter sie in den Süden kamen, desto spärlicher wurde der Schnee.
Gelangweilt blätterte Alban in dem Kräuterbüchlein, während unter ihm der Wagen ruckelte. Er hatte es nicht nur geschrieben, sondern auch illuminiert. Schlichte Zeichnungen waren es, einfach zwischen den Text geworfen, um die Kräuter bestimmen zu können – nichts, was das wahre Ausmaß seines Könnens auch nur ansatzweise verriet.
Es lag lange zurück, dass er seiner Leidenschaft, der Kalligraphie, nachgegangen war, und in Konstanz würde er dies schon gar nicht tun. Keinesfalls wollte er seinen eitlen Leidenschaften frönen, während gleichzeitig der Magister Hus auf das Urteil der Kirche wartete. Alban blickte vorsichtig zu Rogatus. Immer, wenn er an Hus dachte, fürchtete er, der Abt könne es ihm vom Gesicht ablesen.
Der Abt reiste nach Konstanz, um dazu beizutragen, dass Johannes Hus seine Lehren widerrief und ein hartes Urteil über ihn gesprochen wurde. Er, Alban, jedoch hoffte, dazu beitragen zu können, dass das Urteil milde ausfiel. Nur wie, das wusste er beim besten Willen nicht. Im Gefüge des Klerus war er nur ein kleines Licht. Aber der Gedanke, im entlegenen Steinreuth zurückzubleiben, während Rogatus sich zum Konzil aufmachte, war ihm unerträglich gewesen. Wenigstens vor Ort wollte er sein und einen Blick auf seinen heimlichen Meister erhaschen. Das sollte nicht allzu schwierig werden, denn wie er gehört hatte, wohnte Hus in einer bescheidenen Herberge und predigte dort im kleinen Kreise interessierter Menschen. Möglich war das nur, weil er unter dem persönlichen Schutz des Königs stand, der ihm freies Geleit zugesagt hatte. Und Johannes XXIII., der als einziger der drei Päpste in Konstanz weilte, hatte vorläufig das Interdikt sowie die Exkommunikation gegen ihn aufgehoben – die Lage war also keineswegs hoffnungslos. Vielleicht tröstete es Hus ja, wenn er erfuhr, dass seine Lehren auch im abgelegenen Kloster Steinreuth einen Menschen erreicht hatten, der im Geist an seiner Seite stand. Mehr als diesen kleinen Dienst würde Alban ihm wohl nicht erweisen können.
Und vielleicht ... vielleicht war doch mehr möglich. Gottes Wege waren unergründlich.
Ein besonders heftiger Ruck schreckte ihn aus seinen Gedanken hoch. Der Wagen hielt. Rogatus sah auf. »Schon wieder ein Schlagloch.«
»Ein sehr tiefes diesmal«, bestätigte Alban. »Wir werden wohl aussteigen müssen.«
Draußen erklangen Schritte und das Gemurmel der Söldner, die näher traten, um die Sache zu begutachten. Martin ritt so dicht heran, dass der Schweif seines Pferdes gegen den Wagenkasten schlug. Unwillig reckte sich Rogatus nach der Tür, um sie aufzustoßen.
»Bleibt im Wagen«, befahl Martin.
»Warum?«, rief Rogatus ärgerlich. »Mit unserem Gewicht bekommt ihr den Wagen doch nicht flott!«
»Die Schlaglöcher waren mit Geflecht abgedeckt.«
»Ach! Und was bedeutet das?«
Martin antwortete nicht, sondern lenkte sein Pferd ein Stück vom Wagen fort. Gleichzeitig legte er die Hand auf den Schwertgriff.
»Es bedeutet«, murmelte Alban, der plötzlich einen Kloß im Hals hatte, »dass wir überfallen werden.«
»Jesusmariaundjosef!«, entfuhr es Rogatus, der hastig das kleine Holzkreuz, das an seinem Hals hing, küsste. Vorsichtig lugte Alban aus dem Fenster. Auch ihm war danach, ins Gebet zu versinken, doch er musste sehen, was sein Bruder tat. Wenn Martin versagte, war es auch sein Versagen, obwohl das nicht mehr von Belang sein würde, wenn sie alle tot am Wegesrand lagen.
Schweigend standen die Söldner da. Nur das leise Schnauben der Pferde und das allgegenwärtige Vogelgezwitscher durchschnitten die Stille.
Er wusste nicht so recht, ob er sich von dieser bunt zusammengewürfelten Truppe aus Deutschen und Böhmen beschützt fühlen sollte oder nicht. Sechs der Männer besaßen Pferde; drei hatten Brigantinen am Leib, gefütterte Wämser mit innenliegenden Metallplättchen. Auch Martin trug unter seinem Mantel so ein Wams, und es sah kaum weniger mitgenommen aus als die der anderen. Seinen standesgemäßen Brustpanzer hatte er wahrscheinlich in seiner ständigen Geldnot verkaufen müssen. Trotzdem bot er einen beeindruckenden Anblick, wie er groß und breitschultrig auf dem Pferderücken saß. Gemächlich zog er sein Schwert; das metallische Zischen durchschnitt die Luft. In diesem Augenblick erinnerte er wahrhaftig an Martin von Tours, einen jener Heiligen, welche die Reisenden beschützen.
Es raschelte im Unterholz. Männer näherten sich. Sie waren deutlich in der Überzahl, jedoch noch schlechter ausgerüstet als Martins Trupp. Junge Burschen waren darunter, fast noch Kinder, die Gesichter hager und die Füße mit Lumpen umwickelt. Leibeigene vermutlich, die unter zu hoher Abgabenlast litten. Ob sie wussten, welch fette Beute hier zu holen war? Abgesehen vom Lohn der Söldner befanden sich in der Reisetruhe seines Herrn ein wertvolles Kreuz und Geschenke für die Abtei, in der sie Quartier beziehen würden. Allein die Pferde waren ein Vermögen wert.
Martin ließ seine Männer nicht angreifen. Er wartete einfach ab – und das sehr ausgiebig. Voller Ungeduld knetete Rogatus seine Finger. »Was wird das denn jetzt? Warum greift er nicht an?«, zischte er mühsam beherrscht. Martin jedoch hatte sein Schwert quer über den Schenkeln liegen und starrte die Fremden nur an. Einer der Jungen ließ seinen Spieß fallen und wich ins Unterholz zurück. Seine Flucht brachte Unruhe in die Reihe der Wegelagerer. Hatte Martin es darauf angelegt? Da bemerkte Alban einen Reiter, der sich zuvor im Hintergrund gehalten hatte und nun sein Pferd zwischen den Männern hindurchlenkte. Er war tatsächlich im Besitz eines Schwertes; wohl ein verarmter Ritter, den die Not zwang, Reisende auszurauben. Sein Blick war unsicher. Sicherlich war er davon ausgegangen, dass es sofort zum Kampf kam, was seinen Leuten zum Vorteil gereicht hätte. Jetzt musste er einsehen, dass seine armselige Schar würde bluten müssen.
Er atmete mehrmals tief durch. »Nur Ihr und ich«, sagte er zu Martin. »Wir wollen nur zu essen, Geld und Pferde, aber niemandem ein Leid zufügen. Wenn ich Euch besiege, gebt Ihr heraus, was ich verlange. Sicher wollen die Herren dort im Wagen nach Konstanz, wie alle Reisenden. Dort gibt’s genug Pfeffersäcke, die ihnen aushelfen können.«
Mit einem Nicken, das kaum verächtlicher hätte sein können, gab Martin seine Zustimmung. Auch die Art, wie er seinen Mantel abstreifte, zeigte, was er von seinem Gegner hielt. Alban erschrak, als er Rogatus neben sich brüllen hörte: »Die Männer sollen angreifen! Wofür bezahle ich sie denn? Schafft das Pack aus dem Weg, und dann weiter!«
Martin riss am Zügel, sein Pferd tänzelte in Richtung des Wagens. Noch immer sagte er nichts, sondern starrte den Abt so zornig an, dass dieser zurück auf seinen Sitz fiel. Dann glitt Martin vom Pferd und warf Sandro die Zügel zu. Auch der Fremde sprang herunter und zog sein Schwert. Breitbeinig stellten sie sich auf und hoben die Klingen.
Bisher hatte Alban seinem Bruder nur zweimal bei einem Schwertkampf zugesehen. Das erste Mal lag neun Jahre zurück, da war er dreizehn Jahre alt gewesen. Martin hatte die elterliche Burg besucht und im Hof mit dem Schwertmeister seines Vaters gefochten. An den Kampf selbst vermochte Alban sich kaum zu erinnern, nur daran, dass er zwischen Neid und Bewunderung geschwankt hatte, bis er in die Familienkapelle gerannt war, um diese Gefühle wegzubeten. Der zweite Kampf lag erst zwei Jahre zurück. Martin war von seiner ersten Pilgerfahrt zurückgekehrt und den Weg entlanggewandert, der am Kloster vorbeiführte, seinem Freund Sandro entgegen. Alban hatte im Kräutergarten gearbeitet und von dort aus zugesehen, wie die beiden Freunde ihre Schwerter zogen. Offenbar war das ihre Art, Wiedersehensfreude auszudrücken. Martin hatte sich das Pilgerhemd heruntergerissen, damit es ihn nicht behinderte, und dann hatten sie die Klingen gekreuzt, mitten auf dem Weg. Alban war nicht mehr der halbwüchsige Junge gewesen, der sich von Schwertergeklirr beeindrucken ließ, dennoch hatte er den Blick nicht abwenden können.
Hier, auf diesem schlammigen Weg unweit von Konstanz, war es nicht anders: Er musste hinstarren und staunen, als Martin und der Raubritter wie auf ein Handzeichen die Schwerter gegeneinanderschlugen. Neben sich hörte er seinen Herrn aufgeregt atmen; Alban umklammerte den Rosenkranz an seinem Gürtel und wollte beten, doch in der Aufregung fielen ihm die Worte nicht ein.
Martin versuchte, seinem Gegner das Schwert an der Brigantine vorbei in die Schulter zu stoßen, gleichzeitig wehrte er die gegnerischen Hiebe mit kräftigen Schlägen ab. Seine Bewegungen waren beherrscht und kraftvoll, während sein Gegner bald zu keuchen begann. »Herr Jesus!«, zischte Rogatus, als die Breitseite der fremden Klinge auf Martins Knie zielte. Doch Martin stieg darüber hinweg und stach zugleich in Richtung des ungeschützten Halses. Der Fremde hatte Mühe, den Angriff abzuwehren. Martin setzte nach, stand plötzlich an der Seite des Gegners und hieb ihm den Schwertknauf gegen die Schulter. Der Mann stolperte einige Schritte nach vorn, wirbelte auf dem Absatz herum und hob sein Schwert, aber nicht schnell genug; schon war Martin bei ihm und riss mit der Schwertspitze das Leinen der Brigantine auf. Die Bauern stießen unterdrückte Schreie aus. Sie wirkten jedoch eher eingeschüchtert als angriffslustig, und Alban meinte inzwischen drei weniger zu zählen.
»Mach schon«, knurrte Rogatus. Und als habe Martin ihn gehört, verschwand seine Klingenspitze in der Achsel des Gegners. Der Mann fiel auf die Knie und kippte nach vorne. Sein Schwert glitt ihm aus der Hand. Martin stieß es mit dem Fuß in Sandros Richtung, beugte sich vor und säuberte seine Klinge am Beinkleid des Gefallenen. Dann warf er sich die schweißfeuchten Haare aus der Stirn und ließ einen kalten Blick über die Wegelagerer schweifen, doch die schienen abgeneigt, die Auseinandersetzung zu verlängern. Die nächsten schlugen sich in die Büsche. Nur wenige blieben zurück. Diesen erlaubte er mit einem Wink, ihren sterbenden Anführer mitzunehmen.
Alban merkte nun, wie sehr er zitterte. Er wischte sich mit dem Ärmel über das Gesicht, während er zusah, wie die Fremden ihren Herrn wegtrugen. Martin befahl einem seiner Männer, das eroberte Pferd herbeizuführen. »Nun könnt ihr aussteigen«, rief er in Richtung des Wagens.
Rogatus stürmte hinaus. »Ein nettes Schauspiel!«, herrschte er ihn an. »Aber darauf hätten wir gut verzichten können! Was, wenn du nun tot hier lägest? Habe ich allen Ernstes unser Leben jemandem anvertraut, der sich darin gefällt, den Helden zu spielen?«
»Was wollt Ihr denn?«, gab Martin zornig zurück. »Kein einziger meiner Männer ist gestorben, es ist nicht einmal jemand verwundet. Auch Ihr und Alban nicht. Hätte ich angreifen lassen, wie Ihr es wolltet, sähe die Sache ganz anders aus!«
»Du hättest den Kampf auch verlieren können!«
»Ich weiß schon ganz gut selber, was ich mir zumuten kann.« Mit einem Mal lachte Martin, doch es klang alles andere als heiter. »Ach, gebt es doch zu, so schlimm würdet Ihr es gar nicht finden, wenn ich da jetzt im Staub läge.«
»Martin ...«, fing Sandro an, als wolle er seinen aufgebrachten Freund beschwichtigen.
»Halt’s Maul, Sandro.«
Martin ließ nicht ab, den Abt anzustarren. Der verlor zusehends die Fassung, Zorn rötete sein Gesicht. »Dein Ungehorsam wird dich etwas kosten, die Hälfte deines Soldes nämlich. Und wage es ja nicht, dich darüber zu beklagen!«
Alban bekreuzigte sich. »Beklagen?«, sagte Martin überraschend ruhig. Es wäre Alban lieber gewesen, ihn wie üblich herumschreien zu hören, denn diese Ruhe wirkte noch gefährlicher. »Das ist nicht das richtige Wort für das, was ich gern tun würde.«
»Will er mir drohen?«, bellte Rogatus. »Kümmere er sich lieber um den Wagen! Wir haben genug Zeit verloren.«
Alban schickte ein Stoßgebet zum Himmel, dass sein Bruder vernünftig reagieren werde. Langsam hob Martin die Klinge, und Alban stand schon der Atem still. Martin von Tours? Nein, er war eben doch nur ein Raufbold, der nichts anderes konnte, als ein Schwert zu schwingen. Nach einem Moment angespannter Stille, der Alban wie eine Ewigkeit erschien, stieß Martin es heftig in die Scheide zurück. Dann winkte er seine Leute zum Wagen. Alban stieg aus; sofort wurde der Wagen aus dem Schlagloch gehoben, und sie konnten wieder einsteigen. Sowie das Gefährt anfuhr, nahm Alban sein Kräuterbuch und tat, als versinke er darin. Keinesfalls wollte er von Rogatus auf den Vorfall angesprochen werden. Doch der Abt saß nur still da und brütete finster vor sich hin.
***
Den Rest des Weges blieben sie unbehelligt. Hinter Ulm war die Straße so dicht bevölkert, dass höchstens Taschendiebe es wagten, auf Beutezug zu gehen. Nachdem sie Ravensburg hinter sich gelassen hatten, erhaschten sie hin und wieder einen Blick auf die Alpen, über grauen Hügeln wie in einer anderen Welt schwebend. Als sie nach eintönigen Tagen den Bodensee erreichten, war es früh am Morgen, die Stadt am gegenüberliegenden Ufer nur ein Schemen im frühmorgendlichen Nebel, aus dem Dutzende Kirchtürme und Tortürme ragten. Gehört hatte Martin über sie inzwischen einiges: Konstanz, zur Hälfte vom Bodensee umspült, platzte zurzeit aus allen Nähten; die Besucher waren über die Stadt hergefallen wie ein biblischer Heuschreckenschwarm. Sie hausten in Hauseingängen, in Kellergewölben, in Ställen und unter Treppen, und wer eine Kammer ergattert hatte, musste sein Bett mit fremden Leuten teilen. Dreimal so viele Menschen, wie die Stadt Einwohner hatte, befanden sich derzeit hier. Die Zustände waren so schlimm, dass der Heilige Vater Johannes XXIII. mit der Abreise drohte, obwohl er in der geräumigen Bischofspfalz dem bequemen Leben frönte.
Als sie den Hafenort Meersburg erreichten, glaubte Martin im ersten Moment, am Ufer fände eine Hinrichtung statt, so sehr drängten die Menschen mitsamt ihren Fuhrwerken, Heukarren und Reusen dorthin. Sie kamen kaum einen Schritt voran. Pferde wieherten nervös, Frauen keiften, Kinder weinten, und Söldner und Händler brüllten sich an.
Sandro lenkte sein Pferd an Martins Seite. »Was für ein Getümmel. Es wird Stunden dauern, bis wir Plätze auf einem Fährschiff bekommen.«
Martin beobachtete eine Weile das Geschehen auf dem See. Die meisten Schiffe lagen an den Schiffsländen der umliegenden Orte, nur wenige glitten mit prallen Segeln auf dem Wasser, zwischen ihnen unzählige von Möwen begleitete Fischerboote. Eine weit ins Wasser ragende Landungsbrücke markierte den Konstanzer Hafen, doch keines der Schiffe lief sie an. »Es legen zwar Fährschiffe ab, aber nicht nach Konstanz, wie es aussieht. Weiß der Teufel, was das zu bedeuten hat. Ich habe das ungute Gefühl, dass wir heute Nacht noch nicht innerhalb der Stadtmauern schlafen werden.«
»Wie, du denkst schon an Schlaf? Martino! Was kümmert uns der Ort, wo wir schlafen, wenn die Tage so viel interessanter sein werden? Wir werden uns die Stadt so rasch wie möglich anschauen, si?«
Martin nickte. Auch er konnte es kaum erwarten, sich in dieses aufregende Leben zu stürzen, von dem die Welt derzeit voller Entsetzen und Faszination sprach. Hinter sich hörte er Rogatus aus dem Wagen rufen: »Was ist da los? Warum ist die Menge so aufgebracht? Wäre ich nur schon in unserem Quartier. Dieser Lärm hier verursacht mir Kopfschmerzen!«
Seufzend richtete sich Martin in den Steigbügeln auf. Ein Patrizier in feinstem Tuch kam mit ausgreifenden Schritten den Weg vom Hafen herauf, wobei er mit Gott und der Welt schimpfte. Hinter ihm liefen ein paar Knechte und Männer, die wie Schreiber aussahen. Martin sprang vom Pferd und ging ihm entgegen.
»Herr, auf ein Wort. Ihr seht aus, als wüsstet Ihr den Grund, weshalb keine Fährschiffe nach Konstanz ablegen.«
»Und ob ich das weiß!«, entgegnete der Mann gereizt. Er musterte Martin von Kopf bis Fuß, während er ein Spitzentaschentuch aus seinem seidengefütterten Tappert zog und sich die kahle Stirn tupfte. »Du bist anscheinend ein Söldner, den dein Herr vorgeschickt hat?«
»So ist es.«
»Du kannst ihm sagen, dass er einige Tage warten muss, wenn er Pech hat. Nicht einmal mich, ein Mitglied der Ravensburger Handelsgesellschaft, lässt man derzeit in die Stadt. Der Hafen ist abgesperrt, die Tore geschlossen. Und der Grund? Frag mich nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass mich jeder Tag, den ich hier draußen unfreiwillig herumlungere, eine Menge Geld kostet. Gott zum Gruße.«
Der Gedanke, Rogatus diese Nachricht zu überbringen, erheiterte Martin, und er hatte nicht übel Lust, es einfach zu tun. »Gibt es keinen anderen Weg?«, rief er dem davoneilenden Kaufmann nach.
»Doch, natürlich. Aber was nützt das, wenn die Tore überall geschlossen sind?«
»Die bereiten mir jetzt weniger Kopfzerbrechen als das Problem, überhaupt ans andere Ufer zu kommen.«
»Na schön.« Der Kaufmann wandte sich zu ihm um. »Lasst euch nach Bottighofen übersetzen, den nächstgelegenen Ort südlich von Konstanz. Dann braucht ihr nur für eine halbe Stunde der Straße zu folgen, vorbei an einer Abtei und einem Siechenhaus. Wenn ihr die Aussätzigen hört, seid ihr vorm Kreuzlinger Tor. Aber dort seid ihr auch nicht besser dran.« Er ging weiter, seine Gefolgschaft mit sich ziehend, und fuhr fort, lauthals sein Schicksal zu beklagen. Dicht hinter sich hörte Martin die Stimme seines Bruders.
»Der ehrwürdige Abt wünscht heute noch in sein Quartier zu kommen. Das soll ich dir sagen.«
Martin fuhr herum. »Nicht dass er mich dafür angestellt hätte, die Tore zu öffnen!«, fauchte er Alban an. »Aber ich tue mein Bestes, wie du siehst. Richte ihm aus, dass wir einen anderen Weg nehmen werden.«