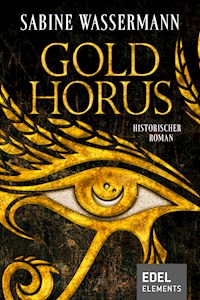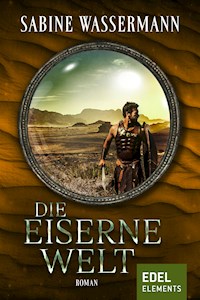Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sonja besitzt eine Kfz-Werkstatt, einige Kilogramm zu viel, doch dafür einiges an Selbstbewusstsein zu wenig. Aber ihr eigentliches Problem ist ihr Lebensgefährte Notker: Das Herzblatt treibt Sonja von einer nicht durchgehaltenen Diät zur nächsten. Zu allem Überfluss hält er sich auch noch eine Geliebte. Das Wiedersehen mit ihrer ebenfalls molligen aber lebenslustigen Freundin Jola bringt eine Kehrtwende in Sonjas Leben. Angeregt von ihrer quirligen und überaus kreativen Freundin, kommt sie auf eine grandiose Idee: Sie schließt Notker in den Keller ein und ist fest entschlossen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurzbeschreibung
Sonja besitzt eine Kfz-Werkstatt, einige Kilogramm zu viel, doch dafür einiges an Selbstbewusstsein zu wenig. Aber ihr eigentliches Problem ist ihr Lebensgefährte Notker: Das Herzblatt treibt Sonja von einer nicht durchgehaltenen Diät zur nächsten. Zu allem Überfluss hält er sich auch noch eine Geliebte. Das Wiedersehen mit ihrer ebenfalls molligen aber lebenslustigen Freundin Jola bringt eine Kehrtwende in Sonjas Leben. Angeregt von ihrer quirligen und überaus kreativen Freundin, kommt sie auf eine grandiose Idee: Sie schließt Notker in den Keller ein und ist fest entschlossen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.
Sabine Wassermann
Wer hält sich schon den Mann im Keller
Edel Elements
Edel Elements Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2018 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2010 by Sabine Wassermann
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München.
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rightsreserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-151-5
www.facebook.com/EdelElements/
www.edelelements.de/
Inhalt
LEIDGEPRÜFT UND FÜR ZU DICK BEFUNDEN
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
WER HÄLT SICH SCHON DEN MANN IM KELLER?
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
EINE NOCKENWELLE IST FÜR VIELES ZU GEBRAUCHEN
Kapitel 1
Kapitel 2
Epilog
LEIDGEPRÜFT UND FÜR
1
MEINEN KLEIDERSCHRANK ÖFFNETE ICH OFT mit einem ängstlichen Prickeln. Nicht, wenn es um Unterwäsche oder den täglichen Schlabberpulli ging. Aber an manchen seltenen Tagen ging auch ich, von Beruf Heimchen am Herd und fetter Punchingball eines hoffnungslos aggressiven und gehässigen Mannes, unter Leute, und denen wollte ich dann gern meine Schokoladenseite zeigen, obwohl ich keine besaß.
So wie damals, an jenem denkwürdigen Abend vor zehn Monaten.
Zugegeben, damals ist ein großes Wort für den relativ kurzen Zeitraum von einem knappen Jahr. Doch wenn ich bedenke, daß ich seitdem eine Veränderung durchmachte, die bei anderen gebeutelten Frauen zig Jahre beansprucht, Selbsthilfegruppe und Gestalttherapie inklusive, paßt es durchaus. Eine Veränderung zum Positiven übrigens, die an diesem Abend in Gang gesetzt wurde …
Ich wollte auf eine Vernissage gehen, ein seltenes Vergnügen. Ich besaß nicht viel an Kleidung. Das meiste waren alte Pullis und Blusen in Größen zwischen 44 und 48; ich hob sie auf in der Hoffnung, sie eines Tages wieder tragen zu können. Dazu Stoffe und begonnene Näharbeiten. Leider beschränkte sich mein näherisches Können auf das Ausbessern von Rissen.
Zwischen Vorfreude und dem ernüchternden Wissen hin- und hergerissen, mit meinen hundertzwanzig Kilo nun einmal keine gute Figur machen zu können, zog ich einen schwarzen Rock und eine lila Bluse heraus. Lila war die einzige auffällige Farbe, die ich zu tragen wagte. Der einfach geschnittene Rock reichte mir fast bis zu den Fesseln. Eigentlich haßte ich diesen Rock, aber womit sonst sollte ich meine fetten Beine bedecken?
Notker, mein Mann, hatte mir versprochen, mich zu begleiten. Dies war ein unerhörter Gnadenerweis; er interessierte sich nicht für Kunst. An diesem Tag kümmerte ihn ohnehin nur das überaus wichtige Bundesligaspiel seiner geliebten Borussia. Oder sollte ich sagen: seiner Geliebten Borussia? Es machte ihm nichts aus, wegen eines Fußballspiels etliche Kilometer nach Mönchengladbach zu fahren. Im Gegenteil, Vorfreude ist am schönsten, und zweihundertfünfzig Kilometer erhöhten seine Lust. Torschrei gleich Orgasmus – bei Notker war das wirklich ein und dasselbe gewesen.
Sie wundern sich vielleicht, daß ich davon spreche, als gehörten diese Fahrten der Vergangenheit an? Es ist wirklich ein Jammer, daß Notker nicht mehr erleben konnte, wie seine Borussia neulich gegen Meister Dortmund haushoch gewann. Es hätte ihn ja so wahnsinnig glücklich gemacht …
Er ist seit einem halben Jahr tot, das nehme ich schon mal vorweg. Vor ein paar Tagen las ich in der Zeitung, daß die polizeilichen Untersuchungen zu seinem Verschwinden eingestellt worden sind. Na, hoffentlich ist das kein Trick der Polizei, um den möglichen Täter in Sicherheit zu wiegen. Sie wissen nicht genau, ob er überhaupt einem Mord zum Opfer fiel, denn es tauchte bis jetzt keine Leiche auf.
Kann sie auch nicht …
Notker hätte sich kein schöneres Grab wünschen können als das, worin er jetzt ruht. Und er hat viel Besuch, mehr als er je auf dem Friedhof bekommen würde, denn es steht in einer großen Halle, und Hunderte von Leuten flanieren täglich daran vorbei. Viele bleiben stehen und blicken staunend, ja mit Ehrfurcht auf sein Grab hinunter. Es war auch wesentlich teurer, als ein schlichtes Loch zu buddeln und einen popeligen Holzsarg darin zu versenken.
Nicht, daß er es verdient hätte …
Wie gesagt, auch an diesem Tag war Notker unterwegs, um seine Fußballgeliebte zu sehen. Aber er hatte sich erstaunlich rasch bereit erklärt, danach gemeinsam mit mir der Kunst zu huldigen (was ihn nicht daran hinderte, zuvor die besagte Tour auf den Bökelberg zu machen, auch auf die Gefahr hin, nicht rechtzeitig zurück zu sein). Vielleicht regte sich in ihm ja doch ein schlechtes Gewissen? Immerhin hatte er mir ein paar Tage zuvor einige dermaßen heftige Ohrfeigen verpaßt, daß ich danach stundenlang unter Kopfweh litt. Es war nicht seine Art, mir ins Gesicht zu schlagen. Für gewöhnlich bevorzugte er meine dick gepolsterten Stellen, die unter seinen Hieben regelrechte Wellen schlugen.
Ich stieg unter die Dusche, schminkte mich dezent (sehr dezent – man sah davon eigentlich gar nichts) und schlüpfte in meinen schwarzen Rock und meine lila Bluse, Modell fünfzigjährige unverheiratete Sachbearbeiterin. Während ich ihn um meinen breiten Hintern herum drapierte, klingelte das Telefon. Ich hastete ins Wohnzimmer und hob den grauen, altmodischen Hörer ab.
»Sonja!« keuchte Notker mir ins Ohr. Seine Stimme klang fast so, als läge er irgendwo in einem fremden Bett, in verfänglicher Situation. Der Gatte teilt seiner Ehefrau mit, daß er später heimkommen werde, während die Geliebte unter der Bettdecke auf Tauchstation geht, dachte ich. Aber die lauten Hintergrundgeräusche paßten nicht dazu. »Hör zu! Ich bin hier auf dem Rastplatz Mosel-West. Ich hatte eine Panne, der Kühler ist defekt.«
»Ach, wie furchtbar.« Daher also der erschöpfte Unterton. Ich sah auf meine Armbanduhr, die sich in mein fülliges Handgelenk drückte. Noch drei Stunden bis zur Ausstellungseröffnung. Wegen so einer blöden Panne wollte ich sie weiß Gott nicht verpassen.
»Ist nicht so schlimm«, brummte er abfällig, »mir ist nichts passiert.« Er schien tatsächlich zu glauben, daß ich mich um ihn sorgte. Was natürlich völlig abwegig war. Ich stellte mir genüßlich vor, wie ihm einer der Reifen platzte, während er mit hundertsechzig Sachen über die Autobahn preschte … Er donnerte in die Leitplanke und wäre für ein paar Monate außer Gefecht gesetzt; oder vielleicht auch noch länger … Welch herrliche Vorstellung! Aber ein verqualmter Kühler ist nun mal nichts Lebensgefährliches. Seine rauhe Stimme dröhnte mir ins Ohr: »Ich muß bloß den Thermostat auswechseln. Daheim hab ich einen, den mußt du mir bringen, also pack dich in dein Auto.«
»Oh. Ist das wirklich nötig? Kannst du dort keinen kaufen?« warf ich ein. »Da gibt es doch eine Tankstelle.«
»Blödsinn, die haben so was nicht. Nun mach schon hin!« Er erklärte mir, wo ich den Thermostat finden würde, und beschwor mich, nicht die dazugehörige Thermostatdichtung zu vergessen. In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, daß Notker gelernter Kfz-Mechaniker war. Ich übrigens auch. Er hatte sich sogar selbständig gemacht. Ich nicht. Ich war höchst unselbständig, in fast jeder Beziehung.
»Jaja, ich denk dran. An welcher Autobahn ist denn dieser Rastplatz?«
»A 61!« Entrüsteter Tonfall, dann knallte der Hörer in dem siebzig Kilometer entfernten Telefonhäuschen auf die Gabel – wie konnte ich es wagen, die Strecke nach Mönchengladbach nicht zu kennen?! In Rock und Bluse und mit meinem klapprigen Audi 50 machte ich mich also auf den Weg in den schönen Hunsrück.
Es war ruhig auf den Straßen, sämtliche Fußballfreunde fummelten daheim schon an ihren Fernbedienungen. Nach etwas mehr als einer halben Stunde hatte ich den Parkplatz angefahren, der ebenfalls völlig verlassen war. Bis auf Notkers VW Jetta. Er winkte mich wie ein Ertrinkender heran; kaum stand ich Schnauze an Schnauze mit seinem Auto, riß er die Tür auf und mir den Thermostat aus der Hand. Ich stieg aus, um mir die Bescherung an seinem Jetta anzusehen, da öffnete sich die Beifahrertür. Eine Frau faltete ihre langen Beine auseinander und schraubte sich auf knappen und mit superdünnen Absätzen versehenen Pumps vor mir in die Höhe. Sie war mindestens einsfünfundsiebzig groß und wog höchstens sechzig Kilo. Ihr Rassekörper steckte in einem wollenen Schlauchkleid, darüber trug sie ein Jeansjäckchen. Es war so winzig, daß sich ihre Hände direkt unterhalb des Busens befanden, wenn sie sie in die Jackentaschen steckte. Die blondierten Haare trug sie hochgesteckt; so hoch, daß sich ihr Pferdeschwanz nach allen Seiten hin verteilte. Nein, wie hübsch.
»Tag«, preßte ich mühsam heraus. Die Blonde zeigte die Andeutung eines Lächelns. Plötzlich war Notker an meiner Seite und zeigte ein schiefes Grinsen.
»Eine Anhalterin«, sagte er prompt. Ich war erstaunt. Notker hatte eine Abneigung gegen Anhalter und sonstige Trittbrettfahrer, gleichgültig, ob es sich um schmierige Penner oder weibliche Fotomodelle handelte. Ich meinte jedoch, den Grund für diese Ausnahme zu begreifen, denn die Dame trug um den Hals einen Borussenschal.
Ein Fan, dachte ich, aber da erkannte ich den Schal. Der gehörte Notker. Ich stellte mir die Frau ohne Schal vor und fand dann doch, daß sie irgendwie billig aussah. Wie ein wandelnder Blondinenwitz.
Und so jemanden hat er mitgenommen? dachte ich perplex. Und so jemandem hat er sein heiliges Stück, eine seiner Reliquien, ausgehändigt, oder womöglich eigenhändig um den Schwanenhals geschlungen? Nicht zu fassen.
Die Dame würdigte mich nach einer ausgiebig-verächtlichen Musterung keines Blickes mehr. »Notker«, näselte sie und zupfte an den Schalfransen, »wie lange dauert das denn?« Sie zog eine der grünen Fransen heraus, drehte sie zwischen den Fingern und ließ sie zu Boden rieseln. Fassungslos sah ich zu, wie der Faden dahinsank. Daß die das wagen durfte! Ich hätte mir eine schallende Ohrfeige eingehandelt.
»Bloß ’ne Viertelstunde«, brummte er und verteilte Thermostat und Dichtung neben anderem Werkzeug auf dem Boden. Dann beugte er sich über den Motor des Jetta, zog den Kühlerschlauch ab und ließ etwas Kühlflüssigkeit ablaufen. Dabei spritzte er ein paar Tropfen auf seinen Bierbauch, so daß er sich fluchend das Sweatshirt hochriß und mit einem Lappen auf seiner Haut herumwischte.
»Aber dann gehen wir noch einen Happen essen, ja?« beharrte sie und deutete mit einem Schalwinken in Richtung Raststätte. Der Anblick seines unappetitlichen Bauches schien sie nicht zu beeindrucken. Überhaupt war Notker nicht gerade attraktiv, mit ebendiesem Bauch und den strähnigen, öligen Haaren, die seinen Hinterkopf durchscheinen ließen. Aber bei Männern zählen ja die inneren Werte … Nicht, daß er davon viele gehabt hätte. Mir fielen jedoch seine sauberen Jeans und das nagelneue Sweatshirt ins Auge; seine Haare wirkten nicht so strähnig wie sonst, und seine Achseln verströmten keinen Schweiß-, sondern Deoduft. Hoppla, wie kam das?
»Na klar, Siggi«, sagte er. Sie nickte zufrieden. Und ich staunte wiederum, denn ich wußte, daß er ungern auswärts aß. Was hatte es denn nur mit dieser Frau auf sich, in deren Gegenwart er sich so merkwürdig benahm? Ich fand, daß ich ziemlich nutzlos herumstand, und fragte sie höflich: »Wie war denn das Spiel?«
Sie winkte noch einmal mit dem Schal, was diesmal als abwertende Geste gedacht war, und verriet mir den Inhalt des Spiels schneller als ein Zwanzig-Sekunden-Bericht in der Tagesschau: »Och …«
»Soso«, machte ich nur und warf noch einen Blick auf meine Uhr. Eine Viertelstunde Herumschrauberei, dann noch ein halbes Stündchen in der Raststätte … Na ja, die Zeit war knapp, würde aber noch reichen. Eigentlich hätte ich ja wieder in Richtung Heimat verschwinden können, aber mir kam der Gedanke gar nicht. Vielleicht lag’s daran, daß mein Magen knurrte und ich gegen einen Teller Kantinenessen nichts einzuwenden hatte; vielleicht lag’s an dieser Siggi. Neugierig war ich ja schon auf sie. Notker hatte sich in den Motorraum verkrochen und fingerte munter darin herum. Schließlich streckte er die Hand aus, ohne sich aufzurichten, und sagte: »Siggi, gib mir doch mal die Dichtung.«
Siggi bückte sich und betastete mit spitzen Fingern die öligen Sachen. Ich begriff sofort, daß sie eine Thermostatdichtung nicht von einem Einmachgummi unterscheiden konnte, nahm die Dichtung und legte sie Notker in die Hand.
»Danke, Siggi«, brummte er unter der Motorhaube hervor, was mich nun schon zum dritten oder vierten Mal zum Staunen veranlaßte, denn er pflegte sich für gewöhnlich nicht für solche Handreichungen zu bedanken. Und daß er diese unbedarfte Madame aufgefordert hatte und nicht etwa mich, begriff ich schon gar nicht.
Wir hörten schweigend-ehrfürchtig zu, wie Notker das Werkzeug und den Behälter mit Kühlflüssigkeit schwang, atmeten erleichtert auf, als er sich mit einem stolzen »So, fertig!« erhob, und strebten gemeinsam der Raststätte zu. Während Notker im Herrenklo verschwand, um seine Hände zu waschen, hockten die Blonde und ich uns an einen der Tische. Sofort erschien eine Bedienung, die unsere dreifache Kaffeebestellung entgegennahm und uns die Speisekarte reichte.
Eigentlich mag ich Kaffee nur mit drei Stückchen Würfelzucker und unendlich viel Milch. Siggi nippte ihn schwarz. Natürlich wegen der Schönheit, vermutete ich. Ich kippte zwei bescheidene Tröpfchen Milch in meine Tasse und nur ein einziges Zuckerstückchen. Notker, der inzwischen halbwegs gesäubert an unseren Tisch gekommen war, träufelte mit einem demonstrativen Blick in meine Richtung Süßstoff in seinen Kaffee. Er verachtete mein Aussehen und meine Eßlust. Unschlüssig fingerte ich an dem eingepackten Kekschen herum, das auf der Untertasse lag. Schließlich packte ich es aus und aß es. Notkers Blick wurde schärfer.
Er griff sich die Speisekarte. »Ein Baguette wäre nicht schlecht«, sagte er. »Was möchtest du?« Die Frage ging ganz klar an Siggi.
»Auch ein Baguette«, erwiderte sie.
»Für mich auch eins«, erwiderte ich, obwohl ich wußte, daß er gern solche Gelegenheiten nutzte, um mich bloßzustellen. Ich liebte das Essen, und er liebte es, mir beleidigende Bemerkungen zuzuwerfen, um es mir zu vergällen. Noch dazu in Gegenwart dieses blonden Kleiderständers, da würde es ihm sicher besonders großes Vergnügen bereiten.
Und so war es denn auch: »Sonja, hör auf, das Essen wahllos in dich hineinzustopfen! Zweifellos hast du heute nachmittag nicht eben gefastet, stimmt’s? Ich kenne dich; wenn ich nicht da bin, um dir auf die Finger zu schauen, schaufelst du doch alles in dich hinein, was du findest. Willst du noch fetter werden? Ich werde die Kellnerin bitten, uns dort hinten in der Ecke das Essen zu servieren, du ziehst ja alle Blicke auf dich. Außerdem steht dort ein Sofa, das hält dich vielleicht eher aus als dieser zierliche Stuhl.«
Ich wurde knallrot, Siggi lachte verlegen. Das hatte ich nun davon, ich hatte es ja herausgefordert. Und ich ärgerte mich über meine Dummheit. Als die Kellnerin kam und die Bestellung entgegennahm, schwieg ich beschämt. Sie brachte zwei unterarmgroße Baguettes, auf denen Notker und Siggi geräuschvoll herumkauten. Ich hingegen kaute auf den Fingernägeln und fragte mich, warum ich hier noch saß.
Ich schielte zur Essenstheke. Dort stand ein wenig abseits ein Süßigkeiten-Automat. Mir lief das Wasser im Mund zusammen. Einfach hinzugehen und mir einen Riegel zu holen, wagte ich nicht. Notker würde wieder lautstark seinen Kommentar dazu abgeben und mich blamieren, so daß es im ganzen Lokal zu hören war. Ich sagte, ich müsse mal aufs Klo, und ging in Richtung Automat. Das Damenklo befand sich nämlich direkt dahinter. Der Automat stand so, daß Notker sich schon hätte zurücklehnen und den Kopf um neunzig Grad drehen müssen, um zu sehen, wer daran herumfingerte. Ich holte ein Markstück aus meinem Portemonnaie und zog mir eine kühle Köstlichkeit der Tropen, dann ging ich aufs Klo, denn ich mußte wirklich mal. Den Riegel dort an Ort und Stelle zu essen, brachte ich nicht über mich; das wäre ja nun nicht sehr appetitlich gewesen. Ich wollte ihn im Auto essen, auf der Heimfahrt. Aber wohin jetzt damit? Ich konnte ihn ja nicht einfach unter Notkers Augen auf den Tisch legen. Und eine Handtasche besaß ich nicht.
Ich verstaute sie kurzerhand in meiner Unterhose. Die Verpackung knisterte ein wenig beim Gehen, als ich mich an den Tisch zurückgesellte und mich hinsetzte. Die beiden wischten sich gerade die letzten Krümel aus den Mundwinkeln. Sie hatten die Köpfe zusammengesteckt und sich angeregt unterhalten, so schien es. Jetzt fuhren sie auseinander und sahen mich irgendwie peinlich berührt an. Ich wußte einfach nicht, was ich von der ganzen Sache halten sollte. Hatten die beiden was miteinander? Eigentlich war die Sache offensichtlich: Sie hatten. Aber ich konnte mir einfach nicht vorstellen, daß es – abgesehen von mir – eine Frau gab, die sich mit Notker einließ. Das mußte schon eine recht dumme Frau sein. Na ja, diese Siggi machte keinen besonders intelligenten Eindruck.
Ich fummelte meinen Schlüsselbund aus der Rocktasche. »Ich fahr schon mal.«
»Jaja, ich komm ja auch gleich«, brummte Notker, »ich fahr nur schnell die Siggi nach Hause, dauert nicht lang. Zieh mal deine Bluse hinten runter, damit man deinen Hintern nicht sieht. Also wirklich, wie du heute wieder rumläufst!«
Ich strich mir die Bluse über meinem Hintern glatt und machte, daß ich in mein Auto und auf den Weg kam. Nachdem ich das aufgewärmte Bounty aus meiner Unterhose gefingert hatte, wurde ich ruhiger. Während ich das Auto lenkte, riß ich die Verpackung auf und aß die schmierige Schokolade. Darin war ich wirklich gut; ich hätte sogar einen Teller Suppe essen und gleichzeitig Auto fahren können.
Das war also der Dank für meine Hilfsbereitschaft gewesen. Aber ich hatte mich längst an seinen Ton gewöhnt.
Vielleicht fragen Sie sich, wie ich an einen solchen Mann geraten konnte? Das ist leicht, wenn man ab seinem zehnten Lebensjahr permanent mit Übergewicht herumläuft.
Warum gerade ich damit so reichlich gesegnet wurde, kann ich nur ahnen. Lag’s an der ebenfalls üppigen Mutter, die mich einerseits nötigte, den Teller leer zu essen, und mir andererseits bei meinem Eintritt in die Pubertät das große Geheimnis verriet, nur schlanke Frauen fänden Gnade und Gefallen in den Augen der Männer? Oder lag’s an meinem Vater, der lieber einen Sohn gehabt hätte (außer mir hatte er kein weiteres Kind zustande gebracht) und in mir einen Sohn sah? Gestandene Männer dürfen nicht nur, sie sollen sogar über einen Wohlstandsbauch verfügen (allerdings nur einen recht kleinen). Trotz dieser veralteten Ansichten hatten meine Eltern nichts dagegen, daß ihre einzige Tochter einen Männerberuf ergriff, nämlich den des Kfz-Mechanikers. Sie besaßen eine kleine Autoreparaturwerkstatt, da paßte das ja ganz gut. Bereits als Kind hatte ich meinem Vater zugesehen, wenn er an den Autos seiner Kunden herumbastelte, und den Schraubenschlüssel geschwungen.
»Mal sehen, was daraus wird«, hatte er vor meinem ersten Berufsschultag gemeint. »Viel Spaß in der Schule. Sie werden dich dort hänseln, du paßt nicht ohne weiteres unter ein Auto, bist nicht gelenkig; ein dickes Mädchen unter Jungens, und die gucken nur nach deinem Aussehen.« Dermaßen ermutigt, war die Berufsschule in der Tat ein einziger Spießrutenlauf. Aber wie man weiß: Lehrjahre sind keine Herrenjahre, die würde ich schon überstehen.
Hier schloß sich der Kreis: Die dicke Tochter muß den Laden irgendwann selbst schmeißen, denn einen Mann wird sie ja nicht abbekommen.
Und die dicke Tochter nahm diese Erkenntnis mit dem täglichen Essen als zusätzliche Nahrung auf; diese Zukunft war für sie selbstverständlich, und selbstverständlich machte sie ihre Lehre im elterlichen Hause.
Es war so praktisch und so naheliegend.
Dies dürfte der Hauptgrund gewesen sein, daß mein Übergewicht ins Uferlose wuchs. Eintönige Nahrung schlägt an, und diese Nahrung war wahrhaft eintönig: Von morgens bis abends dieselben grauen Elternhausmauern, von Geburt an. Was in unserem Rheinhessenstädtchen (oder auch nur eine Straße weiter innerhalb desselben) sonst noch so vor sich ging, davon hatte ich keine Ahnung.
Es war also eine ausgemachte Sache, daß ich von vornherein ins Hintertreffen geriet, was den Kontakt zum anderen Geschlecht betraf. Vor allem, wenn man als Dreingabe schüchtern ist.
Meine Schulfreundin Jola, die einzige echte Freundin, die ich je hatte, konnte mit den heißesten Disco-Stories aufwarten. Jeden Montag kam sie mit einem demonstrativ um den Hals gewickelten Tuch zur Schule, nur um es mit viel Aufhebens herunterzuschieben und einen Knutschfleck zu präsentieren. Fehlte das Tuch und war der Hals rein wie eine Küchenrolle, erklärte sie mit ungekünstelter Selbstverständlichkeit, der Knutschfleck sei diesmal auf dem Busen gelandet. Ich durfte dann in der Pause auf dem Klo einen ehrfürchtigen Blick darauf werfen.
Während Jola ihre Freunde wechselte wie Unterwäsche, schienen Jungen für mich so entfernt wie Außerirdische zu sein. Während Jola an den Fingern abzählte, wie lange ihre Periode überfällig war, erforschte ich meinen Körper noch mit den eigenen Händen. Im Gegensatz zu ihr war ich die klassische graue Maus.
Dabei war Jola beinahe so dick wie ich. Aber das glich sie mit ihrem Mundwerk und ihrer Tatkraft aus. Jola hieß eigentlich Jolanthe, aber niemand kam auf die Idee, sie als die »dicke Sau Jolanthe« zu bezeichnen, ein Schicksal, das mir ganz sicher nicht erspart geblieben wäre. Ich bewunderte sie für ihr Talent, sich aus allen Situationen zu lügen. Wie alle Dicken haßte sie den Sportunterricht. Im Gegensatz zu mir gelang es ihr, dem Sportlehrer glaubhaft zu versichern, mal wieder ihre Tage zu haben, obwohl er gerade noch beim Einlaufen in die Turnhalle Ohrenzeuge ihrer Berichte geworden war, mit welchem Jungen sie am vorigen Abend geschlafen habe. Denn so etwas erzählte sie keineswegs hinter vorgehaltener Hand.
Dieser Sportlehrer, ein sehniger braungebrannter Mittzwanziger, war der Schwarm aller (schlanken) Mädchen. Jolas und meiner nicht, denn er zeigte keine Gnade: Die Sportnote Fünf war für uns Standard, und er kommentierte sie stets recht hämisch. Ich zog dann meinen hochroten Kopf ein, Jola entschlüpfte eine freche Bemerkung.
Ich erinnere mich an den demütigendsten Tag meiner Schulzeit. Sportunterricht an sich war schon schlimm, aber was gab es Furchtbareres als das Vorturnen kurz vor den Zeugnissen, um sich die obligatorische Fünf einzuhandeln? Dreißig Schüler und Schülerinnen hocken im Schneidersitz auf dem Boden und beobachten erwartungsvoll, wie sich eine der ihren anschickt, sich zu blamieren. Ich glaube, man nennt es Geräteturnen. Verschiedene Hindernisse, deren Namen mir nur während Olympischer Spiele gewärtig sind, müssen irgendwie übersprungen werden: Reck, Ringe, Barren und anderer überflüssiger Unsinn. Ich quälte mich mehr schlecht als recht über die Geräte, mußte mich am Ende meines Leidensweges über den verhaßten Stufenbarren beugen, wobei mir ein satter Furz entfleuchte. Dieser Turnlehrer, ich glaube, er hieß Rischmann, sparte nicht mit Häme. Ich suchte, vor Scham sterbend, das Loch im Boden – oder um es noch dramatischer auszudrücken: Ich hätte den Tod gewählt.
Jola entzog sich der Pflicht mit einem lässigen Spruch (»Geben Sie mir gleich eine Sechs, dann stimmt’s«), wofür ich sie beneidete. Ich war Rischmanns und eben auch später Notkers Verachtung hilflos ausgeliefert; ich besaß weder die passenden Worte noch die Kraft, um mich aufzulehnen.
Jola bedauerte mich, und sie zeigte auf ihre Art ihre Freundschaft. Sie kaufte ein Lehrbuch über Fußball – Rischmann war Bayern-Fan –, einen schönen großen Bildband, fing ihn in einer günstigen Minute ab und hielt ihm das geöffnete Buch hin. Sie behauptete schlicht, ein Foto für die Schülerzeitung machen zu wollen. Er mußte das Buch hochhalten und in ihre Kamera lächeln. Sie machte ihr Foto und verschwand, bevor er es genauer in Augenschein nehmen konnte. Als sie mir später das Bild zeigte, sah ich, daß sie dem Buch eine neue, sehr echt wirkende Überschrift verpaßt hatte: »Fußball für Schwule«.
Heute, zehn Jahre später, ist diese Geschichte nur eine von vielen aus dem Kuriositätenkabinett der Erinnerungen. Ob Rischmann schwul war oder nicht, interessierte uns beide nicht. Auch nicht, daß der gute Mann gar nicht wissen konnte, wofür diese Rache galt. Nun, vermutlich hatte seine Fußbaileidenschaft einen Dämpfer bekommen.
Sie werden wahrscheinlich denken, ich müßte diesen Sport hassen. Das stimmt nicht. Bei einer EM oder WM versäume ich kein Spiel. Bittere Tränen habe ich vergossen, als anno 1986 Burruchaga im Endspiel das Siegtor für Argentinien schoß, fünf Minuten vor Spielende. Damals hatte ich Notker noch mit wohlwollenderen Augen betrachtet, und mein Interesse für Fußball entsprang dem weiblichen Wunsch, ihm damit eine Freude zu machen. Und vier Jahre später, als wir uns in der Mainzer Innenstadt in den hupenden Autokorso einreihten, um den Gewinn der Weltmeisterschaft zu feiern, fühlte ich mich geschmeichelt und geehrt, denn ich durfte Notkers schwarzrotgoldene Fahne aus dem Fenster halten.
Doch, ich mag Fußball. In gewissem Sinne habe ich es auch dem Fußball zu verdanken, daß meine Leidenszeit – denn das war mein Zusammenleben mit Notker – ein Ende finden sollte.
2
NOCH AUF DER GAU-ALGESHEIMER HAUPTSTRASSE warf ich das zerknüllte Bounty-Papier aus dem Auto. Nicht auszudenken, wenn Notker es in meinem Audi fände. Allerdings wehte es geradewegs wieder herein und auf den Rücksitz. So ein Mist! Ich lenkte mit den Knien und angelte nach hinten; und prompt passierte es denn auch, ich streifte einen Laternenmast. Ich hielt an und atmete dreimal tief durch. Dann ein Blick auf die Uhr: Es war höchste Zeit. Nicht unbedingt für die Ausstellung; das war noch zu schaffen. Nein, mir fiel etwas anderes siedendheiß ein, das noch vor Notkers Rückkehr erledigt werden mußte … Ich rannte um das Auto und betrachtete den Schaden: ein kaputter Scheinwerfer. Na ja. Darüber würde Notker sich nicht so sehr aufregen. Der graue Laternenpfahl hatte ein paar Farbstriemen abbekommen, was ihm sicherlich nicht schlecht stand, aber das war mir herzlich gleichgültig. Nichts wie weg hier, bevor Passanten kamen und dumme Fragen stellten. Ich hatte ohnehin das Gefühl, daß sämtliche Bewohner dieser Straße hinter ihren Vorhängen gafften und sich über mein völlig überflüssiges Mißgeschick die Hände rieben. Mit hochrotem Kopf hockte ich mich wieder hinters Lenkrad und fuhr weiter.
*
Was wohl aus Jola geworden war?
Wir hatten uns nach der Schule aus den Augen verloren, denn sie verschlug es nach Frankfurt, während ich am elterlichen Herd blieb, diesem großen verbauten Haus mit der Werkstatt und der winzigen Tankstelle. Wie sie wohl mittlerweile aussah? Eine Einladung zu einem Klassentreffen vor einigen Jahren hatte ich abgelehnt. Ich sei krank, hatte ich geschrieben. Ich hätte es nicht ertragen, mich Jola oder den anderen Mädchen zu zeigen – 40 Kilo schwerer.
Notker Mörbel lernte ich auf die einzig mögliche Art und Weise kennen, die mir in meinem tristen Dasein blieb.
Da ich das Haus nur zum Einkaufen oder zu Arztbesuchen oder Ähnlichem verließ – und meine Schüchternheit verbot es mir, in meiner Berufsschulklasse Bekanntschaften zu suchen (ich war ohnehin das einzige Mädchen dort, was ich als zusätzliche Qual empfand) –, mußte der potentielle Bewerber schon zu uns nach Hause kommen. Er tat es in Gestalt von Notker, der eine Lehrstelle suchte.
Genaugenommen suchte er eine Stelle für das letzte halbe Lehrjahr, denn er hatte die Lehre in einer der größeren Werkstätten Gau-Algesheims geschmissen. Mein Vater verfügte zur Zeit über ein sattes Auftragsbuch, also nahm er den Asylsuchenden mitleidig auf. Zum einen war ihm mittlerweile die Erkenntnis gekommen, daß der Berg zum Prediger kommen mußte: Die tägliche Gegenwart eines Mannes, so dachte er, müsse meine Hemmungen – wenn schon nicht gänzlich gegenüber dem gesamten männlichen Geschlecht, so doch wenigstens gegenüber diesem einen – abbauen können.
Zum anderen hatte es sich herausgestellt, daß eine Frau zum Herumschrauben an Autos doch nicht ganz geeignet war. Ich begriff die technischen Zusammenhänge ebenso schnell wie jeder andere, hatte auch keine Probleme damit, mir an heißgelaufenen Motoren die Hände zu verbrennen oder mit öligen Fingern unter den Pulli zu greifen, um meine naßgeschwitzten Achseln zu kratzen. Aber es war nun einmal so, daß ich – obwohl weiß Gott kein Schwächling – bei solchen Arbeiten Mühe hatte, zu deren Erledigung es rohe Kraft aufzuwenden galt. Ich konnte wohl einen Vergaser einstellen oder Ventile wechseln, aber beim popeligen Aufziehen eines Keilriemens versagte ich oft.
Ich wurde gewissermaßen genötigt, mich mit diesem jungen Mann zu befassen, und mangels Vergleichsmöglichkeit gefiel er mir. Er sah nicht gut aus, aber angesichts meiner eigenen Unzulänglichkeiten war ich früher als meine Altersgenossinnen dahintergekommen, daß das Aussehen drittrangig war. Er gab mir zu verstehen, daß er meine Fähigkeiten als Mechanikerin nicht schätzte, mich selbst indessen schon. Meine Eltern sahen es mit Wonne. Charakterlich eher durchschnittlich, fiel er ihnen immerhin durch seinen Fleiß angenehm auf. Notker übernahm stillschweigend meinen Platz in der Werkstatt, ich beendete ebenso stillschweigend vorzeitig meine Lehre, um einer Karriere als Hausfrau entgegenzusehen. Ich hatte Chancen bei diesem Mann, sofern man ihm als Brautpreis die Werkstatt offerierte, und das allein zählte.
Schließlich war er ein solider Mensch, ein bienenfleißiger Handwerker. Ihm rutschte wohl ab und an die Hand aus, jedoch konnte er sich mit dem Gedanken anfreunden, daß die Übernahme der Werkstatt gekoppelt war an eine Bindung mit mir. Eine lose Verbindung, so drückte mein Vater es aus. Von Heirat zu sprechen hatte er nicht gewagt, weil er glaubte, Notker würde erschrocken ablehnen. Meine liebe Sonja, hatte er gesagt, du mußt dir einen Mann verdienen. Sei froh, daß Notker dich überhaupt beachtet. Er ist deine einzige Chance, jemals einen Kerl abzubekommen. Sieh dich doch an.
Notker biß an, schließlich war es seine Leidenschaft, an Autos herumzuschrauben – neben dem Fußball. Eben noch arbeitslos, mit abgebrochener Lehre, jetzt Werkstattbesitzer! Vater schloß ihn selig in die Arme, hatte Notker ihn doch von einem Alptraum befreit, nämlich in einer Zeitungsannonce nach einem Nachfolger für die kleine Werkstatt mitsamt drei Zapfsäulen und 12-Quadratmeter-Verkaufsraum suchen zu müssen. Er konnte jetzt seinen wohlverdienten Lebensabend genießen.
Es blieb beim Vorsatz. Nur drei Jahre später lag er tot im Bett. Vielleicht waren’s die Zigarren, vielleicht die Auspuffgase in der mangelhaft belüfteten Werkstatt. Ich erinnere mich daran, daß meine Mutter ihn ständig ermahnte, die milchigen, mit Reklamepappen geflickten Fenster offenzuhalten. Sie konnte seine Dummheit nicht ändern, auch nicht verhindern, daß sie ihm kurz darauf ins Grab folgte. Ein zu spät erkannter Krebs im Rückenmark.
Notker war zwar der Besitzer der Werkstatt, nicht aber der Eigentümer, wir hatten ja nicht geheiratet. Unser Zusammenleben war so selbstverständlich, daß wir es schlichtweg vergaßen und ich von ihm als »meinem Mann« redete. Die Gefahr, ich könne Notker überdrüssig werden und ihn vielleicht eines Tages vor die Tür setzen, bestand einfach nicht. Besser gesagt, letztere Gefahr bestand nicht.
Auch als ich schwanger wurde und er mich zu einer Abtreibung nötigte, sah ich in ihm noch einen fürsorglichen Ehemann. Fürsorglich allein deshalb, weil er mich Mauerblümchen auserwählt hatte, seine Tage mit ihm zu teilen.
Die Nächte übrigens nicht; die Nacht, die zu besagter Schwangerschaft führte, dürfte in den sieben, acht Jahren, die wir zusammenlebten, eine von einem Dutzend gewesen sein. Den Grund für den Abbruch führte er mir kurz und prägnant vor Augen, wie ich es später noch oft erleben sollte: »Mit deinem Gewicht ist eine Schwangerschaft ein gesundheitliches Risiko.« Sprach’s und wuchtete der (noch) Schwangeren einen 25-Kilo-Kartoffelsack auf den Buckel. Er hatte ja den Tag über gearbeitet und noch ölige Finger.
*
Die mahnenden Worte meines Vaters hatten sich bei mir eingeprägt: Ich wollte von Notker nicht lassen, obwohl er sich rasch als Peiniger entpuppte. Nach außen gab er sich bieder, und er war es auch. Alkohol in erträglichen Maßen, keine anderen Frauen, keine Schulden, solide, langweilig. Er besaß eigentlich nur einen Fehler: Er haßte mein Äußeres. Aber dafür war ich selbst verantwortlich, um mit meinem Vater zu reden. Es lag an mir, es zu ändern, sprich abzunehmen.
Kurz nach meiner geschmissenen Lehre hörte ich, Jola studiere in Frankfurt Kunst. Das brachte mich dazu, selbst noch einmal etwas Derartiges zu versuchen. Meine Eltern, damals lebten sie noch, rieten mir ab: Mein Lebensweg sei schließlich vorgezeichnet, was nütze mir jetzt noch das Fachabitur für Technik? Notker nahm meine Pläne erst gar nicht ernst, darum verbot er es mir auch nicht.
Mit schlotternden Knien, angetan mit einer weiten, altmodischen Jacke und dem unvermeidlichen ellenlangen Rock, reihte ich mich also zu Schulbeginn in den Pulk von schicken Schülern ein und vernahm mit Entsetzen, daß auch Sport auf dem Stundenplan stand. Außerdem erwies sich der Lehrstoff als zu schwierig. Ich mit meiner mäßigen mittleren Reife und der abgebrochenen Lehre in einer veralteten Werkstatt stand auf verlorenem Posten.
Ganze vier Tage hielt ich aus. Bevor ich mich am Freitag, dem fünften Tag, in der Sportstunde blamierte, sprang ich ab und kehrte reumütig und von jeglichen Selbstverwirklichungsplänen geheilt in die Werkstatt zurück.