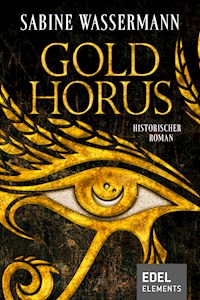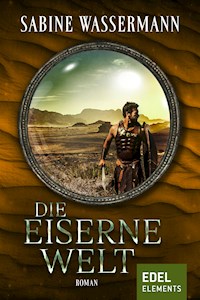Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Gracia & Anschar
- Sprache: Deutsch
Das Tor in eine phantastische Welt Es geschehen seltsame Dinge am Ausgrabungsort des jungen Berliner Archäologen Friedrich. Nicht datierbare Schmuckstücke tauchen auf, und eines Nachts stößt seine Verlobte Gracia auf einen dunklen Fremden, der vor ihren Augen im Wasser verschwindet. Wenig später zieht es auch Gracia in den See, doch sie findet sich nicht am Grund des Sees wieder, sondern in einer fremden Welt voller Magie, Zauber und Gefahr. Während Friedrich in Berlin verzweifelt nach Gracia sucht, wird sie von Kriegern gefangen genommen und vor deren despotischen Herrscher geführt. Als ihr ein mysteriöser Sklave zur Flucht verhilft, beginnt für die junge Frau das Abenteuer ihres Lebens ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 924
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurzbeschreibung
Das Tor in eine phantastische Welt
Es geschehen seltsame Dinge am Ausgrabungsort des jungen Berliner Archäologen Friedrich. Nicht datierbare Schmuckstücke tauchen auf, und eines Nachts stößt seine Verlobte Gracia auf einen dunklen Fremden, der vor ihren Augen im Wasser verschwindet. Wenig später zieht es auch Gracia in den See, doch sie findet sich nicht am Grund des Sees wieder, sondern in einer fremden Welt voller Magie, Zauber und Gefahr. Während Friedrich in Berlin verzweifelt nach Gracia sucht, wird sie von Kriegern gefangen genommen und vor deren despotischen Herrscher geführt. Als ihr ein mysteriöser Sklave zur Flucht verhilft, beginnt für die junge Frau das Abenteuer ihres Lebens ...
Sabine Wassermann
Das gläserne Tor
Roman
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2018 Edel Germany GmbHNeumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2008 by Sabine Wassermann
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München.
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-163-8
www.facebook.com/EdelElements/
www.edelelements.de/
Inhalt
DER ERSTE KRIEGER
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
DER LETZTE GOTT
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
EPILOG
Gott, was ist Glück! Eine Grießsuppe, eine Schlafstelle und keine körperlichen Schmerzen, das ist schon viel.
Theodor Fontane
Ihr Götter, was ist Glück! Der Mann geht dorthin, wo es stürmt; die Frau begleitet ihn. Den Atem dazu, mehr braucht es nicht.
Argadische Weisheit
DER ERSTE KRIEGER
1
Das Wasser leuchtete, als seien Lampen darin versenkt. Langsam begann das kreisförmige Licht zu pulsieren, es schien im niederprasselnden Regen zu tanzen. Grazia traute ihren Augen nicht. Ein Licht in der Havel? Sie reckte den Kopf, um über das Schilf hinwegzublicken. Vielleicht spiegelte sich etwas von der gegenüberliegenden Seite? Aber dort erstreckte sich nur der dicht bewachsene Ufersaum.
»Friedrich?«
Sie drehte sich nach ihrem Verlobten um. Auf der kleinen Lichtung, zwischen Kiefern und Eichen, sah sie ihn bei der Grube stehen, gemeinsam mit dem Meier, der sie vorgestern ausgehoben hatte, als er zufällig auf einen menschlichen Knochen gestoßen war – und dabei möglicherweise einen der erstaunlichsten Funde in der Geschichte der Archäologie gemacht hatte. Die beiden Männer wirkten gehetzt, während sie sich im Wind plagten, eine Plane über die Grube zu breiten, damit möglichst wenig Wasser eindrang. Regen konnte so viel zunichte machen! Grazia biss sich ungeduldig auf die Lippe. Es war kein guter Augenblick, Friedrich zu stören.
Sie beschloss, der Sache allein auf den Grund zu gehen. Also rückte sie nach einem Blick in den steingrauen Himmel ihren Schirm zurecht und machte sich auf den Weg zum Ufer. Ihre Stiefeletten versanken im Schlamm, und sie musste mit einer Hand das knöchellange cremefarbene Kleid raffen. Am Steg, der hinaus auf die Havel führte, blieb sie stehen. Die hölzernen Bohlen waren morsch und glitschig vom Regen. Vorsichtig setzte Grazia einen Fuß vor den anderen. Der Wind riss an ihrem Kleid, peitschte den Regen trotz des Schirms in ihr Gesicht und ließ sie frösteln. Nein, das war zu viel des Guten, am Ende würde sie noch ausrutschen und ins Wasser fallen. Das seltsame Leuchten war immer noch da, dicht neben dem Steg, doch schwächer als eben noch. Großer Gott, was war das? Tatsächlich Lampen? Unter Wasser? Sie wusste ja, dass man jetzt, am Ende des neunzehnten Jahrhunderts, mit elektrischem Licht die unmöglichsten Dinge anstellen konnte, gar die Nacht zum Tage machen. Sogar der Kronleuchter im Salon ihrer Eltern war ans Stromnetz angeschlossen. Aber Glühlampen im Wasser? Oder was mochte es sonst sein? Die Insel war voller wunderlicher Geschichten. Einst hatte hier ein Glasgießer im Auftrag des Großen Kurfürsten geheime Experimente durchgeführt, wohl auch mit Phosphor. Aber das lag mehr als zweihundert Jahre zurück.
Friedrich musste davon wissen. Sie kehrte zur Grabungsstätte zurück, wo die Männer Steine auf die Ränder der Ölplane legten. »Friedrich!«, rief sie gegen den Regen an. »Bitte komm, ich muss dir etwas zeigen!«
Ungeduldig winkte er ab, als habe er sie nicht richtig gehört. »Wir sind hier für heute fertig. Bei diesem Mistwetter kann man ja nichts machen. Regen ist der Feind des Archäologen, er kann so viele wichtige Spuren zunichte machen.«
Er ärgerte sich, das wusste sie. Kaum hatte der alte Meier, der auf der Insel wohnte, das Erdgrab entdeckt, hatte es nach all den sonnigen Spätsommerwochen angefangen, Schusterjungen zu regnen. Heute hatte Grazia ihren Verlobten begleitet, um sich die Grube anzusehen, aber kaum waren sie von der Fähre gestiegen, war wieder der schönste Wolkenguss im Gange. Friedrich warf einen ärgerlichen Blick zum Himmel. Dann zu ihr.
»Geh zum Fährhaus, du wirst dich noch erkälten. Ich komme gleich nach.«
Grazia wollte protestieren. Aber vielleicht war das Licht ja gar nicht mehr da? Oder sie hatte sich getäuscht? Besser, sie sah selbst noch einmal nach; nicht, dass sie ihn noch mehr verärgerte, weil sie ihn zum Ufer lockte, wo es nichts zu sehen gab. Sie lief zum Steg zurück. Das Licht war fort. Nein, ganz leicht schimmerte das Wasser noch. Eilig setzte sie einen Fuß auf das morsche Holz, um einen letzten Blick zu erhaschen, bevor es möglicherweise ganz schwand. Doch dann hielt sie inne.
Auf dem Steg lag ein Mann. Und er war nackt.
Unwillkürlich kniff sie die Augen zu. Dann sah sie wieder hin, weil sie es nicht glauben konnte. Er presste seine Hand auf den Brustkorb, der sich heftig hob und senkte. Ein Havelfischer, der sein Boot verloren und dann im Wasser die Kleider ausgezogen hatte? Grazia warf einen raschen Blick zurück. Von Friedrich war nichts zu sehen. Was sollte sie jetzt tun? Sie konnte sich doch unmöglich einem nackten Mann nähern? Aber er schien in Not zu sein, vollkommen erschöpft, also schritt sie allein über den Steg. Am Ende angelangt, hoffte sie, dass Friedrich nicht kam. Was würde er denken, wenn er sah, wie sie sich zu dem Fremden hinabbeugte? Noch nie hatte sie einen nackten Mann leibhaftig vor Augen gehabt. Zögerlich ließ sie den Blick über seinen Körper gleiten und streckte die Hand aus. Sie wollte ihn an der Schulter berühren, nur ganz leicht, und fragen, wer er war und was ihn plagte.
Kaum trafen ihre Fingerspitzen auf seine Haut, schlug ihr ein gewaltiger Wasserschwall ins Gesicht. Vor Schreck ließ sie den Schirm fallen und fuhr hoch.
Nach Luft schnappend wischte sie sich über die Augen. Als sie wieder sehen konnte, war der Mann fort, offenbar in Windeseile zurück in die Havel gesprungen. Grazia zupfte an ihrem nassen Kleid und blickte ins Wasser. Nur wenige Meter entfernt pulsierte unvermindert, wenn auch schwach, das Licht.
Die Sache war ihr längst nicht mehr geheuer. Sie wollte zum Ufer zurück, drehte sich um – und erstarrte. Der Fremde stand unmittelbar vor ihr.
Sie schluckte. Er war mehr als zwei Meter groß und vollkommen wie Apoll. Das braune Haar verlor sich hinter seinen Schultern. Sein Blick bohrte sich beinahe schmerzhaft in ihren Kopf. Diese Augen! Silbern glänzende Regenbogenhäute – so etwas gab es? Sie drehte sich weg, nestelte an ihrem durchnässten Hut und räusperte sich.
»Würden Sie mich bitte ans Ufer lassen?«
Verstand er sie überhaupt? Er sah nicht so aus, als sei er aus dieser Gegend. Eher wirkte er südländisch, mit seinem dunklen Haar und der sonnengebräunten Haut.
»Wer sind Sie?«, fragte sie und wagte dabei einen zögerlichen Blick, jedoch vermied sie es, tiefer als bis zu seiner Taille zu schauen. Was für eine entsetzliche Situation. Schlimmer noch, sie verspürte den Wunsch, ihn zu berühren. Das durfte nicht sein. Aber vielleicht löste er sich ja wieder auf, diesmal endgültig, wenn sie es tat? Als spüre er ihre Verwirrung, streckte er eine Hand aus. Langsam trat sie näher, betete darum, dass niemand sie sah, und berührte seine Hand. Diesmal geschah nichts. Der Fremde schien den Atem anzuhalten und schloss die Augen, als sei er erschöpft. Das Regenwasser perlte von seinen Wimpern, lief an seinen Wangen herunter und aus seinen durchnässten Haarsträhnen.
Er war schön.
Und er hatte Angst.
Fast vergaß sie, dass sie an ihm vorbeiwollte. Seine Lider hoben sich ein wenig, sein Blick, der wieder auf ihr lag, wurde starr. Sie wollte ihm die Hand entziehen. Mit einem Satz war er bei ihr, packte ihre Schultern. Rücklings drückte er sie auf den Steg und warf sich auf sie. Entsetzt versuchte sie sich gegen ihn zu stemmen, aber er war schwer, und bevor sie schreien konnte, hatte er seine Lippen auf ihre gepresst.
Wasser ergoss sich in ihre Kehle. Die weit aufgerissenen – und immer noch ängstlichen – Silberaugen dicht vor den ihren, begann er Unmengen von Wasser in sie hineinzupumpen. Sie glaubte zu ersticken, versuchte zu schlucken, doch es war so viel, dass sie einfach nur den Mund aufsperren konnte. Das Wasser durchflutete ihren ganzen Körper und floss aus ihrem Unterleib. Sie hing in den Armen des Fremden, der sie aus sich heraus mit Wasser füllte, und fühlte sich dennoch nicht bedroht, nur grenzenlos verwundert. Irgendwann schloss sie die Augen, bereit, in dieser Umarmung zu ertrinken. Da hörte es auf. Sie spuckte, schluckte ein letztes Mal und sah auf.
Er stand über ihr. Sein Kopf war leicht vorgebeugt, die Brauen gerunzelt. Schuldbewusst sah er sie an. Ich wollte dich nicht erschrecken, schien er sagen zu wollen. Aber es war notwendig.
Mit einer Hand an der geschwollenen Kehle, die andere das besudelte Kleid raffend, stemmte sie sich hoch. »Warum?«, flüsterte sie. Er streckte die Hand nach ihr aus. Sie zuckte nicht zurück, als er ihre Wange berührte, mit einer Zärtlichkeit, die sie nicht erwartet hätte. Nicht nach dem, was er mit ihr getan hatte.
Es war notwendig ...
Waren es seine Gedanken, die ihr da durch den Kopf gingen? Oder deutete sie nur seinen Blick?
Verzeih mir.
Warum? Er hatte sie nicht verletzt, nur zu Tode erschreckt. Jäh wandelte sich sein Blick. Die schönen Züge verzerrten sich vor Furcht. Er warf den Kopf zurück, als fahre ihm schmerzhaft etwas in den Körper, und verwandelte sich in Wasser, das nach allen Seiten stob und sie erneut überschüttete. Sie riss die Hände hoch; zwischen den gespreizten Fingern sah sie ihn menschlich werden und dann zu Wasser, wieder und wieder, bis sie es nicht mehr ertrug und das Gesicht bedeckte.
Er schrie in ihrem Kopf. Keuchend nahm sie die Hände fort. Und sah nur noch seine Finger, die sich an die Kante des Stegs klammerten, so fest, dass Holzsplitter herausbrachen. Ohne nachzudenken, warf sie sich nach vorn und versuchte seine Hände zu greifen. Das leuchtende Wasser umspülte seine Schultern, das Licht pulsierte stärker als zuvor und schien an ihm zu zerren. Blankes Entsetzen stand in seinen Augen, der Regen prasselte auf sein Gesicht. Sie umklammerte seine Handgelenke, wohl wissend, dass sie nichts gegen das ausrichten konnte, was ihn in die Tiefe zog.
Verzeih mir!
Seine Finger lösten sich vom Steg, glitten durch ihre Hände. Er versank im Wasser.
Das Licht erlosch. Es blieb nur ein kaum wahrnehmbarer Schimmer.
»So schnell wird man durch einen Grabfund nicht zu einem zweiten Schliemann, und die Pfaueninsel ist nicht Troja. Eine kleine Sensation haben wir hier allerdings.«
Die kraftvolle Stimme ihres Vaters, die durch das geöffnete Fenster drang, schreckte Grazia aus dem Schlaf. Sie warf einen Blick zum Wecker, der auf dem Nachttisch stand. Fünfzehn Uhr! Abrupt setzte sie sich auf und warf die Bettdecke zurück. Dann atmete sie tief durch, tapste zum Fenster und lehnte sich hinaus. Auf dem Balkon des Nebenzimmers stand Carl Philipp Zimmermann, ihr Herr Vater, und klappte sein Zigarrenetui auf. Mit Bedacht wählte er eine Zigarre, knipste das Ende ab und warf es hinunter auf die Straße. Als Nächstes holte er aus der Westentasche das Streichholzetui, dessen Inhalt er sich ebenso sorgfältig widmete. Derweil lehnte Friedrich am schmiedeeisernen Geländer und strich sich zufrieden lächelnd den Schnurrbart glatt. Er sah gut aus mit seinem dunkelblonden Haar und den kräftigen Schultern, aber fremd war ihr der zehn Jahre ältere Mann immer noch, obwohl er ihr schon vor einem Jahr vorgestellt worden war, als Sohn eines befreundeten Professors. Ihr Vater hatte geglaubt, ihr eine Freude zu machen, da er Archäologie studiert hatte. Nicht nur das, Friedrich hatte sogar Heinrich Schliemann kennen gelernt. Er war in dessen Haus in Athen gewesen, wo goldene homerische Verse an den Wänden prangten und die Hausdiener auf die Namen von Sagengestalten hörten. So etwas wollte sie auch: einen Mann, der verrückt genug war, einen ganzen Salon mit einem Mosaik auslegen zu lassen, das den Zweikampf zwischen Achilleus und Hektor zeigte. Einer, der sie bei seiner Arbeit um sich haben wollte, so wie Schliemann seine Sophia. Der ihr beim Frühstück zuhörte, wenn sie aus dem erstmals übersetzten Gilgamesch-Epos vorlas. Oder aus den eher trockenen Schriften ihres Vaters. Die Gelehrtentochter würde einen Gelehrten ehelichen und stets Verständnis für das aufbringen, was er tat. Eine ideale Verbindung, mit der beide glücklich sein sollten.
»Eine kleine Sensation?«, rief Friedrich. »Sie könnte eine große werden, je nachdem, was die Gegend um das Grab noch birgt! Bisher wissen wir ja wenig. Das Grab könnte Teil einer größeren Siedlung sein.«
»Einer havelländischen Hochkultur?« Ihr Vater wiegte zweifelnd den Kopf. »Genauso gut könnte es von Reisenden aus dem Schwarzmeergebiet angelegt worden sein.«
»Mit Verlaub, ich halte das Grab nicht für skythisch. Wie auch immer, was es zu finden gibt, will ich finden, und wenn ich die halbe Insel auf den Kopf stellen muss.«
»Bei allem wohlwollenden Interesse der Öffentlichkeit für Geschichte, dafür bekommen Sie keine Genehmigung. Die Pfaueninsel kann man nicht auf den Kopf stellen.«
Die buschigen Brauen des Vaters hatten sich streng zusammengeschoben. Grazia lächelte in sich hinein. Als klassischer Philologe war er eben ein Mann der Bücher, nicht der Hacken, Spaten und Pinsel. Gern wäre sie auf der Stelle hinübergelaufen, um ihm die Stirn glatt zu küssen. Ihre Blicke trafen sich, und bevor er ärgerlich werden konnte, dass sie im Nachthemd an ihrem Fenster stand, wich sie ins Zimmer zurück, wo es an der Tür klopfte. Ihr kleiner Bruder stürzte herein und blieb wie angewurzelt stehen, als besinne er sich jetzt erst darauf, dass man nicht in das Zimmer einer Dame stürmte.
»Justus!«, tadelte sie ihn und sank zurück aufs Bett. »Was ist denn?«
»Ich hab’s gesehen!« Er trat zu ihr und flüsterte aufgeregt: »Was der Friedrich in seinem Kasten hat.«
»Für dich Herr Mittenzwey. Von welchem Kasten redest du?«
»Ach, das kannst du ja gar nicht wissen. Also, der Herr Mittenzwey hat ihn vorhin gebracht, um ihn Papa zu zeigen. Da drin hat’s geblitzt und geblinkt, so was hast du noch nicht gesehen. Wie geht’s dir eigentlich?«
»Gut.«
»Siehst aber nicht so aus.«
Sie blinzelte in das Spiegelbild über ihrer Frisierkommode: ein vom Schlaf aufgequollenes Gesicht, über und über mit Sommersprossen übersät, die es jetzt zu dieser Jahreszeit besonders schlimm trieben. Darum herum eine Korona flammend roten Haares, lockig, zerzaust und sich gegen jedes Bemühen, es in Form zu bringen, zur Wehr setzend. Der Zopf, in den Grazia es zu bändigen versucht hatte, war schon wieder halb aufgelöst. Schrecklich.
»Hau ab, du Lausejunge.«
Der zehnjährige Bengel grinste von einem Ohr zum andern und rannte wieder hinaus. Grazia rieb sich die Augen. Vor drei Tagen hatte Friedrich sie vollkommen durchnässt auf dem Steg gefunden und nach Hause gebracht, hier in die Stadtwohnung ihrer Eltern. Soweit sie wusste, hatte er seitdem weiter am Grab gearbeitet, während sie in ihrem Zimmer lag, umsorgt von den Eltern, dem Bruder, dem Dienstmädchen. Sogar ein Arzt war gekommen, hatte sie untersucht und nichts festgestellt. Sie fühlte sich nicht krank, auch nicht im Kopf, wenngleich ihre Erzählung verrückt geklungen hatte. Der Arzt hatte die Vermutung geäußert, sie sei ausgerutscht und in den Fluss gefallen. Und obwohl sie nicht schwimmen konnte, hatte sie es irgendwie wieder zurück auf den Steg geschafft. Die Meinung ihrer Mutter war, dass sie das Ganze vergessen sollte.
Den Fremden vergessen? Grazia sah ihn vor sich. Die seidig glänzenden Haare. Der Blick, der sie an sich gezogen hatte. Sein Körper. So vollkommen. Als sei er gar kein Mensch, sondern das fleischgewordene Idealbild eines Menschen.
Sie läutete das Glöckchen auf ihrem Nachttisch. Im Salon hörte sie die Mutter, wie sie Justus zurechtwies, die Nase nicht zu dicht an den Kasten zu halten. Erneut klopfte es, diesmal verhaltener. Das Dienstmädchen kam herein, ein Tablett mit Tee, Honig und zwei gebutterten Stullen in der Hand. »Guten Morgen, Fräulein Grazia! Wie geht es Ihnen heute?«
Grazia seufzte. Anfangs hatte sie es ja noch angenehm gefunden, den Tag im Bett zu verbringen, aber jetzt hatte sie wirklich genug davon. »Gut, Adele, wirklich. Bitte bring mir Waschwasser, ich will aufstehen. Mir tun vom ewigen Herumliegen ja schon die Knochen weh.«
»Ob das Ihrer Frau Mutter gefällt?« Adele stellte das Tablett auf dem Nachttisch ab und sah Grazia prüfend an. »Ein bisschen frische Luft täte Ihnen sicher gut. Außerdem haben die Herren im Salon ... Also, das müssen Sie sich ansehen!«
Jetzt war Grazia wirklich neugierig, was Friedrich so Wundersames in seinem Kästchen hatte. Sie wartete, bis Adele die Waschschüssel gefüllt hatte, entledigte sich ihres Nachthemds und wusch sich mit dem lauwarmen Wasser. Rasch schlüpfte sie in ihren Unterrock, nahm das Korsett vom Stuhl und rief Adele herein, die vor der Tür gewartet hatte, damit sie ihr beim Schnüren half. »Mach hinne, Adele«, trieb sie das Mädchen an. »Bald ist Kaffeezeit, und dann muss ich ewig warten.«
»Keine Sorge«, erwiderte Adele gut gelaunt. »Ihr Herr Vater hat gesagt, dass er seinen Nachmittagskaffee heute später möchte. Er hat einen Photographen bestellt. Wahrscheinlich wegen dieses Fundstücks.«
Ein Grabfund! Grazia ließ sich in die Kleider helfen, schlüpfte in die Pantoffeln und eilte hinüber in den Salon, wo sich ihr Vater und Friedrich inzwischen in den Sesseln vor der Bibliothek niedergelassen hatten. Auf dem Teetisch lag ein glänzendes Mahagonikästchen, das in der Tat geheimnisvoll aussah. Der Vater, der soeben seine Taschenuhr zuklappte und in die Westentasche steckte, sah auf.
»Wo bleibt nur der Photograph? Kindchen, lass nicht deine Mutter sehen, dass du mit zerzausten Haaren herumläufst. Was soll denn Friedrich denken, hm?«
»Ich denke, dass sie aussieht wie Daphne, die vor Apoll flieht«, murmelte Friedrich, der sich erhob und einen Diener machte. »Wäre ich ein Maler, würde mir dieses Motiv jedenfalls vorschweben. Guten Tag, Grazia.«
»Guten Tag, Friedrich.« Das Kompliment war steif geäußert, dennoch errötete sie. Er konnte ja nicht ahnen, wie sehr er die Wirklichkeit damit getroffen hatte. Sie trat an den Tisch, streckte die Hand vor und ließ sie sich küssen, wobei sie den Kasten beäugte. Friedrich schob ihr den Sessel zurecht, während sie sich setzte. Schon wollte sie nach dem Kasten greifen, da kam Adele mit dem Tablett. Schnell nahm Friedrich ihn an sich, als das Dienstmädchen Anstalten machte, sich mit dem Ellbogen Platz zu verschaffen.
Grazia griff nach dem Honigtöpfchen und betupfte ungeduldig eine Brotscheibe. Derweil setzte sich Friedrich an die andere Seite des Tisches und legte den Kasten auf die Knie.
»Bitte lass mich doch hineinsehen«, drängte sie ihn, aber er schien entschlossen, sie warten zu lassen, bis sie gegessen hatte.
»Kind, iss anständig!«, ermahnte sie ihr Vater. Errötend zupfte sie ein Haar vom Brot, das sich im Honig verfangen hatte, und versuchte es von der Hand zu schütteln. Er hielt die Hände vor dem Bauch verschränkt, über dem sich deutlich die Weste spannte, und musterte sie wohlwollend. Dann nahm er wieder sein Zigarrenetui zur Hand und spielte damit herum, während Friedrich auf ihre Hände starrte. Sie machte eine Faust, damit er nicht ihre angeknabberten Nägel sah. Hastig spülte sie mit einem Schluck Tee den letzten Bissen hinunter und leckte sich die Finger. Schon wollte sie fragen, ob sie den Inhalt des Kastens endlich sehen durfte, als Justus durch die Balkontür gesprungen kam.
»Der Photograph kommt! Er steigt gerade aus dem Kremser!«
»Dann nichts wie hinunter, Junge, und hilf ihm beim Tragen.« Der Vater nestelte eine Münze aus der Hosentasche und gab sie ihm. »Hier, für den Kutscher.«
Justus’ Wangen glühten vor Aufregung, und auch Friedrich schien vergessen zu haben, dass er Grazia etwas zeigen wollte. Sie neigte sich vor, um bittend seine Hand zu berühren, aber da erschien die Mutter, mahnte den Jungen mit erhobenem Finger, nicht so laut zu sein, und winkte sie zu sich. Grazia wollte protestieren, aber sie wusste schon, das hatte keinen Zweck. Innerlich tief aufseufzend, folgte sie ihrer Mutter zurück in ihr Zimmer.
»So weit kommt es noch, dass dich sogar der Herr Photograph mit offenen Haaren sieht«, sagte die Mutter. »Willst du dich nicht lieber wieder ins Bett legen?«
»Bloß nicht!«
Die Mutter schloss die Tür und schob einen Stuhl vor die Frisierkommode. Ergeben ließ sich Grazia darauf nieder. Draußen hörte sie Schritte und den Photographen, der sich über das anhaltend trübe Wetter beklagte. Die Mutter füllte einen Porzellanbecher mit dem Rest aus dem Waschwasserkrug und drückte ihn Grazia in die Hand.
»Was soll eigentlich Friedrich von dir denken?« Schwungvoll legte sie ihr einen Frisierumhang um die Schultern. »Früher hätte es das nicht gegeben, dass eine Frau so unordentlich vor ihrem Zukünftigen erscheint. Dein Vater ist viel zu nachsichtig mit dir.«
Grazia unterließ es, mit den Schultern zu zucken, und hielt den Becher hoch, damit ihre Mutter den Kamm eintauchen konnte. »Hast du mich je gefragt, was ich über Friedrich denke?«
»Mit achtzehn Jahren kann man noch gar nicht wissen, was man da denken soll. Aber gut! Sprich dich aus.«
»Oh ... nun, er ist nett.« Sie musste überlegen, schließlich hatte ihre Mutter sie noch nie dazu aufgefordert. »Ich mag ihn ja. Aber er ist irgendwie ein bisschen zu streng für meinen Geschmack.«
»Das kommt dir so vor, weil er um einiges älter ist. Das gibt sich mit der Zeit.«
Aus den Augenwinkeln beobachtete Grazia, wie die Tropfen vom Kamm fielen, sobald die Mutter ihn aus dem Wasser nahm. Was sieht er in mir?, fragte sie sich und betrachtete den Verlobungsring an ihrer linken Hand. Wenn er von dem Grab sprach, war Feuer in seinen Augen. Wenn er sie ansah, loderte es auch, aber nicht immer und schon gar nicht so stark.
»Dass sich Braudeute lieben müssen, sind neumodische Flausen«, unterbrach die Mutter ihre Gedanken. »Das kommt von dem ganzen romantischen Schund in den Buchläden. Liebe entsteht mit der Ehe und wächst langsam. Was die jungen Leute heutzutage Liebe nennen, ist doch nur flüchtige Tändelei, die dem Alltag nicht standhält. Sei froh, dass du so einen ernsten und fleißigen Mann bekommst. Obwohl es ja durchaus anspruchsvollere Tätigkeiten gäbe, als in der Erde zu wühlen.«
Der Kamm fiel zurück in den Becher. Nun wurde Grazias Kopf mit Nadeln traktiert. Mit einem starren Blick in den Spiegel wartete sie auf das Ende der Prozedur. Sie fand, dass eine toupierte Stirn und ein Knoten auf dem Hinterkopf mühelos die zehn Jahre überbrücken halfen, die sie von Friedrich trennten. Als die Mutter ihr auf die Schulter klopfte, schrak sie zusammen, stand auf- und schüttete einen Schwall Wasser auf den Boden.
»Kind! Was machst du denn da?«
Grazia starrte nach unten, wo der Kamm in einer Wasserlache lag. Hätte der Becher nicht halb leer sein müssen? Er schien bis zum Rand gefüllt gewesen zu sein, als habe ihre Mutter nie den Kamm eingetaucht. »Verstehe ich nicht«, murmelte sie und wollte ihn aufheben, was in Korsett und Tageskleid nicht einfach war, doch die Mutter nahm ihr den jetzt leeren Becher ab und stellte ihn auf die Frisierkommode.
»Darum soll sich Adele kümmern. Eine Dame bückt sich nicht. Dreh dich um.«
Grazia gehorchte und ließ sich Puder auf die sommersprossige Haut auftragen. Dann durfte sie endlich zurück in den Salon. Hier hatte der Photograph inzwischen seine Apparatur aufgebaut und befestigte an der Rückseite ein schwarzes Tuch. Der Vater und Friedrich saßen immer noch am Teetisch, und immer noch war das Kästchen geschlossen.
»Du wunderst dich sicherlich, dass ich damit nicht einfach ins Photographenatelier gegangen bin«, wandte sich Friedrich an sie.
»Na, mir wundert det ooch«, warf der Photograph ein. »Det Ding wäre leichter zu tragen jewesen wie die janze Ausrüstung. Aber wat ditte kostet, soll mir nich jucken, Herr Mittenzwey.«
Friedrich stand auf und winkte sie herbei. Da war plötzlich wieder das Feuer in seinem Blick, doch Grazia wusste nicht, ob es nun an ihr lag oder jenem ominösen Fund. »Grazia, du kennst gewiss das Bild von Sophia Schliemann, wie sie das Geschmeide aus Troja trägt?«
Das kannte sie natürlich, sie hatte ja Schliemanns Biographie gelesen, darin war die Photographie seiner Frau abgedruckt: eine ernste griechische Schönheit, mit glänzendem Goldschmuck behängt, von dem man nur vermuten konnte, wie er ursprünglich getragen worden war. Erst dann ging ihr auf, was Friedrich da gesagt hatte. »Geschmeide? Du hast ...«
»Ja, ich habe in der Grube Schmuck gefunden. Sieh her.« Er hob den Deckel.
»Donnerlittchen!«, entfuhr es dem Photographen. »Na, nu versteh ick det. So wat kann man nich einfach durch die Jejend schleppen.«
Auf einem schwarzen Samtpolster lag eine Art Kollier. Es bestand aus einer Goldkette, an der dicht an dicht Schnüre hingen, ebenfalls aus Gold. Längliche Perlen aus blau schimmernden Steinen waren an ihnen aufgereiht, unterbrochen von Goldperlen, in die fremdartige Muster eingraviert waren. Die Schnüre endeten in goldenen Tierköpfen. Daneben lag ein kleiner Reif mit zwei geflügelten Wesen, die an Sphingen erinnerten und sich anstarrten. Der Schmuck wirkte schlicht, archaisch und unendlich kostbar.
»Ich hab dir’s doch gesagt!«, triumphierte Justus, der herangelaufen kam und Anstalten machte, sich über das Kästchen zu beugen.
»Justus!« Grazia packte ihn am Matrosenkragen und zog ihn beiseite. »Darf ich es anfassen?«, fragte sie Friedrich mit ehrfürchtiger Stimme.
»Natürlich, du sollst es sogar tragen. Ist es nicht wundervoll? Sieh dir die Steine an. Kannst du dir vorstellen, was das ist?«
»Nein.« Ganz vorsichtig berührte sie die Steine. Sie fühlten sich samtig an. »Es sieht ein wenig nach Lapislazuli aus, es ist aber keiner, oder?«
»Wir wissen nicht, was es ist«, erwiderte der Vater an Friedrichs statt. »Das muss ein Geologe herausfinden. Die Herkunft dieser Kette wird das jedoch auch nicht klären. Stilistisch würde ich den Schmuck ja eher den Skythen zuordnen, aber Herr Mittenzwey sieht das anders.«
»Ich glaube, es handelt sich um ein Fürstinnengrab einer Kultur, die es noch gänzlich neu zu entdecken gilt. Der Schmuck sieht ganz und gar nicht slawisch aus. Skythische Einflüsse hingegen sind durchaus vorhanden.«
»Eine Fürstin?« Das war neu für Grazia.
»Die Knochen stammen zweifelsfrei von einer Frau. Das Geschmeide selbst deutet ja darauf hin. Mehr Kopfzerbrechen bereitet mir das Alter. Wenn ich wüsste, wie die Tote gelegen hat, könnte das ein Hinweis sein, aber leider hatte der Meier sämtliche Knochen schon herausgeholt. Und dann der Regen ...«
»Der Brauch, Dinge mit ins Grab zu geben, ist doch heidnisch? Es müsste also mehr als tausend Jahre alt sein.«
Sein Bart zitterte, als er unwillig die Lippen schürzte. »So einfach ist das nicht.«
Verlegen senkte sie den Blick. Er hatte natürlich recht. Auch christliche Gräber konnten Schmuck aufweisen, denn so leicht hatten alte Völker ihre heidnischen Bräuche nicht vergessen. Vor ihrem inneren Auge sah sie eine Frau in antikem Gewand, die Kette auf der Brust, an den Händen weitere Kleinodien, wie sie durch die Hallen eines Palastes schritt. Welche Kultur mochte sich hinter diesem Fund verbergen? Wie waren diese Menschen dereinst auf die Pfaueninsel gekommen? Hatten sie wirklich dort gelebt? Gab es ein Gräberfeld? Oder hatte ihr Vater recht, und dort war außer diesem einen Grab nichts zu finden? Unendlich viele Fragen warf dieser Schmuck auf, und unendlich viele Träume.
»Grazia, du hörst ja gar nicht zu. Ich sagte, ich sähe dich gerne damit photographiert. Deshalb habe ich den Photographen herbestellt. Dich in sein Atelier zu begeben, wäre dir derzeit nicht zuzumuten. Deinen Vater habe ich schon gefragt. Er erlaubt es.«
Die Mutter schürzte die Lippen. »Damit behängt, wirst du aussehen wie ein Mädchen vom Varieté. Aber gut, dein Vater hat ja offensichtlich nichts dagegen.«
Dieser hob nur die Brauen. Ein wenig ärgerte es Grazia, dass man ihr nicht zutraute, den Weg ins Atelier zurückzulegen. Weder war sie bettlägerig noch unfähig zu laufen. Und gefragt, ob sie sich überhaupt mit diesem Schmuck ablichten lassen wollte, hatte Friedrich sie auch nicht. Ihr war danach zu schmollen.
Aber dann überwog der Stolz, als er ihr das Geschmeide um den Hals legte. Die Perlenschnüre reichten bis zum Ansatz ihrer unter dem weißen Sommerkleid wohlverschnürten Brüste. Ob die Frau, die einstmals Besitzerin dieses Schmucks gewesen war, ihn auf die gleiche Art getragen hatte? Oder ganz anders? Dies würde wohl für immer ein Rätsel bleiben.
An dem Reif hing ein schmales Kettchen. Wofür es gut war, begriff sie erst, als Friedrich es ihr um die Ohrmuschel legte. Der Reif pendelte gegen ihren Hals – uraltes Gold berührte sie, voller Geheimnisse.
»Sie werden hier doch nicht mit diesem schrecklichen Blitzlichtpulver arbeiten?«, wandte sich die Mutter an den Photographen.
»Gnä’ Frau, det jibt bloß harte Schatten, nee, nee. Det Fräulein Tochter möge sich ant Fenster stellen. Wird zwar nich so jut wie in mein Atelier, aber det jeht schon. Wenn Se so freundlich wären und een Betttuch holen täten?«
Sie sog pikiert den Atem ein. »Ein Bettlaken? Du lieber Himmel. Justus, sag Adele, sie soll eins bringen.«
Sofort stob der Junge aus dem Salon. Der Photograph richtete seine Kamera zum Fenster hin aus, wo eine mannshohe Geigenfeige stand. »Det Kolonienjewächs im Hinterjrund sieht schön exotisch aus. Wissense, det ick als Lehrbub noch det Palmenhaus auf der Pfaueninsel abjelichtet hab? Da jab et Pflanzen, die warn viermal so hoch wie det hier.«
»Die Pfaueninsel ist in jeder Hinsicht ein kleines Wunder«, sagte Friedrich und nahm Adele, die herangelaufen kam, das Laken aus der Hand. Der Photograph wies Friedrich an, sich gegenüber dem Fenster hinzustellen und das Laken hochzuhalten. Grazia lehnte sich ans Fensterbrett, legte eine Hand darauf und ließ die andere herabhängen. In diesem Moment kam sie sich sehr mondän vor, und mit jeder Aufnahme wurde sie mutiger, bis sie gar mit halb geschlossenen Lidern aus dem Fenster blickte, während sie die Brust herausdrückte und den Rock mit beiden Händen raffte, sodass ihre Fesseln hervorblitzten. Gut nur, dachte sie, dass das Laken mich vor Mutters Blick schützt. Ob diese Photographien auch in einem Buch erscheinen würden? Oder in einer Zeitschrift? Das hielt sie für unwahrscheinlich, dennoch genoss sie die Aufmerksamkeit. In diesem Augenblick fühlte sie sich schön.
Schließlich nahm der Photograph das Tuch ab und verstaute Kamera, Stativ und die belichteten Magazine in seinen Koffern.
»Na, so een hübschet Motiv möchte man öfter vor de Linse kriejen. Da werd ick mir jleich dransetzen und de Bilder entwickeln, Herr Mittenzwey. Werte Damen?« Er schlug die Hacken zusammen, machte einen Diener und setzte schwungvoll die Mütze auf. Der Salon leerte sich, als die Eltern ihn hinausbegleiteten und Justus und Adele anwiesen, beim Tragen zu helfen. Friedrich ging zu Grazia, um ihr den Schmuck abzunehmen. Seine warmen Finger nestelten lange in ihrem Nacken, bis es ihm gelang, den Haken zu öffnen.
»Morgen sehe ich auf der Insel nach dem Rechten.« Sorgfältig verstaute er das Collier in seinem Kasten. »Eventuell ist der Boden ja wieder etwas abgetrocknet und ich finde das Gegenstück hierzu.« Er nahm ihr den Ohrring ab und legte ihn dazu.
»Darf ich mit?«
»Nein, mein Fräulein. Du brauchst noch Ruhe.«
»Ach, Friedrich. Es geht mir gut. Ich möchte doch so gerne wissen, wie das Grab inzwischen aussieht.«
»Nein.«
»Aber ich ...«
»Nein.« Hart schlug er den Deckel herunter. Die plötzliche Strenge in seiner Stimme überraschte sie. »Ich will nicht, dass so etwas ... so etwas Skandalöses noch einmal passiert. Meine Braut, durchnässt am See liegend und von einem nackten Mann plappernd! Du kannst Gott dafür danken, dass keine Ausflügler in der Nähe waren. Sie hätten sich die Mäuler zerrissen!«
Sie schluckte. »Das stimmt wohl, aber es war doch nicht meine Schuld. Es ist ja auch gar nicht nötig, dass ich ans Ufer gehe. Du hattest doch bisher nichts dagegen, wenn ich deiner Arbeit zusah?«
»Dich aufs Betteln zu verlegen, wird dir nichts nützen. Und diskutieren will ich mit dir auch nicht.«
»Heißt das, ich darf gar nicht mehr zur Ausgrabungsstätte?«
Mit verkniffener Miene wandte er sich ihr wieder zu. »Vorerst nicht. Ich möchte, dass du das akzeptierst. Und bitte, Grazia ...«
»Ja?«
»Versuch nicht, deinen Vater zu beschwatzen, dass er mich umstimmt. Du würdest damit meine Autorität untergraben. Versprich mir das.«
Sie schluckte wieder. So ein Gnatzkopp, dachte sie. Wollte er wirklich, dass sie als ordentliche Tochter und Braut ihren Platz ausschließlich zu Hause einnahm und nicht dort draußen bei seiner Arbeit? Tränen traten ihr in die Augen. Nicht wegen seines strengen Auftretens, sondern weil sie plötzlich befürchtete, dass er das immer von ihr verlangen würde. Ihr Vater war wirklich zu nachsichtig mit ihr gewesen, sonst würde sie nicht anders als ihre Mutter darüber denken.
»Ist gut«, presste sie heraus.
»Schön, das freut mich. Setz dich ein wenig an die frische Luft. Das tut dir gut.« Er schenkte ihr ein Lächeln, das wohl versöhnlich wirken sollte, und gesellte sich zu ihrem Vater. Dieser steuerte seinen Sessel vor der Bibliothek an, um endlich seinen Nachmittagskaffee einzunehmen. Da die beiden Männer sicherlich keinen Wert auf ihre Gesellschaft legten, setzte sich Grazia auf den Balkon. Sie bemerkte kaum, wie Adele eine Karaffe mit Wasser brachte, ein Kristallglas füllte und es ihr in die Hand drückte. Ihre Gedanken kehrten zur Insel zurück, die ihr jetzt verwehrt war. Zurück zu dem geheimnisvollen Mann. Nie würde sie erfahren, wer er gewesen war – wenn er wahrhaftig existiert hatte.
Als sie das Glas abstellte, bemerkte sie, dass es noch bis zum Rand gefüllt war. Aber sie hatte davon getrunken. Sie war sich sicher, es fast leer getrunken zu haben.
2
Er hatte mit ihr etwas getan, das war ihr jetzt klar. Grazia setzte sich auf und entzündete die Kerze auf dem Nachttisch. Mitternacht. Seit Stunden lag sie im Bett, wälzte sich von einer Seite auf die andere und grübelte darüber nach, was es mit dem Wasser auf sich hatte. Es musste mit dem Mann zu tun haben. Irgendetwas hatte er bewirkt, als er sie dazu gebracht hatte, Unmengen von Wasser zu schlucken. Durch einen Kuss. Sie berührte ihre Lippen, versuchte nachzufühlen, wie es gewesen war. Anders als bei ihrem ersten und einzigen Kuss mit Friedrich, ganz anders – selbst wenn nicht das Wasser durch sie hindurchgeflossen wäre. Allein bei dem Gedanken daran fühlte sich ihr Inneres kühl an, als schlucke sie es wieder. Wenn sie die Lider schloss, sah sie den Fremden sich über sie beugen. Nach ihr greifen. Dann wollte sie zurückzucken und doch auch nicht. Seine kalte Haut anfassen, um sie zu wärmen. Seine Finger ergreifen, die sich hilflos an den Steg geklammert hatten.
Aber das, was er in ihr bewirkt hatte, erschreckte sie. Hatte sie sich auch nicht getäuscht? Sie holte den Porzellanbecher von der Frisierkommode und schlüpfte wieder unter die Decke, den Becher zwischen den Knien. Wie war es geschehen? Wie hatte sie das gemacht? Sie hatte an den Fremden gedacht und dabei irgendwie das Trinkglas aufgefüllt. Starr hielt sie den Blick auf den Becher geheftet, rief sich die Begegnung ins Gedächtnis und stellte sich vor, wie er sich füllte.
Nichts geschah. Natürlich nicht. Das ist doch albern, dachte sie, dennoch legte sie die Hand auf den Becher und schloss die Augen. Sicher hatte sie sich getäuscht, und was sie hier versuchte, war nichts als Spielerei. Als Kind war sie auf einen Hocker gestiegen und herabgesprungen, im Glauben, mit genügend Willenskraft fliegen zu können. Das hier war genauso unsinnig, und doch – sie glaubte, dass es gelingen konnte. Sie spürte, wie ihr Atem regelmäßig ging und sie sich entspannte. An nichts versuchte sie zu denken, nur an den Moment, als das Wasser durch ihren Körper geströmt war. Ihre Finger über dem Rand des Bechers zitterten, und ein Kloß wand sich ihre Kehle hinauf. Was, wenn jetzt wirklich etwas passierte?
Kühl wurde es unter ihrer Hand. Sie riss die Augen auf. Wahrhaftig, der Becher war bis zum Rand gefüllt, das Wasser schwappte über. Mit einem Aufschrei warf sie ihn von sich, sodass er auf dem Boden zersprang, und hüpfte aus dem Bett.
»Das gibt’s doch nicht, das gibt’s doch nicht«, murmelte sie, während sie die Scherben auflas und dabei lauschte, ob jemand wach geworden war. Vom Stuhl am Bettende riss sie ihr Beinkleid und trocknete die Dielen. Das konnte es nicht geben! Sie musste träumen. Ja, das war die einzig denkbare Erklärung: Sie lag immer noch krank im Bett und schlief. Jedoch, wenn dies ein Traum war, dann war es auch der Mann selbst gewesen, und dann hätte es die drei müden Tage im Bett nicht gegeben. Nein, nein, all dies geschah wirklich!
Ich sollte es Vater erzählen, überlegte sie. Oder Friedrich?
Aber sie würden nur wieder den Doktor rufen und sie bis auf weiteres in ihrem Zimmer einsperren. Oder gleich in die Irrenanstalt. Grazia schüttelte sich vor Entsetzen. Nein, das taten sie natürlich nicht, aber sie wären sehr erschrocken. Nichts mehr würde sein wie zuvor. Grazia durfte es niemandem erzählen. Höchstens Justus, der hätte für derartige märchenhafte Vorgänge am ehesten Verständnis.
Sie löschte die Kerze und schlüpfte zurück ins Bett. Wenigstens war die Decke halbwegs trocken geblieben. Sie zog sie sich über den Kopf, aber an Schlaf war nicht zu denken. Was sollte sie tun? Vielleicht gar nichts, außer darauf aufzupassen, dass ihr so ein Malheur nicht wieder passierte. Doch wie konnte sie eine solche Fähigkeit ignorieren? Ständig würde sie daran denken müssen. Es kam ihr vor wie ein Fluch, der sie womöglich eines Tages den Verstand kosten würde.
»Er hat mich gebeten, ihm zu verzeihen«, flüsterte sie in die Stille. Deshalb? Weil er sie ... verändert hatte? Ihr Herz krampfte sich zusammen, und das nicht nur, weil sie sich vor dem, was sie unversehens zu tun imstande war, fürchtete. Angst hatte in seinen Augen gestanden, in diesen seltsamen silbernen Augen. Er hatte trotz seiner heftigen Umarmung so hilflos gewirkt, beinahe zart. War er überhaupt ein Mensch gewesen? Aber wenn er keiner war, was war er dann?
Grazia warf die Decke zurück und atmete tief auf. Hier zu liegen und die Gedanken kreisen zu lassen, machte alles nur noch schlimmer. Sie stieg aus dem Bett, schlüpfte in den Morgenmantel und tastete sich aus dem Zimmer. Glücklicherweise war niemand von dem Zerspringen des Bechers wach geworden, es herrschte tiefe Stille. Als sie am Schlafzimmer der Eltern vorbeiging, hörte sie den Vater schnarchen. Leise öffnete sie die Tür zum Jungenzimmer und schlich sich an Justus’ Bett. Auf seinem Bauch lag aufgeklappt ein Buch. Der Kurier des Zaren.
»Justus«, flüsterte sie und schüttelte ihn. Ihr Bruder grunzte, rieb sich die Augen und setzte sich widerwillig auf.
»Ist’s wirklich schon Zeit zum Aufstehen? Ich bin doch gerade erst eingepennt.«
»Pscht.« Sie setzte sich zu ihm an die Bettkante, klappte das Buch zusammen und legte es beiseite. »Was liest du auch heimlich im Bett?«
»Och, tust du doch auch«, murrte Justus. »Was ist denn los? Brennt es?«
»Nee. Pass auf, ich will gleich nachher in der Frühe auf die Pfaueninsel.«
»Was?« Erst jetzt schien er richtig aufzuwachen, denn er machte große Augen. »Das hat dir der Fried... ich meine, der Herr Mittenzwey doch verboten?«
Sie lächelte. Hatte der neugierige Bengel das also mitbekommen. »Ja, und Papa auch. Da sind sie beide einer Meinung. Ich muss aber auf die Insel. Wenn ich Glück habe, ist Friedrich noch nicht dort, und keiner merkt es.«
Bewunderung angesichts so viel Wagemutes, den er ihr wohl nicht zugetraut hätte, blitzte in seinen Augen auf. »Nimmst du mich mit?«
»Das geht nicht.«
»Wieso denn nicht?«
Abwehrend hob sie den Finger. »Hör zu: Bevor du zur Schule gehst, sagst du, ich sei im Grunewald spazieren. Nach drei Tagen Herumliegen muss man sich ja die Beine vertreten. Sie werden deswegen zwar schimpfen, aber sie werden es glauben. Sag, ich sei mit der Eisenbahn gefahren und am Bahnhof Grunewald ausgestiegen.«
»Na, hoffentlich krieg ich wegen dir nicht den Hosenboden stramm gezogen«, sagte Justus so ernst, dass Grazia sich kaum das Lachen verbeißen konnte.
»Ich werde mich für dich in die Bresche werfen, wenn das passiert«, versprach sie ihm. »Du darfst aber keinem sagen, dass ich weiter zum Wannsee fahre.«
»Ist gebongt. Aber dann hab ich bei dir was gut! Was willst du da eigentlich?«
Sie zuckte mit den Achseln. Wie sollte sie das erklären? So genau wusste sie es ja selbst nicht. Nachsehen, ob das Licht noch da war. Ob er da war und mit ihr sprach. Ihr Antworten gab. »Schlaf weiter. Das erzähle ich dir dann später.«
»Na jut. Hier«, Justus nahm seine Taschenuhr vom Nachttisch und drückte sie ihr in die Hand. Er hatte sie erst vor wenigen Wochen zum Geburtstag geschenkt bekommen und trug sie seitdem immer bei sich. »Damit du deinen Zug nicht verpasst.«
»Danke«, sagte sie gerührt, drückte ihn in die Kissen und deckte ihn zu. Dann ging sie zur Tür, wo sie beschwörend den Finger an den Mund legte, und schlich zurück in ihr Zimmer. Hier fand sie keinen Schlaf mehr, ihr Herz klopfte aufgeregt. Als es hell zu werden begann, beschloss sie, dass es Zeit war. Adele stand immer als Erste auf, setzte das Waschwasser in der Küche auf und weckte die Eltern, sobald es erhitzt war. Bis dahin musste Grazia fort sein. Es würde seltsam erscheinen, dass sie das Frühstück nicht abgewartet hatte. Nun, ihre Eltern würden glauben, dass sie sich habe fortstehlen wollen, damit sie niemand zurückhielt, was ja auch stimmte. Schlimmstenfalls handelte sie sich eine Ohrfeige ein; aus dem Alter, den Hintern versohlt zu bekommen, war sie heraus. Und Stubenarrest hatte sie ja gewissermaßen schon. Welche Folgen es auch nach sich zog, sie konnten nicht schlimmer sein als die Ungewissheit. Sie musste noch einmal zurück, musste nach dem geheimnisvollen Fremden sehen. Darauf hoffen, dass er sich erklärte. Falls er dort war und nicht tot am Grund lag!
Sie trat zur Waschschüssel, stellte sich mit geschlossenen Augen davor und ließ die Hände über dem Porzellan schweben. Zunächst tat sich nichts, aber dann spürte sie einen kühlen Luftzug an den Handinnenflächen, als halte jemand Eisstücke darunter. Es plätscherte. Die Schüssel füllte sich. Es war einfach unglaublich, geradezu beängstigend. Gerne wäre sie hinausgelaufen, um alle zu wecken und das Kunststück vorzuführen. Andererseits, wollte sie diese Fähigkeit, oder was immer es war, behalten? Geheuer war sie ihr nicht, aber immerhin ersparte sie ihr jetzt, in die Küche zu schleichen und den Hahn aufzudrehen, was Adele sicherlich gehört hätte. Rasch beugte sie sich über die Schüssel und sog einen Schluck auf. Das Wasser war kühl und wohlschmeckend wie sonst keines. Wie reines Quellwasser.
Grazia richtete sich auf und wischte bedächtig die Tropfen vom Kinn. Wenn es nun giftig war! Nein, der Fremde hatte ihr auf solche Weise gewiss nicht schaden wollen.
Sie wusch sich und kleidete sich an. Ohne helfende Hand war es mühselig, das Korsett zu schnüren. Ganz zu schweigen vom Drapieren der gelockten Haare. Den schiefen Knoten verbarg sie unter einem weißen Hut, den sie mit Nadeln feststeckte. Dann schlüpfte sie in ihr Sommerjäckchen, steckte Theodor Fontanes Havelland-Band, an dem sie gerade las, in die Handtasche und hängte sie sich an den Arm.
Eine halbe Stunde später saß sie im Zug, das Buch auf dem Schoß.
Pfaueninsel! Wie ein Märchen steigt ein Bild aus meinen Kindertagen vor mir auf: ein Schloß, Palmen und Känguruhs, Papageien kreischen, Pfauen sitzen auf hoher Stange oder schlagen ein Rad, Volièren, Springbrunnen, überschattete Wiesen, Schlängelpfade, die überall hinführen und nirgends; ein rätselvolles Eiland, eine Oase, ein Blumenteppich inmitten der Mark.
Der Zug ruckte, rasselte und zischte. Grazia sah auf und klappte das Buch zu. Es fiel ihr schwer, sich auf die Lektüre zu konzentrieren. Sie hatte gehofft, Ablenkung darin zu finden, doch die Gedanken glitten immer wieder zu dem, was sie mit ihren Händen – oder Gedanken – zu schaffen imstande war. Dagegen war ihr heimlicher Ausflug kaum der Rede wert, nur deshalb wagte sie ihn überhaupt. Sie wünschte sich, alles wäre vorbei und wie zuvor. Sie wünschte sich, Friedrich hätte dieses Grab nie gefunden, denn dann wäre sie nicht in der Nähe des Stegs gewesen und alles andere nicht passiert.
Und doch war es nicht nur die Furcht, die ihr Herz pochen ließ. Wann war das Leben so aufregend gewesen? Abenteuer kannte sie nur aus Büchern. Nicht einmal der seltene Anblick eines Motorwagens, der vom Zug überholt wurde, und dessen Chauffeur fröhlich winkte, da sich alle Zugreisenden, die an den Fenstern saßen, die Nasen platt drückten, konnte sie jetzt beeindrucken.
»Wenn das so weitergeht, fliegen wir noch«, sagte der Fahrgast ihr gegenüber und zwinkerte ihr zu. Grazia lächelte höflich. Er zog aus der Rocktasche eine Tageszeitung und faltete sie auseinander. Auf der unteren Hälfte der Titelseite, eingerahmt von Reklame für allerlei Wundermittelchen, stand ein Artikel über den Grabfund. »Ein havelländisches Troja?«, hieß es da arg reißerisch. Man liebte es, Bezüge zu Troja herzustellen, aber selbst Grazia, die ihr archäologisches Wissen für bescheiden hielt, wusste, dass das unsinnig war. Der Text ließ sich kaum entziffern, zu lesen war nur, dass der Kaiser höchstpersönlich Geldmittel fließen lassen wollte, damit die Sensation ans Tageslicht kam. Verwunderlich war das nicht, Wilhelm II. war sowohl an fortschrittlicher Technik als auch an der Vergangenheit interessiert. Aber dass Friedrich ihr das nicht erzählt hatte, enttäuschte sie. War sie für ihn nur ein nettes Mädchen, das nichts im Kopf hatte? Sie, die Tochter eines Philologen? Eine, die ein mehr oder weniger hübsches Modell hergab, um den Schmuck zu tragen, die aber ansonsten in ihrem Zimmer am besten aufgehoben war? Ärgerlich schnaufend stopfte sie ihr Buch in die Handtasche. Der Zug fuhr ohnehin in den Bahnhof Wannsee ein. Die Bremsen quietschten, ein Ruck ging durch Grazia, sodass sie sich an der Sitzbank festhalten musste. Sie beeilte sich, auf den Bahnsteig zu kommen, wo es durchdringend nach verbrannter Kohle roch. Am Ausgang warteten die Kutscher neben ihren Kremsern auf Fahrgäste. Grazia wäre gern gelaufen, doch dazu war es zu weit, also legte sie den Weg zur Fähre mit einer Droschke zurück. An der Ablegestelle angekommen, steckte sie vorsichtig den Kopf aus dem Fenster. Niemand war hier, nur der Fährmann hockte vor seinem Häuschen und las eine Zeitung. Grazia stieg aus, bezahlte den Kutscher und sah ihm zu, wie er das Gespann wendete. Erst dann wandte sie sich an den Fährmann, denn jetzt ging ihr auf, dass sie gar nicht auf die Insel konnte, ohne dass Friedrich davon erfuhr.
»Hab ick det Frollein nich schon neulich jesehn?«, fragte der Mann, nachdem er sie übergesetzt hatte und ihr beim Aussteigen half.
Grazia setzte eine steife Miene auf. »Ja, in Begleitung von Herrn Mittenzwey.«
»Ach ja, der Herr Archäologe! Der is schon fleißig bei die Arbeet.«
O nein!, dachte sie. Welch ein Pech.
»Und ick hatte mich schon jewundert, dat Sie alleene unterwegs sind. Na, det is ooch en Ding, wa? Alte Knochen uff meene Insel!«
Lachend nahm er einen Groschen entgegen. Grazia beeilte sich, das Fährhaus hinter sich zu lassen und durch einen offenen Laubengang in die kunstvoll angelegte Gartenlandschaft einzutauchen. Gottlob war sie hier allein, sodass sie stehen bleiben und ihre Gedanken sammeln konnte. Hinter dem Garten ragte das weiße Ruinenschlösschen auf, das Friedrich Wilhelm II. vor hundert Jahren hatte bauen lassen. Auf dem sorgfältig gepflegten Rasen stolzierte ein Pfau, seine Schleppe elegant hinter sich herziehend. Ihr Erscheinen bedachte er mit einem nervösen Rucken des Kopfes. Eine Pfauenhenne schrie. Sein Hals wurde länger, dann trippelte er auf das Schloss zu, als sei es selbstverständlich, dass es für einen Vogel wie ihn keinen angemesseneren Ort für ein Rendezvous gab. Grazia runzelte die Stirn. Friedrich würde wohl kaum ähnlich erfreut auf sie zueilen.
Der Gedanke, er könne sie stören, wenn sie auf den Fremden traf, missfiel ihr. Und wie sollte sie ihr Hiersein erklären? Einfach sagen, sie habe sich die Grabungsstätte ansehen wollen? In der Früh? Sie würde ihre Nervosität ohnehin nicht verbergen können, aber vielleicht hatte sie Glück, und er bemerkte sie gar nicht. Sie ging durch einen Rosengarten, vorbei an Eichen und Winterlinden, deren welke Blüten den Boden benetzten, und blieb im Schatten einer Kiefer stehen, vor sich einen runden Springbrunnen, in dessen Mitte eine hohe sprudelnde Säule stand. Stockenten schwammen im Wasser und ließen sich nicht stören, als sie an die Einfassung trat und die Finger benetzte. Sie blickte zurück zum Schloss, das durch die Blätter der Bäume schimmerte. Der Zauber der Insel nahm sie gefangen. Preußens Arkadien nannte man sie, und es war wahrhaftig so, als sei man in einer verwunschenen Welt, mit ihren pittoresken Gebäuden zwischen knotigen Eichen und Büschen. Vögel pfiffen, Pfauen balzten, und das Wasser der Fontäne gischtete ihr ins Gesicht. Gern hätte sie hier verweilt und vergessen, was sie herführte. Als ihr Blick auf den schmalen Weg fiel, der zur Grabungsstätte führte, straffte sie sich und ging weiter. Sie musste sich unziemlich durch die Büsche schlagen, um zum Ufer zu gelangen. Glücklicherweise gab es zu so früher Stunde keine Ausflügler, die sie dabei beobachten konnten. Sie verbarg sich hinter einer Buche und reckte vorsichtig den Hals.
Auf der Lichtung, nur wenige Schritte entfernt, lag Friedrich bäuchlings und mit aufgekrempelten Ärmeln im Gras und wühlte in der Grube. Einiges hatte sich hier verändert. Ein meterhoher Zaun umstand weitläufig die Grabungsstelle, und statt des Meiers waren gleich mehrere Arbeiter damit beschäftigt, Friedrich zur Hand zu gehen. Ein junger Mann, vermutlich ein Student, saß an einem Klapptisch, vor sich eine Schachtel, und notierte etwas in einer Kladde. Knochen lagen in der Schachtel, soweit Grazia erkennen konnte. Die Männer unterhielten sich, wobei sie nicht von ihren Tätigkeiten aufsahen, auch dann nicht, als Grazia langsam zum nächsten Baum schlich. Was, wenn Friedrich jetzt den Kopf hob? Ihr schlug das Herz bis zum Hals. Würde er ihr zürnen? Gar die Verlobung lösen?
Das Rauschen der Blätter verriet, dass es zu regnen anfing. Die Männer sprangen auf und schickten sich an, die Plane über die Grube zu werfen. Grazia nutzte die Ablenkung, um im Schutz der Bäume zum Ufer zu laufen. Da war auch schon der Steg. Unschuldig ragte er in die Havel. Nichts erinnerte an das, was hier geschehen war. Die Holzbohlen waren ein wenig getrocknet, sodass die Regentropfen dunkle Flecken hinterließen. Hoffentlich gab es nicht wieder so einen heftigen Guss wie vor drei Tagen. So oder so würde Grazia nass werden, da sie nicht daran gedacht hatte, ihren Schirm mitzunehmen. Vielleicht sollte sie unter dem Blätterdach warten, bis es vorbei war, und dann nach Hause fahren. Was erhoffte sie sich auch von diesem Ausflug? Der Fremde war fort, versunken vor ihren Augen, und lag vielleicht tot auf dem Grund.
Ein eisiger Schauer lief über ihren Rücken, als sie den Steg betrat. Langsam schritt sie ihn ab und starrte rechts und links ins Wasser. Trüb war es, grünlich. Algen und winzige schwarze Fische schwammen darin, aber tiefer als einige Handbreit konnte sie nicht blicken. Schließlich stand sie auf dem letzten Brett. Ihr war schwindlig, vermutlich von der langen Wegstrecke. Gern hätte sie sich hingesetzt, aber dazu war der Steg zu feucht. Warum nur hatte sie ausgerechnet ihr weißes Sonntagskleid angezogen? Plötzlich erschien ihr der Ausflug so lächerlich und dumm, dass sie sich auf dem Absatz umdrehte. Augenblicklich würde sie sich wieder an Friedrich vorbeistehlen, um heimzufahren, das hoffentlich erträgliche Donnerwetter der Eltern über sich ergehen zu lassen und für die nächsten Tage in ihrem Zimmer zu bleiben.
Und dann? Wollte sie auf ewig an diese Begegnung zurückdenken und sich den Kopf darüber zermartern? Irgendwo hier musste die Antwort auf ihre Fragen zu finden sein. Sie versuchte in die Tiefe zu schauen und sich gegen den Anblick eines Leichnams zu wappnen, der womöglich genau in diesem Moment auftrieb. Ihr schauderte es, und als sie das Licht sah, musste sie einen leisen Schrei unterdrücken.
Es war schwach. Kaum wahrnehmbar für jemanden, der nicht wusste, dass es da war. Sie beugte sich vor. Dass dort unten etwas leuchtete, erschien ihr so unfassbar wie bei ihrem letzten Besuch hier. Und noch seltsamer – je länger sie hinschaute, desto stärker wurde es. An den Rändern waberten Wasserpflanzen, deutlich beleuchtet. Ein Fisch verschwand im Lichtkreis, als werde er darin verschluckt, doch dann kam er auf der anderen Seite wieder hervor.
»Grazia!«
Sie fuhr herum. Am Ufer stand Friedrich, Hose und Hemd beschmutzt, die Arme bis zu den Ellbogen voller Schlamm. Sein Gesichtsausdruck schwankte zwischen Fassungslosigkeit und Ärger. Dann stapfte er auf sie zu, so heftig, dass der Steg ins Wanken geriet.
»Ich hatte dir doch gesagt ... du hattest es mir versprochen! Grazia, was soll das?«
»Bitte, Friedrich.« Es fiel ihr schwer, nicht heiser und schuldbewusst zu klingen. »Mach mir keine Szene.«
»Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Nur dass ich enttäuscht bin. Das genügt fürs Erste, ansonsten reden wir später darüber.« Auf einmal war er so dicht bei ihr, dass sie sein Rasierwasser riechen konnte. Er hob die Hand, um sie am Ellbogen zu berühren, aber dann schien er sich darauf zu besinnen, wie dreckig er war. »Ich bringe dich nach Hause zu deinen Eltern.«
»Nein, bitte brich nicht deine Arbeit ab«, fiel sie ihm ins Wort. »Es hört sicher gleich wieder auf zu regnen. Und ich kann allein fahren.«
»Warum bist du bloß hergekommen?«
»Weil ich ...«
»Nur, um deinen Dickkopf durchzusetzen, ja?«
Das wollte sie empört von sich weisen, aber vielleicht war es gar nicht so falsch. Wie auch immer, sie musste ihm nur das Licht zeigen, dann würde er verstehen. Sie drehte sich auf dem Absatz um und blickte ins Wasser. Ja, es war noch da. »Sieh doch nur, Friedrich, sieh dir das an!«
»Was? Was denn?«
»Da unten im Wasser. Das Licht! Es kann doch nicht sein, dass du es nicht siehst.«
Aber er sah gar nicht hin. Stattdessen griff er ungeachtet seiner schmutzigen Finger nach ihrem Arm. »Grazia, nicht schon wieder so eine merkwürdige Geschichte! Was ist nur mit dir? Mir scheint, du bist wirklich krank.«
»Ich bin nicht krank!«, schrie sie ihn an. Erschrocken schlug sie die Hand vor den Mund. »Verzeih, ich wollte nicht laut werden.«
»Du bist nicht nur laut, du bist überspannt.«
»Überspannt? Bitte!«
»Komm jetzt.« Er wollte sie mit sich ziehen, doch sie riss sich von ihm los und machte einen Schritt zurück. Ihre Stiefelsohle rutschte über die Kante. Mit einem lauten Schrei fiel sie in die Havel.
»Grazia! Mein Gott! Grazia!«
Sie wollte ihm antworten, doch das Wasser schlug über ihr zusammen und erstickte jeden Laut. Verzweifelt suchte sie mit den Füßen Halt. Sie paddelte hilflos mit den Armen und reckte den Kopf nach oben. Es gelang ihr, Luft zu schnappen, doch als sie den über ihr knienden Friedrich um Hilfe anschrie, schwappte das Wasser in ihren Mund. Er streckte eine Hand nach ihr aus. Wild schlug sie danach, bekam sie jedoch nicht zu fassen.
»Bleib doch ruhig«, rief er ihr zu und machte Anstalten, ins Wasser zu springen. Da bekam sie die Kante des Stegs zu fassen. Er packte ihr Handgelenk, dann das zweite. »Ganz ruhig«, ermahnte er sie. »Ich habe dich ja.«
»Friedrich«, keuchte sie. »Etwas ist ... da unten.«
Nein, nicht das Licht. Etwas war dort, ein Sog, der an ihren Beinen zerrte, ohne sie zu berühren. Friedrich stemmte die Füße gegen die Holzbohlen und versuchte sie hochzuziehen. Schweiß perlte durch seinen Schnauzbart. »Du bist zu schwer«, stieß er zwischen zwei Atemzügen hervor. »Ich kann dich nicht hochziehen!«
»Hilf mir!«, schrie sie. Seine Finger glitten an ihren Händen ab. Wieder wollte sie schreien, doch das Wasser drängte in ihren Mund. Sie wollte es ausspucken, warf den Kopf in den Nacken und tat einen gurgelnden Schrei. Mit aller Kraft versuchte sie sich dem Sog zu entziehen, versuchte zu strampeln, nach Friedrichs Händen zu packen ...
Ihr gelang nur ein letzter Atemzug. Das Wasser schlug über ihr zusammen, dunkel und kalt. Das Licht umschloss sie, nur noch schemenhaft sah sie den Steg und Friedrich, wie er sich herabbeugte. Seine entsetzt aufgerissenen Augen, seine Hände, wie sie das Wasser durchpflügten, auf der Suche nach ihr. Allzu rasch wurde er kleiner, dann sah sie nichts mehr. Das Licht erlosch, wurde zu Schwärze. Sie hätte tot sein können, hätte nicht das Blut in ihren Ohren gerauscht und sie nicht gespürt, wie sich ihr Kleid bauschte und an der Hüfte verfing. Allmählich schmerzten ihre Schläfen, und die Lungen schrien nach Luft. Vor sich glaubte sie das Gesicht ihres Vaters zu sehen. Justus ... Niemand war da, sie starb allein. Sie würde sterben. In den Tod sinken.
Aber das Licht kehrte zurück. Unter ihren Füßen pulsierte es, breitete sich aus und umschloss sie wie eine Röhre, bis sie vollkommen darin eingetaucht war. Eine Wasserpflanze trieb dicht vor ihrem Gesicht vorbei, weißlich glänzend. So unwirklich ... Grazia wurde müde, konnte nicht mehr gegen den brennenden Wunsch, Luft zu holen, ankämpfen. Auch nicht gegen die Reue, auf den Steg gegangen zu sein. Was würde ihre Familie sagen? Ihre Eltern, die noch glaubten, sie läge im Bett? Ihr Bruder, der sich nun auf ewig Vorwürfe machen würde, ihr geholfen zu haben?
Etwas leuchtete unter ihren Füßen, heller noch als das sie umgebende Licht. Eine kreisrunde Öffnung, wie das Ende eines Tunnels. Und das, was sie dort sah, war rot, ockerfarben, von harten Schatten durchzogen – eine Wüstenlandschaft. Sie wollte schreien, als sie erkannte, dass sie wie aus großer Höhe zu fallen drohte. Immer näher kam die Öffnung. Tief, tief unter sich erkannte sie Sanddünen und schroff aufragende Klippen. Dürre Vegetation. Gar eine Schlange, die sich tänzelnd durch den Sand pflügte.
Ich sterbe, dachte sie. Das sind nur Bilder, die mir mein sterbendes Hirn vorgaukelt.
Die Lichtsäule bahnte sich ihren Weg bis zum Sandboden.
Grazia konnte sehen, wie der Sand aufspritzte. Plötzlich schwand der Druck des Wassers um ihre Beine. Luft umhüllte sie, dicke, heiße Wüstenluft.
Sie stürzte in die Tiefe.
3
Felsengras war das zäheste Material, das er kannte. Es war geschmeidig und gleichzeitig so fest, dass man es nur mit einer scharfen Klinge durchtrennen konnte. Zum vermutlich hundertsten Mal in diesen zehn Tagen, seit ihn das Wüstenvolk gefangen genommen hatte, versuchte Anschar mit einem scharfkantigen Stein die Grasfessel an seinen Füßen zu durchtrennen, die ihm nur winzige Schritte erlaubte. Doch außer Blasen an den Händen brachte es ihm nichts ein. Die Knoten zu lösen, hatte er aufgegeben; sie waren zu klein und zu fest, seine Fingernägel längst gesplittert.
Mit einem Aufschrei schleuderte er den Stein, der von der Wand seines Gefängnisses abprallte. Es war eine Felsenhöhle, ein kleiner runder Raum mit einer niedrigen Öffnung, vor die seine Wärter einen Felsbrocken geschoben hatten. Ob er hier drinnen gefesselt war oder nicht, machte keinen Unterschied, aber irgendwann würden sie den Steinblock beiseiteschieben, und dann musste er sich bewegen können, wollte er die Gelegenheit zur Flucht nutzen.
Obwohl der Gedanke sinnlos war. Er konnte schließlich nicht kopflos in die Wüste rennen, das wäre sein Tod. Zuerst musste er ein Reittier stehlen, Proviant, ausreichend Wasser.
Eine Waffe. Die Wüstenmenschen waren zwar einfältig, aber sie würden ihm kaum die nötige Zeit für derlei Vorbereitungen lassen.
Einfältig, ha!, dachte er grimmig. Immerhin war es ihnen gelungen, ihn, einen der zehn besten Krieger Argads, einzufangen. Er errötete vor Scham, wenn er nur daran dachte. Dass es mehr als hundert Wüstenmänner gewesen waren, die seine kleine Reisegruppe überfallen hatten, änderte daran nichts, obgleich es ihm als Einzigem gelungen war, zu überleben. Die anderen – vier weitere Krieger, die seinem Befehl unterstanden hatten, und dazu der Priester, den sie hätten schützen sollen – lagen irgendwo dort draußen und verrotteten in der Sonne. Manchmal wünschte er sich, ihr Schicksal geteilt zu haben; dann wieder fragte er sich, ob es nicht doch einen Grund gab, dass er noch lebte. Einen tieferen Grund als den, welchen die Wüstenmenschen haben mochten, ihn zu verschonen. Einen göttlichen Grund. Aber das war unsinnig. Die Götter hatten die Welt ja längst verlassen.