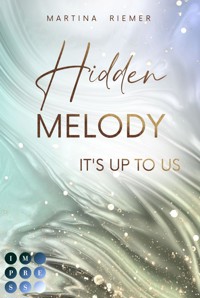
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
**Kann die Liebe wieder zusammensetzen, was die Trauer zerbrochen hat?** Durch einen schweren Autounfall hat Ava alles verloren. Ein Ortswechsel nach San Francisco soll Erleichterung bringen, doch auch dort wird sie von ihrem Schmerz verfolgt, den nicht einmal mehr die Musik zu lindern vermag. Erst als sie an der Uni den ebenso verletzten Nathan trifft, beginnt ihre Barriere zu bröckeln. Auch Nathan, der mit seiner Schwester Sarah und ihrem Freund Johnny nach Amerika gezogen ist, versucht sich nach dem Tod seiner Mutter vor der Welt zu verstecken, bis er merkt, dass Ava nur ihn sieht und nicht das, was er getan hat … Wenn Schuldgefühle dich um die halbe Welt verfolgen, kann die Liebe dich davon befreien? //»Hidden Melody« ist der zweite Band der New Adult Reihe »Its Up To Us« von Martina Riemer. Alle Bände der musikalischen Trilogie bei Impress: -- Broken Harmony (Its Up To Us 1) -- Hidden Melody (Its Up To Us 2) -- Crushed Symphony (Its Up To Us 3)// Diese Reihe ist abgeschlossen. Die New Adult Reihe »It's Up to Us« ist eine überarbeitete Neuauflage der »Herzenswege«-Trilogie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Martina Riemer
Hidden Melody (It‘s Up to Us 2)
**Kann die Liebe wieder zusammensetzen, was die Trauer zerbrochen hat?**
Durch einen schweren Autounfall hat Ava alles verloren. Ein Ortswechsel nach San Francisco soll Erleichterung bringen, doch auch dort wird sie von ihrem Schmerz verfolgt, den nicht einmal mehr die Musik zu lindern vermag. Erst als sie an der Uni den ebenso verletzten Nathan trifft, beginnt ihre Barriere zu bröckeln. Auch Nathan, der mit seiner Schwester Sarah und ihrem Freund Johnny nach Amerika gezogen ist, versucht sich nach dem Tod seiner Mutter vor der Welt zu verstecken, bis er merkt, dass Ava nur ihn sieht und nicht das, was er getan hat …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
© privat
Martina Riemer wurde 1985 in Niederösterreich geboren und wohnt nun in Wien. Zurzeit ist sie als Sachbearbeiterin mit eher zahlenlastigen Arbeiten beschäftigt. Privat geht sie ihrer Leidenschaft Bücher zu lesen und eigene Geschichten zu schreiben mit Freude nach. 2014 hat sie ihre ersten beiden Bücher veröffentlicht und es damit bei Lovelybooks sogar auf Platz 3 der besten Debütautoren des Jahres geschafft.
VORBEMERKUNG für die Leser*innen
Liebe Leserin, lieber Leser,
dieser Roman enthält potenziell triggernde Inhalte. Aus diesem Grund befindet sich hier eine Triggerwarnung. Am Romanende findest du eine Themenübersicht, die demzufolge Spoiler für den Roman enthält.
Entscheide bitte für dich selbst, ob du diese Warnung liest. Gehe während des Lesens achtsam mit dir um. Falls du während des Lesens auf Probleme stößt und/oder betroffen bist, bleib damit nicht allein. Wende dich an deine Familie, Freunde oder auch professionelle Hilfestellen.
Wir wünschen dir alles Gute und das bestmögliche Erlebnis beim Lesen dieser besonderen Geschichte.
Martina Riemer und das Impress-Team
1. Kapitel
Adam Lambert – »Mad World«
Ava
Wie lebt man ein Leben, das einmal perfekt erschien und nun in Scherben vor einem liegt?
Ich wusste es nicht. Wollte es nicht wissen. Gleichzeitig hatte ich Angst, es nie zu erfahren, oder es doch zu tun. Dieses Wissen konnte mich jedoch nicht aus meinem derzeitigen Zustand herausreißen, der sich wie ein Wachkoma anfühlte – ein belangloses, angenehm taubes Dahindriften. Und ich hatte keine Ahnung, ob ich das überstehen würde.
In dem einen Moment war noch alles in Ordnung gewesen: Familie und Liebe ein Teil meines Lebens, die Zukunft so reich und voller Möglichkeiten vor mir. Nur einen Wimpernschlag später war alles anders. Noch immer konnte ich das Quietschen und die Schreie hören, wobei ich nicht wusste, ob diese von mir gekommen waren. Zu einer anderen Zeit, in einem anderen Leben.
Nun war alles weg und es gab bloß noch Schmerz, Trauer und Einsamkeit. Letzteres hatte ich mir selbst ausgesucht und dabei würde es auch bleiben. Mir war bewusst, wie unfair es meinen Eltern und meiner Familie gegenüber war. Auch wenn man weiß, dass etwas falsch ist, kann man es oft nicht ändern. Genauso erging es mir, seit es passiert war, jeden Tag, und es halfen kein gutes Zureden, keine Therapien, die ich besucht hatte, oder Pillen, die ich einwerfen sollte, um mich aus der Depression zu reißen, die jetzt mein Leben war.
Es half auch eindeutig nicht, wie ein Idiot auf der kalten Tribüne zu sitzen und auf die Laufbahn zu starren. Besonders, wenn ein einsamer Läufer Bahn um Bahn lief und jede weitere Runde meine Kehle verengte, mich immer weiter erstickte. Obwohl ich wusste, wie falsch es war, grub ich die Fingernägel in meinen linken Handballen, kratzte über den Schorf am Handgelenk und hörte erst auf, als ich eine warme Flüssigkeit spüren konnte. Beinahe erleichtert seufzte ich, als mir der brennende Schmerz Tränen in die Augen trieb, gleichzeitig jedoch den grausamen Druck in meinem Inneren entweichen ließ, ihn erträglicher machte, als könnte ich erst jetzt wieder richtig atmen.
Der Wind blies stärker, rollte vom Meer ausgehend über die Küste und das Universitätsgelände der Stadt San Francisco. Mir wehten die hüftlangen rabenschwarzen Haare in die Augen, was sie kurz tränen ließ. Was natürlich bloß am Wind lag.
Nachdem ich mir die Strähnen und die feuchte Spur von der Wange weggewischt hatte, sah ich aus dem Augenwinkel, dass ich auf der Tribüne nicht so alleine rumsaß, wie ich gedacht hatte. In der untersten Reihe, am anderen Ende der Tribüne, saß ein Typ, die Ellbogen auf die Knie gestützt, sein Gesicht ebenfalls der leeren Rasenfläche zugewandt, die von der Laufbahn eingesäumt wurde. Dabei hatte er das Kinn auf seine verschränkten Finger gelegt und ich konnte nur sein Profil sehen. Vermutlich einer aus den verschiedenen Sportteams an der Uni, der im Geiste seine Spieltaktik oder Siegesrufe durchging.
Neid durchstieß meine Wut und Traurigkeit – ein Gefühl, das ich noch weniger leiden konnte als die anderen beiden. Aber diese drei gingen oft Hand in Hand wie Geschwister, die man nicht trennen konnte.
Da ich nicht länger alleine war, hatte ich keine Lust, sitzen zu bleiben und Trübsal zu blasen; das konnte ich auch in meinem Zimmer. Außerdem sollte ich langsam meine Sachen aus den Kartons auspacken, da in zwei Tagen mit Anfang September mein erstes Unisemester begann – der Start in mein neues Leben. Ob ich nun Freude dabei empfand oder nicht.
Mir war klar, wie erdrückend und undankbar ich war. Dieses Leiden ging mir genauso auf die Nerven wie wohl jedem anderen auch, doch ich konnte partout nicht aus meiner Haut.
Seufzend stand ich auf und schnappte beim Davongehen meinen schwarzen Rucksack, der mit Sicherheitsnadeln verziert war, um zumindest kleine Akzente in all dem Schwarz zu setzen. Auf diese hatte meine dreijährige Nichte bestanden, auch wenn ich sie nicht alleine damit hatte herumhantieren lassen. Sie war von ihrem Projekt »Rucksack verzieren« nicht abzubringen gewesen, egal wie lange und oft ich »Nein« gesagt hatte oder wie mies ich sonst zu allen gewesen war. Aber es war eben meine Nichte Sookie und gegen ihre süßen blonden Locken und ihr einnehmendes Lächeln konnte man einfach nicht bestehen. Oder ihr Geschrei, wenn sie etwas nicht bekam und sich hysterisch auf dem Boden wälzte.
Der Wind strich erneut durch meine Haare und gab meine Sicht durch den dunklen Vorhang frei, wodurch ich beim Vorbeigehen einen raschen Blick auf den Typen werfen konnte, der nicht aufsah. Er musste definitiv ein Sportler sein, das verrieten mir sein Körperbau und das enge Shirt, das um seinen Brustkorb und die Oberarme spannte. Er sah jedoch nicht zu aufgeblasen aus, weshalb ich ihn nicht zu den übertrainierten Quarterbacks zählte. Seine Haare schätzte ich blond, was schwer zu sagen war, da er sie kurz geschoren trug. Und seine Augen waren … Ungelenk stolperte ich und behielt gerade noch mein Gleichgewicht, als ich dieselbe Sehnsucht und diesen tiefen Schmerz in seinen Augen las. Die gleichen Qualen, die ich selbst kannte, die mir jeden Tag aus dem Spiegel entgegenschrien.
Er blickte auf und für einen Moment fühlte ich mich wie in einem Vakuum, als würde die Zeit stillstehen und alles verschlucken, was um mich herum passierte. Was vollkommener Schwachsinn war und mich daran erinnerte, vielleicht doch bald wieder meinen Psychiater aufzusuchen. Nicht zum Reden, aber für neue Medikamente.
Der Bann, der mich eben überkommen hatte, brach jäh ab, als er den Mund aufmachte. »Hi. Alles in Ordnung mit dir?«
Er hatte einen ungewöhnlichen Akzent, den ich nicht zuordnen konnte, der jedoch deutlich machte, dass er nicht aus Amerika stammte. Was mir am meisten zu schaffen machte, war nicht diese unbeantwortete Frage seiner Herkunft, sondern dass es mich interessierte. Mich hatte schon lange nichts mehr interessiert.
»Hallo? Hast du dir was verknackst?«, fragte er erneut und dieses Mal trat sein Akzent noch deutlicher hervor, als würde dieser stärker durchkommen, wenn er sich sorgte.
Europäisch, aus dem deutschsprachigen Raum vielleicht? Weiter kam ich mit meinen Überlegungen nicht, denn er machte Anstalten aufzustehen. Was ich auf jeden Fall vermeiden wollte. Schnell schüttelte ich mit zusammengepressten Lippen den Kopf und schleppte mich fort Richtung Parkplatz, während ich bemerkte, wie mir die Hitze ins Gesicht stieg. Etwas, das ich eigentlich seit damals abgelegt hatte.
Nachdem ich einige Schritte davongehastet war, hörte ich ihn noch einmal nachfragen, ob mit mir alles okay wäre. Zu mehr als einem Wink mit der Hand, der alles hätte bedeuten können, war ich nicht in der Lage und stakste davon. Das Knirschen der Sitzfläche der Holztribüne ließ mich erleichtert aufatmen. Das sichere Zeichen dafür, dass er sich wieder gesetzt hatte und mir nicht folgen würde. Zum Glück läutete in diesem Moment mein Handy und holte mich aus meinen Gedanken über diesen Typen, den ich hoffentlich nicht so schnell wiedersehen würde.
Nat
Ich war einmal ein netter Typ gewesen. Wirklich. Einer von den Guten. Aber das war Vergangenheit. In meinem Inneren war ich nun so dunkel wie schmieriges Öl, das sich nicht mehr abwaschen lässt, egal was man versucht. Da halfen kein Therapeut, kein Reden mit meiner Schwester Sarah oder ihrem Freund und meinem besten Kumpel Johnny, die es immer wieder versuchten. Ich machte es ihnen nicht zum Vorwurf, nicht aufgeben zu wollen, da sie in ihren Erinnerungen noch immer den guten Nat vor sich sahen. Der Nat, der gerne in einem Verein mit anderen Jungs Fußball spielte, backte, das Frühstück machte und andere aufheiterte, wenn es ihnen scheiße ging. Aber das war vorbei. Ich redete nicht mehr viel – machte schon gar keine Scherze –, hatte keine Hobbys, zog mich immer weiter in mich zurück und wollte nur meine Ruhe.
Willkommen im Schneckenhaus.
Seit einem Monat waren wir drei – Sarah, Johnny und ich – in Amerika, genauer gesagt in San Francisco, und hatten unsere Zelte im Domizil von Kelsey aufgeschlagen. Das Haus war der Hammer, lag unglaublich gut entlang der schicken South Bay und bot vom Obergeschoss aus einen einzigartigen Blick auf die in der Ferne liegende Golden Gate Bridge. Kelsey war eine gute Freundin der beiden, die auch mit mir befreundet sein wollte. Sogar ziemlich vehement, egal wie oft ich murrte und versuchte, ihr verständlich zu machen, nicht der Richtige zu sein, um Spaß zu haben.
Bisher hatten Sarah und Johnny gut als Puffer fungiert und mit ihr Zeit verbracht, aber die beiden waren seit heute mit ihrer Zwei-Frau/Mann-Band »Hallelujah’s Rising« auf einer Musiktour durch den Bundesstaat und ich ahnte Böses. Solche Mini-Touren würden sie in der nächsten Zeit öfter unternehmen, da das Label der Shaw-Morrison-Group sie unter die Fittiche genommen hatte, deren Besitzer Kelseys Onkel war. Zwar betonten die beiden, nur für eine gewisse Zeit in den Musikhimmel zu schnuppern, weil sie eine andere Ausbildung und Jobs für ihre Zukunft planten, aber momentan genossen sie es.
Sarah hatte vor, später etwas in Webdesign, Gestaltung und Werbung zu machen, wohingegen Johnny aufgrund seiner Kindheit eine Ausbildung als Erzieher machen wollte, um später besonders im Bereich Jugend-Sozialbetreuung in Kinderheimen oder der Fürsorge zu arbeiten. Momentan lebten sie ihren Traum, den ich ihnen so wenig wie möglich vermiesen wollte. Daher hatte ich sie gestern Nachmittag breit lächelnd verabschiedet, Sarah mehrmals versichert, alles wäre in bester Ordnung und dass sie diese Zeit genießen und sich auf keinen Fall um mich sorgen sollte.
Zum Abschied hatte ich Sarah umarmt und ihr ins Ohr geflüstert: »Passt auf euch auf und meldet euch.«
Ihre Antwort war ein lächelndes Zwinkern gewesen und ich wusste, wie sehr sie sich freute, da wieder ein wenig meines besorgten Wesens durch die dunkle Fassade geschienen hatte. »Mache ich, großer Bruder.«
Als Nächster war Johnny an der Reihe gewesen, dem ich freundschaftlich auf den Rücken geklopft hatte. »Gib ja acht auf sie und wehe, ich höre etwas Negatives … Du weißt schon, ich will es zwar nicht, aber meine angedrohten Prügel werden dann immer noch zum Einsatz kommen.«
Sein wölfisches Grinsen wäre für mich Antwort genug gewesen, doch er wollte es dennoch genauer ausführen: »Keine Sorge, ich werde sie behüten wie meinen Augapfel und alle ihre Wünsche erfüllen. Ehrlich, damit meine ich jeden einzelnen.«
Typisch Johnny, er musste immer übertreiben, aber er tat es mit so einem gewinnenden Lächeln, bei dem man ihm nicht böse sein konnte. Ich wusste nicht, wie er das tat, doch er schaffte es jedes Mal. So wie kleine Kinder, die etwas anstellten, wie das ganze Wohnzimmer mit Schokoladeneis zu bekleckern oder weiße Wände mit Buntstiften zu bemalen. Aber wenn sie einen dann mit diesen unschuldigen Augen angrinsten, war alles vergessen.
Ich hatte daher bloß den Kopf geschüttelt und ebenfalls grinsend geantwortet: »So genau will ich das nicht wissen, Mann. Sie ist meine kleine Schwester. Wenn du nicht die Klappe hältst, kannst du die Prügel auch gleich beziehen.«
Schelmisch hatte es in Johnnys Augen gefunkelt. »Ach, du weißt doch, ich steh auf Schläge.«
»Idiot«, war es von mir und von ihm postwendend zurückgekommen: »Selbst.«
»Jungs, ich stehe wie immer neben euch, wenn ihr über mich redet. Hört auf damit, auch wenn ihr dabei ja wirklich süß seid. Aber es reicht, wir müssen los.«
»Ja, okay«, hatte Johnny geantwortet und war schlagartig wieder ernst geworden. Im Vorbeigehen hatte er mir auf die Schulter geklopft und nach Sarahs Hand gegriffen, um zum Wagen zu gehen. Nach einem kurzen Lächeln von ihr waren sie in ihren Tourbus gestiegen – ein teils verrosteter blauer VW Polo mit etlichen Stickern beklebt, die Kelsey gesponsert hatte, um eben diese Rostflecken zu verbergen – und losgefahren. Kelsey hatte ihnen ein Leasingauto besorgen wollen, was die beiden vehement abgelehnt hatten, weshalb Kelsey ihnen nur auf diese Weise helfen konnte. Ich hatte ihnen noch lange hinterhergesehen, auch noch, nachdem sie längst aus meinem Blick verschwunden waren.
Es war wohl ganz gut, dass sie jetzt unterwegs waren, mich nicht ständig sorgenvoll musterten und nicht mit ansehen mussten, wie ich immer mehr in die Dunkelheit abrutschte. Sie konnten mir nicht helfen, warum also sollte ich sie dabei zusehen und leiden lassen? Es alleine mit mir auszutragen, war das Einzige, das ich machen konnte, um sie zu beschützen.
Denn ich hatte mich vollkommen verloren, war ein anderer Mensch geworden, einer, den ich selbst nicht mehr im Spiegel erkannte. Nur die beiden wollten es nicht wahrhaben. Doch früher oder später würden sie es ebenfalls erkennen und mich, bei Gott, dann endlich in Ruhe lassen. Damit ich alleine vor mich hinvegetieren und das Sein über mich ergehen lassen konnte, das man Leben nennt.
Die erste äußerliche Veränderung hatte ich gestern Abend durchgezogen, nachdem sie weg waren: Ich hatte meine blonden Locken abrasiert, die Sarah oder meine Mum und Großmutter immer geliebt hatten. Jedoch erinnerten mich diese Haare im Spiegel daran, wer ich einmal gewesen war und nie wieder sein würde. In mir war etwas zerbrochen und es war an der Zeit, dies auch andere sehen zu lassen.
Und sie hatten mich gesehen – zumindest Kelsey. Denn wie ich bisher mitbekommen hatte, kannte sie das Wort Privatsphäre nicht oder hatte es schon vor langer Zeit aus ihrem Vokabular gestrichen. Gestern Abend war sie einfach so in das zu meinem Zimmer gehörige Bad marschiert, um sich mit verschränkten Armen an den Türrahmen zu lehnen. Ich war gerade mit dem Abrasieren auf drei Millimeter Haarkürze fertig geworden und räumte die letzten Reste säuberlich weg.
»Was geht denn bei dir ab, Hübscher? Hast du einen Hitzeschlag bekommen oder machst du jetzt einen auf Vin Diesel? Versteh mich nicht falsch, du bist echt gut gebaut«, hatte sie gesagt, während ihr Blick eindringlich über mich hinweggestrichen war, um ihre Aussage noch weiter zu bekräftigen, »aber an Diesel reichst du leider nicht heran. Da hilft es auch nichts, dir wie er die Haare fast abzurasieren.«
Zur Antwort hatte ich unbeteiligt mit den Schultern gezuckt, als wäre es keine große Sache, obwohl es genau das war. Zumindest für mich. Wahrscheinlich auch für Sarah, bestimmt für meine verstorbene Mum und Großmutter – aber die waren beide nicht mehr da, also wen kümmerte es?
»Neuer Wohnort, neuer Haarschnitt. Macht man doch so. Außerdem müsste es gerade dir gut gefallen, immerhin ist deine rechte Seite auch geschoren. Wenn du dich beim Rest ebenfalls trauen würdest, könnten wir im Partnerlook gehen. Oder gefällt es dir nicht?«
Daraufhin hatte sie mich als erneute Anspielung auf Vin Diesel »Ach, Vinny, Vinny, Vinny«, genannt, weshalb ich kurz den Mund verzogen, mir aber sonst nichts hatte anmerken lassen.
Sie war näher getreten. »Ich find’s, ehrlich gesagt, erschreckend gut. Aber du hast auch mit den ganzen Locken als blonder Engel nicht schlecht ausgesehen. Damit wirkst du jetzt viel härter, unnahbarer. Gibt dir so einen verruchten Touch«, plapperte sie weiter, tippte dabei mit dem Zeigefinger auf ihre Hüfte. Plötzlich bekam sie große Augen und streckte den Finger in die Luft empor. Dabei sah sie ein klein wenig aus wie Wickie aus der gleichnamigen Zeichentrickserie. Früher hätte ich diesen Gedanken laut geäußert und gelacht. Jetzt nicht mehr. Vermutlich hätte sie mir sowieso keine Zeit dafür gelassen, denn Kelsey fuhr unbeirrt fort: »Ah, deshalb mussten die Haare fallen! Du schlimmer Finger! Du willst wohl die Mädels, die auf böse Buben stehen, ansprechen. Sehr subtil, muss ich sagen.«
Mit ihren schlanken Fingern hatte sie über meine Stoppelhaare gestrichen, schließlich zufrieden genickt und ein Grinsen war auf ihrem Gesicht erschienen. »Zugegeben, fühlt sich richtig sexy an. Wenn ich nicht Frauen bevorzugen würde, hättest du gute Chancen, Vinny.«
Ich hatte geseufzt. Tief, sehr tief. »Witzig. Wie lange willst du das mit dem neuen Namen nun durchziehen?«
»Hm, bis es mir zu langweilig wird, was nie im Leben passiert. Oder einfach nur so lange, bis du wieder Engelshaare trägst. Und dann kann ich dich ja wie den Erzengel – Michael – nennen. Schön wie eine Heldenstatue, aber unnahbar wie ein Engel. Wahnsinn. Das wird ein Spaß!«, hatte sie lachend geantwortet, nur um im nächsten Moment aus dem Raum zu verschwinden und mich grummelnd und nachdenklich zurückzulassen. Seitdem dachte ich ständig nach und es nahm gar kein Ende mehr. Würde es das je?
Gerade eben kam ich mir selbst beinahe lächerlich und wie ein verheultes Weichei vor, wie ich hier auf die Rasenfläche in der Mitte der Sportanlage blickte. Es war jämmerlich, so richtig schwach, trotzdem konnte ich nicht aufstehen, noch nicht einmal den Blick abwenden. Dabei rasten immer wieder die letzten Momente an meinem geistigen Auge vorbei: die letzten Sekunden, bevor ich meine Mum gefunden hatte; die letzten Sekunden, bevor ich mich bis zur Besinnungslosigkeit besoffen hatte; die letzten Sekunden, bevor ich von der beschissenen Fahrbahn abgekommen war. Es hätte weit schlimmer ausgehen, ich hätte tot sein können, trotzdem saß ich hier und jammerte rum wie ein Mädchen.
Was ist nur aus mir geworden? Wie konnte das passieren?
Das Wissen, noch zu leben, half mir nicht über die Schmerzen hinweg, die ich in meinem linken Bein verspürte, nachdem es sich verdreht und einen mehrmaligen offenen Bruch erlitten hatte. Oder über die Tatsache, dass ich meine Mum, Oma, Sarah und alle anderen enttäuscht hatte, schon vor dieser Sache mit dem Autounfall. Oder über den Wunsch, wie früher über diesen Rasen laufen zu können, um meiner Leidenschaft, dem Fußballspielen, nachzugehen – die Schmerzen würden das nicht zulassen, nie wieder. Dieser Sport war für mich Geschichte, zumindest auf professioneller Ebene in einem guten Verein.
Plötzlich riss mich eine Gestalt, die vor mir stolperte, aus meinen tristen Gedanken. Kurz befürchtete ich, sie würde komplett der Länge nach auf die Nase fallen, aber sie fing sich noch und blieb aufrecht stehen. Ich blickte in ihr Gesicht. Zwei hellgraue Augen starrten mich an, die mit dickem schwarzem Lidstrich umrandet waren. Obwohl sie einen grimmigen Ausdruck zur Schau trug, der deutlich machte, man sollte sich von ihr fernhalten, hatte sie ein hübsches Gesicht mit feinen Zügen. Trotz dieser grässlichen dunklen Augenschminke, die beinahe wie eine Kriegsbemalung wirkte; eine Verkleidung, eine abwehrende Maske. Erst jetzt bemerkte ich auch ihre fast ausschließlich schwarzen Klamotten, was meinen Eindruck verstärkte.
Und obwohl sie äußerlich eine harte Schale um sich gelegt hatte, war da etwas sehr Zerbrechliches an ihr, etwas, das mich ansprach. Nicht als Mann oder auf irgendeine abartige, sexuelle Weise. Sondern meine alte Seite, den guten Nat, der ich früher gewesen war. Der mit Menschen gesprochen hatte, höflich und freundlich gewesen war und hatte helfen wollen.
Aus dem alten Drang heraus fragte ich sie deshalb, wie es ihr ginge, ob alles okay wäre oder sie sich wehgetan hätte. Da sie nichts erwiderte, mich bloß für einen Moment anstarrte wie ein verschrecktes Rehkitz, machte ich mir schließlich tatsächlich Sorgen um sie. Erst als ich mich hochhieven wollte und noch mal fragte, ob alles klar wäre, wurde sie aus ihren Gedanken geholt und ihre düstere Miene trat wieder in den Vordergrund. Mehr als ein grimmiges Nicken – kein »Nein danke« oder irgendein Wort – und einen kurzen Wink mit der Hand bekam ich nicht von ihr.
Sie verwirrte und stellte mich vor ein Rätsel, obwohl es mir egal sein sollte. Dennoch war ich neugierig, warum sie derart ablehnend auftrat, wieso kurz Panik in ihren Augen aufgeflackert war, als ich ihr hatte helfen wollen. War sie schon immer so gewesen? Oder war sie so jemand wie ich, ein Mensch, der sich grundlegend verändert hatte?
Auch als sie schon lange aus meinem Blickfeld verschwunden war, kreisten meine Gedanken noch eine Zeit lang um dieses Mädchen, das für einen flüchtigen Moment wieder das Gute aus mir herausgekitzelt hatte.
2. Kapitel
Vance Joy – »Best That I Can«
Ava – im Frühling zuvor
Bilder schießen vor meinem inneren Auge vorbei. Dunkelheit, Regen, ein Lichtblitz, auf mich zurasende Bäume, Schreie, Schreie, Schreie …
Mit einem Aufkeuchen erwachte ich und stellte erleichtert fest, dass die Schreie nur in meinem Kopf widerhallten und ich nicht, wie so viele Nächte zuvor, im Schlaf geschrien hatte. Sonst wäre meine Mum längst in meinem Zimmer gewesen und hätte beruhigend auf mich eingeredet. Das ging mir durch den Kopf, als neben mir der Wecker zu läuten begann und mich nicht aus dem Schlaf, sondern aus meinen Gedanken riss.
Mit zittrigen Fingern strich ich mir den Schweiß von der Stirn und schüttelte den letzten Rest des Traumes fort. Mechanisch, wie an jedem anderen Tag, stand ich auf, zog mich an und machte mich für die Schule fertig. Nur dauerte es dieses Mal doppelt so lange wie früher und ich war viel nervöser. Wobei ich deutlich weniger darauf achtete, ob meine Klamotten zusammenpassten oder mein Make-up saß. Denn ernsthaft? Ich hatte definitiv andere Probleme.
Humpelnd stieg ich die Treppe hinunter und ging in die Küche, in der bereits meine Mum und mein kleiner Bruder Aston plauderten. Sie unterhielten sich über die bevorstehende Woche, über Schulprojekte von Aston und was sonst anstand.
Vor Schreck, mich zu sehen, hätte Mum beinahe die Kaffeekanne fallen lassen, fing sich aber im letzten Moment gerade noch. Dennoch zeichneten sich tiefe Sorgenfalten auf ihre Stirn, die wohl nie wieder weggehen würden. Und das alles wegen mir. Schuldgefühle, die nun immer Teil meines wachen Zustandes waren, machten sich stärker bemerkbar. Ich hatte schon eine Familie zerstört, ich wollte dasselbe nicht bei uns anrichten.
Beschwichtigend lächelte ich ihr zu und versuchte ganz normal zu wirken, aufmunternd und gefestigt. Auch wenn ich mich überhaupt nicht so fühlte.
»Schatz, warum bist du denn schon auf? Willst du dich nicht noch ein wenig ausruhen und schlafen?«
Ich schluckte meine Widerworte hinunter und behielt eine neutrale, freundliche Miene bei, um Mum nicht zu verletzen. Für sie war es ebenfalls nicht leicht gewesen, aber manchmal übertrieb sie es einfach mit ihrer Fürsorge. Daher setzte ich mich an den Tisch, schnappte mir ein Brötchen und begann es mit Erdnussbutter und Marmelade zu bestreichen – alles ganz normal, wie an all den Tagen zuvor.
»Heute ist Schule und ich habe mich die letzten Wochen lange genug ausgeruht, Mum. Ich muss wieder raus und lernen, sonst hinke ich viel zu weit hinterher.«
Sichtlich unschlüssig schob sie sich eine hellbraune Strähne hinters Ohr, dieselbe Haarfarbe, die mein Bruder und ich ebenfalls teilten, und kam an den Tisch. Mum beugte sich vor und griff nach meiner freien Hand. Nachdrücklich spürte ich den Druck ihrer Finger. »Wegen der Schule. Darüber haben wir doch geredet und dein Dad und ich fänden es wirklich am besten, wenn du die restliche Zeit, wie besprochen, zu Hause unterrichtet wirst. Das wäre für alle Beteiligten die beste Lösung.«
Ich konnte nicht anders, als bei ihren Worten kurz zusammenzuzucken, obwohl ich versuchte, mich so wenig wie möglich zu regen. Schämten sie sich für mich? Wollten sie nicht, dass mich andere sahen, oder hatten sie Angst vor dem Getratsche? Aber nein, das war sicher nicht der Grund und mein rationales Denken übernahm wieder die Oberhand. Sie machten sich bloß Sorgen, was ich verstehen konnte. Alles hatte sich verändert und ich war kein Kind mehr, ich musste ruhig und besonnen bleiben. »Danke, Mum, das ist lieb von euch, wirklich. Aber ich möchte zur Schule gehen. Ich packe das, bitte. Das ist mein Abschlussjahr, die letzten Monate. Und die will ich dort verbringen wie ein normaler Teenager.«
Obwohl der letzte Satz gelogen war. Eigentlich hatte ich Angst davor, nach der langen Zeit im Krankenhaus und der Rehabilitation wieder in die Schule zu gehen und mich dieser unangenehmen Situation zu stellen. Nicht nur, weil sich die anderen Schüler das Maul über mich und Sam zerreißen würden, sondern auch, weil ich unweigerlich auf seine kleine Schwester stoßen würde, meine ehemals beste Freundin Stephanie. Sein älterer Bruder Jordan war zum Glück schon am College, also hatte ich von ihm nur in den Ferien etwas zu befürchten.
Ich wusste nicht, wie sie nach den Geschehnissen zu mir standen, was sie über mich dachten, aber ich befürchtete so ziemlich das Schlimmste. Steph hatte sich seitdem mit keiner SMS, keinem Anruf bei mir gemeldet oder mich besucht. Jegliche Nachrichten meinerseits waren ignoriert worden. Ebenso wie bei meiner zweiten besten Freundin Chloe – wir waren immer ein Dreiergespann gewesen, das alles zusammen gemacht hatte. Anscheinend war das nun vorbei.
Obwohl ich keine Ahnung hatte, was auf mich zukommen würde, wollte ich es zumindest herausfinden und versuchen mit ihnen zu reden. Die Hoffnung stirbt zuletzt, nicht wahr?
»Ich weiß nicht … ich, ich weiß nicht, ob das gut für dich ist, Schatz. Wir sollten nichts überstürzen und die Sache noch etwas auf sich beruhen lassen«, entgegnete meine Mutter und lenkte mich von meinen Gedanken ab.
Statt einen weiteren Bissen von meinem Frühstück zu nehmen, schob ich den Teller mit dem halben Brötchen beiseite. Der Appetit war mir vergangen, meine Kehle wie zugeschnürt. Jedoch durfte ich jetzt nicht nachgeben, sonst wäre es in Zukunft immer so, dass ich Konfrontationen verlieren und sie mich wie ein rohes Ei behandeln würde.
»Mum, ich hab dich lieb, aber ich werde gehen. Ob ihr damit einverstanden seid oder nicht. Ich muss das machen, das weißt du.« Ich unterstrich meine Worte mit einem theatralischen Zurückrutschen des Stuhls, der über den Boden quietschte.
Meine Stimme klang deutlich entschlossener, als ich mich tatsächlich fühlte, was ich auf keinen Fall zugeben wollte. Daher stand ich entschieden, obgleich auch etwas zittrig auf und schlüpfte in meine Jacke, die ich vorhin über die Sessellehne geschmissen hatte. Zum guten Abschluss der ganzen Szene hängte ich mir demonstrativ den Rucksack über die Schultern, starrte sie an und wartete und wartete. Endlos, wie mir schien.
Aus Mums Gesicht wich jegliche Farbe und erneut fragte ich mich, ob sie sich Sorgen um mich oder um das Gerede der Leute machte, wenn sie mich sahen. In ihren Augen erkannte ich, wie sie nach einem Ausweg suchte, und ich sah auch das Aufleuchten in dem Moment, als ihr eine Idee kam, mich von meinem Vorhaben abzubringen.
»Und wie willst du dorthin kommen, Schätzchen? Du kannst doch nicht mit einem … ich meine … wie …« Sie unterbrach sich und suchte sichtlich nach dem richtigen Wort. Ich würde ihr dabei sicher nicht helfen, ich wollte selbst wissen, warum genau ich das nicht konnte. Schließlich schluckte sie und faltete ruhig die Hände im Schoß. »Du kannst so doch nicht mit einem Bus fahren.«
Sie meint es gut, sie meint es nur gut, redete ich mir ganz fest ein und wollte kurz die Augen zusammenkneifen, um nur das zu hören und alle anderen Vermutungen auszublenden. Stattdessen blickte ich Hilfe suchend zu meinem kleinen Bruder, der die ganze Szene kommentarlos beobachtet hatte. Und es nebenbei geschafft hatte, eine Schüssel Müsli und zwei Brote zu verspeisen. Ach ja, und mein halbes Brötchen war auf magische Weise ebenfalls verschwunden – wahrscheinlich in den Magen seiner schlanken Gestalt. Wo aß er das nur hin, und auch noch so schnell?
Egal. Ich blickte ihm in die Augen und flehte stumm, als ich meiner Mutter Konter gab. »Aston nimmt mich mit. Jetzt, da er den Führerschein hat, haben wir ein Problem weniger. Stimmt doch, oder, Aston?«
Mein Blick hakte sich an seinem fest, bis er mich schließlich erlöste, indem er schief grinste und Mum gewinnend zunickte. »Klar, bin der beste Taxifahrer aller Zeiten. Sind schon auf dem Weg.«
Schnell schnappte er sich noch ein trockenes Brötchen und schob es sich zwischen die Lippen, als er auch schon aufsprang, mit einer Hand seinen Rucksack schnappte und sich mit der anderen seine hellgraue Beanie über die zu langen Haare zog, die nun seitlich um die Ohren wegstanden. Ich hätte ihn küssen können, auch wenn er manchmal unglaublich nervte und mich zur Weißglut brachte. Aber genauso oft, wie wir uns zankten, waren wir füreinander da. Wie gerade eben.
Bevor unsere Mutter noch einen Einwand hervorbringen konnte, humpelte ich hinter Aston die Haustür hinaus und hoffte, der restliche Tag würde nicht so nervenaufreibend wie der Morgen sein. Natürlich war das reines Wunschdenken, und das wusste ich auch selbst.
Nat – im Sommer zuvor
Mit dem Rücken schob ich die Hauseingangstür unseres bald ehemaligen Wohnhauses auf, da beide Hände mit schweren Koffern beladen waren. Ächzend schleppte ich sie weiter, wobei es nicht an mangelnder Muskelmasse lag, sondern an den Schmerzen in meinem Bein, das auch Wochen nach dem Unfall bei jeder Bewegung noch höllisch wehtat. Dennoch biss ich die Zähne zusammen, um mir ein Stöhnen zu verkneifen.
Ich näherte mich dem bereits fast vollgestopften Wagen, an dessen Seite Sarah lehnte, an der wiederum Johnny hing und die sich ausgiebig küssten. Schon wieder. Ständig. Sie waren dermaßen glücklich, dass ich mir schon fast wie bei dem Ende eines kitschigen Disneyfilms vorkam, in dem Fanfaren im Hintergrund zu hören waren und alle lachend miteinander tanzten, während sich das Paar in der Mitte küsste. Glücklich für immer und ewig oder so ein Schwachsinn …
Auch wenn das jetzt anders klang, ich freute mich für die beiden. Wirklich. Sarah war meine kleine Schwester, einer der besten Menschen, die ich kannte, und Johnny mein bester Freund – ein aufrichtiger Kumpel. Die beiden hatten dieses Glück verdient, mehr als andere, und das wollte ich ihnen nicht madigmachen. Aber dennoch – es hielt mir immer wieder vor Augen, wie verflucht unglücklich ich mich fühlte. Wie zerrissen ich war und wie verloren, obwohl ich jede Sekunde versuchte, diese Seite in mir wegzusperren, sie nicht nach außen dringen zu lassen.
Langsam machten sich kleine Risse in meiner Fassade bemerkbar und obwohl ich es nicht wollte, purzelten die nächsten Worte über meine Lippen: »Leute, müsst ihr ständig vor mir rummachen? Nehmt euch ein Zimmer. Es will nicht jeder sehen, wie ihr euch gegenseitig abschleckt.«
Ich beobachtete, wie sich Johnny nur widerwillig von Sarah löste, ihr etwas ins Ohr flüsterte, das sie grinsen ließ, obwohl sie ihm gleichzeitig mit dem Handrücken auf den Oberarm schlug, und ich die Augen verdrehte. Ich wollte gar nicht wissen, was er gesagt hatte, besonders nicht, wenn es um meine kleine Schwester ging. Aber sie war längst erwachsen und ich war der Letzte, der ihr etwas vorschreiben sollte. Die Rolle des Aufpassers, des großen Bruders, desjenigen, der für diese Familie sorgte, damit sie nicht weiter auseinanderfiel, stand mir nicht mehr zu. Nein, diese Rolle hatte ich vollkommen vermasselt und es gab keinen Weg mehr zurück. Wegen mir waren wir bloß noch zu zweit.
Zuerst war unsere Großmutter gestorben, die immer auf uns aufgepasst hatte. Dann unsere Mutter, während ich auf sie hätte achtgeben müssen, als Sarah mit Johnny in Amerika gewesen war. Und was hatte ich getan? Genau das Falsche.
Johnny kam auf mich zu und half mir das erste Gepäckstück in den Kofferraum zu hieven. Gleichzeitig grinste er und seine blauen Augen strahlten – er sah so verdammt glücklich aus und ich fühlte mich immer mieser, dass ich mich nicht so für ihn freuen konnte, wie er es von mir als seinem besten Freund verdient hatte, mein Lächeln nicht echt war und ich es nicht fühlte, obwohl ich mich wirklich bemühte. Aber Gefühle konnte man nicht verändern, die waren einfach da.
»Ach, Nat, ich mache wie immer nur, was du mir aufgetragen hast. Schon vergessen? Ich soll sie glücklich machen und das ist sie nun mal nur, wenn sie meine Lippen auf ihren hat. Das unwiderrufliche Gesetz der Natur. Da kann man nichts gegen machen.«
Im Hintergrund stöhnte Sarah, aber dennoch war ein Lächeln in ihrer Stimme zu hören: »Johnny, hörst du dir manchmal auch selbst zu? Man könnte meinen, du seist ein wenig selbstverliebt.«
»Ein wenig?«, prustete ich und hob gleichzeitig den letzten Koffer hoch. Schnell griff Johnny ebenfalls zu und grinste blöd. Ich begriff immer noch nicht, wie sie sich ständig gegenseitig aufziehen konnten und es Johnny gefiel, von Sarah veräppelt zu werden. Da hatten sich zwei gefunden.
»Leute, das habe ich nie bestritten. Wo ist also das Problem?«, antwortete er und funkelte zu Sarah hinüber.
Ich gab ihm mit einem »Danke« einen Schulterklopfer und machte einen Schritt zurück, da ich noch einmal in die Wohnung musste. Noch bevor ich ging, war Johnny wieder bei Sarah angelangt, also seufzte ich gespielt und legte so viel gute Laune in meine Stimme, wie ich aufbringen konnte: »Na gut, dann kommt schon. Küsst euch wieder. Und, Johnny, lass dir dabei durch die langen schwarzen Haare streichen. Es gibt ja viele, die darauf stehen, wenn zwei Mädels miteinander rummachen.«
Während Johnny gespielt verletzt »Mann, keine Tiefschläge« antwortete und gleichzeitig dabei lächelte, strich Sarah durch seine kinnlange Mähne. »Hör nicht auf ihn, ich steh auf deine Haare.«
Johnny zwinkerte mir zu und ich winkte ihm, dann verschwand ich im Wohngebäude, während die beiden da weitermachten, wo ich sie unterbrochen hatte.
Oben in der Wohnung angekommen, ging ich einen letzten Rundgang durch die leeren Zimmer, in denen wir, seit ich denken konnte, gelebt hatten und die wir endgültig verlassen wollten. Zum Teil war ich traurig darüber, zum anderen erleichtert. Hier war meine Mum gestorben, hier hatten wir Dinge erlebt und gesehen, die ich gerne vergessen würde. Vielleicht half es auch, über die Schuldgefühle hinwegzukommen, wenn ich nicht immer diesen Ort sehen musste.
Einige Wochen, nachdem Sarah und Johnny aus Amerika zurückgekommen waren, hatte Kelsey ihnen ein Angebot gemacht, das sie nicht ausschlagen konnten. Während sie als Vorband eine Tour begleiten sollten, würde ich mit Kelsey in San Francisco wohnen und dort die Uni besuchen. Daher befanden wir uns nur noch wenige Stunden vor einem neuen Leben in Amerika entfernt. Wie auch immer das aussehen würde.
Ein letztes Mal wollte ich die Taubheit in diesen Räumen meiner Kindheit abschütteln. Mit raschen Schritten ging ich zum großen Fenster des leer stehenden Wohnzimmers, öffnete die breiten weiß lackierten Holzflügel, zog mich mit den Armen hoch, setzte mich mit geschlossenen Lidern auf das Fensterbrett und hörte auf die Geräusche der Straße, die gleich um die Ecke des Wohnhauses lag.
Erst als ich mich mit dem Oberkörper nach vorne über den Abgrund lehnte, öffnete ich wieder die Augen, starrte in die asphaltierte Gasse drei Stockwerke unter mir. Der Wind zerrte wie gierige Arme an meinen Locken und an den Klamotten. Er musste bloß ein wenig stärker an mir reißen, oder ich mit meiner Hand einen Zentimeter am Fensterrand abrutschen, und ich würde fallen – tief fallen. Adrenalin schoss angetrieben vom Nervenkitzel durch meine Venen, was ein heftiges Hämmern in meiner Brust auslöste. Wumm, wumm, wumm.
Ja, genau so. Für einen Augenblick fühlte ich mich lebendig, wie verrückt es auch erscheinen mochte. Einen tiefen Atemzug später rutschte ich wieder in die Wohnung, schloss die Fensterflügel und wandte mich zum Gehen. Gerade als ich nach meiner Jacke griff, klingelte das Haustelefon. Ich hob ab und das Einzige, worüber ich mich wunderte, war die Tatsache, noch einen funktionierenden Anschluss zu haben.
»Hallo, bei Familie Steger«, sprach ich in das Telefon und spürte ein komisches Kribbeln im Nacken, als mein Gegenüber antwortete: »Guten Tag, hier spricht Notar Dr. Kirchner. Sind Sie Nathan Steger, der Sohn der verstorbenen Frau Lisa Steger und von Herrn Nawin Muangyai?« Ich bejahte. »Sehr gut, ich bin für die Hinterlassenschaft Ihrer Mutter zuständig und würde gerne einen Termin mit Ihnen vereinbaren, um diesbezüglich etwas zu besprechen, wenn Sie es zeitlich einrichten könnten.«
Das Kribbeln in meinem Nacken wuchs zu einer unbestreitbaren Nervosität an. Meine Stimme klang dennoch überraschend fest. »Um was geht es? Ein Termin wird sich leider nicht mehr machen lassen, da meine Schwester und ich nach Amerika gehen. Der Flug ist heute Nachmittag.«
Zuerst herrschte absolute Stille auf der anderen Seite der Leitung, als wäge dieser Dr. Kirchner ab, wie er die Sache weiter angehen sollte. Während ich wartete, legte ich die freie Hand in den Nacken und strich über die angespannten Muskeln, um das Prickeln zu vertreiben. »Hören Sie, wenn es wichtig ist, können Sie es mir am Telefon sagen. Oder ich gebe Ihnen meine neue Adresse und Sie senden mir einen Brief.«
Ein kurzes Seufzen war zu hören und ein Klopfen, so als würde er mit einem Stift spielen und damit auf eine Tischplatte tippen. »Na schön, Sie haben recht. Das ist wohl die beste Lösung, auch wenn ich Ihnen diese Neuigkeit lieber persönlich unterbreitet hätte. Die genauen Daten werde ich Ihnen per Einschreiben senden. Könnten Sie mir dazu bitte Ihre neue Adresse nennen?«
Zwar wollte ich endlich erfahren, was verdammt noch mal los war, dennoch blieb ich ruhig, rasselte die Adresse herunter und wurde genau in dem Moment fertig, als Sarah zur Wohnungstür hereinkam und nach mir rief. Jedoch konnte ich ihr nicht antworten, da Dr. Kirchner endlich zum Punkt kam.
»Nach dem Tod Ihrer Mutter haben wir in ihrem Namen einen Brief versendet. Daraufhin hat sich bei uns eine Familie gemeldet, und wie sich nun herausgestellt hat, handelt es sich dabei um die Eltern Ihres verstorbenen Vaters – also um Ihre Großeltern. Ich gratuliere Ihnen herzlich, Sie haben noch Verwandte und diese möchten sich mit Ihnen treffen.«
Ich war sprachlos, vollkommen angespannt, trotzdem bemerkte ich, wie mein Kopf wie ein Wackeldackel auf- und abging, und nickte, obwohl dieser Dr. Kirchner mich nicht sehen konnte. Noch immer hatte ich nichts erwidert, doch als Sarah in die Küche stürmte und mich sah – ich musste wohl jegliche Gesichtsfarbe verloren haben –, wurden ihre Augen riesig und holten mich aus meiner Benommenheit.
Ich musste mich regelrecht dazu zwingen, Worte zu formen, als Dr. Kirchner noch einmal nachfragte, ob es in Ordnung wäre, alle Kontaktdaten per Post zu senden. Dabei nannte er in kurzen Worten die Daten dieser lang verschollenen Großeltern und wartete auf eine Antwort von mir. Verdattert nickte ich erneut, bis mir Schwachkopf einfiel, dass er mich nicht sehen konnte. Mit den Worten: »Ja, danke. Alles bestens. Ja, das machen wir. Vielen Dank. Auf Wiedersehen«, legte ich entgeistert auf und starrte auf das Telefon in meiner Hand. Das alles fühlte sich so surreal an. Wir hatten Familie? Jemanden, der sich für uns interessierte? Der sich sogar mit uns treffen wollte?
»Was ist los?«, fragte Sarah besorgt, die näher getreten war und mir eine Hand auf den Unterarm legte.
»Das war der … der Notar, der mit Mums Erbe beauftragt war. Tja, nach der ganzen Abwicklung hat sich … Es hat sich jemand bei ihm gemeldet.«
Langsam blickte ich ihr wieder ins Gesicht und ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte – ich fühlte nur puren, durchs Mark gehenden Schock.
»Okay, und was hat das mit uns zu tun? Wer war es und was wollte er?«
Früher war ich ein kleines fröhliches Plappermaul gewesen, aber in den letzten Wochen musste man mir alles aus der Nase ziehen – das wusste ich selbst. Wie jetzt, als ich Sarahs Ungeduld spüren konnte, also riss ich mich zusammen. »Die Eltern unseres Vaters haben ihn kontaktiert. Sie meinten, sie hätten erst jetzt von uns erfahren und wollen sich mit uns treffen. Uns kennenlernen.«
Sarah stockte wie mir zuvor der Atem – vor Glück, Schock, Angst oder Freude? Ich wusste es nicht. Ich wusste ja nicht einmal, was ich selbst empfinden sollte, außer Unglauben. Die Fragen, was wir mit dieser Information machen sollten, ob wir sie wirklich treffen wollten, konnte ich zu diesem Zeitpunkt ebenso wenig beantworten. Zum Glück mussten wir das jetzt noch nicht. Wir hatten die letzten zwanzig Jahre nichts von ihrer Existenz gewusst, also kam es auf ein paar Tage mehr oder weniger auch nicht an. Zuerst mussten wir diese Information verarbeiten, erst dann konnten wir planen.
Dennoch sah ich die Neugierde in Sarahs Augen aufblitzen, als sie fast atemlos fragte: »Wo leben sie?«, und ich ihr antwortete: »In Amerika.«
3. Kapitel
Damien Rice – »The Greatest Bastard«
Ava – Gegenwart
Bei meinem Wagen angekommen, stieg ich erleichtert ein und ließ mich in die weichen Lederpolster sinken. Angehaltene Luft strömte mit einem tiefen Seufzer aus meinem Mund, was mir wieder bewies, wie aufgewühlt ich mich fühlte. Zweimal stieß ich mit dem Kopf nach hinten gegen die Stütze und versuchte mich wieder einzukriegen.
Wie immer, wenn ich mich so fühlte, begann meine rechte Hand ganz automatisch an meinem linken Handballen zu kratzen, gleich an der Stelle, die sonst meine breite Lederarmbanduhr versteckte. Unruhig, als ob mich jemand aufgezogen hätte, fuhren die Nägel kräftig über meine wunde Haut. Erst als ich blutig war und der körperliche Schmerz mich aus diesem Zwang heraus wie durch Wasser an die Oberfläche beförderte, konnte ich wieder Luft holen.
Was sollte dieser Mist und warum reagierte ich so stark darauf? War es die Panik vor einem fast peinlichen, filmszenenmäßigen Bauchklatscher vor einem heißen Typen? Oder schämte ich mich inzwischen selbst so, um niemanden mein Bein sehen zu lassen? Vielleicht war auch gar nichts zu sehen gewesen und wenn doch, na und? Ich hatte schon Schlimmeres in meiner alten Highschool durchgemacht, und ich hatte es überstanden.





























