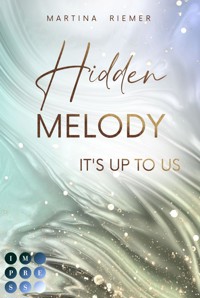5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
I'm drawn to darkness – and it's drawing me back. Um ihren Liebeskummer zu vergessen, stürzt sich die erfahrene Gildenjägerin Jess in einen mysteriösen Fall bei den Niagarafällen. Mit Hilfe eines spitzfindigen Fae, einer befreiten Vampirdienierin und einer Prise Magie stellt sie sich dem unaussprechlichen Schrecken, der im Dunklen lauert – bereit, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Doch während die tosenden Wasser der Niagarafälle ihre nächste Herausforderung noch verbergen, erkennt Jess, dass sie nicht nur gegen das Böse kämpfen muss – sondern auch gegen die unauslöschliche Sehnsucht nach Matej. Seine Stärke und sein Mut, die sie so verwirrten, haben Spuren hinterlassen, die sie tiefer hinabziehen als jede Flut. Sexy Prickeln, düstere Atmosphäre und ein Hauch Thrill – diese Rivals to Lovers Fantasy Romance fesselt bis zur letzten Seite. #RivalsToLovers #ForcedProximity BadGirlxBadBoy #HiddenIdentity #ImComingBackForYou #FightingSupernatural //Dies ist der zweite Band der »Gildenjäger Chroniken« von Martina Riemer. Alle Bände der Reihe: -- A Curious Kiss (Gildenjäger Chroniken 1) -- A Missing Heart (Gildenjäger Chroniken 2) -- An Endless Love (Gildenjäger Chroniken 3)// Es handelt sich um eine bearbeitete Neuauflage der Reihe »Monster Geek«, erstmals erschienen unter dem Pseudonym May Raven.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Martina Riemer
A Missing Heart (Gildenjäger Chroniken 2)
I'm drawn to darkness – and it's drawing me back.
Um ihren Liebeskummer zu vergessen, stürzt sich die erfahrene Gildenjägerin Jess in einen mysteriösen Fall bei den Niagarafällen. Mit Hilfe eines spitzfindigen Fae, einer befreiten Vampirdienierin und einer Prise Magie stellt sie sich dem unaussprechlichen Schrecken, der im Dunklen lauert – bereit, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Doch während die tosenden Wasser der Niagarafälle ihre nächste Herausforderung noch verbergen, erkennt Jess, dass sie nicht nur gegen das Böse kämpfen muss – sondern auch gegen die unauslöschliche Sehnsucht nach Matej. Seine Stärke und sein Mut, die sie so verwirrten, haben Spuren hinterlassen, die sie tiefer hinabziehen als jede Flut.
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Bonusszene
Danksagung
Content Notes
© privat
Martina Riemer lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern in Österreich. Zurzeit ist sie Vollblut-Mama und arbeitet im Büro. Wenn sie nicht liest, macht sie sich mit Kaffee und Laptop bewaffnet auf, um eigene Geschichten zu schreiben, die ihr im Kopf herumschwirren. Tagträumerin war sie immer, später wurden die Gedankensplitter zu Büchern. 2014 hat sie ihre ersten Romane veröffentlicht und kam bei Lovelybooks auf Platz 3 der besten DebütautorInnen.
Für alle Monsterjäger, Traumfänger und Fantasyliebhaber, die an mehr glauben, als mit den eigenen Augen zu sehen ist. Das Übernatürliche ist nur einen Steinwurf entfernt, hinter einem dünnen Schleier verborgen. Man muss nur genau hinsehen.
Vorbemerkung für die Leser*innen
Liebe*r Leser*in,
dieser Roman enthält potenziell triggernde Inhalte. Aus diesem Grund befindet sich hier eine Triggerwarnung. Am Romanende findest du eine Themenübersicht, die Spoiler enthält.
Entscheide bitte für dich selbst, ob du diese Warnung liest. Gehe während des Lesens achtsam mit dir um. Falls du auf Probleme stößt und/oder betroffen bist, bleibe damit nicht allein. Wende dich an deine Familie und an Freunde oder suche dir professionelle Hilfe.
Wir wünschen dir alles Gute und das bestmögliche Erlebnis beim Lesen dieser besonderen Geschichte.
Martina und das Impress-Team
1.
Hör auf, an einen Vibrator zu denken!
Ein ersticktes Keuchen drang aus meinem Mund und ich musste mich anstrengen, genügend Luft in meine Lunge zu pressen, damit mir vor Sauerstoffmangel nicht schwindelig wurde.
Was gar nicht so einfach war, da ein knapp achtzig Kilogramm schwerer Kerl auf mir lag und mich beinahe zerquetschte. Nun ja, liegen war genau genommen der falsche Ausdruck dafür, da sich der Typ ja bewegte, rauf und runter. Ein Stoß nach dem anderen. Dabei stellte er sich nicht so schlecht an, wie es vermutlich den Anschein machte, aber ich konnte einfach nicht meinen Kopf ausschalten und es genießen. Stattdessen ratterte mein Hirn unablässig weiter: Ich analysierte seine Technik, seinen Duft und seine Berührungen, als wäre das hier ein Training für den Kampf und nicht eine heiße Nummer auf dem Rücksitz seines AutoGleiters. Es sah aus wie ein alter roter Pick-up mit Dach, der aber wie all die anderen Gleiter mittels Geothermik einige Zentimeter über dem Boden schwebte, statt wie früher mit Reifen über die Straßen zu preschen und dabei die Umwelt zu verpesten. Damals hatte man noch fossile Brennstoffe benötigt und die Welt Stück für Stück weiter abgetötet. Das war dank dieser Erfindung zum Glück längst Geschichte – ein Hoch auf den menschlichen Erfindergeist.
Dafür gab es jedoch genügend andere Dinge auf dieser Welt, die einem nach dem Leben trachteten. Wenn schon nicht die vernichtete Umwelt, dann biestige Monster, Faes, Vampire, Werwölfe und unzählige andere nette Gesellen, deren liebste Beschäftigung es war, Menschen zum Frühstück zu verspeisen. Eigentlich gab es ein ganzes abartiges Sammelsurium an Monstern, um die sich die Jägergilde kümmerte. Diese war eine kampferprobte, meist mit erkennbarer Magie angereicherte Truppe, die wie ich zum Schutz der Menschen mit netten Waffen arbeitete. Zumindest wenn ich nicht gerade Feierabend hatte.
Nur machte die kurze Auszeit nicht so viel Spaß wie erhofft. Genauer gesagt sehnte ich mich lieber nach ein wenig Vampirblut oder nach etwas, das ich bekämpfen konnte, um mich besser zu fühlen. Ich wollte eine Aufgabe, um meinen Körper sinnvoll einzusetzen, meinem Geist eine Beschäftigung zu geben, die zukünftige Leben rettete.
Stattdessen lag ich hier rum und war zur Untätigkeit verdammt. Und das nur, weil mein Jägerkollege und Ziehbruder Jayden uns dazu verdonnert hatte, höchstens alle zwei Nächte auf die Jagd zu gehen. Seiner Meinung nach war das zu unserer eigenen Sicherheit, damit wir ausgeruht und konzentriert auf die Jagd gingen. Langweilig, jammerte ich gedanklich und verbiss mir einen lauten Kommentar.
Während der Typ über mir heftiger atmete und irgendwas mit »Ja, Baby« stöhnte, hielt ich mich mit einer Hand an der Wagentür fest, damit mein Kopf nicht gegen die Innenseite des Gleiters stieß, und sah durch das Autofenster zum Himmel, in die Sterne hoch. Anstelle der glitzernden Lichter mit all ihrer unverwechselbaren Schönheit, die mich immer an die guten Zeiten mit meinem Dad erinnerten, schob sich erneut hartnäckig eine Erinnerung vor mein geistiges Auge. Das Gesicht eines attraktiven wie auch nervig sturen Mannes, den ich in der Realität seit Monaten nicht mehr gesehen hatte. Dennoch war er in meinen Gedanken ständig anwesend, lauerte am Rande meines Geistes und passte meine unachtsamen Momente ab, um mich mit brutaler Heftigkeit die Sehnsucht spüren zu lassen. Obwohl ich nur wenige Tage mit dem umwerfenden Pfarrer in einem tschechischen Dorf verbracht hatte, schaffte ich es nicht, die Erinnerung an Matej abzuschütteln. Sein freundliches Gesicht, seine kecken Sprüche, seine aufopferungsvolle Art und liebevolle Fürsorge konnte ich nicht vergessen. Von seinem heißen Körper ganz zu schweigen.
Es half vermutlich auch nichts, dass ich mir ebendiesen, wie auch sein Gesicht, manchmal – okay, jedes Mal – vorstellte, wenn ich selbst Hand anlegte, um mich um meine Bedürfnisse zu kümmern. Nur war mir das nach fünf Monaten doch etwas zu armselig vorgekommen und ich hatte zaghaft begonnen, mich wieder mit realen Männern zu treffen. Aber keiner von ihnen reichte an Matej heran. Niemand ließ ihn aus meinen Gedanken verschwinden oder kitzelte aus mir die gleichen Reaktionen heraus wie dieser tschechische Pfarrer.
Was mich unglaublich wurmte, weil ich noch nie einem Mann hinterhergetrauert, mich nach ihm gesehnt, geschweige denn so viele Gedanken an ihn verschwendet hatte. Schon aus Prinzip nicht. Durch meine Eltern wusste ich, welch zerstörerische Kraft Liebe hervorrufen konnte, und genau aus diesem Grund hatte ich nie zuvor jemanden an mich herangelassen. Diese wenigen Tage mit Matej hatten jedoch gereicht, und das nur, weil ich mich hatte gehen lassen, weil ich in meiner emotionalen Verteidigung nachlässig geworden war, und nun hatte ich den verdammten Salat. Mein unabhängiger, schöner Seelenfrieden war somit dahin und ich sehnsüchtig Verliebte war selbst schuld an dieser Misere. Es war zum Haareraufen.
Voller Frust stieß ich einen derben Fluch aus, kaschierte ihn aber schnell mit einem tiefen Seufzer, den der Typ über mir wohl als zustimmendes Gemurmel interpretierte, da er seine Bewegungen beschleunigte und erneut in mein türkises, blau gesträhntes Haar hauchte. »Baby, ja, du bist so heiß. O, ja! Ich komme gleich.«
Wie schön für ihn, wird auch Zeit.
»Danke. Ähm, du bist auch … ganz toll. Bravo«, murmelte ich und tätschelte unbeholfen seine Schulter, verzog aber gleich darauf den Mund. Sogar für mich hörte es sich so an, als hätte ich gerade einen kleinen Welpen gelobt, der ein Kunststück vollführt hatte. Ich biss mir fest auf die Lippen, um mich wieder zu konzentrieren, und hoffte, er hatte meinen verbalen Aussetzer nicht gehört.
Himmelherrgott! Ich musste mich endlich zusammenreißen und loslassen. Immerhin war das nicht mein erstes Mal, ich war geübt im Umgang von Verlust. Warum also tat es dieses Mal so viel mehr und hartnäckiger weh?
Dennoch überkam mich ein schlechtes Gewissen, weil ich dem Kerl – ein mit Farbe in den Haaren bekleckerter Künstler –, der anscheinend ganz nett war und den ich in einer Bar aufgegabelt hatte, nicht das geben konnte, was er brauchte. Gar verdiente. Und auch, weil ich mit dem Kopf nicht hier war. Ganz zu schweigen von meinem Herzen. Das hatte ich allem Anschein nach in dem tschechischen Dorf verloren. Statt körperliche Nähe zu einem richtigen Menschen wünschte ich mir lieber meinen verfluchten Vibrator her, mit dem geistigen Bild von Matej vor Augen.
Tja, wie es aussah, war bei mir irgendetwas entschieden falsch gelaufen, und das schon, bevor ich den Pfarrer kennengelernt und ohne ein Abschiedswort in seiner Heimat zurückgelassen hatte. Die Schuldgefühle wurden bei diesem Gedanken noch um einiges stärker. Ich biss mir erneut fest auf die Lippen, um meine aufgewühlten Gefühle zu ersticken, genau in dem Moment, als der Typ zu seinem Höhepunkt kam. Hurra, endlich!
Zum Glück hatte ich auf ein Kondom bestanden. Obwohl ich durch den HandChip, der an meiner linken Hand in der weichen Stelle zwischen Daumen und Zeigefinger implantiert war, mit Hormonen und ausreichend Schutz versorgt wurde, um eine Schwangerschaft und jegliche Ansteckung bekannter Krankheiten zu verhindern. Seit Matej hatte ich keinen anderen Mann mehr so nahe an mich herangelassen und es fühlte sich eigenartig an. Als hätte ich das verraten, was Matej und ich gehabt hatten, obwohl ich es war, die es beendet hatte. Es war wie immer meine Schuld, wenngleich ich es getan hatte, um Matej vor den Gefahren meiner verborgenen Welt zu schützen.
Egal, darüber konnte ich jetzt nicht nachdenken. Mit flauem Gefühl im Magen rutschte ich zurück und wartete die angemessenen Minuten ab, um noch kurz mit dem Kerl ein paar Floskeln zu wechseln. Dann verschwand ich wie von einer Biene gestochen aus seinem Gleiter, gleichzeitig auch aus seinem Leben. Die meisten würden das als Glücksfall bezeichnen. Mich eingeschlossen.
Rasch sprang ich auf mein schwarz-silbernes GleitBoard, das ich mir vom Vordersitz geschnappt hatte, um damit nach Hause zu düsen. Ein angenehmer Fahrtwind schlug mir entgegen, der meine erhitzten Wangen kühlte und mir ein wenig Lebendigkeit schenkte. Kurz griff ich an meine Hüfte zu meinem Dolch Sid und überlegte, ob ich nicht doch einen kleinen Abstecher machen sollte, um wortwörtlich ein paar Biester abzustechen. Man musste nur Augen und Ohren offen halten, dann konnte man leicht ein paar Vampire, Faes oder andere Monster in den dunklen Gassen der verlasseneren Gegenden aufspüren. Man brauchte bloß das nötige Know-how und die Erfahrung, ich hatte beides.
Seufzend hielt ich inne. Dann korrigierte ich mit zusammengebissenen Zähnen meinen Schwung und ließ von dem Plan ab, die Welt von ein paar dieser gefährlichen Biester zu säubern. Ich hatte meinem Cousin Jayden mit einem Ehrenwort versprochen, nicht mehr allein, sondern nur noch mit ihm auf die Jagd zu gehen. Bisher hatte ich es geschafft, mich daran zu halten. Aber manchmal, an gewissen Tagen, war dieses Versprechen schwieriger einzuhalten als an anderen. Ähnlich wie bei einem Alkoholiker, der schlechte Tage hatte und dem es dann schwerer fiel, nicht in alte Gewohnheiten abzurutschen.
Jedoch war ich bis jetzt stärker als meine Triebe gewesen, und das würde ich auch weiterhin sein. Wofür sonst besaß ich einen derartigen Dickschädel? Er musste immerhin für irgendetwas gut sein. Außerdem würde mich Rosie, die für die nächstgelegene Gildenbude zuständig war und bei der alle übernatürlichen Souvenirs abgegeben wurden, nur wieder bei ihm verpfeifen. Einerseits war sie meine Freundin, weshalb man eine gewisse Loyalität und Verschwiegenheit erwarten konnte, andererseits war sie auch so eine Freundin, die um die Gefahren von Einzeljagden wusste und genau das Gleiche davon hielt wie meine geliebte Verwandtschaft. Sprich: rein gar nichts. Das war ihre Art, auf mich aufzupassen, egal, ob ich darüber glücklich war oder nicht.
Daher erreichte ich einige Minuten später mein Zuhause. Es lag zwischen meterhohen Tannenbäumen direkt vor einer steilen Felswand, die weit in den Himmel reichte. Anstatt gemütlich wirkte das Haus eher wie eine verfallene Holzhütte aus einem alten Horrorwestern, mit schiefer Tür und zerborstenen Fenstern. Es sah aber nur wegen meines Schutzzaubers nach außen hin derart heruntergekommen aus, um mein Heim vor unliebsamen, gefährlichen Wesen oder neugierigen Menschen zu schützen. Sogar die Zeugen Jehovas fühlten sich davon abgeschreckt und hatten noch nie an meiner Türschwelle gestanden, ein zusätzlicher Pluspunkt. Bevor ich den geschwungenen Kiesweg zur Tür entlangging, kontrollierte ich mithilfe der Amethyststeine das Schutzwehr rund um das Grundstück. Dies teilte mir bei Berührung mit, ob sich jemand genähert oder gar den Schutzkreis übertreten hatte. Es war wie eine magische Alarmanlage, nur gratis. Denn es kostete mich bis auf die Steine nur einen Funken meiner Magie. Erst nachdem ich festgestellt hatte, dass alles in Ordnung war, näherte ich mich meinem Haus, das im Inneren viel mehr Platz bot, als man von außen vermutete.
»Hallo, alter Freund«, flüsterte ich, tätschelte die raue Fassade, trat ein und schloss die Tür. Der Vorraum ging nach einer einzelnen Stufe direkt in das weitläufige, helle Wohnzimmer über, an dessen gegenüberliegender Seite sich die offene Küche befand. Der Boden bestand aus hellen Ahorndielen. Die Möbel selbst waren hauptsächlich in Weiß gehalten, bis auf eine verschlissene alte dunkelbraune Ledercouch, die mich sentimentalerweise an meinen Dad und unser zerstörtes Zuhause erinnerte.
Zur hellen Einrichtung gehörten auch ein weißer Couchtisch mit schimmernder Oberfläche, weiße Stühle um einen robusten Tisch aus Buche sowie bequeme Fellimitate auf der Couch. Violette und goldene Farbtupfer im Raum unterstrichen das einladende Gefühl des Raumes. Ein großes lila-goldenes Bild an der Wand, violette Zierkissen mit goldenen Sprenkeln auf der Couch oder die lila Blumen in mehreren weißen schlanken Vasen mit goldenem Anstrich auf Kommoden oder dem Esstisch.
Natürlich alles künstliche Blumen, denn ich hatte in etwa so einen grünen Daumen, wie ich auf einem Seil tanzen konnte – also gar nicht. Ich mochte meine Zufluchtsstätte, die ich mit mehr Sorgfalt ausgewählt und eingerichtet hatte, als man mir zutrauen würde, wenn man mich abends in der versifften Bar »Red Conquer« antraf, die auch die verborgene Gildenbude von uns Jägern beherbergte. Aber mir war das eigene Zuhause wichtig. Einen Ort zu haben, der hell und freundlich war und zum Entspannen einlud, wenn ansonsten so viel Dunkelheit im Leben eines Jägers herrschte. Das hier war meine architektonische Pause von dem ganzen Wahnsinn, den ich trotz allem doch irgendwie liebte und brauchte, um zu funktionieren. Mein gefährliches Leben und die Jagd, gaben mir auf abstruse Weise Halt und Kontrolle, was mir im kindlichen Alter brutal genommen worden war.
Im Eingangsbereich begrüßten mich meine Frettchen Billy Joel und Gertrude. Sie wuselten wie aufgezogen um meine Beine, zwickten mich sogar in einen Zeh. Ihr Zeichen, dass sie sich freuten, mich zu sehen. Meinem selbst erklärten Fae-Beschützer/Bodyguard namens Sir Harmsty nickte ich zu, der aber bloß ein grimmiges »Hallo, Mensch« murmelte und sich augenscheinlich weniger freute. Seine blauen Haare standen wie bei einem Löwen wild zu Berge. Was so gar nicht zu seiner ansonsten zierlichen fünfzehn Zentimeter großen Gestalt mit dem neuen, schicken Schottenrock passte, den Rosie extra für ihn genäht hatte. Und der das einzige Kleidungsstück war, das er nicht zornig zerfetzte, sondern tatsächlich trug. Dieser Rock war um einiges besser, als ihn ständig nackt herumschwirren zu sehen.
Grimmig hockte er auf der Couch, lehnte sich gegen seine zarten Flügelchen im Rücken, hatte die dünnen Ärmchen vor dem Brustkorb verschränkt und sah fern. Irgendeinen Zombie-Slasher-Film, den Geräuschen und dem Geruch nach süßlicher Verwesung zu schließen, die von dem modernen Mediensystem Inn∞Cube erzeugt wurden und mich beinahe würgen ließen. Hach, wie toll diese neuen Errungenschaften aller Sinne wären, wenn Hollywood doch nur etwas sparsamer damit umginge. Sir Harmsty beachtete mich nach seinem kurzen Gruß nicht weiter.
Ein Schatz wie eh und je, stellte ich schmunzelnd fest. Ich hatte ihn damals in der Tschechischen Republik aus dem Gefängnis einer mächtigen Fae-Spinne befreit, wäre dabei aber beinahe selbst draufgegangen. Seitdem hatte er es zu seiner Fae-Ehre erklärt, diese Schuld begleichen zu müssen, obwohl ich ihm das schon hundertmal hatte ausreden wollen. Ich hatte ihm sogar angeboten, eine gefährliche Situation nachzustellen, aus der er mich retten könnte, nur um uns beide aus dieser Lebensschuld zu befreien. Worüber er gar nicht begeistert gewesen war. Er ließ nicht locker und somit hatte ich ihn an der Backe, bis er mir ebenfalls das Leben retten würde, was nicht mehr so leicht war wie früher. Es lag hauptsächlich daran, dass ich einerseits nicht mehr jeden Abend auf die Jagd ging und andererseits nun Jayden stets dabei war. Außerdem verdonnerte ich Sir Harmsty oftmals zum Babysitten meiner Frettchen. Komischerweise mochten sie ihn, und er tolerierte sie. Das war mehr, als ich von ihm erwartet hatte.
Das Problem war zusätzlich, dass die meisten Gildenjäger nicht für ihre Toleranz bekannt waren, wenn es um übersinnliche Wesen ging. Immerhin bestand unser Job, besser gesagt unser ganzes Leben darin, die Übernatürlichen zu töten und nicht mit ihnen in einer Wohngemeinschaft zu leben. Ich konnte es ihnen nicht verdenken, diese Konditionierung war fest in uns verankert. Bevor ich Sir Harmsty kennengelernt hatte, war jede übernatürliche Gestalt etwas Böses gewesen, das vernichtet gehörte, um die Menschen zu beschützen. Der Grund dafür war, dass magische Wesen oftmals nach der Magie in uns lechzten. Sie zu töten, war beinahe wie ein Reflex gewesen. Besonders, wenn man bedachte, wie sie uns aussaugten, indem sie unser Blut tranken oder unser Fleisch vertilgten, um an die Magie in uns zu kommen. Außerdem hatte ich von einem fünfzehn Zentimeter großen, blau schimmernden Fae mit Flügeln wie Tinkerbell zuvor auch noch nie gehört. Und bis auf seine grimmige Laune war er eigentlich ganz süß.
Daher stellte Sir Harmsty mein Weltbild ein wenig auf den Kopf. Er zeigte mir, dass auch Faes gütig sein konnten, Gutes in sich trugen und somit ein Anrecht auf Leben besaßen. Zum Glück waren nach anfänglicher Skepsis – wohlgleich auch Belustigung – meine Familie und Rosie derselben Meinung. Doch ich konnte nicht davon ausgehen, dass jeder Jäger so offen war und darüber denken würde, sollte er oder sie Sir Harmsty begegnen. Aus diesem Grund passte ich genau auf, wann und wo ich mit ihm die Sicherheit meines Hauses verließ. Genau deshalb konnte ich ihn nicht einfach zu meinen Aufträgen mitnehmen, bei denen er mir das Leben hätte retten können, um daraufhin in sein glitzerndes Feenreich zurückzukehren. Die Aufträge bargen die Gefahr, von einem anderen Jäger, der bereits dort war, entdeckt zu werden. Dann würde Sir Harmsty auffliegen. Woraufhin ich auch Probleme mit der Gilde bekäme, weil ich einen Fae bei mir aufgenommen hatte, oder es endete gar mit seinem Tod. Was ich ebenfalls nicht zulassen konnte. Irgendwie hatte ich mich nämlich an diesen griesgrämigen, ruppigen Fae gewöhnt.
∞
2.
Es ist nicht gesund, an einem getragenen Shirt zu schnüffeln
Nachdem ich mich geduscht und dadurch alle Spuren des heutigen freien Abends abgewaschen hatte, schlich ich über den Flur in mein helles Schlafzimmer. Mein noch feuchtes türkisfarbenes Haar hatte ich zu einem lockeren Dutt hochgedreht. Die Bildflächen der Wände waren alle über den Beleuchtungsmodus auf neutrales Weiß voreingestellt. Das ovale große Bett schwebte einen halben Meter über dem Boden. Ein weißer Baldachin hing darüber, der an einer Seite von einem metallischen Roboterarm, der an der Decke montiert war, gehalten wurde. Da mir das weiße Zimmer mit dem hellbeigen Flauschteppich auf granitgrauem Untergrund zu fröhlich für meine derzeitige Stimmung erschien, stellte ich das Design via HandChip auf Abenddämmerung – Wald um.
Augenblicklich verdunkelten sich alle Wände, Bäume wurden darauf projiziert und sogar der Geruch von Tannenzapfen zog durch den Raum. Im Hintergrund hörte man leises Wasserplätschern und das Gezwitscher von Vögeln. Dies war der einzige moderne Schnickschnack, den ich mir neben der in die Felsen geschlagenen Dusche, direkt beim versteckten Wasserfall des kleinen Berges, gegönnt hatte. Ein bisschen Luxus brauchte selbst ich.
Als müsste ich frische Luft schnappen, atmete ich einmal tief ein und ging dann zum in die Wand eingelassenen Kleiderschrank, betätigte die Tür, die innen zur Seite glitt, und bückte mich in die Ecke, um dort einen kleinen, luftgeschützten Behälter hervorzuholen. Mit der Box setzte ich mich vor den Schrank auf den Boden, öffnete den luftversiegelten Deckel und holte ein Shirt heraus, auf dem das verblichene Logo der Band AC/DC zu erkennen war.
Obwohl ich das Kleidungsstück bereits seit einigen Monaten darin aufbewahrte, haftete Matejs Geruch noch immer daran. Ich schloss die Augen und so eigenartig ich mir dabei auch vorkam, schnüffelte ich genüsslich an seinem getragenen Shirt. Wenige Sekunden später rief ich über meinen HandChip das 3D-Foto seiner entspannten Gestalt auf und öffnete die Augen, um Matej in der Luft schweben zu sehen. Seine Projektion lag direkt vor mir. So, wie ich ihn vor Monaten nackt schlafend in seinem Bett fotografiert hatte. Nur ein Teil seiner Oberschenkel und sein bestes Stück waren leider Gottes unter einer dünnen Decke verborgen. Zum Glück war mein Erinnerungsvermögen gut ausgeprägt und somit konnte ich mir auch diesen speziellen Abschnitt bestens vorstellen – der ebenfalls nicht von schlechten Eltern war. Ich seufzte bei der Erinnerung, einmal, zweimal und, wenn ich schon dabei war, gleich ein drittes Mal. Dass ich mich beim Anstarren des Bildes und beim Schnüffeln am Shirt ein wenig armselig und wie eine Stalkerin fühlte, musste ich nicht extra erwähnen.
Wehmut machte sich in meinem Herzen breit. Bevor ich jedoch etwas richtig Blödes tun konnte, wie zum Beispiel ihn anzurufen, nur um seine einladende Stimme zu hören, riss mich ein warnendes Klingeln in meinem Kopf aus meiner Träumerei von verbotenen Leckerbissen. Zum Glück. Denn so war es am besten, und ich hatte die richtige Entscheidung getroffen, ihn damals zurückzulassen. Zu Hause war er sicher. Müsste nie in Angst leben, ob ich von meinem nächsten Auftrag zurückkäme. Oder ob ich gar das Böse selbst an unsere Schwelle lockte. Dennoch konnte ich die Fragen in mir nicht stoppen oder damit aufhören, die Was-wäre-wenn-Szenarien durchzuspielen.
Dachte er manchmal ebenfalls an mich? Wären wir zusammengekommen, wenn ich ihn mitgenommen hätte? Wären wir dann glücklich? Hätten wir in dieser Welt überhaupt die Chance auf eine gemeinsame Zukunft gehabt?
Tief einatmend schüttelte ich den Kopf. Nein, das war keine Option. Vermutlich hatte er mich längst vergessen, womöglich sogar eine nette Frau kennengelernt, die ihm gab, was ich nie gekonnt hätte. Ich hoffte, dass er glücklich war, und vor allem in Sicherheit, denn das war der einzige Gedanke, der mich dazu bewegte, die Kraft aufzubringen, nicht seine Nummer zu wählen. Nun gut, hin und wieder hatte ich sie doch gewählt, da ich die Nummer seines ganz gewöhnlichen Handys noch gespeichert hatte, jedoch gleich wieder aufgelegt. Matej war vom alten Schlag, der sich gegen die modernen HandChips wehrte. Dank meiner vorsichtshalber verborgenen Nummer würde er nie und nimmer herausfinden, wer sein Handy zu den unmöglichsten Zeiten zum Klingeln brachte. Vermutlich verfluchte er denjenigen sogar, trotz seiner christlichen Berufung.
Von meinen ganzen Überlegungen wollte mein magisch errichtetes Sicherheitssystem nichts wissen und klingelte unterdessen stetig in meinem Kopf weiter. Es war ungefähr genauso nervig wie ein Wecker am frühen Morgen, der das Krähen eines Hahnes imitierte. Herzallerliebst.
Das magische Schutzwehr der Amethyststeine rund um mein Grundstück informierte mich über das Übertreten der unsichtbaren Grenze durch zwei menschliche Wesen – Männer. Normalerweise wäre das die einzige Information gewesen, die mir der Schutzzauber übermitteln konnte. Da ich diese beiden Männer jedoch so gut kannte, wusste ich durch die Schwingungen im Zauber – wie ein Gefühl, das mitgetragen wurde – sofort, dass es sich dabei um meine Ziehbrüder, die Zwillinge Jayden und Julian, handelte. Diese Tatsache ließ mich endgültig hochschrecken. Die beiden besaßen einen Schlüssel für mein Haus und würden jeden Moment hereinschneien, ohne auch nur einen Gedanken an meine Privatsphäre zu verschwenden.
Ich wollte mir ihre Kommentare gar nicht vorstellen, wenn sie mich hier Trübsal blasend wie ein Häufchen Elend vorfanden. Noch dazu mit einem alten Shirt, in das ich meine Nase vergraben hatte und das nicht mir gehörte. Vermutlich hielten sie mir das ewig vor. Außerdem waren sie furchtbar neugierig wie Waschweiber und würden mir die Ohren abkauen, um zu erfahren, was mit mir los war. Aber ich wollte nicht darüber reden. Weder über die Geschehnisse in dem Dorf in der Tschechischen Republik. Noch darüber, dass wir nicht blutsverwandt waren. Als ich es herausgefunden hatte, war meine Welt ein weiteres Mal erschüttert worden. Aber in der Zwischenzeit hatte ich mich daran gewöhnt. Vor allem war mir klar geworden, dass Familie nicht unbedingt etwas mit Blut zu tun hatte. Sondern mit den Menschen, die für einen zur Familie wurden. Und egal was unser Blut sagte, im Herzen wären diese beiden Männer immer meine Brüder.
Vor einigen Monaten hatte ich durch Zufall herausgefunden, dass mein an Alzheimer erkrankter Dad nicht mein leiblicher Vater war. Zuerst hatte es mich erschüttert, anschließend hatte ich es hingenommen. Etwas anderes blieb mir auch nicht übrig. Die fehlende Blutsverwandtschaft änderte nichts an unserem Zugehörigkeitsgefühl. Denn er hatte mich aufgezogen wie sein Kind. Auch die anderen hatten mir nie das Gefühl gegeben, nicht zu ihnen zu gehören. Wir waren ein wilder Haufen – eine Familie.
Mit Onkel Héctor hatte ich mich ebenfalls wieder zusammengerauft, obwohl es im Moment nicht mehr ganz so war wie zuvor. Denn ich knabberte an der Tatsache, dass er es gewusst und mir so lange die Wahrheit verschwiegen hatte. Den Schmerz, der bei dem Gedanken manchmal aufwallte, schluckte ich gekonnt hinunter. Darin war ich in der Zwischenzeit ein Profi geworden. Da meine Mutter von übernatürlichen Monstern getötet worden war, als ich sechs gewesen war, wusste ich nun so gut wie nichts über meine Wurzeln. Dad zu fragen, brächte nichts. Dreimal hatte ich ihn seitdem im Heim besucht und ihn zur Vergangenheit befragt, war aber nie durch den Schleier seiner Krankheit durchgedrungen. Ich hätte gern ein paar Antworten auf meine Fragen bekommen: Wie hatten sie sich kennengelernt? Wie alt war ich damals gewesen? Wusste er etwas über meinen leiblichen Vater? Gab es noch andere Verwandte?
Natürlich würde ich mich nicht auf der Stelle auf die Suche nach ihnen machen und hier alles zurücklassen, da ich mich in meiner Heimat Montreal wohlfühlte, aber neugierig war ich dennoch. Theoretisch hätte ich Héctor darauf ansetzen können, da er in seiner Freizeit – während andere Pensionisten Blumenbeete pflegten oder Bingo spielten – lieber Computersysteme hackte. Irgendetwas hielt mich aber zurück. Eine Angst, die ich nicht benennen konnte, als sei ich noch nicht bereit, zu erfahren, was dabei womöglich aufgedeckt werden konnte. Jedoch musste ich langsam die ersten Schritte tun, ob ich wollte oder nicht. Ich war normalerweise kein Mensch, der vor etwas kniff, zumindest nicht zu lange.
Deswegen hatte ich Onkel Héctor vor wenigen Tagen darauf angesprochen, als ich bei ihnen zu Hause gewesen war. Die Zwillinge hatten indessen in der Werkstatt weltbewegende neue technische Errungenschaften erforscht – ihre Worte, nicht meine. Wahrscheinlicher war, dass sie Blödsinn gemacht hatten. Jedoch war es gut gewesen, Héctor allein zu erwischen. Er hatte mit einer Tasse Tee und seinem liebsten Spielzeug, seinem Inn∞Cube, am Esstisch gesessen und seine Finger waren mit unglaublicher Geschwindigkeit über die Holo-Tastatur getanzt, um im Inn∞Net herumzustöbern. Seine dunklen Augen hatten neugierig zu mir aufgeblickt, aber sein Gesicht war sofort etwas bleicher geworden, nachdem ich ihn ausführlich zu Mum und Dad befragt hatte. Anstatt mich zu erleuchten, hatte er bedauernd den Kopf geschüttelt. Trotz der paar Tage, die seitdem vergangen waren, konnte ich mich noch ganz genau an die Enttäuschung bei seinen Worten erinnern, als wäre es gerade eben passiert.
»Tut mir leid, Kleines. Ich werde dir keine große Hilfe sein. Ich weiß nicht viel mehr als du. Mein Bruder war immer sehr verschwiegen über deine Mum.«
Das glaube ich kaum, war es mir durch den Kopf geschossen und ich hatte die Stirn gerunzelt, als ich mich neben ihn auf einen Stuhl plumpsen ließ. Für Héctor Anzeichen genug, meinen Unglauben zu erkennen und mit mehr Details herauszurücken.
»Na schön, es ist nicht leicht, über diese Zeit zu reden. Denn ich bin nicht stolz darauf. Ehrlich nicht. Aber nach dem Auftrag, bei dem dein Vater deine Mutter gerettet hat und danach ein Leben mit ihr aufbauen wollte, haben wir uns aus den Augen verloren. Ich habe sie nur einmal kurz kennengelernt. Außerdem hat er mich schwören lassen, ihr nicht hinterherzuschnüffeln. Raúl wurde nach diesem Auftrag etwas paranoid und hatte Angst, mein Rechner könnte gehackt werden. Als ob das möglich wäre.«
Halb belustigt, halb traurig schüttelte Héctor den Kopf, als könnte er nicht glauben, je einen derartigen Zweifel bei meinem Dad ausgelöst zu haben. Oder lag es an etwas anderem? Ich tippte ganz eindeutig auf Letzteres.
»Wie meinst du, aus den Augen verloren?«, fragte ich daher schnell und verschränkte die Arme vor der Brust, ließ sie aber rasch sinken, als ich meine eigene Abwehrhaltung bemerkte. Ich wollte mich wieder mit Héctor vertragen, die Barriere zwischen uns in Luft auflösen. Aber egal, wie sehr man manches wollte, oftmals konnte man nichts erzwingen, sondern nur der Zeit die Heilung des Bruches überlassen. Genauso wie hier. Statt also wie ein Kleinkind mit den Füßen aufzustampfen, biss ich mir auf die Zunge und forderte ihn mit meinem Blick auf – der Gold wert war und dem nur die wenigsten trotzen konnten – weiterzuerzählen.
Er knetete seine Finger, seufzte tief. Ein Bild der Unruhe, das mich erst recht verrückt machte, bis er mich endlich erlöste.
»Wir hatten einen riesigen Krach und haben danach nicht mehr miteinander geredet, bis zu dem Tag, an dem deine Mutter gestorben ist und er Hilfe suchend zu mir kam, um dich für einige Zeit bei uns abzugeben. Dass er danach verändert zurückkam und nie wieder derselbe war, muss ich dir nicht erzählen.«
Traurig schüttelte ich den Kopf und schluckte den dicken Kloß, der sich bei seinen Worten in meiner Kehle verkeilt hatte, hinunter. Mit einem Schlag war damals alles anders, für immer fort gewesen: die gemeinsamen Abendspaziergänge, bei denen er mir die Sterne beigebracht und unerlaubt Geschichten von den Monstern erzählt hatte, sofern Mum nicht dabei war, um ihm deswegen die Ohren lang zu ziehen. Die urigen Filmabende mit Retro-Filmen und -Serien, die wohl kein Kind sehen durfte, aber die Dad mir nie hatte abschlagen können. All die lustigen Spiele, die er sich extra für mich ausgedacht hatte, wenn wir unser Fort aus Decken und Kissen rund um das Sofa bauten. Oder die schönen Momente, wenn er für mich oder meine Mum gesungen hatte. Vielleicht nicht wie der beste Sänger, aber mit so viel Herz und Inbrunst, dass ich immer mit einem bewundernden Lächeln zu ihm aufgesehen hatte. Er war mein Held gewesen. Ganz und gar. Unerschütterlich. Bis er es eines Tages nicht mehr war.
Ohne mir etwas von meinen Gefühlen anmerken zu lassen, bohrte ich weiter, denn meine Fragen waren nicht weniger geworden. Im Gegenteil. »Aber ich kenne dich und die Jungs schon immer. Wie kann es dann sein, dass du Mum nur einmal kurz getroffen hast?«
Sichtlich aufgewühlt griff Onkel Héctor nach meiner Hand. Seine Stärke und seine Wärme umhüllten meine klammen Finger, die während seiner Erzählungen ganz kalt geworden waren.
»Du standest genauso unter Schock wie dein Vater. Es ist nicht verwunderlich, dass du dich nicht mehr genau an alles erinnerst oder Zeiten durcheinanderbringst.«
»Was willst du damit sagen?«, fragte ich beinahe tonlos.
»Du bist erst mit etwa sechs zu uns gekommen, Kleines. Und ja, du warst sofort ein Teil unserer Familie, doch zuvor hast du die Jungs nicht gekannt, mich genauso wenig.«
Auf der Stelle durchforstete ich mein Gehirn, um diese Behauptung zu überprüfen. Drehte, wendete und versuchte mich, so gut es ging, an meine frühere Kindheit zu erinnern, aber so sehr ich mich auch anstrengte, da war nichts. Sie war vor allem durch die Momente mit meinem Dad oder meiner Mum geprägt. Hätte ich bisher geschworen, auch Episoden mit Julian, Jayden und Héctor vorzufinden, so war das nun plötzlich nicht mehr möglich. Verwirrt kniff ich die Augen zusammen. Ich konnte nichts finden, er musste recht haben. Er würde mich kein weiteres Mal anlügen oder mir etwas verschweigen, das wusste ich.
»Warum hattet ihr Streit?«
Langsam ließ Onkel Héctor meine Hand wieder los und strich sich über den Kopf, wodurch sein schwarz meliertes Haar an einigen Stellen wild zu Berge stand. Erst als er sich zurücklehnte, sah er zu mir hoch, wirkte plötzlich um Jahre gealtert. Ich hielt gebannt den Atem an.
»Du bist schon jahrelang ein Mitglied der Jägergilde, du kennst die Regeln. Weißt, was wichtig ist«, begann er, und ich nickte wie ein Wackeldackel, obwohl er mich nicht ansah, sondern sein Blick in die Ferne glitt. In eine andere Zeit.
»Ich weiß das, und dein Dad wusste es auch. Aber als er deine Mum kennenlernte, sie und ihr Kind – dich – bei einer Mission rettete, warf er auf einmal alle Regeln über Bord. Er verliebte sich auf der Stelle in sie, wollte bei ihr bleiben. Ein Leben mit ihr aufbauen. Du weißt, wie wir sind. Wir lassen uns nicht auf Menschen ein, die mit unseren Aufträgen zu tun haben, wir arbeiten im Geheimen. Das ist unser Leben, und da holen wir keine Fremden hinein. Es ist zu gefährlich.«
Ich wusste nur zu gut, wovon er sprach. Erneut nickte ich etwas geistesabwesend. Einerseits wegen meiner Sehnsucht nach Matej und andererseits aufgrund meines schlechten Gewissens, da ich genau diese Regel ein wenig gedehnt hatte, obwohl mir das alles gut eingebläut worden war. Sehr, sehr gut sogar.
»Jedenfalls habe ich ihn vor die Wahl gestellt. Sein Leben als Jäger hinzuschmeißen und mit der Frau zu verschwinden oder sie gehen zu lassen und zu uns zurückzukommen. Du kennst seine Wahl. Ich dachte nie, dass er wirklich gehen und den Job als Gildenjäger aufgeben würde. Oder dass er danach deiner Mutter alles zeigen, ihr all sein Wissen beibringen würde. Sie sogar ausbilden und dich mit hineinziehen würde. Es tut mir so leid, so hätte es nicht ausgehen sollen.«
Nun war ich diejenige, die ihm tröstend eine Hand auf den Arm legte, obwohl mir die Berührung vermutlich genauso viel Trost spendete.
»Das muss es nicht. Geschehen ist geschehen, man kann es nicht rückgängig machen. Gib dir nicht die Schuld an etwas, für das du nichts kannst. Er war erwachsen. Er wusste, was er tat.«
»Und wenn doch? Wenn ich ihn nicht vor die Wahl gestellt hätte? Wenn ihr bei uns geblieben wärt? Vielleicht würde deine Mutter noch leben, vielleicht wäre dein Dad noch der Alte.«
Entschieden schüttelte ich den Kopf. »Er hat Alzheimer. So eine Krankheit kann niemand auslösen. Sie ist unaufhaltsam.«
Fast schon unwirsch redete sich Onkel Héctor in Rage. »Das glaube ich nicht. Wir sind mit mehr Magie gesegnet, wir sind stärker, robuster als Menschen mit weniger Magie. Weniger oft krank, wir heilen schneller. Wir bekommen keinen Krebs und ich bin mir sicher, dass wir auch kein Alzheimer bekommen sollten – die starke Magie schützt uns vor solchen Erkrankungen. Warum also sollte es gerade deinen Dad erwischen? Ich glaube nicht an einen unglücklichen medizinischen Zufall. Ich glaube, dass ihn der Verlust deiner Mutter in eine Art Wahnsinn, in eine geistig abgeschirmte Welt getrieben hat, um vor dem Schmerz zu flüchten … Es hätte alles anders ausgehen können. Ich hätte für ihn da sein sollen … Ich …«
Zuerst war er noch laut und aufbrausend, dann stetig leiser, bis seine Stimme schließlich vollkommen brach. Er senkte den schmerzerfüllten Blick auf seine geballten Fäuste auf dem Tisch, als könnte er sie allein dadurch wieder öffnen. Seine Argumente machten Sinn. Sie machten verdammt viel Sinn, doch daran konnte ich nicht denken. Wollte ich auch gar nicht, denn sonst würde ich daran zerbrechen. Trotz meiner Trauer über die verspielten Was-wäre-Wenns klang meine Stimme sanfter und fester, als ich gedacht hätte. »Nein, lass es sein, Héctor. Die Zeit kann man nicht zurückdrehen. Es ist, wie es ist. Dafür haben wir uns und wir halten wie Pech und Schwefel zusammen. Das ist mehr, als andere von sich behaupten können. Es geht uns gut und wir sind zusammen.«
Das Leben war nicht perfekt, ich hätte vieles daran geändert. Aber warum sich um etwas Gedanken machen oder das Herz zerbrechen lassen, das man nicht ändern konnte, anstatt sich an den Dingen zu erfreuen, die man hatte?
Keine Ahnung, warum ich diesen Lebensratgeber plötzlich aus dem Ärmel schüttelte, denn ansonsten war ich so dunkel wie meine Lederklamotten. Héctors traurig blickende Augen und sein Kummer brachten mich dazu, alles zu versuchen, damit es ihm besser ging. Und sei es auch nur mit ein paar weisen Sprüchen.
»Ich weiß, dennoch wünsche ich es mir oft. Weißt du, das ist die eine Sache, die ich in meinem ganzen Leben am meisten bereue. Nicht die Trennung von meiner Frau. Nein, wir haben uns auseinandergelebt, sind nun gute Freunde. Sondern genau dieses eine: Deinem Dad nicht die Freiheit gegeben zu haben, sein Leben, so wie er wollte, mit deiner Mum zu führen. Ihn nicht unterstützt zu haben, wenngleich ich nicht damit einverstanden war. Ich war stur, selbstgerecht, und wir alle haben dafür bezahlt.«
Nun schluckte ich, musste mich zusammenreißen, um mich von seiner Traurigkeit nicht hinunterziehen zu lassen. Obwohl sie, seit ich Kind war, ebenfalls fest in meinem Herzen schlummerte. Daher wendete ich ein paar dieser weisen Sprüche an, die mir vorhin durch den Kopf gegangen waren, und siehe da, er lächelte. Wobei ich nicht wusste, ob sie ihm wirklich halfen oder er nur lächelte, um mich zu beruhigen.
Erst danach war ich aufgestanden, um zu den Zwillingen zu gehen. Es war alles gesagt worden und nun hatte ich ein kleines Puzzlestück mehr von damals gefunden, das ich horten und für später bewahren würde. Der Rest würde sich finden. Musste es.
∞
3.
Wenn drei sich streiten, freut sich der Vierte auf Popcorn
Für all meine Sorgen hatte ich später noch Zeit, also rappelte ich mich auf und stopfte das Shirt zurück in den luftdichten Behälter. Immerhin wollte ich, dass Matejs Duft noch länger erhalten blieb. Anschließend versteckte ich die Box wieder ganz hinten in meinem Schrank. Als ich aus dem Schrank trat, um aus dem Schlafzimmer zu eilen, hörte ich ein verdächtiges Flattern im Flur, das sich entfernte. Hatte mir dieser kleine Fae etwa hinterhergeschnüffelt?
»Sir Harmsty, ich habe schon einmal gesagt, dass du in meinem Schlafzimmer nichts zu suchen hast, außer wenn du mir ein Glas Whiskey bringst. Was du jedoch noch nie getan hast, wie ich an dieser Stelle anmerken möchte«, brummte ich, während ich den hellgrauen Flur Richtung Wohnraumküche entlangging. Obwohl ich Sir Harmsty nicht sehen konnte – der kleine Wicht hatte sich versteckt –, hörte ich seine grimmige Antwort: »Als würde mich dein unaufhörliches Leiden interessieren, Mensch.«
Ha, er hatte also doch geschnüffelt!
»Ich leide nicht, ich stehe nur tierisch auf getragene Shirts, wenn du es genau wissen willst. Jeder braucht einen Fetisch. Ist eine Menschensache, die verstehst du nicht, Glitzerfee!«, rechtfertigte ich mich und brachte ihn zum Schnauben. Wobei ich nicht wusste, ob es an meiner lahmen Ausrede oder am Kosenamen lag. So nannte ich ihn nämlich nur, wenn er mir mehr als sonst auf die Nerven ging, also beinahe die meiste Zeit.
Genau in diesem Moment flog die Eingangstür auf und Jayden stand in seiner gesamten Glorie, mit breitem Grinsen und ausgebreiteten Armen im Eingangsbereich. Hinter ihm hörte ich Julians genervten Südstaaten-Akzent, der so gar nicht zu ihm passte, den er sich aber bei einer langen Mission angeeignet hatte. »Schwing deinen Hintern zur Seite, Alter. Ich will auch rein.«
»Erst, wenn mir Jess zur Begrüßung in die Arme springt, um mich zu knuddeln«, meinte Jayden zwinkernd. Ich verdrehte die Augen, während Julian ihn mit einem kleinen Stoß zur Seite bugsierte. »Als würde sie das je tun. Wann war das letzte Mal?«
Fragend blickte er zu mir hoch, als er mit seinem GleitRoller, in dem er saß und den er vor zwei Monaten endlich gegen seinen uralten Rollstuhl eingetauscht hatte, weiter in den Raum schwebte, ungefähr dreißig Zentimeter über dem Boden.
»Hm, als ich elf oder zwölf war? Jedenfalls hatte er damals im Zweikampf noch eine Chance gegen mich. Also wissen wir alle, dass es schon einige Jahre her sein muss«, meinte ich feixend, woraufhin ein kurzes, aber umso kostbareres Lächeln in Julians Gesicht aufblitzte, während Jayden seines verzog.
»Gar nicht wahr! Jess-Bär würde mich nie schlagen, dafür sind meine Tricks viel zu fies. Ich kämpfe nie fair, weißt du doch«, gab er selbstgerecht zurück. Dann drückte er mir im Vorbeigehen einen Willkommenskuss auf die Wange und marschierte weiter ins Wohnzimmer hinein, als gehörte die Bude ihm. »Und seit wann tue ich das? Wäre mir neu«, schnaubte ich grinsend und wandte mich an den letzten Besucher.
Denn hinter ihnen folgte noch Teddy. Eigentlich hieß er Gilbert, aber er sah nicht aus wie ein Gilbert. Seit ich ihn kannte, nannte ihn jeder Teddy. Vermutlich lag es an seinem Teddybären-Tattoo, das er am Hals trug und das metallisch blaugrün auf seiner dunkelbraunen Haut schimmerte. Er war ein guter Freund aus der Gilde, der nebenbei als Türsteher bei der Gildenbude arbeitete.
Bei mir angelangt, hob er mich hoch und drückte mich an seine wuchtig breite Brust, wobei meine Beine einen halben Meter über dem Boden baumelten. Teddy war unglaublich groß und stark wie Hulk, doch im Herzen butterweich und sensibel. Ausgerechnet dieses Herz war vor wenigen Monaten gebrochen worden, als sein Freund Schluss gemacht hatte. Seitdem zog er manchmal mit den Jungs um die Häuser und blies Trübsal. Ähnlich wie ich, daher verstanden wir uns wohl auch so gut.
»Hi, Teddy. Schön, dich zu sehen.«
Spielerisch wuschelte ich ihm durch den violetten kurzen Afro, den er sich nach der Trennung geschnitten und gefärbt hatte. In seinem attraktiven Gesicht mit dünnem Kinnbart blitzte ein schwaches Lächeln auf. »Hey, Jess. Danke, dass wir hier abhängen dürfen.«
»Gerne. Du bist immer willkommen, das weißt du«, erwiderte ich ernsthaft und klopfte ihm aufmunternd auf die breite Schulter.
»Danke.«
Schnurstracks stampfte er zur Couch, um sich darauf fallen zu lassen. Dabei ächzte sie gefährlich, hielt seinem Kampfgewicht aber stand. Zum Glück, ich mochte diese Couch.