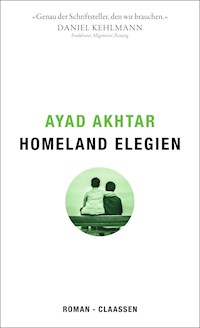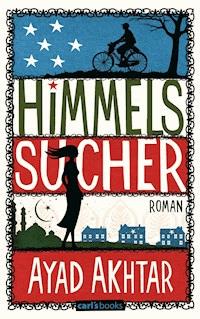
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: carl's books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Eine Geschichte von Verblendung, Schuld und der Hoffnung auf Versöhnung
Milwaukee, Ende der siebziger Jahre: Hayat ist zehn Jahre alt, als Mina, die Jugendfreundin seiner Mutter, aus Pakistan nach Amerika kommt. Zwischen der schönen wie klugen Frau und dem verschlossenen Jungen entsteht eine innige Beziehung. Mina ist ihrem neuen Leben gegenüber aufgeschlossen, fühlt sich ihrer Kultur und ihrem Glauben aber weiter eng verbunden. So ist sie es auch, die Hayat mit dem Koran vertraut macht. Doch niemand, am allerwenigsten Mina selbst, ahnt, welch tiefgreifenden Einfluss dies auf den Teenager hat.
Als Mina sich in Nathan Wolfsohn verliebt, sieht Hayat seine Welt und alles, was ihm wichtig scheint, bedroht. Aus Eifersucht und Angst begeht er einen ungeheuerlichen Verrat. Zu spät begreift er, welche Katastrophe er damit über diejenigen heraufbeschwört, die er am meisten liebt.
Mit diesem bewegenden Familiendrama ist Ayad Akhtar ein überaus beeindruckender Debütroman gelungen. Klar und einfühlsam zeichnet er seine Figuren, ihre innere Zerrissenheit, ihre Sehnsüchte und Enttäuschungen. Er erzählt von Verblendung und Schuld, ohne zu verurteilen – und von der Hoffnung, dass Versöhnung möglich ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 462
Ähnliche
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel»American Dervish« bei Little, Brown and Company, New York.
1. AuflageCopyright © 2012 by Ayad AkhtarCopyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2012bei carl’s books, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München.Satz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-09027-2V002
www.carlsbooks.de
Für meine Mutter & Marc H. Glick
Und Allah sprach: Ich bin bei denen, deren Herz zerrissen ist.
Hadith Qudsi
PROLOG: 1990
Es war der Wendepunkt in meinem Leben, und ich erinnere mich daran, als wäre es erst gestern gewesen.
Die Halle glühte, honigfarben schimmerte der Holzboden im Licht der Scheinwerfer unter der Decke. Am Spielfeldrand drängten sich die Spieler um ihre Trainer, dahinter wir, die tobenden Zuschauerreihen, die es kaum erwarten konnten, dass die Auszeit zu Ende ging.
Einige Reihen unter uns entdeckte ich den Verkäufer, einen untersetzten Typen mit Schwabbelhüfte und rotbraunem Pferdeschwanz, der ihm hinten aus der orange-schwarzen Kappe hing – das waren die Farben unseres College. »Wiener, Bratwürste!«, rief er. »Wiener, Bratwürste!«
Ich hob die Hand. Er nickte mir zu, während er drei Reihen unter uns stehen blieb und einen anderen Kunden bediente. Ich fragte meine beiden Kumpel neben mir, ob sie was wollten.
Bier und Bratwurst, antwortete jeder.
»Glaube kaum, dass er Bier hat«, erwiderte ich.
Unten kehrten die Spieler aufs Feld zurück und nahmen für die letzten Minuten der Spielhälfte ihre Positionen ein. Die Zuschauer sprangen von den Sitzen.
Der Verkäufer gab das Wechselgeld heraus, schob sich den Metallkasten auf die Hüfte, stieg die Stufen herauf und wartete am Rand unserer Reihe.
»Gibt es auch Bier?«, fragte einer meiner Freunde.
»Nur Wiener und Bratwürste.«
»Dann zwei Hotdog mit Bratwurst und einen mit Wiener«, sagte ich.
Er nickte, öffnete den Deckel seines Kastens und fasste hinein. Ich zückte die Brieftasche und wischte die Geldscheine zur Seite, die meine Kumpel mir hinhielten. Der Verkäufer reichte mir drei Päckchen, die sich weich und warm anfühlten.
»Wiener ist oben. Macht neun Dollar.«
Ich gab die Bratwürste weiter und zahlte.
Die Menge johlte, unsere Mannschaft hatte den Ball und näherte sich dem Korb. Ich wickelte den Hotdog aus, aber im Brot steckte keine Rinder-Wiener, sondern eine marmorierte, braun-weiße Bratwurst aus Schweinefleisch.
»He, hat einer von euch meine Wiener?«, schrie ich im Lärm der Menge meinen Kumpel zu.
Beide schüttelten den Kopf. Auch sie hatten Bratwürste.
Ich drehte mich um und wollte dem Verkäufer schon nachrufen, ließ es dann aber sein. Welchen Grund gab es denn, die Wurst nicht zu essen?
Überhaupt keinen.
Wieder kam unsere Mannschaft vor den Korb, der Spieler wurde gefoult. Der Lärm nach dem Pfiff war ohrenbetäubend.
Ich hob die Wurst an den Mund, schloss die Augen, biss ab und kaute. Mein Herz raste, während sich mein Mund mit einem süßen, rauchigen, leicht beißenden Geschmack füllte, der mir absolut bemerkenswert vorkam – was vielleicht auch daran lag, dass er mir so lange verboten gewesen war. Ich kam mir mutig und lächerlich zugleich vor. Und als ich schluckte, überkam mich eine gespenstische Ruhe.
Ich sah zur Decke hinauf.
Sie war noch da. Nichts deutete darauf hin, dass sie jeden Moment einstürzen würde.
Nach dem Spiel ging ich allein über den Campus, die Lampen an den Wegen leuchteten im Nebel, weiße Blüten an einem milden Novemberabend. Ich fühlte mich lebendig. Frei, zu tun und zu lassen, was ich wollte. Richtig aufgekratzt.
Im Wohnheim stand ich vor dem Badezimmerspiegel. Meine Schultern waren anders. Nicht eingefallen, sondern gerade. Ohne Last. Ich musterte meine Augen, und in meinem Blick sah ich, was ich fühlte: eine starke, stille Entschlossenheit.
Ich fühlte mich als ganzer Mensch.
In jener Nacht schlief ich tief und fest wie ein Baby in den Armen seiner Mutter. Als ich endlich den Wecker hörte, war es schon Viertel vor neun. Sonnenlicht flutete ins Zimmer. Es war Donnerstag, das hieß, in einer Viertelstunde begann Professor Edelsteins Vorlesung über die Geschichte des Islam. Ich schlüpfte in die Jeans und zuckte zusammen beim prickelnden Gefühl, das die neue Hose auf meiner Haut hinterließ. Das Wunder des vergangenen Abends entfaltete anscheinend immer noch seine Wirkung.
Draußen war es ungewöhnlich warm und windig. Ich eilte zur Student Union hinüber, besorgte mir einen Becher Tee, lief dann, den Koran unter den Arm geklemmt, weiter zur Schirmer Hall und verschüttete dabei die heiße Flüssigkeit. Ich wollte nicht zu spät zu Edelsteins Vorlesung kommen und mir auf jeden Fall einen Platz ganz hinten sichern, nahe am Fenster, das er immer gekippt ließ, wo ich für mich sein und in aller Ruhe nachdenken konnte, wenn der klein gewachsene, charismatische Edelstein allwöchentlich das zertrümmerte, was vom Glauben meiner Kindheit noch übrig war. Und noch etwas zog mich in die letzte Reihe.
Rachel saß dort.
Professor Edelstein war wie immer in seinem förmlich-frischen pastellfarbenen Sammelsurium erschienen, das diesmal aus einem tadellos gebügelten malvenfarbenen Hemd bestand, gekrönt und am Kragen zusammengehalten von einer roséfarbenen Fliege, dazu Hosenträger, die zum kastanienbraunen Farbton seiner frisch gewienerten Collegeschuhe passten.
Er begrüßte mich mit einem freundlichen Lächeln. »Guten Tag, Hayat.«
»Guten Tag, Professor.«
Ich schlängelte mich zwischen den Tischen zu meinem angestammten Platz in der Ecke, wo die wunderbare Rachel an einem Keks knabberte.
»Hallo.«
»Hallo auch.«
»Wie war das Spiel?«
»Gut.«
Sie nickte. Dann lächelte sie verhalten, während sie mir in die Augen sah. Blicke wie diese – wenn ihre hellblauen Augen funkelten – hatten mich am Vorabend tatsächlich das Wagnis eingehen lassen, sie zum Spiel einzuladen. Das ganze Semester hatte ich sie schon bitten wollen, mit mir auszugehen, und als ich mich schließlich dazu durchringen konnte, sagte sie, sie müsse lernen.
»Willst du mal?«, fragte sie. »Es sind Hafermehlkekse mit Rosinen.«
»Klar.«
Sie brach eine Ecke ab und reichte sie mir. »Hast du dich vorbereitet?«, fragte sie.
»War nicht nötig.«
»Warum nicht?«
»Ich kannte die Suren schon, ich musste sie nicht mehr lesen … Ich kann sie auswendig.«
»Ach?« Rachel machte große Augen.
»Ich hab das Zeug mal auswendig gelernt«, erklärte ich. »Manche muslimische Kinder unterziehen sich dieser Tortur. Sie lernen den ganzen Koran auswendig … Damit sie ein Hafiz werden.«
»Echt?« Sie war beeindruckt.
Ich zuckte mit den Schultern. »An viel kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber an die Suren, die wir für heute lesen sollten …«
Edelstein begann mit seinem Vortrag. »Ich gehe davon aus, dass Sie alle Ihrer Lektüre nachgekommen sind. Wir werden uns heute nicht direkt damit beschäftigen, auch wenn es ganz offensichtlich sehr wichtig ist. Man kann sich am Koran die Zähne ausbeißen, und je mehr wir in diesem Semester schaffen, umso besser.« Er hielt inne und ordnete die vor ihm liegenden Blätter.
Rachel bot mir den Rest ihres Kekses an. »Willst du?«, flüsterte sie.
»Klar«, sagte ich und nahm ihn.
»Heute möchte ich von der Arbeit erzählen, der augenblicklich einige meiner Kollegen in Deutschland nachgehen. Ich kann Ihnen keine Texte zu ihren Forschungen zur Verfügung stellen, weil alles noch sehr neu ist. Es gehört mit zum Aktuellsten in der Islamwissenschaft …« Erneut hielt Edelstein inne, suchte Blickkontakt mit den Studenten muslimischer Abstammung – es waren insgesamt drei – und fügte vorsichtig hinzu: »Und was ich Ihnen mitzuteilen habe, könnte für manche von Ihnen vielleicht ein Schock sein.«
So begann er seinen Vortrag über die Sana’a-Handschriften.
1972 stießen Arbeiter bei der Restaurierung der Großen Moschee in der jemenitischen Stadt Sana’a in einem Hohlraum zwischen Dach und Decke auf unzählige Pergament- und Papierfragmente. Es handelte sich dabei um eine Art Büchergrab, in dem Muslime – denen es verboten ist, den Koran zu verbrennen – beschädigte oder abgegriffene Ausgaben ihres heiligen Buches deponieren. Die Arbeiter stopften die gefundenen Manuskripte damals in Kartoffelsäcke, die anschließend weggesperrt wurden, bis etwa sieben Jahre später einer von Edelsteins engen Freunden – ein Kollege – gebeten wurde, sich die Dokumente genauer anzusehen. Was er entdeckte, war einzigartig: Die Pergamentmanuskripte datierten aus den ersten beiden islamischen Jahrhunderten, es waren Fragmente der ältesten noch existierenden Koranausgaben. Das Schockierende daran allerdings war, sagte uns Edelstein, dass die Texte von der Standard-Koranausgabe abwichen, die Muslime seit über tausend Jahren benutzten. Kurz gesagt, Edelstein behauptete, sein deutscher Kollege werde in Kürze aller Welt aufzeigen, dass die unerschütterliche muslimische Überzeugung, der Koran sei buchstäblich das unveränderte, ewige Wort Gottes, reine Fiktion sei. Den Muslimen würde nicht erspart bleiben, womit sich die Christen und Juden in den vergangenen drei Jahrhunderten hatten auseinandersetzen müssen. Wie die Bibel würde sich auch der Koran, so wie es der gesunde Menschenverstand verlangte, als ein historisches Dokument erweisen.
Ahmad, einer der Studenten in der ersten Reihe und Muslim, unterbrach Edelsteins Vortrag und hob wütend die Hand.
Edelstein sah auf. »Ja, Ahmad?«
»Warum hat Ihr Kollege seine Erkenntnisse noch nicht veröffentlicht?«, blaffte Ahmad.
Edelstein sah ihm einen Moment in die Augen, bevor er in versöhnlichem Tonfall antwortete. »Mein Kollege fürchtet um den weiteren Zugang zu den Texten, wenn diese Erkenntnisse den jemenitischen Behörden vorgelegt werden. Er und seine Mitarbeiter bereiten eine Artikelreihe vor, wollen aber sicherstellen, dass noch genügend Zeit bleibt, um alle vierzehntausend Seiten sorgfältig durchzugehen, falls sie die Dokumente später nicht mehr zu Gesicht bekommen sollten.«
Zornig erwiderte Ahmad: »Und warum, bitte schön, sollte ihnen der Zugang verwehrt werden?«
Stille. Die Spannung war mit Händen zu greifen.
»Es gibt keinen Grund, sich so aufzuregen, Ahmad. Wir können wie Akademiker darüber reden …«
»Akademiker! Was ist das für ein Akademiker, der solche Behauptungen aufstellt, ohne sie ausreichend zu belegen? Hä?«
»Mir ist bewusst, dass es sich um kontroverse Dinge handelt … aber es gibt keinen Grund …«
Ahmad fiel ihm ins Wort. »Das alles ist nicht kontrovers, Professor«, sagte er voller Verachtung. »Sondern ketzerisch.« Ahmad sprang auf, die Bücher in der Hand. »Ketzerisch und beleidigend!«, schrie er. Nach einem Blick zu Sahar, der stillen malaiischen Studentin, die links von ihm saß und mit gesenktem Kopf nervös in ihren Notizblock kritzelte, und einem weiteren Blick zu mir stürmte Ahmad aus dem Raum.
»Will noch jemand gehen?«, fragte Edelstein, sichtlich betroffen. Nach einer kurzen Pause packte Sahar schweigend ihre Sachen, stand auf und ging hinaus.
»Bleiben noch Sie, Hayat.«
»Keine Sorge, Professor. Ich bin durch und durch ein Mutazilit.«
Edelsteins Miene hellte sich auf. »Gesegnet seien Sie.«
Nach dem Seminar stand ich auf, streckte mich und war erneut verblüfft, wie hellwach ich mich fühlte.
»Wohin gehst du?«, fragte Rachel.
»Zur Student Union.«
»Willst du mich begleiten? Ich muss in die Bibliothek.«
»Klar«, sagte ich.
Unter den schattenspendenden Eschen schlenderten wir zur Bibliothek, und Rachel erzählte, wie sehr es sie überrascht habe, dass Ahmad und Sahar den Raum verlassen hatten.
»Das muss dich nicht überraschen«, sagte ich. »In manchen Kreisen wird man schon wegen Geringerem umgebracht.« Sie stutzte. »Denk nur an Rushdie.« Die Fatwa gegen ihn lag damals nur ein Jahr zurück und war jedem noch frisch im Gedächtnis.
Rachel schüttelte den Kopf. »Ich verstehe das alles nicht. Was du zu Edelstein gesagt hast … Was hast du damit gemeint?«
»Dass ich ein Mutazilit bin?«
»Ja.«
»So nennt sich eine Schule im Islam, die im Koran nicht das ewige Wort Gottes sieht. Aber das war nicht ernst gemeint. Ich bin kein Mutazilit. Die sind schon vor tausend Jahren ausgestorben.«
Sie nickte. Dann, nach einigen weiteren Schritten, fragte sie: »Wie ging’s dir damit?«
»Wie soll’s mir damit schon gehen? Die Wahrheit ist die Wahrheit. Es ist besser, wenn man sie kennt.«
»Genau«, sagte sie und musterte mich. »Aber das heißt nicht, dass man dabei nicht auch etwas empfinden kann, oder?« Sie fragte ganz vorsichtig. Etwas Zärtliches schwang darin mit.
»Willst du es wirklich wissen? Ich fühle mich frei.«
Sie nickte. Schweigend gingen wir weiter.
»Was dagegen, wenn ich dir eine persönliche Frage stelle?«, sagte ich schließlich.
»Kommt drauf an.«
»Worauf?«
»Was du wissen willst.«
»Hast du letzten Abend wirklich lernen müssen, oder hast du das nur so gesagt?«
Rachel lachte, ihre Lippen teilten sich und ließen ihre kleinen Zähne aufblitzen. Sie war wirklich wunderschön. »Ich habe morgen eine Prüfung in organischer Chemie, das habe ich dir doch gesagt. Deswegen gehe ich jetzt auch in die Bibliothek.« Sie blieb stehen und legte mir die Hand auf den Arm. »Aber zum nächsten Spiel komme ich mit … Versprochen!«
Mein Herz hopste vor Freude. »Okay«, sagte ich und verschluckte mich fast dabei.
Als wir die Stufen zur Bibliothek erreichten, war mir plötzlich danach, ihr zu erzählen, was mir am Abend zuvor passiert war. »Kann ich dir noch eine persönliche Frage stellen?«
»Schieß los.«
»Glaubst du an Gott?«
Rachel stutzte, dann zuckte sie mit den Schultern. »Nein. Jedenfalls nicht daran, dass da so ein Typ im Himmel sitzt.«
»Wie lange ist das schon so?«
»Vermutlich schon immer. Meine Mom ist Atheistin, daher habe ich das wohl nie so recht ernst genommen. Also, mein Dad hat uns manchmal gezwungen, in die Synagoge zu gehen – zu Rosch ha-Schana und so –, aber selbst da hat sie den ganzen Weg, hin und zurück, immer nur gemeckert.«
»Dann weißt du also nicht, wie es ist, wenn man seinen Glauben verliert.«
»Eigentlich nicht.«
Ich nickte. »Es ist befreiend. Unglaublichbefreiend. Das Befreiendste, was mir jemals zugestoßen ist … Du hast mich gefragt, wie es mir mit dem Seminar gegangen ist. Wenn ich Edelstein vom Koran reden höre, als wäre er nur ein Buch, ein Buch wie jedes andere auch, dann ist mir nach feiern zumute.«
»Klingt gut«, sagte sie lächelnd. »Wenn du bis morgen warten kannst, könnten wir zusammen feiern …«
»Klingt noch besser.«
Rachel verharrte auf der Stufe über mir gerade so lange, um bei mir einen Gedanken heraufzubeschwören – einen Gedanken, den ich nicht hinterfragte. Kurzentschlossen beugte mich vor und drückte ihr meine Lippen auf den Mund.
Sie presste sich gegen mich. Ich spürte ihre Hand am Hinterkopf, und ihre Zungenspitze streifte sanft meine Zungenspitze.
Plötzlich löste sie sich, drehte sich um und sprang die Stufen hinauf, blieb an der Tür stehen und warf mir einen schnellen Blick zu. »Wünsch mir alles Gute bei der Prüfung«, sagte sie.
»Alles Gute«, sagte ich.
In meinem Kopf drehte sich alles, nachdem sie fort war. Ich konnte mein Glück kaum fassen.
An diesem Abend, nach dem Unterricht und den Tischtennispartien in der Student Union, saß ich auf dem Bett, versuchte zu lernen und konnte nur an Rachel denken … bis das Telefon klingelte. Es war meine Mutter.
»Sie ist gestorben, Behta.«
Ich schwieg. Natürlich wusste ich, von wem sie sprach. Einen Monat zuvor hatten wir Mina – nicht nur die beste Freundin meiner Mutter, sondern auch der Mensch in meinem Leben, der mich wahrscheinlich am meisten beeinflusst hatte – in Kansas City besucht, wo sie, schon völlig vom Krebs zerfressen, im Krankenhaus gelegen hatte.
»Hast du mich gehört, Hayat?«, fragte Mutter.
»Ist wahrscheinlich besser so, oder, Mom? Ich meine, jetzt hat sie keine Schmerzen mehr.«
»Aber sie ist tot, Hayat«, stöhnte Mutter. »Sie ist tot …«
Ich lauschte ihrem Weinen. Dann tröstete ich sie.
Mutter fragte mich an jenem Abend nicht nach meinen Gefühlen. Wahrscheinlich hätte ich ihr sowieso nicht gesagt, was in mir vorging. Selbst mein Geständnis an Minas Totenbett hatte nicht gereicht, die Schuld zu lindern, die ich seit dem zwölften Lebensjahr mit mir herumtrug. Wenn ich meiner Mutter nicht mitteilen wollte, wie sehr es mich bedrückte, dann deshalb, weil mein Schmerz nicht nur Mina galt, sondern auch mir.
Wie konnte ich jetzt, nachdem sie tot war, den Schaden jemals wiedergutmachen, den ich angerichtet hatte?
Am darauffolgenden Abend saß ich mit Rachel an einer Pizzeria-Theke, wo wir vor dem Kino noch etwas aßen. Ich erzählte ihr nicht von Mina, aber irgendwie spürte sie, dass etwas nicht stimmte. Sie fragte mich, ob alles in Ordnung sei. Ja, sagte ich. Sie hakte nach. »Wirklich, Hayat?« Dabei sah sie mich mit einer Zärtlichkeit an, die ich nicht ergründen konnte. »Ich dachte, es gäbe was zu feiern«, sagte sie lächelnd.
»Na ja … es gab schlechte Neuigkeiten … nachdem wir uns gestern verabschiedet haben.«
»Welche?«
»Meine Tante ist gestorben. Sie war für mich … wie eine zweite Mutter.«
»O Gott. Das tut mir leid.«
Mit einem Mal schnürte es mir die Kehle zu. Ich war den Tränen nahe.
»Tut mir leid«, sagte ich und sah weg.
Ich spürte ihre Hand auf meinem Arm und hörte ihre Stimme. »Du musst darüber nicht reden …«
Ich sah sie an und nickte.
Der Film, eine Komödie, lenkte mich ein bisschen ab. Zum Ende hin drückte sich Rachel an mich, und wir hielten eine Weile lang Händchen. Danach lud sie mich zu sich auf ihr Zimmer ein, wo sie Kerzen anzündete und mir ein selbst komponiertes Lied auf der Gitarre vorspielte. Ein sehnsuchtsvolles, trauriges Lied über eine verlorene Liebe. Nur drei Tage vorher hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dass ich so viel Glück haben sollte. Trotzdem ging mir Mina nicht aus dem Sinn.
Ich sagte Rachel, dass ihr Song wunderbar sei.
Sie sah mir an, dass ich in Gedanken ganz woanders war. »Du denkst immer noch an deine Tante, oder?«
»Ist es so offensichtlich?«
Sie zuckte mit den Schultern und lächelte. »Schon gut«, sagte sie und stellte ihre Gitarre zur Seite. »Meine Großmutter ist mir wahrscheinlich genauso wichtig gewesen. Es ging mir ziemlich mies, als sie starb.«
»Aber es geht nicht nur darum, dass sie gestorben ist … sondern, dass ich etwas damit zu schaffen habe.« Erst als der Satz schon ausgesprochen war, wurde mir bewusst, was ich gesagt hatte.
Überrascht sah mich Rachel an.
»Was ist passiert?«, fragte sie.
»Du kennst mich kaum … ich meine, na ja, du kannst mich ja gar nicht kennen. Es ist nur … ich glaube, dir ist nicht bewusst, wie ich aufgewachsen bin.«
»Ich kann dir nicht folgen, Hayat.«
»Du bist Jüdin, oder?«
»Ja? Und?«
»Du wirst mich nicht sonderlich mögen, wenn ich dir erzähle, was geschehen ist …«
Sie rutschte auf ihrem Stuhl herum und streckte den Rücken durch. Sie sah weg.
Du kennst sie kaum, dachte ich. Was willst du dir damit beweisen?
»Vielleicht sollte ich gehen«, sagte ich.
Sie sagte nichts.
Ich rührte mich nicht. Ich wollte nämlich nicht gehen. Ich wollte bleiben. Ich wollte ihr alles erzählen.
Lange saßen wir uns schweigend gegenüber, dann berührte mich Rachel an der Hand.
»Erzähl es mir«, sagte sie.
I
DAS VERLORENE PARADIES
1
MINA
Lange bevor ich Mina kennenlernte, kannte ich ihre Geschichte.
Eine Geschichte, die Mutter oft erzählt hatte: wie ihre beste Freundin, die so begabt, so großartig war – laut meiner Mutter so etwas wie ein Genie –, immer wieder enttäuscht und in ihrer Entwicklung durch ihre kleingeistige Familie gehemmt, wie ihr starker Wille durch eine Kultur, in der für Frauen kein Platz war, gelähmt wurde. Ich hörte von den Schulstufen, die Mina übersprungen hatte, von den Klassen, in denen sie die Beste war, meist zum Verdruss ihrer Eltern, denen ihre irgendwann anstehende Hochzeit wichtiger war als ihre Zeugnisse. Ich hörte von den Jungs, die in sie verliebt waren, und wie auch sie sich im Alter von zwölf Jahren in einen verliebte, worauf ihr Vater, als dieser den Zettel des Angebeteten im Mathebuch fand, ihr mit einem Faustschlag die Nase brach. Ich hörte von ihren Nervenzusammenbrüchen, von ihren Essstörungen und natürlich von ihren Gedichten, die ihre Mutter eines Abends im offenen Wohnzimmerkamin verbrannte, als sie sich mit Mina darüber stritt, ob diese auf die Universität gehen dürfe, um Schriftstellerin zu werden.
Und weil ich das alles wahrscheinlich so oft hörte, ohne die Frau selbst zu kennen, war Mina Ali samt ihren Geistesgaben und Seelenqualen wie der immerwährende Currygeruch in unseren Zimmern und Fluren: eine Allgegenwart in meinem Leben, von der ich kaum Notiz nahm.
Und dann, an einem Sommernachmittag, ich war acht Jahre alt, sah ich ein Bild von ihr. Als Mutter Minas neuesten Brief aus Pakistan öffnete, fiel ein handtellergroßes Hochglanzfoto heraus. »Das ist deine Tante Mina, Kurban«, sagte Mutter, als ich es aufhob. »Schau, wie schön sie ist.«
Schön, in der Tat.
Das Bild zeigte eine auffallend attraktive Frau in einem Korbsessel vor grünen Blättern und orangefarbenen Blüten. Ihr tiefschwarzes Haar wurde fast ganz von einem blassrosa Schal bedeckt, und Haar und Schal rahmten ein durch und durch fesselndes Gesicht: hohe Wangenknochen – sanft durch etwas Rouge erhöht –, ovale Augen und eine kleine, kecke Nase über vollen Lippen. Ihre Gesichtszüge waren von vollkommener Harmonie und versprachen Geborgenheit und Zartheit. Aber nicht nur. Denn in ihren Augen lag eine Intensität, die dieser Verheißung mütterlichen Trosts widersprach oder sie zumindest problematischer machte: Es waren schwarze Augen, erfüllt von einem durchdringenden Licht, als wäre Minas Wahrnehmung seit Langem am Schleifstein eines namenlosen Schmerzes geschärft worden. Und obwohl sie lächelte, war ihr Lächeln eher eines, das etwas verbarg und nichts preisgab und das wie ihre Augen auf etwas Rätselhaftes, schwer Fassbares verwies, auf etwas, das man herausfinden wollte.
Meine Mutter heftete das Foto an unseren Kühlschrank, wo es von einem regenbogenförmigen Magneten gehalten wurde, mit dem auch mein Schulspeiseplan angebracht war. (Der Speiseplan, den Mutter jeden Abend studierte, um zu sehen, ob am folgenden Tag Schweinefleisch serviert wurde, so dass ich in diesem Fall ein Essenspaket mitbekam, und den ich an jedem Schulmorgen studierte in der Hoffnung, mein Lieblingsessen, Lasagne mit Rinderhack, im Angebot vorzufinden.) So verging zwei Jahre lang kaum ein Tag, an dem ich nicht wenigstens einen beiläufigen Blick auf Minas Foto warf. Und mehr als nur ein paar Mal, wenn ich morgens mein Glas Milch trank oder nach der Schule an einem Zopf Fadenkäse kaute, starrte ich versonnen auf das Foto, so wie ich an manchen Sommernachmittagen auf die Oberfläche des Teichs im Worth Park starrte und zu erhaschen versuchte, was sich in den Tiefen dort verbarg.
Es war ein außergewöhnliches Foto und hatte, wie ich einige Jahre später von Mina selbst erfuhr, eine ebenso außergewöhnliche Geschichte. Minas Eltern, die darauf bauten, dass die Schönheit ihrer Tochter einen lukrativen Bräutigam anlockte, beauftragten einen Modefotografen, um Bilder von ihr anzufertigen, und die fragliche Aufnahme war jene, die über einen Heiratsvermittler einem gewissen Hamed Suhail zugestellt wurde, dem einzigen Sohn einer wohlhabenden Familie aus Karatschi.
Sobald Hamed das Foto sah, war er in Mina verliebt.
Eineinhalb Wochen später erschienen die Suhails im Haus der Alis, und nach Beendigung des Treffens besiegelten die beiden Väter mit einem Handschlag die Verlobung ihrer Kinder. Mutter beharrte stets darauf, dass Mina keine Abneigung gegen Hamed gefasst und immer gesagt habe, sie hätte mit ihm glücklich werden können. Wäre nicht Irshad gewesen, Hameds Mutter.
Nach der Hochzeit zog Mina in den Süden nach Karatschi, wo sie bei ihren Schwiegereltern lebte. Bereits in der ersten Nacht begannen die Probleme zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter. Irshad kam ins Schlafzimmer, in der Hand eine Halskette mit runden, granatroten Steinen, ein Familienerbstück, das – wie Irshad erklärte – seit fünf Generationen jeweils von der Mutter an die Tochter vererbt worden war. Da sie selbst keine Tochter hatte, wollte Irshad diese Kette, den einzigen Familienschmuck, der Frau ihres einzigen Sohnes vermachen. So hatte sie sich das immer vorgestellt.
»Leg sie an«, drängte Irshad sie herzlich.
Mina tat es. Und als sie beide in den Spiegel sahen, bemerkte Mina Irshads verkniffenen Blick. Sie erkannte ihren Neid.
»Du solltest es nicht tun, Ammi«, sagte Mina und nahm die Kette ab.
»Was sollte ich nicht tun?«
»Ich weiß nicht … ich meine, sie ist so schön … bist du dir sicher, dass du sie mir schenken willst?«
»Ich schenke sie dir noch nicht«, erwiderte Irshad abrupt. »Ich wollte nur sehen, wie sie dir steht.«
Gekränkt von Irshads plötzlichem Meinungsumschwung, gab Mina ihrer Schwiegermutter die Kette zurück. Irshad nahm sie in Empfang und verließ ohne ein weiteres Wort das Zimmer.
Das war der Auftakt zu Irshads Feindseligkeiten. Als Erstes kamen schneidende Bemerkungen, zunächst nur geflüstert oder beiläufig geäußert: wie starrköpfig das »neue Mädchen« sei; wie tief sie sich beim Essen über ihren Teller beuge, als wäre sie eine Bedienstete; wie sehr sie wie eine »Maus« aussehe, so Irshads Worte. Bald darauf folgten Änderungen im häuslichen Tagesablauf, die einzig und allein darauf abzielten, Mina das Leben schwer zu machen: Hausangestellte wurden nach oben geschickt, um Minas Zimmer zu reinigen, während sie noch schlief; auf dem Familienspeiseplan wurden jene Speisen gestrichen, die Mina am liebsten mochte; dazu kamen wie vorher gemeine Bemerkungen, nun aber nicht mehr hinter vorgehaltener Hand. Mina tat alles, um ihre Schwiegermutter versöhnlich zu stimmen. Was Irshads Argwohn nur noch mehr schürte. Versuchte Mina, Irshad mit Unterwürfigkeit zu begegnen, fasste die ältere Frau dies als Bestätigung für Minas Verschlagenheit auf. Irshad streute nun Gerüchte über den »schweifenden Blick« und die »diebischen Hände« ihrer Schwiegertochter. Sie riet ihrem Sohn, Mina von den männlichen Bediensteten fernzuhalten, und wies die Angestellten an, ihre Wertsachen zu verschließen. (Weder Hamed noch sein Vater, die beide unter Irshads Fuchtel standen, wagten es, den sich zuspitzenden Konflikt zur Sprache zu bringen.) Und als das Vergnügen an den verbalen Misshandlungen schal wurde, nahm Irshad Zuflucht zu körperlichen Züchtigungen. Sie schlug Mina, weil sie ihre schmutzige Wäsche im Schlafzimmer herumliegen ließ oder vor Gästen unpassende Bemerkungen machte. Als Mina einmal erwähnte, das Essen sei nicht so scharf wie sonst, fasste Irshad diese Äußerung als Beleidigung auf, packte ihre Schwiegertochter an den Haaren, zerrte sie vom Esstisch und stieß sie hinaus in den Flur.
Nach vierzehn Monaten in diesem immer schlimmer werdenden Albtraum wurde Mina schwanger. Um den Misshandlungen zu entgehen und die Schwangerschaft in aller Ruhe zu Ende zu bringen, kehrte sie in den Norden, ins Haus ihrer Eltern im Punjab, zurück. Dort, drei Wochen zu früh und ohne ihren Mann – der sie aus Angst vor dem Zorn seiner Mutter nicht begleitete –, brachte Mina einen Jungen zur Welt. Und während sie erschöpft von den einen ganzen Tag dauernden Wehen im Krankenhausbett lag, erschien in der Tür ein Mann in einem langen dunklen Gewand. Er trat ein und fragte, ob sie Amina Suhail, geborene Ali, sei.
»Das bin ich«, erwiderte Mina.
Der Mann näherte sich ihrem Bett, in der Hand hielt er einen Umschlag. »Ihr Ehemann hat Sie verstoßen. Hier ist das für die Scheidung notwendige Schriftstück. Er hat es eigenhändig verfasst – Sie werden seine Handschrift erkennen – und schriftlich kundgetan, dass er Sie verstößt, dass er Sie verstößt, dass er Sie verstößt. So sieht es das Gesetz vor, wie Sie sehr wohl wissen, Mrs. Suhail … ich meine, Miss Ali.« Er legte ihr den Umschlag sacht auf den Bauch. »Sie haben gerade Hamed Suhails Sohn geboren. Er hat für den Jungen den Namen Imran bestimmt. Imran wird bis zum Alter von sieben Jahren bei Ihnen bleiben, von da an fällt das alleinige Sorgerecht an Mr. Hamed Suhail.« Der Anwalt trat einen Schritt zurück, war aber noch nicht fertig. Mina blinzelte ihn ungläubig an. »All dies erfolgt in Übereinstimmung mit den Gesetzen des Landes Pakistan, datiert auf den 15. Juni 1976. Das Gesetz stellt Ihnen frei, einen Sorgerechtsprozess anzustrengen, ich rate Ihnen aber, Mrs. Suhail … ich meine, Miss Ali, einzusehen, dass jede gerichtliche Auseinandersetzung für Sie nutzlos ist und nur Mittel verschlingen wird, über die Ihre Familie nicht verfügt.«
Daraufhin machte der Anwalt kehrt und ging hinaus.
Mina weinte an den Tagen und Nächten und in den Wochen, die folgten. So sehr Hameds grausames Vorgehen ihr auch zusetzte – und so sehr sie sein drohendes Versprechen fürchtete, ihr eines Tages das Kind wegzunehmen –, als sie ihrem Sohn in die Augen sah, sprach sie ihn mit dem Namen an, den ihr nunmehriger Exmann ohne Absprache mit ihr bestimmt hatte.
Sie nannte den Jungen Imran.
Im Winter 1981 hörte ich zum ersten Mal, dass meine Mutter Mina nach Amerika holen wollte. Ich war zehn. Die Geiseln aus dem Iran waren vor Kurzem nach Hause gekommen, und in den Abendnachrichten sah man brennende amerikanische Flaggen. Es war an einem Samstagnachmittag, zur Teezeit, meine Eltern saßen sich am Küchentisch gegenüber und nippten schweigend an ihren Tassen. Ich saß am anderen Ende, mit dem Rücken zum Glas Milch, das meine Mutter mir hingestellt hatte, und beobachtete ein halbes Dutzend Fliegen, die gegen die Fensterscheibe stießen, durch die der Garten hinter dem Haus zu sehen war.
»Weißt du, Kurban, deine Tante Mina kommt vielleicht zu uns und wird bei uns wohnen«, sagte Mutter schließlich. »Kurban?«
Ich drehte mich um. »Wann?«, fragte ich.
»Je früher, umso besser. Ihre Familie treibt sie noch in den Wahnsinn. Und der Junge muss außer Landes … oder sein Vater holt ihn. Nein, beide müssen raus.«
Mutter sah zu meinem Vater. Er blätterte eine Anglerzeitschrift durch, ohne auf ihre Kommentare einzugehen.
Ich sah wieder zu den Fliegen, die gegen die Glasscheibe schwirrten.
»Diese Fliegen! Wo kommen die bloß alle her?«, rief Mutter plötzlich. »Und auf dem Dachboden sind auch so viele! Weiß Gott, wie sie da hinaufgekommen sind!«
Missmutig blickte Vater von seiner Zeitschrift auf. »Du sagst das, als ob wir es noch nie gehört hätten, als ob du es uns zum ersten Mal erzählst. Aber du sagst es nicht zum ersten Mal. Ich kümmere mich darum.«
»Ich habe nicht mit dir geredet, Naveed.«
»Mit wem dann?«, fragte Vater in scharfem Ton. »Sonst ist nur noch der Junge hier, und ich weiß nicht, was er damit zu schaffen hat.«
Mutter starrte ihn ausdruckslos an. Vater starrte mit seinen haselgrünen Augen kalt zurück. Dann verschanzte er sich wieder hinter seiner Zeitschrift.
Mutter stand vom Tisch auf und ging zum Kühlschrank. »Es wird nicht einfach werden, Kurban. Selbst wenn wir es arrangieren können, wer weiß, ob ihre Eltern sie kommen lassen. Manchmal denke ich mir, sie wollen sie nur bei sich behalten, damit sie jemanden haben, den sie quälen können. Weißt du, was ihr Vater getan hat? Er hat ihre Bücher verkauft! Kannst du dir das vorstellen? Mina ohne ihre Bücher!«
Mutter sah zu Vater, dann erwartungsvoll zu mir. Ich sollte etwas sagen, aber ich wusste nicht, was.
»Warum hat er ihre Bücher verkauft?«, fragte ich schließlich.
»Weil er glaubt, die Bücher seien der Grund für die Scheidung. Die Bücher seien schuld an ihrem losen Mundwerk … so hat er immer von ihrer Intelligenz gesprochen. ›Alles, was sie davon bekommt, ist ein loses Mundwerk …‹« Verstohlen sah Mutter erneut zu Vater.
Er rutschte nur auf seinem Stuhl hin und her und blätterte eine Seite um.
Grummelnd nahm Mutter einen Krug aus dem Kühlschrank. »Hayat, ihre Intelligenz ist der Fluch ihres Lebens. Ist eine muslimische Frau zu klug, muss sie dafür bezahlen. Und sie bezahlt nicht mit Geld, Behta, sondern durch Misshandlungen.« Mutter verstummte und wartete auf eine Reaktion von Vater. Aber er rührte sich nicht. »Weißt du, was Freud gesagt hat, Behta? Dieser brillante Mann?«
Von Freud wusste ich nicht recht viel mehr als das, was mir meine Mutter von Zeit zu Zeit über ihn und seine Aussprüche berichtete. »Er hat gesagt, Schweigen bringt einen um. Wenn man über die Dinge nicht redet … geht man innerlich kaputt.« Ein weiterer Seitenblick zu Vater.
Jetzt sah er auf, aber nicht ihretwegen. Er warf den Kopf zurück und leerte seine Tasse Tee. Mutter knallte hinter ihm die Kühlschranktür zu. Vater setzte seine Tasse ab und blätterte eine weitere Seite um.
»Ich erzähle dir das alles, weil du mein Behta bist, mein Kind … aber eines Tages wirst du ein Mann sein. Und du solltest über diese Dinge Bescheid wissen …«
Ich sah wieder zum Fenster, hinter dem eine scharlachrote Sonne unter purpur-pinkfarbenen Wolken unterging, die wie Zuckerwattebäusche über dem Horizont hingen. Die Fliegen knallten immer noch gegen die Scheibe.
»Sie sind ja so lästig. Wo kommen die eigentlich her?«, beschwerte sich Mutter erneut, während sie aus dem Krug einschenkte.
Wieder Schweigen. Schließlich hörte ich Vater hinter mir: »Hier.«
Ich drehte mich um. Er streckte mir die zusammengerollte Zeitschrift hin. »Bring sie um! Damit Schluss ist.«
»Zwing ihn nicht dazu«, sagte Mutter seltsam flehentlich. »Mach du es, Naveed.«
Vater rührte sich nicht, sondern hielt mir nur die Zeitschrift hin.
Ich nahm sie und ging ans Fenster, holte aus und schlug zu. Die Scheibe zitterte. Eine Fliege fiel zu Boden. Die anderen stoben auf. Ich benötigte ein Dutzend weiterer Schläge, um sie alle zu erwischen. Als ich fertig war, sah ich auf das Küchenlinoleum, wo die toten Fliegen lagen.
»Gut gemacht«, sagte Vater und nahm die Zeitschrift entgegen. Er stand auf, riss die Titelseite ab, zerknüllte sie und stopfte sie in seine leere Teetasse. Dann ging er hinaus.
Mutter stellte ihr unberührtes Glas Wasser in die Spüle. »Das nächste Mal machst du nicht, was er sagt«, fauchte sie mich an. »Sondern das, was ich sage.«
Die Ehe meiner Eltern war von Anfang an schwierig gewesen. Sie hatten sich in Lahore kennengelernt und sich verliebt. Beide hatten dort studiert, Mutter Psychologie, Vater Medizin. Sie heirateten, und nach Abschluss seines Studiums wurde meinem Vater als Jahrgangsbestem eine Stelle in einem Programm angeboten, das ihn nach Wisconsin führte, wo er zum Neurologen ausgebildet wurde. Mutter brach ihr Studium ab, begleitete ihn – immer bedauerte sie, nicht mehr ihren Abschluss gemacht zu haben – und fand sich in den ländlichen westlichen Suburbs von Milwaukee wieder, einer Landschaft, die flach wie ein Brett und monatelang unter Schnee begraben war. Ein Ort, den sie nie recht verstand. Und sie war mit einem Mann zusammen, der sie betrog, sobald sie in Amerika angekommen waren. Kurz gesagt, als ich zehn war, war sie seit Jahren unglücklich.
Eine Woche nach der Episode mit den Fliegen wachte ich mitten in der Nacht auf und war mir nicht sicher, ob ich träumte. Mein Zimmer glühte in flackerndem orangefarbenem Licht. Von draußen ertönte das Geschrei von Menschen. Ein aufheulender Motor schien die Luft erzittern zu lassen. Ich stand auf und trat ans Fenster. Durch den Schleier wirbelnder Schneeflocken bot sich mir ein chaotischer Anblick: Ein Wagen stand in Flammen, dahinter zwei helle Scheinwerferkegel, durch die immer wieder schwarze Gestalten huschten. Ich brauchte eine Weile, bis mir klar wurde, dass es sich um ein Feuerwehrauto handelte. Die Feuerwehrleute verteilten sich um die Flammen und zogen an einem weißen Schlauch. Plötzlich gab es ein lautes Zischen, der weiße Schlauch versteifte sich zwischen den ungleichmäßig verteilten Verbindungsstücken und spie milchigen Schaum.
Ich war mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich träumte.
»Geh wieder ins Bett«, hörte ich hinter mir eine Stimme. Ich drehte mich um. Mutter stand in der Tür. Die lodernden Flammen spiegelten sich in ihren Augen. »Eines von den weißen Flittchen deines Vaters hat seinen Mercedes abgefackelt.« Sie stellte sich neben mich. Zusammen sahen wir zu, wie die Feuerwehrleute die Flammen löschten. Es dauerte nicht lange. Fast augenblicklich war das Feuer aus, und die nasse, ausgebrannte Karosserie rauchte nur noch vor sich hin.
Mutter drehte sich mir zu, noch immer blitzten ihre Augen, obwohl es jetzt dunkel war im Zimmer. »Deshalb sage ich dir immer, Behta … Lass dich nicht auf eine weiße Frau ein.«
Sie brachte mich zum Bett und packte mich mit einem Kuss unter die Decke. Als sie fort war, stand ich wieder auf und kehrte ans Fenster zurück. Ich entdeckte Vater, der nach vorn gebeugt durch den fallenden Schnee stapfte und die Feuerwehrleute ins Haus führte. Ich kroch ins Bett und schlief unter dem Gemurmel von Männerstimmen, das die Treppe heraufzog, wieder ein.
Die ganze Nacht träumte ich vom Feuer.
Als ich am nächsten Morgen zum Frühstück nach unten kam, war Vater nicht da.
»Wo ist Dad?«, fragte ich.
»In der Arbeit«, erwiderte Mutter. »Er hat meinen Wagen nehmen müssen«, fügte sie mit einem genüsslichen Grinsen hinzu, während sie zwei Teller mit Parathas und Spiegeleiern auf den Tisch stellte.
»Parathas?«, fragte ich. Sie machte sonst nur an Wochenenden Parathas.
»Iss, mein Lieber. Ich weiß, das magst du am liebsten.«
Mutter ließ sich mir gegenüber nieder, riss eine Kante des mit Ghee getränkten, knusprig herausgebackenen und von mir so sehr geliebten Brotes ab, stocherte damit in ihrem Ei herum, bis der Dotter platzte und zerlief. »Eine seiner weißen Prostituierten hat von seinen Versprechungen anscheinend die Schnauze voll gehabt«, begann Mutter. »Weiß der Teufel, was er ihr alles versprochen hat. Wenn er sich betrinkt, plappert er einfach drauflos und weiß wahrscheinlich später selbst nicht mehr, was er gesagt hat.« Sie löffelte sich mit ihrem Paratha Eigelb in den Mund. »Deshalb trinken wir nicht, Kurban, weil es dich beeinträchtigt. Es macht dich töricht.« Zähflüssige gelb-orange Pünktchen klebten an ihren Mundwinkeln, während sie kaute und redete. »Gib einem muslimischen Mann Alkohol, und er hechelt wie der letzte Trottel den weißen Frauen hinterher!«
Von den Geliebten meines Vaters hörte ich, seitdem meine Mutter mich als Fünfjährigen durch die Straßen von Milwaukee geschleift hatte – auf der Suche nach Vater, den wir schließlich in der Wohnung einer Frau fanden, die mit ihm im Krankenhaus arbeitete; damals wartete ich auf der Treppe, während sie und Vater sich oben auf dem Absatz anschrien. Während meiner Kindheit ersparte mir Mutter kaum ein Detail ihrer Probleme mit Vater. Mit zehn kannte ich mich selbst schließlich gut genug, um zu wissen, dass es mich wütend machte, wenn ich ihr länger zuhörte.
Ich zog den Kopf ein und hoffte, das Gewitter würde über mich hinwegziehen, aber das war unwahrscheinlich. Sie war richtig in Fahrt an diesem Morgen. Selbst ihr Äußeres war verändert – meistens erschien sie ungekämmt, verbittert, mit zunehmend verhärmtem Gesicht, und ihr dünnes braunes Haar war oft am Abend noch so zerzaust, als wäre sie gerade erst aufgestanden. Doch an diesem Morgen hatte sie geduscht und sich angezogen, als wollte sie wirklich das Haus verlassen.
»Aber jetzt hat er die Möglichkeit, zur Abwechslung mal das Richtige zu tun«, sagte sie und brach ein weiteres Stück vom Paratha ab. »Jetzt kann er jemandem helfen, der in Not ist. Deine Tante Mina braucht jemanden, der ihr und dem Jungen hilft … Jede Nacht liege ich wach und muss daran denken, was sie alles durchmacht. Der Junge ist schon vier. Sie müssen sich jetzt überlegen, wie sie rauskommen wollen. Oder es wird zu spät sein.« Sie nahm einen weiteren Bissen, kaute und schüttelte den Kopf. »Man demütigt nicht seine Frau und sein Kind vor den Augen aller Welt, ohne dass das Folgen hätte. Hier weiß er nicht so recht, dort weiß er nicht so recht, aber jetzt hat er keine andere Wahl mehr. Sie kommt, und er wird nichts dagegen einwenden können. Nach der vergangenen Nacht ist er mir das schuldig.«
»Mom, ich verpasse noch meinen Bus.«
Sie sah auf und zur Uhr. »Du hast noch Zeit. Fünf Minuten. Iss dein Frühstück zu Ende.«
»Ich habe keinen Hunger. Ich muss noch meine Sachen packen. Meine Hausaufgaben.«
»Trink deinen Saft aus.«
Ich stand auf und leerte mit einem Zug den Orangensaft. Bevor ich gehen konnte, zog Mutter mich zu sich heran. »Meri-Jaan, vergiss nicht: Das Geheimnis eines glücklichen Lebens liegt im Respekt. Respekt, den du dir selbst und anderen entgegenbringst. Das habe ich von meinem Vater gelernt, Behta, den du nicht kennst … und der ein kluger Mann war. Man könnte sogar sagen, dass er noch nicht mal ein Muslim war. Er hatte eher was von einem Juden an sich.«
»Ich habe meine Sachen noch nicht gepackt, Mom«, maulte ich.
»Schon gut, schon gut«, seufzte sie. Ich küsste sie auf die Wange und lief in mein Zimmer, um die Schulsachen zu packen.
2
EINE LEISE STIMME
Mutter behielt recht. Nach dem Zwischenfall mit dem Wagen gewann sie problemlos Vaters Unterstützung für ihren Plan, Mina nach Milwaukee zu holen. Jetzt mussten nur noch Minas Eltern überzeugt werden. Mutter telefonierte stundenlang mit Rafiq und Rabia Ali und versicherte ihnen, man würde hier auf ihre Tochter gut aufpassen. Sie könne so lange unterkommen, bis sie ihr Leben neu geordnet habe, und Mutter versprach, für Imran zu sorgen, als wäre er ihr eigener Sohn. Es stellte sich heraus, dass die Beteuerungen, die Minas Eltern eigentlich hören wollten, weniger mit der Unterbringung ihrer Tochter, sondern eher mit deren Unbescholtenheit zu tun hatten. Denn selbst für Muslime aus der westlich orientierten Mittelschicht wie die Alis – Minas Mutter war ein glühender Elvis-Fan, und ihr Vater pflegte eine große Leidenschaft für Marlboros und Wildwest-Romane – war Amerika keineswegs das Land des Überflusses und der unbegrenzten Möglichkeiten, sondern das der Sünde; die Freiheit, an der sich sonst die Vorstellungskraft berauschte, verdarb und zersetzte die Seelen der Menschen. Und für Amerikas moralische Verkommenheit gab es kein besseres Sinnbild als die amerikanische Frau, die, von der Freiheit dazu ermutigt, sich ihrer Vergnügungs- und Selbstsucht hinzugeben, ganz begierig darauf war, sich im Beisein wildfremder Menschen die Kleider vom Leib zu reißen. Dass ihre Tochter zu einem dieser Wesen werden könnte, wünschten die Alis unter allen Umständen zu vermeiden.
Oder unter fast allen Umständen, wie Vater eines Abends beim Essen anmerkte.
»Wie scheinheilig«, beschwerte sich Mutter, während Vater und ich Hühnchen-Karahi mampften. »Rafiq will, dass seine Söhne hierher kommen, aber nicht seine Tochter. Wenn die Söhne mit weißen Frauen herumziehen, spielt das keine Rolle, aber Gott behüte, wenn sie dabei ertappt würde, wenn sie einen weißen Mann auch nur ansieht.«
»Die Söhne?«, fragte Vater.
»Das ist der einzige Grund, warum er überhaupt einen Gedanken daran verschwendet. Wenn sie kommt, kann sie ihren jüngeren Brüdern später unter die Arme greifen.«
Vater lächelte mokant. »Rafiq versucht also herauszukriegen, ob das Geld, das seine Söhne ihm aus Amerika schicken werden, es wert ist, wenn er seine Tochter zur Hure macht …«
Ich wusste nicht, was dieses Wort genau bedeutete, aber bevor ich danach fragen konnte, schaltete sich Mutter dazwischen. »Findest du das witzig? So ein Wort vor deinem eigenen Kind?«
Vater sah mich an. »Je früher er weiß, wie es auf der Welt zugeht, umso besser.«
Mutter wandte sich an mich. »Halt dir die Ohren zu!«
»Mom …«
»Keine Widerrede, Hayat.«
Widerstrebend wischte ich mir die curryverschmierten Hände ab und tat wie angewiesen. Das verhinderte allerdings nicht, dass ich hörte, was sie als Nächstes zu ihm sagte.
»Wenn du noch mal in seiner Gegenwart solche Ausdrücke in den Mund nimmst, werde ich dich hier rauswerfen lassen. Rauswerfen, hörst du?«
Vater wartete kurz, bevor er zu einer Erwiderung ansetzte. »Ist das ein Versprechen?«, sagte er trocken, sah dann schulterzuckend weg und aß weiter.
Letztlich erklärten sich Minas Eltern aus welchen Gründen auch immer dazu bereit, sie zu uns zu schicken. Wir erfuhren davon, als es eines Nachmittags an der Tür klingelte. Ich öffnete. Vor mir stand ein spindeldürrer Mann mittleren Alters mit stechend blauen Augen und einem violetten Muttermal, das sich über die Nase und die rechte Wange zog. In der einen Hand hielt er ein Klemmbrett, in der anderen einen dünnen Umschlag.
»Shah?«
»Ja.«
»Telegramm«, sagte er und reichte mir den Umschlag.
»Was ist das?«
»Ein Fernschreiben. Hier unterschreiben.« Er hielt mir das Klemmbrett hin, und ich trug meinen Namen ein.
»Was ist das überhaupt für ein Name? Shah? Bist du Perser, oder was?«
»Pakistani.«
Er grummelte. Er schien sich nicht ganz sicher zu sein, ob er mich verstanden hatte. Daraufhin neigte er den Kopf und musterte mich. Ich bemerkte das dünne silberne Kreuz, das er an einer Kette um den Hals trug. »Hasst ihr auch die Amerikaner?«, fragte er.
»Nein.«
Er starrte mich weiter an, schließlich nickte er. »Gut«, sagte er zufrieden. Damit drehte er sich um und ging zum olivgrünen Wagen, der mit laufendem Motor in unserer Einfahrt stand.
Am Küchentisch riss Mutter den Umschlag auf. »Minas Telegramm!«, rief sie erfreut.
»Was ist das, Mom?«
»Ein Brief, der telegrafisch übermittelt wird. Von einem Amt zum anderen. Von der einen Erdhalbkugel zur anderen, Behta. Als ich klein war, Hayat, wurden Nachrichten nach Übersee immer mit dem Telegramm geschickt. Heute hat man das Telefon, das ist einfacher. Aber in Pakistan ist das Telegramm immer noch hundertmal billiger als ein Telefonat.« Sie las es. »Sie hat ein Ticket gekauft.«
»Was schreibt sie?«
KOMME NACH AMERIKA STOPP ANKUNFT 13. MAI CHICAGO STOPP BRITISH AIRWAYS
Sie reichte mir das hauchdünne Blatt. Alles war in Großbuchstaben gedruckt, sogar das Wort »Stopp«.
»Warum steht hier ›Stopp‹?«
»Satzzeichen würden mehr kosten«, sagte Mutter und nahm das Telegramm wieder an sich. Dann sah sie mich mit weit aufgerissenen Augen an. »Schicken wir ihr eines zurück!«, sagte sie.
»Wo?«
»Bei Western Union.«
So machten wir uns auf den Weg. Mutter und ich gingen zur Mall, traten dort an den Schalter und füllten das Formular für das zu versendende Telegramm aus. Würde die Nachricht aus zehn oder weniger Wörtern bestehen, kostete es nur sechs Dollar. Jedes Wort darüber wurde mit siebzig Cent abgerechnet. Es war mir schleierhaft, wie Mutter überhaupt auf zehn Wörter kommen sollte, schließlich wollte sie doch nur mitteilen, dass Minas Telegramm angekommen war.
TELEGRAMM ERHALTEN STOPP SEHR AUFGEREGT STOPP INSCHALLAH
Mutter sah mich an. »Was meinst du?«
Klang für mich okay.
Während Mutter am Schalter zahlte, entdeckte ich den Boten mit dem Fleck im Gesicht; er kam aus dem hinteren Raum, und unsere Blicke trafen sich.
Er nickte. Ich nickte ebenfalls.
Wie angekündigt kam Mina im Mai. Auf dem Weg zum Flughafen blieben wir im Stau stecken, so dass wir erst eintrafen, als das Flugzeug schon zur Landung ansetzte. Mutter war außer sich. Vater hielt an, und Mutter zerrte mich vom Rücksitz. Wir rannten zum Schalter der Fluggesellschaft, um uns nach dem Flug zu erkundigen, während Vater den Wagen parkte. Als der Angestellte verkündete, die Maschine sei bereits gelandet, stieß Mutter einen spitzen Schrei aus. Wir stürmten durch das Terminal zu Minas Gate. Doch als wir dort ankamen, war die Lounge leer. Zwei Stewardessen standen am Schalter. Mutter trat zu ihnen. In diesem Augenblick fiel mir eine Frau auf, die vor der Glasscheibe zum nächsten Gate stand. Sie war klein und drückte ein großes schlafendes Kind an sich, dessen Arme wie die Enden einer Stola zu beiden Seiten herunterbaumelten. Als Mutter zurückkehrte, deutete ich auf sie. »Ist sie das?«
»Miinnaa!«, rief Mutter voller Freude.
Mina drehte sich zu uns um, und ich staunte. Sie war genauso schön wie auf dem Foto, aber es war noch etwas an ihr: Selbstvertrauen, eine große Anziehungskraft.
Sie lächelte, und ich war hin und weg.
»Bhaj, ich habe mich schon gefragt, ob ich in der falschen Stadt gelandet bin!«
Mutter lachte, ihre Augen wurden feucht. Sie fasste Mina an den Schultern und sah sie eindringlich an. Minas selbstbewusstes Lächeln geriet ins Wanken, auch ihre Augen füllten sich mit Tränen. Die beiden Frauen umarmten sich. Minas Sohn, der zwischen ihnen klemmte, rührte sich und stöhnte.
Schniefend löste sich Mutter und nahm Mina den Jungen ab. »Hallo, mein Kleiner …«, gurrte sie. »Willkommen in Amerika.«
Imran legte den Kopf auf Mutters Schulter und schlief wieder ein.
Lächelnd trocknete sich Mina die Augen. »Er mag dich, Bhaj!«
»Alle mögen mich.«
»Bilde dir bloß nicht zu viel darauf ein!«
Sie lachten. Mina wandte sich an mich und rief entzückt aus: »Das ist also Hayat! Wie hübsch er ist. Wie ein Filmstar!«
Mutter rollte mit den Augen. »Und genauso verzogen …«
»Du wirst den Mädchen die Herzen brechen, was, Behta?« Sie sah mich unverwandt an. Und wieder war ich überrascht von der Intensität, der Lebhaftigkeit in ihrem Blick, die auf dem Foto nur andeutungsweise zu erkennen gewesen war. Es war überwältigend.
»Was ist los, Behta?«, fragte sie belustigt und strich mir durch die Haare. »Hat es dir die Sprache verschlagen?«
Ich grinste dämlich und nickte nur. Mir hatte es in der Tat die Sprache verschlagen.
Im Garten vor unserem Haus gab es drei große knorrige Bäume, alte, wunderschöne Eichen. Sie standen in einer Reihe, wobei die beiden äußeren sich mit ihren Wipfeln dem Baum in der Mitte zuneigten, als wären sie drei alte Weiber – so sagte Mutter immer –, die die Köpfe zusammensteckten, um ihre Geheimnisse auszutauschen. Man hatte Mutter gesagt, dass sie zu nah am Haus stünden und das Dach Schaden nehmen könnte, falls bei einem Sturm Äste herunterkrachten. Man hatte ihr deshalb geraten, sie zu fällen. Aber Mutter liebte die Bäume. Sie und Mina blieben vor einem der Stämme stehen, während Vater Minas Gepäck ins Haus trug. Auch ich hatte eine Tasche in der Hand und blieb stehen, um umzugreifen.
Mina hatte Imran auf den Armen – er tat so, als würde er schlafen, musterte mich in Wirklichkeit aber mit einem offenen Auge – und sah in die Krone hinauf. »Weißeichen«, sagte sie.
»So was in der Art«, erwiderte Mutter. »Ulmen oder Eichen oder so was.«
»Es sind Eichen, Bhaj. Weißeichen. Das sieht man an den Blättern.« Mina deutete darauf. »Im Frühling sind sie so rosa wie jetzt. So eine stand mitten im Hof der Bahnhofsschule, erinnerst du dich noch?« Mutters Blick schweifte in die Ferne. »Die Blätter waren genauso rosa wie hier, erinnerst du dich?«, fragte Mina.
Mutter nickte. »Ich wusste doch, dass es einen Grund geben muss, warum ich sie nicht fällen lassen will.«
Mina strich über den Stamm. »Muss hundert Jahre alt sein.«
»Das hat der Baummensch auch gesagt.«
An der Haustür rief Vater: »Ins grüne Zimmer, oder?«
»Ja, Naveed«, rief Mutter zurück. Sie wandte sich an Mina, als er drinnen verschwunden war. »Wie oft habe ich ihm gesagt, wo wir dich unterbringen! Und trotzdem muss er nachfragen! Außerdem gibt es sowieso nur ein freies Zimmer.«
Mina gluckste.
»Los, Kurban«, sagte Mutter zu mir. »Bring deiner Tante die Tasche ins grüne Zimmer.«
»In Ordnung, Mom.«
Ich schleppte die Tasche ins Haus und die Treppe hinauf zum ersten Zimmer im Flur, das wir wegen des leuchtend gelb-grünen Teppichs das grüne Zimmer nannten. Wir hätten es auch das Zeichentrick-Zimmer nennen können, denn die Wände waren mit vier lebensgroßen Comicfiguren geschmückt – mit Goofy, Daffy Duck, Bugs Bunny und Schneewittchen –, die bereits da gewesen waren, als wir das Haus gekauft hatten. Wochen vor Minas Ankunft hatte Mutter davon gesprochen, einen neuen Teppich verlegen und die Wände neu tapezieren zu lassen. Vater hatte gesagt, er werde sich darum kümmern, aber nie etwas unternommen.
Als nun Mina ihre Sachen aufs Bett legte, entschuldigte sich Mutter. »Ich wollte einen neuen Teppich reinlegen lassen. Naveed hat es mir versprochen.«
»Aber warum?«
»Die Farbe? Bekommst du keine Kopfschmerzen davon?«
»Die ist wunderbar. Ich will nicht, dass du dir so viele Umstände machst.«
»Es macht gar keine Umstände. Aber jetzt bist du hier, da können wir es zusammen machen. Du kannst dir eine Farbe aussuchen. Und wir überstreichen diese blöden Zeichentrickfiguren …«
Mina sah zu mir. Ich stand mit ihren Sachen vor dem Schrank. »Was meinst du dazu, Behta?«
Um die Wahrheit zu sagen, mir hatten die Farbe des Teppichs und auch die Zeichentrickfiguren immer gefallen. Sie brachten etwas Leben in unser ansonsten unerbittlich düsteres Haus. Aber ich bekam keine Möglichkeit, darauf zu antworten. Mutter schaltete sich dazwischen. »Es ist nicht wichtig, was er dazu meint. Wichtig ist, was du denkst.«
In diesem Augenblick tapste Imran, Minas vierjähriger Sohn, schlaftrunken von der Toilette ins Zimmer. Seine Füße waren unerklärlicherweise nass, mit seinen kurzen, schlurfenden Schritten hinterließ er dunkle Tapper auf dem knallgrünen Teppich. Mit weit geöffneten Augen sah er auf, und plötzlich lächelte er. Er trat an die Wand, streckte die Arme aus und drückte sich gegen Daffy Duck.
Mutter und Mina tauschten einen Blick.
»Oder wir lassen es einfach so, wie es ist«, sagte Mina.
Mutter nickte. »Na, vielleicht ist das wirklich das Beste.«
Mina und Imran litten an Jetlag. Am Nachmittag legten sie sich hin und schliefen die nächsten zwei Tage mehr oder weniger durch. Erst Mitte der Woche aßen wir zum ersten Mal zusammen. Ich kam am Nachmittag von der Schule heim, und im Haus hing der Duft von Lamm nach Lahori-Art, von selbstgemachtem Nanund Bhindi bhuna. Bei den Hausaufgaben am Küchentisch sah ich Mina und Mutter zu, die bis in den Abend hinein kochten, lachten und sich Geschichten auf Panjabi erzählten – das ich verstand, aber selbst nicht sprechen konnte. Mutter war so glücklich. Und neben ihr Mina, die tatsächlich und sehr lebendig um eben den Kühlschrank herumschwebte, an dem ihr Foto hing, das ich zwei Jahre lang angestarrt hatte. Es hatte wirklich etwas Erstaunliches, Wunderbares an sich.
Das herrliche Essen an diesem Abend versetzte sogar Vater in eine sentimentale Stimmung. Am Ende der Mahlzeit lehnte er sich auf dem Stuhl zurück, in seinem Blick ein weiches, zufriedenes Schimmern, und mit dem Lassi-Glas prostete er Mina und ihrem Sohn zu und sagte: »Es ist schön, dich hier zu haben.«
Mina sah ihn an, auf den Lippen dieses verführerische Lächeln, das ich vom Foto her kannte. »Danke, Naveed«, sagte sie. »Du bist sehr großzügig.«
Vater gab sich empört. »Unsinn«, widersprach er. »Außerdem solltest du nicht mir danken. Sondern Muneer. Sie hätte mir beide Beine gebrochen, wenn ich mich nicht einverstanden erklärt hätte … Aber ich muss sagen, ich bin froh darüber.«
»So, dann wissen wir jetzt also«, flachste Mutter, »dass der Weg zu deinem Herzen über den Magen geht.«
Er schenkte ihr ein maliziöses Lächeln. »Unter anderem.«
Mutter wurde rot und sah weg.
Auch Mina wandte den Blick ab und sah zu ihrem Sohn. »Sag danke zu deiner Tante Muneer und deinem Onkel Naveed.«
»Danke, Tante. Danke, Onkel«, murmelte Imran.
»Es ist uns eine Freude«, jubilierte Mutter.
Vater betrachtete liebevoll den Jungen. »Keine Ursache, Kurban«, sagte er.
Verwirrt sah ich zu Vater. Es schmerzte – wie ein Insektenstich am Herzen –, dass er Imran so genannt hatte.
»Was?«, fragte er.
»›Kurban‹?«, platzte ich heraus. »So nennst du sonst nur mich!«
»Was heißt das?«, kam es von Imran.
»Damit bezeichnen wir das Wichtigste, das wir verschenken können«, sagte Mina und wandte sich mit einem Lächeln an mich. »Das Opfer unseres Herzen.« Sie strich mir die Haarsträhnen aus den Augen. »Du bist auch mein Kurban«, sagte sie liebevoll.
Einige Wochen nach ihrer Ankunft erlebte ich zum ersten Mal, welch tieferes Verständnis Mina allem und jedem entgegenbrachte. Andere hielten dies für einen Ausdruck ihrer Intelligenz, meiner Ansicht nach handelte es sich dabei eher um eine spirituelle Gabe.
Sie saß am Esstisch, war in ein Buch vertieft, während ein Streifen der Nachmittagssonne wie ein glänzender Schal über sie drapiert war. Ich konnte sie klar und deutlich aus dem angrenzenden Wohnzimmer sehen, wo ich saß und wegen des Eiscreme-Festes schmollte, das wieder einmal ohne mich stattfinden sollte.
In der letzten Woche des Schuljahrs, jeweils am Donnerstag, baute die Lutherische Kirche auf der Rasenfläche neben der Mason Elementary – wo ich die fünfte Klasse besuchte – einen Mini-Rummel auf und veranstaltete dort jedes Jahr das sogenannte Eiscreme-Fest. Es gab Buden, ein Karussell und mehr als nur ein paar Eisstände. Man bekam Banana-Split und Turtle Sundaes und das bei allen besonders beliebte Softeis in der Waffel. Dazu stellte die Schule die Turnhalle zur Verfügung, und während die Mütter und Schwestern und Freundinnen in Sandalen und pastellfarbenen Kleidern ihr Eis aßen, traten die Jungs und Väter zu einem Basketballspiel an, das schon Monate vorher in aller Munde war. Seit der zweiten Klasse versuchte ich meine Mutter dazu zu bringen, mich dorthin zu lassen.
»Wir gehen nicht in die Kirche, Hayat. Wir sind keine Christen. Irgendwo müssen wir eine Grenze ziehen.«
»Es geht nicht um die Kirche, Mom. Sondern ums Spielen und ums Eisessen.«
»In einer Kirche.«
»Davor. Und in der Schule.«
»Auf dem Schild vor der Kirche steht ›Eiscreme-Fest der Lutherischen Gemeinde‹.«
»Bitte, Mom.«
»Hayat, mach keine Schwierigkeiten.«
»Biiitte.«
»Nein. Und das ist mein letztes Wort.«