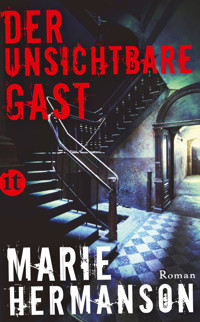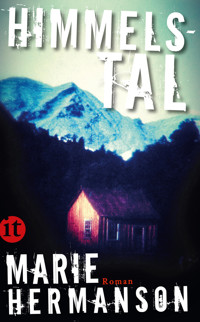
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Himmelstal, idyllisch in den Schweizer Alpen gelegen, ist das Paradies auf Erden. Hier können sich reiche Patienten von ihrem Burnout-Syndrom erholen. Sie verbringen ihre Tage am Pool, genießen die frische Luft und die Aussicht auf die Berge. Als Daniel seinen Zwillingsbruder Max in der Kurklinik besucht, ist er von der »Zauberberg«-Atmosphäre so angetan, dass er sich ohne zu zögern auf ein folgenschweres Angebot einlässt: Max muss dringend nach Italien und bittet Daniel, heimlich an seiner Statt in der Klinik zu bleiben. Aber in dem malerischen Alpental ist nichts, wie es scheint, und was als entspannter Urlaub beginnt, verwandelt sich schnell in ein albtraumhaftes Verwechslungsspiel, bei dem Gut und Böse nicht mehr zu unterscheiden sind …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Himmelstal, idyllisch in den Schweizer Alpen gelegen, ist das Paradies auf Erden. Hier können sich reiche Patienten von ihrem Burnout-Syndrom erholen. Sie verbringen ihre Tage am Pool, genießen die frische Luft und die Aussicht auf die Berge. Als Daniel seinen Zwillingsbruder Max in der Kurklinik besucht, ist er von der »Zauberberg«-Atmosphäre so angetan, dass er sich ohne zu zögern auf ein folgenschweres Angebot einlässt: Max muss dringend nach Italien und bittet Daniel, heimlich an seiner statt in der Klinik zu bleiben. Aber in dem malerischen Alpental ist nichts, wie es scheint, und was als entspannter Urlaub beginnt, verwandelt sich schnell in ein albtraumhaftes Verwechslungsspiel, bei dem Gut und Böse nicht mehr zu unterscheiden sind …
Marie Hermanson, 1956 geboren, lebt in Göteborg und hat etliche Jahre ihres Lebens als Journalistin gearbeitet. Sie debütierte mit einer Sammlung von Erzählungen, die, so ein schwedischer Kritiker, Zeichen sind »einer großen, sich entwickelnden Autorin, welche die altnordische Saga mit den besten Exempeln angloamerikanischer Fantasy und Science-Fiction zu vereinen versteht und deren Wurzeln bis hin zu Poe reichen«. Sie erhielt für ihren Roman Die Schmetterlingsfrau (1995) den renommierten schwedischen August-Preis. Mit ihrem Roman Muschelstrand (1998) gelang ihr der internationale Durchbruch.
Marie Hermanson
HIMMELSTAL
Roman
Aus dem Schwedischen von Regine Elsässer
Titel der Originalausgabe:
Himmelsdalen
Albert Bonniers Förlag
Published by arrangement with Nordin Agency AB, Sweden
eBook Insel Verlag Berlin 2013
© Marie Hermanson 2011
© der deutschen Ausgabe Insel Verlag Berlin 2012
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des
öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung
durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form
(durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren)
ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert
oder unter Verwendung elektronischer Systeme
verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Satz: Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
»Bosheit ist bloß eine Art Ungeschicklichkeit«
Bertolt Brecht,
Teil 1
1 Als Daniel den Brief bekam, glaubte er zunächst, er käme aus der Hölle.
Es war ein dicker DIN-A4-Umschlag aus einem gelblichen, grobfasrigen Papier. Er hatte keinen Absender, aber er erkannte in den schludrigen, fast unleserlichen Großbuchstaben die Handschrift seines Bruders. Wie in großer Eile hingekritzelt.
Aber der Brief konnte eigentlich nicht von Max sein. Daniel konnte sich nicht erinnern, jemals einen Brief oder eine Ansichtskarte von seinem Bruder bekommen zu haben. Wenn Max sich meldete, was selten genug vorkam, dann rief er an.
Es war eine ausländische Briefmarke. Und natürlich stand darauf nicht Helvete, das schwedische Wort für Hölle, wie er einen eiskalten Augenblick lang geglaubt hatte, sondern Helvetia.
Er nahm den Brief mit in die Küche und ließ ihn auf dem Tisch liegen, während er die Kaffeemaschine anschaltete. Er hatte die Angewohnheit, nach der Arbeit eine Tasse Kaffee zu trinken und ein paar Brote zu essen. Er aß mittags warm in der Schulkantine, und weil er allein lebte, hatte er abends keine Lust, für sich zu kochen.
Die alte Kaffeemaschine hustete, er wollte den Brief mit einem Messer öffnen, hielt jedoch inne, als er bemerkte, dass seine Hände zitterten, so sehr, dass er kaum das Messer halten konnte. Er bekam nur mühsam Luft, als ob er sich an einem zu großen Bissen verschluckt hätte. Er musste sich setzen.
Seine Gefühle angesichts des noch ungelesenen Briefs waren die gleichen wie früher, vor den Treffen mit Max, eine große Freude darüber, sich endlich zu sehen, auf den Bruder zuzulaufen und ihn zu umarmen. Und gleichzeitig hielt ihn etwas zurück. Eine diffuse, pochende Unruhe.
»Ich kann wenigstens einmal lesen, was er schreibt«, sagte er laut zu sich, mit fester, entschlossener Stimme, als ob eine andere, vernünftigere Person aus ihm spräche.
Er nahm das Messer und öffnete den Brief.
2 Von ihrem Platz am Konferenztisch konnte Gisela Obermann durch das große Panoramafenster direkt auf die senkrechte Felswand an der gegenüberliegenden Seite des Tals schauen. Die Oberfläche war glatt und gelblich weiß wie ein auseinandergefaltetes Blatt Papier mit schwarzen Punkten. Sie ertappte sich dabei, nach Schriftzeichen zu suchen.
Ganz oben wurde die Felswand von einem Kamm kühner Tannen gekrönt. Einige hatten sich zu weit nach vorne gewagt und hingen über den Rand wie abgebrochene Streichhölzer.
Die Gesichter um den Konferenztisch verblassten im Gegenlicht, die Stimmen wurden leiser.
»Gibt es diese Woche irgendwelche Besucher?«, fragte jemand.
Gisela Obermann war müde und durstig, irgendwie ausgelaugt. Das kam von dem Wein, den sie heute Nacht getrunken hatte. Aber nicht nur vom Wein.
»Wir haben einen Angehörigenbesuch«, sagte Doktor Fischer. »Für Max.«
Gisela wurde plötzlich munter.
»Wer besucht ihn?«, fragte sie erstaunt.
»Sein Bruder.«
»Aha. Ich dachte, sie hätten keinen Kontakt.«
»Das wird ihm sicher guttun«, sagte Hedda Heine. »Das ist sein erster Besuch, seit er hier ist, nicht wahr?«
»Kann sein.«
»Ja, das ist sein erster Besuch«, bestätigte Gisela. »Wie nett. Mit Max passiert gerade viel Positives. Ich finde, er wirkte in letzter Zeit sehr harmonisch und gut gelaunt. Es tut ihm sicher gut, wenn er Besuch von seinem Bruder bekommt. Wann kommt er?«
»Er müsste heute Nachmittag oder Abend ankommen«, sagte Doktor Fischer, schaute auf die Uhr und sammelte seine Papiere ein. »War das alles?«
Ein rotbärtiger Mann Mitte vierzig winkte eifrig mit der Hand.
»Brian?«
»Gibt es was Neues über Mattias Block?«
»Nein, leider nicht. Aber die Suche geht weiter.«
Doktor Fischer nahm seine Papiere und erhob sich. Die anderen folgten ihm.
Typisch, dachte Gisela Obermann. Max' Bruder kommt heute. Und niemand gibt mir, seiner Ärztin, Bescheid.
Genauso lief es hier. Deswegen war sie so müde. Ihre Energie, mit der sie bisher immer wie ein Messer durch jeden Widerstand hatte schneiden können, war verschwunden. Es war, als prallte sie an Wänden ab und richtete sich schließlich gegen sie selbst.
3 Daniel folgte dem Menschenstrom zum Ausgang des Flughafens, wo eine kleine Schar Taxifahrer handgeschriebene Namensschilder hochhielt. Er ließ den Blick über die Schilder schweifen, zeigte auf eines davon und sagte auf Deutsch:
»Das bin ich.«
Der Fahrer nickte und führte ihn zu einem kleinen Bus. Daniel stieg ein, der Fahrer kümmerte sich um das Gepäck.
»Ist es weit?«, fragte er.
»Ungefähr drei Stunden. Wir machen unterwegs eine Pause«, sagte der Fahrer und schob die Tür zu.
Sie verließen Zürich und fuhren an einem großen See entlang, der von waldbedeckten Bergen umgeben war. Daniel hätte den Fahrer gerne gefragt, was man rechts und links des Weges so sah, aber sie waren durch eine Glasscheibe getrennt. Daniel lehnte sich im Sitz zurück und strich sich mit den Fingern durch den Bart.
Es war nicht allein die brüderliche Fürsorge, die ihn veranlasst hatte, das Angebot zu dieser Reise anzunehmen, das musste er zugeben. Es ging ihm ökonomisch nicht sehr gut. Seine Aushilfsstelle als Lehrer lief zum Herbst aus, wenn die reguläre Lehrerin nach dem Mutterschaftsurlaub wiederkam. Dann würde er sich wieder mit solchen Gelegenheitsjobs und Übersetzungen durchschlagen müssen. Eine Ferienreise konnte er sich diesen Sommer auf keinen Fall leisten. Max' Angebot, die Reise in die Schweiz zu bezahlen, war verlockend. Nach dem Besuch in der Klinik konnte er noch eine Woche in einem kleinen Hotel auf einer Alm bleiben und die Tage mit ein paar gemütlichen Wanderungen in der schönen Landschaft verbringen.
Ulmen, Eschen und Haselnusssträucher sausten vor dem Autofenster vorbei. Am See lagen hübsche kleine Häuser mit abschüssigen Gärten. Große braune Vögel segelten langsam über die Straße.
In den letzten Jahren hatte Daniel nur wenig Kontakt mit seinem Bruder gehabt. Max lebte im Ausland, erst in London, dann an verschiedenen anderen Orten, wo er, soweit Daniel wusste, irgendwelchen Geschäften nachging. Auch Daniel hatte die ersten Berufsjahre im Ausland verbracht.
Seit seiner Jugend hatte Max sich auf einer Berg-und-Tal-Bahn aus Erfolgen und Niederlagen befunden, für die er immer selbst verantwortlich war. Seine Projekte entwickelte er mit einem imponierenden Ideenreichtum und einer fast unmenschlichen Energie. Aber wenn er das Erstrebte erreicht hatte, verlor er plötzlich das Interesse an der ganzen Sache und verschwand einfach, während verzweifelte Mitarbeiter und Kunden versuchten, ihn auf ausgeschalteten Telefonen und in verwaisten Büros zu erreichen.
Mehr als einmal musste der schwer geprüfte Vater der Brüder einspringen und Max aus irgendeiner Klemme helfen. Vielleicht waren die Turbulenzen, die sein unberechenbarer Sohn ihm bereitete, schuld daran, dass er eines Morgens im Badezimmer einen Herzinfarkt erlitt und kurz darauf starb.
Bei einer psychiatrischen Untersuchung im Rahmen eines Gerichtsprozesses wurde festgestellt, dass Max an einer bipolaren Störung litt. Die Diagnose erklärte das rätselhafte Chaos, in dem Max sich offenbar ständig befand, seine waghalsigen Geschäfte, sein selbstzerstörerisches Verhalten und seine Unfähigkeit zu einer längeren Beziehung mit einer Frau.
Hin und wieder telefonierte Daniel mit seinem Bruder. Max rief oft zu den merkwürdigsten Tageszeiten an und klang immer ein wenig betrunken.
Als ihre Mutter starb, unternahm Daniel große Anstrengungen, ihn zu finden, aber es gelang ihm nicht, und das Begräbnis fand ohne Max statt. Irgendwie musste er dennoch davon erfahren haben, denn ein paar Monate später rief er an und fragte, wo die Mutter begraben sei, er wolle Blumen aufs Grab bringen. Daniel hatte vorgeschlagen, dass sie sich treffen und zusammen hinfahren könnten. Max versprach, sich zu melden, sobald er nach Schweden kam, aber das tat er nicht.
Die Glasscheibe glitt zur Seite. Der Fahrer drehte sich um und sagte:
»Nach ein paar Kilometern kommt ein Gasthaus. Wollen Sie eine Pause machen und etwas essen?«
»Essen möchte ich nicht, aber gerne eine Tasse Kaffee trinken«, antwortete Daniel.
Die Glasscheibe glitt wieder zu. Kurz darauf hielten sie an einem kleinen Gasthaus und tranken einen Espresso an der Bar. Sie sprachen nicht miteinander, und Daniel war dankbar für die Schlagermusik, die aus den Lautsprechern dröhnte.
»Sind Sie schon einmal in Himmelstal gewesen?«, fragte der Fahrer schließlich.
»Nein, noch nie. Ich möchte meinen Bruder besuchen.«
Der Fahrer nickte, als wisse er Bescheid.
»Fahren Sie regelmäßig dorthin?«, fragte Daniel vorsichtig.
»Hin und wieder. In den neunziger Jahren, als es eine Klinik für plastische Chirurgie war, fuhr ich häufiger. Mein Gott, da musste man Leute fahren, die aussahen wie Mumien. Nicht alle konnten es sich leisten, in der Klinik zu bleiben, bis die Operationswunden ausgeheilt waren. Ich erinnere mich vor allem an eine Frau, von der man nur die Augen zwischen den Verbänden sah. Und was für Augen! Geschwollen, verweint, unendlich traurig. Sie hatte solche Schmerzen, dass sie die ganze Zeit weinte. Als wir hier Rast machten – ich mache immer hier Rast, das Gasthaus liegt genau auf dem halben Weg nach Zürich –, blieb sie im Auto sitzen, ich brachte ihr Orangensaft und einen Trinkhalm, sie saß auf dem Rücksitz und schlürfte den Saft. Ihr Mann hatte eine junge Geliebte, sie hatte sich liften lassen, um ihn zurückzugewinnen. Meine Güte. ›Alles wird gut. Sie werden schön sein wie der Tag‹, sagte ich zu ihr und hielt ihr die Hand. Ja, meine Güte.«
»Und jetzt? Was ist das jetzt für ein Ort?«, fragte Daniel. Der Fahrer ließ die Espressotasse in der Luft schweben und schaute Daniel kurz an.
»Hat Ihr Bruder Ihnen das nicht erzählt?«
»Nicht genau. Irgendeine Reha-Klinik.«
»Ja, genau.« Der Fahrer nickte eifrig und stellte die Tasse auf den Unterteller. »Sollen wir weiterfahren?«
Kaum waren sie wieder losgefahren, schlief Daniel ein, und als er die Augen wieder aufschlug, befanden sie sich in einem Tal mit grünen Wiesen, die von der Abendsonne beschienen wurden. Er hatte noch nie eine so intensive grüne Farbe in der Natur gesehen. Sie wirkte künstlich, wie mit chemischen Zusätzen versetzt. Das lag vielleicht am Licht.
Das Tal wurde schmaler, und die Landschaft veränderte sich. Die rechte Straßenseite wurde von einer fast senkrechten Felswand begrenzt, die die Sonne verdeckte. Es wurde dunkler im Auto.
Plötzlich bremste der Fahrer. Ein Mann in einem kurzärmeligen Uniformhemd und Schirmmütze versperrte ihnen den Weg. Hinter ihm war eine heruntergelassene Schranke zu sehen. Ein bisschen weiter weg stand ein Transporter, und von dort näherte sich ein weiterer uniformierter Mann.
Der Fahrer ließ seine Scheibe herab und wechselte ein paar Worte mit dem Mann, während der zweite die Heckklappe ihres Busses öffnete. Die Scheibe zwischen Vorder- und Rücksitz war immer noch geschlossen, so dass Daniel nicht hören konnte, was gesprochen wurde. Er öffnete die Seitenscheibe und lauschte. Der Mann sprach freundlich mit dem Fahrer, sie unterhielten sich offenbar über das Wetter. Er sprach einen Dialekt, der schwer zu verstehen war.
Dann beugte er sich zu Daniel und bat ihn um seinen Ausweis. Daniel reichte ihm seinen Pass. Der Mann sagte etwas, das er nicht verstand.
»Sie können aussteigen«, übersetzte der Fahrer, der sich zu ihm umgedreht und die Trennscheibe geöffnet hatte.
»Ich soll aussteigen?«
Der Fahrer nickte auffordernd.
Daniel stieg aus. Sie standen ganz nahe an der Felswand, die mit Moos und Tüpfelfarn bedeckt war, an manchen Stellen gluckerten kleine Rinnsale. Der Geruch vom Fels war kühl und säuerlich.
Der Mann hatte einen Metalldetektor, den er an Daniels Körper entlangführte.
»Sie haben eine weite Reise hinter sich«, sagte er freundlich und gab ihm seinen Pass zurück.
Der Kollege stellte Daniels Koffer, den er offensichtlich durchsucht hatte, wieder in den Bus und schloss die Klappe.
»Ja, ich bin heute morgen in Stockholm abgeflogen«, antwortete Daniel.
Einer der Männer beugte sich ins Auto, fuhr mit dem Metalldetektor über den Rücksitz und zeigte dann mit einer Geste, dass er fertig war.
»Sie können wieder einsteigen«, sagte der Fahrer und nickte Daniel zu.
Der Mann salutierte, die Schranke ging auf, und sie fuhren weiter.
Daniel beugte sich vor, um dem Fahrer eine Frage zu stellen, aber der kam ihm zuvor.
»Routinekontrolle. Schweizerische Gründlichkeit«, sagte er und ließ mit einem Knopfdruck die Scheibe wieder vor Daniels Nase zugleiten.
Durch das offene Seitenfenster sah er die moosige Felswand vorbeirasen, sie warf das Motorengeräusch zurück und verstärkte es.
Er rutsche auf dem Sitz hin und her und schloss die Augen. Die Kontrolle hatte ihn verschreckt. Er wusste, dass er nicht auf einer Vergnügungsreise war. Wenn Max sich nach so vielen Jahren wieder bei ihm meldete, ging es um etwas Wichtiges. Max brauchte ihn.
Die Erkenntnis beunruhigte ihn. Wie sollte er seinem Bruder helfen können? Max war, das musste er nach all den Jahren betrogener Hoffnung einsehen, nicht zu helfen.
Er tröstete sich damit, dass er mit dieser Reise immerhin seinen guten Willen zeigte. Er kam, wenn Max ihn rief. Er würde ihm zuhören, für ihn da sein. Und nach ein paar Stunden würde er wieder abreisen. Mehr als das würde bei diesem Besuch nicht herauskommen.
Der Bus machte eine Linkskurve. Daniel öffnete die Augen. Er sah Bergwiesen, Tannenwald und weiter weg ein Dorf und einen Kirchturm. In einer Gärtnerei arbeitete eine Frau gebückt in einem Meer von Dahlien. Sie richtete sich auf, als der Wagen näher kam, und winkte mit einem kleinen Spaten.
Der Fahrer bog in eine kleine Straße ein, die den Hügel hinaufführte. Sie fuhren durch Tannenwald, der Weg wurde steiler.
Kurz danach sah Daniel die Klinik, ein gewaltiges Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, mitten in einem Park. Der Fahrer fuhr bis zum Eingang, holte Daniels Koffer und öffnete ihm die Tür.
Die hereinströmende Luft war klar und von einer Schärfe, die seine Lungen vor Überraschung zittern ließ.
4 Max und Daniel waren eineiige Zwillinge, aber es hätte nicht viel gefehlt und ihr Geburtstag wäre nicht auf den gleichen Tag gefallen. Als ihre Mutter, eine achtunddreißigjährige Erstgebärende, sich nach zehn Stunden harter Geburtsarbeit endlich von dem einen Zwilling befreit hatte, war der andere, Max, immer noch drinnen und wollte da offenbar auch noch eine Weile bleiben. Es war spät am Abend, und die Hebamme, die allmählich auch müde war, seufzte und sagte zu der erschöpften Mutter: »Es sieht so aus, als müssten Sie zwei Geburtstagsfeste für diese Kinder ausrichten.«
Während Daniel gewaschen und gewogen wurde und dann brav in einem kleinen Bettchen einschlief, holte der Arzt die Saugglocke, die jedoch den widerspenstigen, sich entziehenden Bruder nicht zu fassen bekam, und sich stattdessen an den inneren Organen der Mutter festsaugte, die dadurch beinahe umgestülpt worden wäre wie ein Pullover. Als die Saugglocke schließlich da war, wo sie hingehörte, schien Max einzusehen, dass es ernst war, er fügte sich und machte den ersten von vielen Schnellstarts, mit denen er später seine Umgebung überraschen sollte.
»Jetzt haben wir ihn an der Angel …«, sagte der Arzt, aber noch ehe er seinen Satz beenden konnte, glitt der Fang ganz von selbst auf einer Rutschbahn aus Blut und Schleim dem Arzt in den Schoß.
Da war es fünf vor zwölf, und die Brüder konnten nun doch gemeinsam Geburtstag feiern.
Fünf vor zwölf. Wie sollte man das wohl deuten?
Dass Max auf seiner Einzigartigkeit bestand und um keinen Preis am gleichen Tag wie sein Bruder geboren werden wollte, um sich dann in letzter Minute doch umzubesinnen, weil er die Gemeinsamkeit der Individualität vorzog?
Oder war es eher ein Balancieren auf dem schmalen Grat, um Aufmerksamkeit zu wecken, wenn er mal wieder spät – aber nicht zu spät – zu einem Termin kam, Zug oder Flugzeug gerade noch erreichte und seine nervösen Freunde mit einem Lächeln fragte, was sie denn von einem, der fünf vor zwölf geboren worden war, erwarteten.
Die erste Zeit verbrachten die Jungen im Haus der Eltern in Göteborg. Der Vater war ein erfolgreicher Unternehmer in der Elektronikbranche, die Mutter hatte bis zur Geburt der Zwillinge etwas planlos diverse Fächer studiert.
Am Anfang waren die beiden Zwillinge ziemlich verschieden.
Daniel aß tüchtig, weinte selten und entwickelte sich entsprechend der Gewichtskurve.
Max war ein Spätentwickler, und als er im Alter von zwanzig Monaten immer noch kein Wort von sich gab und keinerlei Ansatz zeigte, sich fortzubewegen, machte seine Mutter sich Sorgen. Sie brachte die beiden Jungen zu einer bekannten Kinderärztin in ihrer Heimatstadt Uppsala. Nachdem die Ärztin die beiden Jungen zusammen beobachtet hatte, fand sie eine einfache Erklärung. Sobald Max den Blick auf eines der netten Spielsachen richtete, die die Ärztin im Raum verteilt hatte, machte Daniel sich auf seinen rundlichen Beinchen auf den Weg und brachte es ihm.
»Man sieht es ganz deutlich«, sagte sie zur Mutter der Zwillinge und deutete mit einem Stift auf die Jungen. »Max braucht gar nicht zu gehen, Daniel holt ihm alles. Spricht er auch für seinen Bruder?«
Die Mutter nickte und berichtete, dass Daniel auf fast gespenstische Weise zu wissen schien, was der Bruder wollte, und mit seinem kleinen, aber geschickt genutzten Wortschatz vermittelte. Er konnte sagen, ob Max Durst hatte, ob ihm heiß war oder wenn er die Windel gewechselt haben wollte.
Die Kinderärztin war besorgt über das symbiotische Verhältnis der Brüder und schlug vor, sie für eine Zeitlang zu trennen.
»Max hat keine natürliche Motivation, zu laufen oder zu sprechen, solange sein Bruder alles für ihn tut«, erklärte sie.
Die Mutter der Jungen wollte zunächst einer Trennung nicht zustimmen, sie würde für beide schmerzlich sein. Sie waren ja so eng miteinander verbunden. Aber sie hatte großes Vertrauen in die Ärztin, einer Autorität in Pädiatrie und Kinderpsychologie, und so willigte sie nach langen Diskussionen und Gesprächen mit dem Vater der Kinder, der das vernünftig fand, ein. Es wurde beschlossen, die Kinder den Sommer über zu trennen, da hatte der Vater Ferien und konnte sich zu Hause in Göteborg um Max kümmern, die Mutter würde Daniel mit zu ihren Eltern nach Uppsala nehmen. Die Ärztin sagte auch, dass Kinder sich im Sommer am schnellsten entwickeln und am offensten für Veränderungen sind.
In den ersten Tagen weinten beide Jungen verzweifelt. In der zweiten Woche wurde Daniel ruhiger. Er schien die Vorteile eines Einzelkinds zu erkennen und genoss die ungeteilte Aufmerksamkeit von Mutter und Großeltern.
Max hingegen brüllte weiter. Tag und Nacht. Der Vater, unerfahren in der Kinderbetreuung, klang in seinen Telefongesprächen nach Uppsala immer verzweifelter. Die Mutter schlug vor, das Experiment abzubrechen, und rief die Kinderärztin an, die sie jedoch zum Weitermachen überredete. Aber der Vater brauchte Unterstützung durch ein Kindermädchen.
Mitten im Sommer ein Kindermädchen zu finden war nicht so einfach. Und die Mutter wollte ihren Sohn natürlich nicht irgendjemandem anvertrauen. Eine schlampige, unreife Fünfzehnjährige, die unbedingt einen Sommerjob suchte, kam hier nicht in Frage.
»Ich will sehen, was ich tun kann«, sagte die Kinderärztin, als die Mutter ihr das Problem schilderte, und ein paar Tage später rief sie an und empfahl eine gewisse Anna Rupke. Sie war 32, ausgebildete Kinderkrankenschwester und spezialisiert auf Kinder mit psychischen Störungen. Ihr Interesse für das Seelenleben von Kindern war schnell gewachsen, so dass sie angefangen hatte, Psychologie und Pädagogik zu studieren, und gerade an ihrer Dissertation arbeitete. Die Kinderärztin kannte sie als Studentin, ihre Begabung und ihr Engagement hatten sie beeindruckt. Sie wohnte in Uppsala, aber wenn die Familie ihr eine Unterkunft besorgte, würde sie für den Sommer nach Göteborg ziehen und sich um Max kümmern.
Wenige Tage nach diesem Gespräch bezog Anna Rupke das Gästezimmer der Familie. Für den Vater war sie eine große Hilfe. Der jungen Frau schien das Kindergeschrei nichts auszumachen, sie las in aller Ruhe einen Forschungsbericht, während Max auf dem Boden saß und brüllte, dass die Wände wackelten. Ab und zu kam der Vater ins Kinderzimmer geschlichen und fragte, ob das wirklich normal sei. Vielleicht war der Junge ernstlich krank? Anna schüttelte mit einem wissenden Lächeln den Kopf.
Aber er musste doch hungrig sein? Er hatte den ganzen Tag noch nichts gegessen. Ohne den Blick zu heben, deutete Anna auf einen Keks, der ein paar Meter von dem Jungen entfernt auf einem Hocker lag. Max liebte diese Kekse. Der Vater widerstand dem Impuls, dem Jungen den Keks zu geben. Er ging zurück in sein Arbeitszimmer im ersten Stock, verfolgt vom Geschrei des Jungen. Irgendwann wurde es still. Er lief hinunter, weil er fürchtete, der Junge sei vor Erschöpfung oder Hunger zusammengebrochen.
Als er ins Kinderzimmer kam, sah er, wie sein Sohn sich halb rutschend, halb krabbelnd auf den Hocker zu bewegte, seinen konzentrierten und wütenden Blick auf den Keks gerichtet. Max erreichte den Hocker, und mit einer letzten Anstrengung zog er sich hoch und nahm sich den Keks. Er biss ein großes Stück ab, drehte sich mit vollem Mund um und lächelte triumphierend und so breit, dass die Hälfte wieder aus dem Mund fiel.
Anna Rupke warf dem Vater einen vielsagenden Blick zu und vertiefte sich dann wieder in ihre Lektüre.
Die folgende Woche war sehr intensiv. Mit Hilfe von listig verteilten Keksen durchlief Max in Rekordzeit die Krabbel-, Steh- und Laufphase.
In der folgenden Woche brachte Anna ihm das Sprechen bei. Zu Beginn kommunizierte Max wie gewohnt, er zeigte auf etwas und schrie. Aber statt aufzuspringen und die gewünschten Dinge zu holen, blieb Anna ruhig sitzen und las weiter ihr Buch. Erst wenn er das Ding beim Namen nannte, wurde er belohnt. Max verfügte nämlich über einen großen passiven Wortschatz und verstand fast erschreckend viel von dem, was man ihm sagte. Es war ihm bisher nur nicht in den Sinn gekommen, dass er selbst reden könnte.
Als der Sommer vorbei war, sollten die beiden Brüder wieder vereint werden.
Sie schienen sich nicht mehr zu erkennen.
Daniel benahm sich wie jedem fremden Kind gegenüber, schüchtern und abwartend.
Max schien seinen Bruder als Eindringling zu empfinden und verhielt sich aggressiv, wenn Daniel Spielsachen nahm, die er als sein privates Eigentum betrachtete. (Eine nicht sehr überraschende Reaktion, wenn man bedenkt, dass sein erstes Wort »mein« war und sein erstes Zweisilbenwort »haben!«.)
Wenn die Kinder aneinandergerieten, teilte die Familie sich sogleich in zwei Lager, und beide verteidigten »ihr« Kind. Auf der einen Seite die Mutter, die Großeltern und Daniel. Auf der anderen Seite der Vater, Anna Rupke und Max. Die Mutter fand, dass Anna ihren kleinen Daniel schlecht behandelte. Der Vater und Anna bewerteten das aggressive Benehmen von Max positiv und sahen es als Ausdruck der Befreiung vom Bruder.
Nach der missglückten Wiedervereinigung wurden die Kinder nach Rücksprache mit der Kinderärztin wieder getrennt.
Anna Rupke wollte nun eigentlich die Arbeit an ihrer Dissertation wieder aufnehmen, aber sie beschloss, weiter als Kindermädchen für Max zu arbeiten. Sie bezeichnete sich allerdings als Pädagogin. Der Vater des Jungen war ihr zutiefst dankbar, er war sich bewusst, dass sie ihm zuliebe auf eine Karriere verzichtete. Aber Anna versicherte, dass Max ein so interessantes Kind sei und daher eher von Nutzen für ihre Forschungsarbeit.
Die Mutter nahm Daniel wieder mit zu ihren Eltern nach Uppsala, und so lebten die Eltern weiterhin getrennt, jeder mit seinem Zwilling. Sie verständigten sich täglich per Telefon über die Fortschritte der Jungen.
Zu Weihnachten sollte die Familie wieder zusammengeführt werden. Aber der Riss war jetzt so tief, dass er nicht mehr gekittet werden konnte. Während der langen Trennung hatte der Vater nämlich ein Verhältnis mit dem Kindermädchen seines Sohns begonnen.
Er wusste selbst nicht so recht, wie es dazu kommen konnte. Angefangen hatte es damit, dass er beeindrucktwar. Von Annas Umgang mit Max, ihrer Sicherheit, Ruhe und Intelligenz. Zufrieden stellte er fest, dass sie genau wie er eine pragmatische Forschernatur war, kein wankelmütiger Gefühlsmensch wie die Mutter der Kinder.
Und ganz unmerklich ging das Beeindrucktsein über in Anziehung. Annas hohe slawische Wangenknochen, der Duft, den sie im Badezimmer hinterließ, die Art, wie sie nachdenklich ihre Halskette drehte und geräuschvoll gähnte, bevor sie zu Bett ging.
Vielleicht ist es ganz normal, dass ein Mann angezogen wird von der Frau, die mit ihm in einem Haus wohnt und sich um sein Kind kümmert.
Die Mutter hatte sich inzwischen eine eigene Existenz in Uppsala aufgebaut. Ihre Mutter kümmerte sich um Daniel, und sie selbst arbeitete ein paar Stunden als Sekretärin am Institut für klassische Sprachen, wo ihr Vater immer noch Professor war.
Ein Jahr später wurde das Arrangement besiegelt. Die Eltern trennten sich, der Vater heiratete Anna, die Mutter richtete sich in einer Wohnung zehn Minuten vom Haus der Eltern entfernt ein.
Die Zwillinge wuchsen also getrennt voneinander auf und trafen sich nur einmal im Jahr am 28. Oktober, um gemeinsam ihren Geburtstag zu feiern.
Vor diesen Geburtstagstreffen waren alle gespannt. Waren sich die Brüder immer noch ähnlich? Was hatten sie gemeinsam? Was war anders?
Es wurde deutlich, dass die Jungen charakterlich sehr verschieden waren. Max war umgänglich, forsch und redete viel. Daniel war zurückgezogen und vorsichtig. Inzwischen konnte sich niemand mehr vorstellen, dass Max einmal völlig abhängig von seinem Bruder gewesen war.
Auch wenn sie vom Charakter her immer unterschiedlicher wurden, äußerlich ähnelten sie sich immer mehr. Max, der zu Beginn kleiner und dünner als sein Bruder war, wuchs schnell, und im Alter von drei Jahren gab es, was Größe und Gewicht anging, keinen Unterschied mehr. Auch die Ähnlichkeit der Gesichter trat deutlicher hervor, nachdem Daniel seinen rosigen Babyspeck verloren hatte, und ihre Stimmen zeigten die gleiche angenehm weiche Tonlage. Als die Jungen sich an ihrem siebten Geburtstag trafen, stellten sie mit einer Mischung aus Begeisterung und Schreck fest, dass sie geradewegs in ihr Spiegelbild schauten.
Wenn sich die beiden Lager Max-Vater-Anna und Daniel-Mutter-Großeltern einmal im Jahr zum Geburtstag der Zwillinge trafen, wurden alle möglichen Gefühle aufgerührt. Für die Großeltern war der Vater ein Verräter und Ehebrecher. Der Mutter gefiel nicht, wie Anna ihren Sohn erzog. Anna, die meinte Expertin auf diesem Gebiet zu sein, wollte sich von einer Laiin nicht zurechtweisen lassen. Und der Vater der Jungen war verwirrt, weil er seinen Sohn plötzlich in doppelter Ausführung vor sich hatte.
Während die Erwachsenen diskutierten und stritten, liefen die Jungen in den Garten, in den Keller oder an andere spannende Orte. Sie wollten zusammen sein, waren neugierig und erwartungsvoll. Sie stritten sich, gingen auseinander und kamen wieder zusammen. Sie balgten sich, lachten, weinten und trösteten sich gegenseitig. Während dieses einen intensiven Tages waren sie so heftigen Gefühlsregungen ausgesetzt, dass sie die folgenden Wochen ganz erschöpft waren und oft hohes Fieber bekamen.
Trotz aller Meinungsverschiedenheiten, in einem waren die Erwachsenen sich einig: ein Treffen pro Jahr genügte.
5 Daniel betrat eine Halle, die eher der Lobby eines eleganten Hotels glich als der Rezeption eines Sanatoriums.
Eine junge Frau in einem hellblauen, gut geschnittenen Kostüm und Schuhen mit niedrigen Absätzen empfing ihn. Ihre Kleidung, die aufrechte Haltung und das Lächeln ließen an eine Stewardess denken. Und genauso stellte sie sich auch vor, als »Hostess«.
Sie schien sofort zu wissen, wer Daniel war und wen er besuchen wollte. Sie bat ihn, seinen Namen in ein großes Buch zu schreiben, und führte ihn dann zu einer Sitzgruppe neben einem prachtvollen offenen Kamin mit Jugendstilornamenten. Über dem Kamin hingen zwei alte überkreuzte Skier, daneben zwei ausgestopfte Tierköpfe: ein Steinbock mit riesigen, geriffelten Hörnern und Bart, und ein Fuchs mit hochgezogener Oberlippe über den scharfen Zähnen.
»Ihr Bruder kommt sofort, ich werde ihm mitteilen, dass Sie da sind. Mein Kollege trägt Ihr Gepäck ins Gästezimmer.«
Daniel wollte sich gerade setzen, als ein blonder Mann in kurzärmeligem Stewardhemd auftauchte und mit seinem Koffer verschwand.
»Aber ich möchte nicht hierbleiben. Ich will gleich weiter in ein Hotel«, protestierte Daniel. »Kann mein Koffer nicht ein paar Stunden hierbleiben?«
Der Mann blieb stehen und drehte sich um.
»In welches Hotel wollen Sie?«
»Ich weiß nicht so recht. In das nächstgelegene. Können Sie mir eines empfehlen?«
Die Frau und der Mann schauten sich besorgt an.
»Da hätten Sie noch einen weiten Weg«, sagte die Frau. »Und hier oben in den Bergen gibt es fast nur Kurhotels. Die haben ihre Stammgäste und sind Monate im Voraus ausgebucht.«
»Da unten ist doch ein Dorf. Gibt es da niemanden, der Zimmer vermietet?«, fragte Daniel.
»Wir raten unseren Besuchern, nicht im Dorf zu logieren«, sagte die Frau. »Hat Ihnen jemand eine Unterkunft angeboten?«
Sie lächelte immer noch, aber ihr Blick war eine Idee schärfer.
»Nein«, sagte Daniel. »Das war nur so ein Gedanke.«
Der Mann räusperte sich und sagte ruhig:
»Sollte Ihnen jemand ein Zimmer im Dorf anbieten, dann lehnen Sie bitte ab. Freundlich, aber bestimmt. Ich möchte Ihnen vorschlagen, in einem unserer Gästezimmer zu übernachten. Die meisten Besucher machen das. Sie können mehrere Tage bleiben, wir haben genug freie Zimmer.«
»Das hatte ich nicht geplant.«
»Das kostet Sie nichts. Die meisten Angehörigen kommen von weit her, und deshalb bieten wir ihnen an, ein paar Tage hier zu bleiben. Damit man ›landen‹ und auf normale Art miteinander umgehen kann. Waren Sie schon einmal in Himmelstal?«
»Nein.«
Für den Mann, der während des ganzen Gesprächs seinen Koffer in der Hand gehabt hatte, schien die Sache entschieden.
»Möchten Sie vielleicht Ihr Zimmer sehen und sich ein wenig frisch machen? Wir nehmen den Lift da drüben«, sagte er und ging über den dicken Teppich voraus.
Daniel folgte ihm. Vielleicht, dachte er im Lift nach oben, war es doch keine schlechte Idee, eine Nacht hier- zubleiben. Es war schon spät, und er hatte eigentlich keine Lust, noch ein Zimmer zu suchen.
Das Gästezimmer war klein, aber hell und angenehm eingerichtet. Auf einem weiß gestrichenen Tisch stand eine Vase mit frischen Blumen, und die Aussicht über das Tal und die entfernten Berggipfel entsprach genau dem, was ein Tourist in den Alpen erwartete.
Himmelstal. Ein schöner Name für einen schönen Ort, dachte Daniel.
Er wusch sich die Hände und zog ein frisches Hemd an. Dann legte er sich auf das Bett und ruhte sich ein paar Minuten aus. Es war ein modernes, sehr bequemes Bett, das merkte er gleich. Am liebsten wäre er liegen geblieben und hätte ein paar Stunden geschlafen, bevor er seinen Bruder traf. Aber die Hostess hatte Max schon von seinem Kommen unterrichtet. Schlafen konnte er später.
Im Lift zur Eingangshalle wusste er plötzlich, was so eigenartig an dem Gespräch da unten gewesen war. Er hatte es die ganze Zeit gespürt, als er mit dem Mann und der Hostess sprach, aber nicht wahrgenommen: Sie hatten verschiedene Sprachen gesprochen. Er hatte Deutsch gesprochen, weil er davon ausging, dass dies ihre Muttersprache war, und sie hatten ihm auf Englisch geantwortet.
Er war es so gewohnt, zwischen verschiedenen Sprachen zu wechseln, dass es ihm gar nicht aufgefallen war. Es war nur so ein Gefühl der Disharmonie gewesen, irgendwie holprig.
Daniel hatte sich schon immer für Sprachen interessiert. Als Kind hatte er viel Zeit bei seinem Großvater verbracht, der Sprachwissenschaftler war. Fast täglich aßen er und seine Mutter bei den Großeltern. Wenn die Mutter und die Großmutter zusammen in der Küche den Abwasch machten, ging Daniel mit dem Großvater in dessen großes, nach Tabak riechendes Arbeitszimmer.
Daniel saß am liebsten auf dem Boden und blätterte in Büchern mit Bildern von ägyptischen Grabfresken, griechischen Skulpturen und mittelalterlichen Stichen, dabei erzählte der Großvater von Sprachen, lebendigen Sprachen und toten Sprachen. Wie Sprachen miteinander verwandt sind, genau wie Menschen, und wie man den Ursprung der Wörter bis weit in die Vergangenheit verfolgen kann. Das fand Daniel besonders faszinierend. Er fragte den Großvater ständig, woher die Wörter stammten. Manchmal bekam er sofort eine Antwort, manchmal musste der Großvater in einem Buch auf seinem Schreibtisch nachschlagen.
Erstaunt stellte Daniel fest, dass die Wörter, die er so selbstverständlich verwendete, viel älter waren als er, als der Großvater, als das uralte Haus mit den knarrenden Holzfußböden. Sie waren weit durch Länder und Zeiten gereist und dann ganz kurz in Daniels kleinem Mund gelandet, wie ein Schmetterling in einem Blütenkelch. Und sie würden ihre Reise fortsetzen, wenn es ihn schon lange nicht mehr gab.
Die Begeisterung und Achtung vor der Sprache hatte er beibehalten. Auf dem Gymnasium hatte er den halbklassischen Zweig gewählt und dann Deutsch und Französisch studiert. Nach dem Studium arbeitete er als Dolmetscher am Europaparlament in Brüssel und Straßburg.
Es war stimulierend und aufregend, die Ansichten eines anderen Menschen in eine andere Sprache zu übertragen, Ansichten, die den eigenen oft total widersprachen. Wenn der zu übersetzende Vortrag gefühlsmäßig stark aufgeladen war, genügte die gesprochene Sprache nicht, dann musste er die Botschaft des Gesagten auch mit Gestik und Mimik unterstreichen. Er fühlte sich dann manchmal wie eine Kasperlepuppe, die ganz vom Wesen des anderen erfüllt war. Als ob seine eigene Seele davonschweben würde. Er hörte, wie seine Stimme sich veränderte und er Gesichtsmuskeln ins Spiel brachte, die er sonst nie einsetzte. »Aha«, dachte er dann fasziniert, »so fühlt es sich also an, ›du‹ zu sein!«
Am Schluss einer besonders lebhaften Diskussion gab es manchmal eine kleine Kluft, bis er wieder bei sich selbst ankam. Eine schwindelerregende Sekunde lang hatte er das Gefühl, überhaupt niemand zu sein.
Es kam häufig vor, dass man zwischen dem Gedolmetschten und ihm keinen Unterschied machte. Gesprächspartner der Gegenseite behandelten ihn dann kurz und abweisend, wie einen weiteren Gegner.
Das Umgekehrte kam allerdings auch vor: dass die Sympathie für eine gedolmetschte Person auf ihn abfärbte. Und so, vermutete er, hatte er das Interesse der Frau geweckt, die er später heiraten sollte.
Emma war Juristin, spezialisiert auf internationales Umweltrecht. Daniel sollte ein Gespräch zwischen ihr und einem deutschen Experten für Wasserrecht dolmetschen, einem eleganten, älteren Herrn mit einer starken erotischen Ausstrahlung. Während des Dolmetschens erlebte Daniel eine starke Verschmelzung mit dem Deutschen und wusste auf beinahe gespenstische Weise schon vorher, was dieser sagen würde.
Auch Emma schien sie als eine Person erlebt zu haben, denn als der Mann gegangen war, diskutierte sie weiter mit Daniel über Wasserrecht, als wäre er die ganze Zeit ihr Gesprächspartner gewesen und nicht dessen nachsprechender Schatten. Er musste sie immer wieder daran erinnern, dass er sich in Wasserfragen nicht auskannte. Aber das Gespräch war in Gang gekommen. Sie gingen zu anderen Themen über, setzten den Abend in einem kleinen italienischen Restaurant fort und gingen schließlich zusammen und ziemlich betrunken in ihr Hotelzimmer. Während sie sich liebten, nannte sie ihn ein paar Mal scherzhaft »mein Herr«, was ihn ein bisschen störte.
Auch nach der Heirat hatte Daniel sich nicht ganz von dem Gefühl freimachen können, dass seine Frau ihn mit einem anderen verwechselte und dass sie immer wieder enttäuscht war, wenn sie ihren Irrtum bemerkte.
Dann fand er heraus, dass sie ihn mit einem Biologen aus München betrog, und sie ließen sich scheiden.
Im Jahr nach der Scheidung geriet Daniel in eine seelische Krise. Er wusste nicht recht, warum. Über die Trennung war er erstaunlich schnell hinweggekommen und fand im Nachhinein, dass es eine kluge Entscheidung war. In seinem Beruf war er geschätzt, er verdiente gut und wohnte in einer modernen Wohnung mitten in Brüssel. Er hatte kurze Beziehungen mit Frauen, die sich auf ihre Karriere konzentrierten und an einer festen Beziehung ebenso wenig interessiert waren wie er. Eigentlich fehlte ihm nichts. Bis er eines Tages plötzlich einsah, dass sein Leben völlig leer und sinnlos war. Seine Beziehungen waren flüchtig wie Gas, und die Worte, die er bei seiner Arbeit aussprach, gehörten einem anderen. Wer war er eigentlich? Ja, eine Handpuppe, die ein paar Stunden pro Tag buckelte und dann in eine Ecke geworfen wurde. Er lebte nur, wenn er dolmetschte, und auch dieses Leben gehörte nicht ihm, es war geliehen.
Die Einsicht überfiel Daniel eines Morgens, als er auf dem Weg zur Arbeit war und an einem Kiosk eine Zeitung kaufen wollte. Er blieb wie versteinert mit der Münze in der Hand stehen. Schaute auf die Münze, seine Hand, dann seinen Körper hinab. Der Zeitungsverkäufer fragte ihn, welche Zeitung er haben wolle, aber er konnte nicht antworten. Er steckte das Geld wieder in die Tasche und ließ sich auf eine Bank in der Nähe fallen, unendlich müde. Er hatte an diesem Tag einen wichtigen Auftrag, aber er spürte, dass er außer Stande war, ihn auszuführen.
Zwei Monate lang war er krank geschrieben. Laut Attest wegen einer Depression. Aber er selbst wusste, dass es sich um etwas anderes handelte. Eine fürchterliche Scharfsichtigkeit. Eine Offenbarung von fast religiöser Natur. Wie die Erleuchteten das Licht sehen, hatte er das Dunkel gesehen, und das hatte in ihm genau das Gefühl von Wahrheit ausgelöst, das diese Menschen beschrieben. Der trügerische Vorhang des Daseins war beiseitegerissen worden, und er hatte sich selbst und sein Leben so gesehen, wie es war. Dieses Erlebnis war ein richtiger Schock, aber er war dem Schicksal zutiefst dankbar, und ihn schauderte beim Gedanken, dass er ebenso gut im Wahn hätte weiterleben können.
Daniel hatte seine Stelle als Dolmetscher gekündigt, war zurück in seine Heimatstadt Uppsala gezogen und hatte eine Stelle als Aushilfslehrer für Sprachen an einem Gymnasium gefunden. Die Arbeit war schlechter bezahlt als seine bisherige, aber damit musste er sich abfinden, solange er noch nicht wusste, was er aus seinem Leben machen wollte.
In der Freizeit spielte er Computerspiele. World of Warcraft und Grand Theft Auto. Am Anfang als Zeitvertreib, später mit immer größerem Engagement. Je grauer sein echtes Leben war, umso lebendiger erschien ihm die fiktive Welt. Die Klassenzimmer und das Lehrerzimmer waren Warteräume, in denen er unzählige Stunden verbrachte und wie schlafwandlerisch Verbformen und kollegialen Smalltalk herunterratterte. Nach der Arbeit zog er die Rollos in seiner kleinen Einzimmerwohnung herunter, schaltete den Computer an und stürzte sich in das Leben, in dem sein Puls vor Erregung pochte und sein Gehirn vor listigen Einfällen nur so blitzte. Wenn er dann im Morgen
6 Als Daniel aus dem Lift trat, kam Max ihm entgegen.
Vor genau diesem Moment hatte er sich gefürchtet. Dass er sich selbst entgegenkam, sich in die eigenen Augen schaute, die eigenen Gesichtszüge sah.
Zu seiner großen Erleichterung war es dieses Mal ganz anders. Der Mann, der ihm unter dem Kristallleuchter entgegenlief, kam ihm bekannt vor, aber irgendwie entfernt und flüchtig.
Daniel fuhr sich mit der Hand durch den Bart, wie um sich zu vergewissern, dass er noch da war. Dieses weiche, aber effektive Visier schützte sein empfindliches Gesicht.
Max war braungebrannt, lässig in Bermudashorts, Polohemd und Sandalen wie ein Tourist gekleidet. Seine Haare waren kurz geschoren, sein Lächeln war so breit und strahlend, dass Daniel sofort wusste, dass Max sich am manischen Ende der Skala befand, auf der seine Psyche sich ständig auf und ab bewegte. Diesen Eindruck hatte er ja auch durch seinen Brief bekommen, aber der war vor einem Monat geschrieben worden, und Max' Laune konnte sich schnell ändern. Innerhalb von Stunden konnte sie von Euphorie in nachtschwarze Verzweiflung oder aggressive Wut umschlagen. Aber nun war er bester Laune. Solange Daniel keine Verantwortung für die Folgen übernehmen musste, war das auf jeden Fall besser.
Max' Umarmung war herzlich, beinahe leidenschaftlich, es folgte ein männlicher Schulterschlag und spielerisches Schattenboxen.
»Bruderherz! Was! Dass du da bist! Du bist gekommen! Yesss!«
Er lachte laut und schloss seine Fäuste zu einer Siegesgeste, blickte zur Decke, als danke er einem unsichtbaren Gott. Daniel lächelte vorsichtig zurück.
»Das war doch klar, dass ich komme«, sagte er. »Nett, dich zu sehen. Es scheint dir gutzugehen.«
»Die Lage ist stabil. Und selbst? Mein Gott, hast du immer noch diesen albernen Bart! Der ist ja noch schlimmer als früher. Wundert mich, dass sie dich ins Flugzeug gelassen haben. Du siehst aus wie ein Taliban.«
Max packte Daniels Bart und zog scherzhaft daran.
»Mir gefällt er«, sagte Daniel und trat einen Schritt zurück.
»Wirklich?« Max lachte. »Und diese Brille! Gibt es auch Secondhand-Läden für Brillengestelle? Oder wo hast du die gefunden? Warum hast du denn keine Kontaktlinsen wie alle anderen vernünftigen Menschen?«
»Ich finde es unangenehm. Sich Dinge in die Augen fummeln.«
»Dummes Zeug. Aber es ist ein Gefummel, das stimmt. Ich will mich schon seit Jahren lasern lassen, bin nur noch nicht dazu gekommen. Man muss mit zwei Wochen für die Heilung rechnen. Wann hätte ich dafür Zeit? Okay, jetzt gehen wir erst zu mir und deponieren deine Sachen, dann essen wir im Restaurant. Sie haben heute Forelle auf der Karte, ich habe schon geschaut. Wo ist dein Gepäck?«
»Das Personal hat es ins Gästezimmer gebracht.«
»Gästezimmer? Was soll das denn! Kommt nicht in Frage! Du bist mein Gast und wohnst natürlich bei mir.«
»Wo wohnst du?«
»Ich habe eine kleine Hütte ganz in der Nähe. Einfach, aber gemütlich. Gästezimmer! Ist das der Schlüssel?«
Max nahm ihm den Zimmerschlüssel mit dem Messinganhänger aus der Hand und verschwand Richtung Lift.
»Warte hier«, befahl er und drückte ungeduldig auf den Liftknopf.
Nachdem er ein paar Sekunden gewartet hatte, gab er auf und nahm die Treppe, immer zwei Stufen auf einmal.
Daniel blieb bestürzt und verwirrt stehen. Blitzschnell war er überrumpelt, dominiert, überfahren worden.
Ein paar Minuten später kam Max mit seinem Koffer zurück und ging mit raschen, zielsicheren Schritten durch die Eingangstür, die protzige Treppe hinab und weiter durch den Park. Daniel trabte folgsam hinterher. Was hätte er sonst tun sollen?
»Scheint prima hier zu sein«, begann er eine Konversation, als er den Bruder eingeholt hatte. »Angenehmes Personal. Keine weißen Kittel.«
»Nein, wozu weiße Kittel? Noch ist niemand von einem weißen Kittel geheilt worden, soweit ich weiß. Mir gefallen die Kostüme der Hostessen. Die haben Stil. Und sie sind sexy. Findest du nicht?«
»Doch, vielleicht.«
Oberhalb des Parks lagen mehrere Reihen von kleinen Hütten aus grobem Holz im Alpenstil. Max öffnete eine davon und bat Daniel, einzutreten.
»So wohne ich. Und?«
Die Hütte bestand aus einem einzigen Raum und war mit rustikalen Holzmöbeln eingerichtet. Auf den Bänken an den Wänden lagen Kissen mit folkloristischen Motiven. Es gab einen offenen Kamin, eine Kochecke und einen Schlafalkoven mit einem Vorhang davor.
»Man kann hier eleganter wohnen, wenn man will, aber mir gefällt das rustikal Einfache«, sagte Max und stellte Daniels Koffer mit einem Knall ab. »Du kannst da auf der Bank schlafen. Das geht doch für eine Nacht, oder?«
»Wohnst du allein hier?«, fragte Daniel erstaunt.
»Klar. Ich will nicht mit jemandem zusammen wohnen. Außer mit dir, natürlich. Nein, ich möchte für mich sein. Das ist der Vorteil hier. Man hat die Wahl. Jetzt gehen wir essen. Ich hoffe, du hast nicht in diesem schrecklichen Gasthaus gegessen, wo der Fahrer immer hält.«
»Nein, wir haben nur einen Kaffee getrunken.«
»Gut, dann bist du sicher hungrig und weißt eine frisch gefangene Forelle und einen kühlen Riesling zu schätzen. Oder was immer du möchtest. Aber ich empfehle die Forelle.«
Vor dem Essen wollte Max seinem Bruder die Anlage zeigen.
Die Klinik war größer, als Daniel zunächst gedacht hatte. Außer dem alten Hauptgebäude gab es noch einige mehrstöckige, moderne Gebäude mit Glasfassaden. Das Ganze war eingebettet in den schönen Park, in dem sich Menschen mit leichtem Schritt bewegten. Die meisten trugen Freizeitkleidung und sahen aus wie gut erholte Touristen und nicht wie Patienten einer Reha-Klinik. Daniel vermutete, dass ihre Probleme, ähnlich wie bei seinem Bruder, psychischer Natur waren.
»Spielst du eigentlich Tennis?«, fragte Max. »Wir können einen Platz buchen und morgen früh eine Runde spielen.«
»Nein danke.«
»Ansonsten sind hier die Sportgebäude. Turnhalle. Tischtennis. Und ein richtig gutes Fitness-Studio.«
Max zeigte auf ein großes Gebäude, das sie gerade umrundeten. Auf der Rückseite war ein großer Swimmingpool. Ein paar Patienten lagen auf weißen Liegen und genossen die Nachmittagssonne. Daniel beschattete die Augen mit der Hand und betrachtete sie erstaunt.
»Du hast von einer Reha-Klinik geschrieben, darunter habe ich mir etwas völlig anderes vorgestellt«, sagte er. »Mehr wie ein Krankenhaus.«
Max nickte.
»Es ist eine Privatklinik, das hast du sicher bemerkt. Für die, die es sich leisten können.«
»Was kostet der Aufenthalt hier?«
Max verzog das Gesicht zu einer Grimasse und schüttelte den Kopf, als wäre es allzu schmerzlich, darüber zu reden.
»Viel zu viel für meine Brieftasche. Noch schaffe ich es. Aber wenn ich nicht bald gesund geschrieben werde, wird es eng. Deswegen benehme ich mich so normal wie nur möglich. Ich halte Abstand zu den schlimmsten Deppen, flirte mit dem weiblichen Personal und plaudere angeregt mit den Ärzten. Hinter meinem Rücken habe ich sie schon sagen hören: ›Was macht der denn noch hier? Er wirkt ja so gesund wie ein Fisch im Wasser.‹ Es besteht natürlich die Gefahr, dass sie einen hierbehalten, weil sie auf das Geld scharf sind. Ich habe zu meiner Ärztin, Gisela Obermann, gesagt, dass meine finanziellen Möglichkeiten nahezu erschöpft sind und ich ihr dankbar wäre, wenn sie mich bald entlassen würde.«
Sie gingen durch den Park. Die Luft war kühl, und es roch nach dem Tannenwald weiter unten. Vom Tennisplatz hörte man das Aufschlagen der Bälle.
»Was für eine Behandlung bekommst du denn?«, fragte Daniel.
»Gar keine.«
»Aber deine üblichen Medikamente nimmst du doch?«
Ein Mann kam ihnen entgegen. Er sah aus, als wolle er mit ihnen sprechen, aber Max legte den Arm um Daniels Schultern und führte ihn schnell auf einen anderen Weg.
»Als ich herkam, setzte Gisela Obermann alle Medikamente ab. Sie wollte sehen, wie ich ohne Medikamente bin. Sie will immer wissen, wie die Patienten ohne Medikamente sind.«
Er blieb vor Daniel stehen, legte ihm eine Hand auf die Schulter und fuhr in heftigem Ton fort, jede Silbe sollte bei ihm ankommen:
»Einen unter Medikamenten stehenden Patienten zu untersuchen ist für einen Psychiater ungefähr so, als würde ein Allgemeinmediziner einen Patienten in Kleidern untersuchen. Der Patient könnte einen Hautausschlag oder einen Tumor haben, ohne dass der Arzt etwas merkt. Die wichtigste Aufgabe der Psychopharmaka ist es, zu verbergen. Sie heilen nicht, töten auch nicht wie Penicillin bösartige Bakterien. Sie legen sich nur wie Kleider schützend über die Krankheit.«
Daniel nickte zustimmend und trat einen Schritt zurück, um den Speicheltropfen auszuweichen, die Max in seinem Eifer versprühte.
»Oder wie eine Sprengmatte, du weißt schon«, fuhr der Bruder fort. »Sie dämpfen eine Explosion und sorgen dafür, dass Steine und Felsbrocken nicht umherfliegen und Schaden anrichten. Aber …«
Max schob den Kopf vor, schaute Daniel streng an und senkte die Stimme zu einem intensiven Flüstern:
»Was für Schäden richten diese unterdrückten Explosionen im Innern an!«
Er machte eine Pause, schaute Daniel in die Augen und ging dann weiter.
Ein junger Mann in Trainingskleidung joggte auf sie zu, sie mussten einen Schritt beiseitetreten, um ihn vorbeizulassen.
»Und wie findet deine Ärztin dich ohne Medikamente?«, fragte Daniel vorsichtig.
»Gut, nehme ich an. Als wir uns das letzte Mal trafen, sah sie keinen Grund, mir etwas zu verschreiben.«
»Wirklich?«
Daniel war erstaunt. Soviel er wusste, nahm Max seit dem fünfzehnten oder sechzehnten Lebensjahr regelmäßig Medikamente. Die er zeitweise abgesetzt hatte, das stimmte, aber das hatten alle, auch er, als großen Fehler erkannt. Wenn er seine Medikamente regelmäßig nahm, ging es ihm richtig gut, und er konnte ein einigermaßen normales Leben führen. Und jetzt stand er hier und behauptete, seine Ärztin habe alles abgesetzt. Merkwürdig.
Max lachte.
»Jetzt guck nicht so erschrocken. Kennst du das Phänomen der Selbstheilung nicht? Darauf vertraut man hier. Auf die heilende Kraft der Natur.«
Max zeigte auf die Almwiesen, die Glasfassaden und die Berge.
»Gutes und nahrhaftes Essen. Saubere Luft. Ruhe. Alte bewährte Heilmittel, die in Vergessenheit geraten sind, seit es all die chemischen Präparate gibt. Viele glauben, es braucht unglaublich viel, um einem Menschen zu helfen oder ihn umzuhauen. Als seien wir Riesen aus Stahl, kaum zu stürzen, aber genauso schwer wieder aufzurichten, wenn wir erst einmal umgefallen sind. Aber denk doch nur, was ein bisschen Stress mit einem Menschen machen kann. Viele hier in der Klinik leiden an einem Erschöpfungssyndrom. Kennst du das? Ich sah einmal eine Frau, die immer nur vor sich hin starrte und nicht wusste, wie sie hieß. Man musste sie füttern, weil sie keine Gabel mehr halten konnte. Man hätte annehmen können, dass ein schreckliches Trauma dazu geführt hatte, Kriegserlebnisse, Folter. Aber nein. Nur ganz normaler Stress. Zu große Erwartungen. Druck von allen Seiten. Es ist eigenartig, dass einen das so fertigmachen kann. Aber wir Menschen sind ja eigentlich ziemlich einfach konstruiert. Es braucht nicht viel, und wir fallen auseinander. Und es braucht auch nicht sehr viel, um uns wieder zusammenzufügen. Zeit. Ruhe. Eine angenehme, natürliche Umgebung. Einfache, kleine Dinge.«
Daniel nickte nachdenklich.
»Bei dir ist es also … Selbstheilung?«
Max wandte sich ihm mit einem strahlenden Lächeln zu.
»Laut Frau Obermann bin ich jedenfalls auf einem guten Weg.«
»Das freut mich zu hören.«
Max nickte kurz und schlug die Hände mit einem lauten Klatschen zusammen, als Zeichen dafür, dass dieses Gespräch zu Ende war.
»Aber jetzt müssen wir etwas essen.«
7 Zu Daniels großer Verwunderung beherbergte die Klinik ein Restaurant, das aussah wie jedes andere gepflegte Restaurant auf der Welt. Es lag im zweiten Stock des Haupthauses, hatte Stuckdecken und Orientteppiche. Die Tische waren weiß eingedeckt, mit langstieligen Gläsern und Leinenservietten. Außer einem älteren Mann, der allein in einer Ecke saß, war niemand im Lokal.
»Ist das für die Patienten?«, rief Daniel erstaunt aus, Max steuerte auf einen Tisch zu und setzte sich.
»Was für Patienten? Hier gibt es keine Patienten. Wir sind Gäste, die teuer dafür bezahlen, sich hier eine Weile auszuruhen. Anständiges Essen in angenehmer Umgebung ist wohl das mindeste, was man erwarten kann. Wir nehmen die Forelle.«
Max wedelte der Bedienung abwehrend zu, als sie ihnen eine Speisekarte reichen wollte.
»Und eine Flasche Gobelsburger. Kalt.«
Die Bedienung lächelte ihm freundlich zu und entfernte sich.
»Und wie geht es dir, Daniel, oder habe ich dich das schon gefragt?«, sagte Max.
»Mir geht es gut. Ich wohne wieder in Uppsala, wie du weißt. Das EU-Leben wurde mir zu stressig. Am Ende ging es mir richtig schlecht. Und dann noch die Scheidung. Du weißt schon.«
»Hier kommt der Wein!«
Max probierte den kleinen Schluck, den die Bedienung ihm eingeschenkt hatte, und nickte zustimmend.
»Probier den mal, Daniel. Ich trinke fast jeden Tag ein, zwei Gläser davon.«
Daniel nippte am Wein, der frisch und trocken war, wirklich sehr gut.
»Es wurde alles zu viel«, sagte er jetzt.
»Zu viel? Hast du heute schon etwas getrunken?«, sagte Max erstaunt.
»Nein, nein. Zu viel … Vergiss es. Es ist ein wunderbarer Wein. Frisch, erquickend.«
»Erquickend. Das ist genau das Wort. Du hast immer so tolle Wörter für alles, Daniel. Aber du bist ja auch Experte für Sprachen.«
»Nein, nein. Ich bin Dolmetscher. Oder war.«
»Aber Dolmetscher sind doch Sprachexperten!«
Daniel zuckte verlegen die Schultern.
»Ich lerne leicht Sprachen«, gab er zu. »Aber eigentlich bin ich bloß ein Papagei.«
»Papagei? Ja, da ist etwas dran. Du ahmst gerne Leute nach, Daniel. Und gleichzeitig hast du schreckliche Angst, wie die anderen zu sein. Wie ich zum Beispiel. Warum hast du diese Angst?«
»Ich habe keine Angst. Ich versteh nicht, warum du das sagst«, protestierte Daniel aufgeregter, als er eigentlich wollte.
»Nun ja, lass uns nicht streiten. Die kleine Marike bekommt sonst Angst, glaube ich.«
Er lächelte der Bedienung zu, die mit zwei gefüllten Tellern neben ihrem Tisch stand.
»Du kannst servieren, Marike. Er sieht gefährlich aus, aber er beißt nicht.«
Die Forelle war im Ganzen gebraten und wurde mit neuen Kartoffeln, geschmolzener Butter und Zitrone serviert.
»Süß, die Kleine, nicht wahr?«, sagte Max, als die Bedienung sich ein paar Schritte entfernt hatte. Sie war bestimmt über vierzig und wirklich keine Kleine mehr.
»Nicht im üblichen Sinn«, fügte er hinzu. »Aber sie hat etwas. Hast du gesehen, was für einen breiten Hintern sie hat? Wie alle Frauen, die hier aus der Gegend kommen. Du siehst es einer Frau sofort an, ob sie aus den Bergen kommt oder zugezogen ist. Also ich rede von denen, die seit Generationen hier leben. Sie haben alle einen Überschuss an Unterhautfett, besonders konzentriert auf Hintern und Hüften. Die Männer sind auch korpulent, aber an den Frauen sieht man es deutlicher. Weiß du, warum das so ist?«
»Dass man es bei den Frauen deutlicher sieht? Weil man sie lieber anschaut als die Männer, nehme ich an«, sagte Daniel.
»Das meine ich nicht. Ich frage mich, warum sind die Menschen hier oben in den Bergen fetter als im Flachland? In allen Bergregionen der Welt ist das so. Aber nicht nur da. Inselbewohner, in der Südsee zum Beispiel, oder Menschen, die tief im südamerikanischen Dschungel leben, sind stämmig und fett. Während Völker der Ebene, die Massai in Ostafrika zum Beispiel, groß und schlank sind. Warum? Also«, sagte Max und zeigte mit seiner Gabel auf Daniel, »wenn eine Hungersnot kommt, können die Völker der Ebene in andere Gegenden ausweichen, um Nahrung zu finden. Die langbeinigen, beweglichen überleben, während die plumpen Fettklöße auf ihren dicken Hintern sitzen bleiben und verhungern. Isoliert auf einer Insel, im dichten Dschungel oder einem eingeschneiten Alpental nutzen dir die langen Beine nichts. Du musst bleiben, wo du bist, und ausharren, bis die Zeiten wieder besser werden. Wenn man da eine zusätzliche Fettschicht hat, überlebt man Hungerzeiten besser.«
Daniel nickte.
»Klingt vernünftig. Wo wir von Hunger reden. Ich war wirklich hungrig, und diese Forelle ist ausgezeichnet. Scheint total frisch zu sein. Ist sie hier in der Gegend gefangen worden?«
»Die Forelle? Ja klar. In der Stromschnelle da drüben. Vielleicht habe sogar ich sie gefangen.«
»Du?«
»Oder jemand anders. Ich fische mehr, als ich essen kann, und dann gebe ich die Fische im Restaurant ab.«
Die Bedienung kam wieder an ihrem Tisch vorbei, die Hände voller Geschirr. Max streckte eine Hand aus und klatschte ihr leicht auf den Po.
»Das war wirklich unnötig«, sagte Daniel vorwurfsvoll.
Max lachte.
»Ein paar Verrücktheiten kann ein Verrückter sich erlauben. Man muss schließlich die Erwartungen erfüllen. Aber man muss wissen, wo die Grenzen sind. Sonst sind sie sofort mit Zwangsjacke und Spanngurten hier, und dann tauscht man das Luxusleben gegen die Folterkammer im Keller.«
»Aber warum bist du eigentlich hier, Max? Es scheint dir ausgezeichnet zu gehen.«
Max' scherzhaftes Lächeln verschwand. Er streckte sich und sagte ernst:
»Ich arbeite jetzt in Italien, wie du vielleicht weißt. Olivenöl.«
»Nein, das habe ich nicht gewusst«, sagte Daniel überrascht.
»Das ist eine harte Branche. Besonders wenn man Ausländer ist. Ich habe es ziemlich weit gebracht, das muss ich schon sagen, aber der Erfolg hat seinen Preis. Da hat man keine Vierzig-Stunden-Woche. In letzter Zeit habe ich eigentlich Tag und Nacht gearbeitet.«
»Oh«, sagte Daniel leise. Er wusste, was es bedeutete, wenn Max Tag und Nacht arbeitete.
»Ich bin gegen die Wand gelaufen, wie man so sagt. Das gilt für die meisten hier in der Klinik. Das Arbeitsklima für Leute in Spitzenpositionen ist heutzutage unmenschlich. Und da meine ich nicht Schweden, das ist ein Kindergarten, verglichen mit dem restlichen Europa. Hier hält es niemand sonderlich lang auf einem Chefposten aus. Darüber redet man nicht laut, aber die meisten klappen irgendwann zusammen. Das gehört zum Konzept. Wir sind wie Formel-1-Wagen, müssen regelmäßig in die Box, um Reifen zu wechseln und Brennstoff nachzufüllen. Dann können wir weiterfahren.«
Max machte eine Drehbewegung mit dem Finger und freute sich über seinen gelungenen Vergleich.
»Das hier ist also die Box?«, sagte Daniel und sah sich im Restaurant um, wo sie jetzt die einzigen Gäste waren.
»Jawoll. Himmelstal ist eine Box. Vielleicht die beste in ganz Europa. Und jetzt genehmigen wir uns einen Kaffee mit Kognak.« Max schlug mit der Handfläche auf den Tisch. »Aber nicht hier«, fügte er hinzu. »Ich kenne ein nettes Lokal im Dorf. Komm.«
Er knäulte die Serviette zusammen und stand auf.
Daniel schaute sich nach der Bedienung um. Er wollte das Essen bezahlen, wusste jedoch nicht, wie es hier vor sich ging.
»Im Dorf?«, sagte Daniel. »Aber kannst du die Klinik so einfach verlassen?«
Max lachte.
»Natürlich. Das ist der Witz an Himmelstal. Schreib's auf mich, Schatz«, rief er der unsichtbaren Bedienung zu und schritt forsch auf den Ausgang zu.
8 Moselwein. Kalt, köstlich, wie aus einer Quelle tief in der Erde.
Gisela Obermann hätte lieber aus ihren geerbten böhmischen Kristallgläsern getrunken als aus den langweiligen Gläsern aus Massenproduktion, die es in der Personalwohnung gab. Aber sie hatte ihre Gläser einem wohltätigen Verein für einen Flohmarkt geschenkt. Sie hatte alles verschenkt, als sie das Angebot bekam, in Himmelstal zu arbeiten. Sie hatte sich von ihrer schönen Wohnung getrennt und eine lange, destruktive Beziehung beendet. Sie hatte nur ein paar Kleidungsstücke von guter Qualität behalten, ein wenig Fachliteratur und Schneeflöckchen, ihre Katze.
Gisela legte sich aufs Bett, kuschelte sich an die langhaarige Katze und sog deren schwachen, sauberen Duft ein. Im Gegensatz zu Hunden rochen Katzen immer gut.
Die Katze schnurrte, das weiße Fell vibrierte weich und leicht an ihrem Gesicht.
Das Fenster war angelehnt. Draußen sang eine Amsel. Sie hörte Stimmen und das Geräusch von Metall auf Steinplatten. Kurze Zeit später roch sie brennende Grillkohle. Schon wieder ein Personalfest. Sie hatte nicht vor, hinzugehen.
Sie schloss die Augen, das weiche Fell der Katze streichelte ihre Wange, und sie stellte sich vor, es sei Doktor Kalpaks Hand. Auf einem Personalfest würde sie Doktor Kalpak nicht treffen, er nahm nie daran teil. Sie erinnerte sich noch genau, wie seine Hand sich angefühlt hatte, als sie neu in der Klinik war und ihn begrüßte. Schmal und braun, und mit den längsten Fingern, die sie je gesehen hatte. Sie sah nicht aus wie eine Hand, eher wie ein eigenständiges Wesen. Ein Tier. Ein flinkes, geschmeidiges, seidiges Tier. Vielleicht ein Iltis.
Sein singender Akzent passte gut hier in die Berge, weich und aufsteigend, wie die Österreicher oder die Norweger. Aber seine wirkliche Sprache waren die gestikulierenden Hände, wenn man sie sah, hörte man fast nicht mehr, was er sagte.
Gisela Obermann hatte sich von fast all ihren Träumen verabschiedet. Einen nach dem anderen hatte sie losgelassen und im harten Wind des Lebens davonfliegen sehen. Aber den Traum, einmal die Hände von Doktor Kalpak auf ihrem nackten Körper zu spüren, den behielt sie, und sie holte ihn hervor, wenn sie allein war.