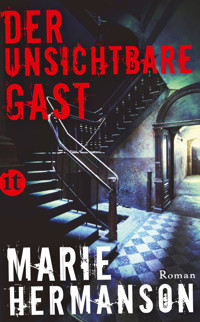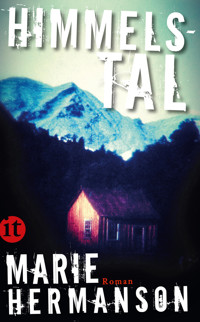8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Drachenpilz, Wolfsblut, Fliegenpilz, Stinkmorchel: Wenn der „Pilzkönig“ Holger Haglund seine legendären Seminare abhält, liegen ihm die Frauen zu Füßen. Auch die reiche, welterfahrene Schlossbesitzerin Madeleine erliegt seinem Charme. Sehr zum Leidwesen von Gunnar, Haglunds Sohn, der zeitlebens im Schatten seines Vaters stand. Als die Liebe zwischen Holger und Madeleine abzukühlen droht, fasst Holger einen heimtückischen Plan. Was, wenn Vater und Sohn die gleiche Frau lieben? Und giftige Pilze im Spiel sind? In »Pilze für Madeleine« meistert Marie Hermanson die Verbindung von schauriger Spannung, absurder Tragödie und zärtlich-ernsthafter Liebesgeschichte. Ein modernes Märchen für Erwachsene – Happy End inbegriffen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Drachenpilz, Wolfsblut, Fliegenpilz, Stinkmorchel: Wenn der »Pilzkönig« Holger Haglund seine legendären Seminare abhält, liegen ihm die Frauen zu Füßen. Auch die reiche, welterfahrene Schloßbesitzerin Madeleine erliegt seinem Charme. Sehr zum Leidwesen von Gunnar, Haglunds Sohn, der zeitlebens im Schatten seines Vaters stand. Als die Liebe zwischen Holger und Madeleine abzukühlen droht, faßt Holger einen heimtückischen Plan. Was, wenn Vater und Sohn die gleiche Frau lieben? Und giftige Pilze im Spiel sind? In Pilze für Madeleine meistert Marie Hermanson die Verbindung von schauriger Spannung, absurder Tragödie und zärtlich-ernsthafter Liebesgeschichte. Ein modernes Märchen für Erwachsene – Happy-End inbegriffen.
Marie Hermanson, 1956 geboren, lebt in Göteborg. Für ihren Roman Die Schmetterlingsfrau (1995) erhielt sie den renommierten schwedischen August-Preis. Mit ihrem Roman Muschelstrand (1998) gelang ihr der internationale Durchbruch. Zuletzt erschien ihr Roman Himmelstal (it 4241).
MARIEHERMANSON
PILZE FÜRMADELEINE
ROMAN
Aus dem Schwedischenvon Regine Elsässer
Insel Verlag
Die Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel Svampkungens son bei Albert Bonniers förlag.
© Marie Hermanson 2007
ebook Insel Verlag Berlin 2014
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des insel taschenbuchs 4327.
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2009
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagfoto: Mohamad Itani / plainpicture
Umschlag: Zero Werbeagentur, München
eISBN 978-3-458-73959-3
www.insel-verlag.de
Stinkmorchel (Phallus impudicus)
Wird auch Leichenpilz genannt.
Geschmack: Mild!
Geruch: Widerwärtig, eklig süßlich,
wie verwesende Kadaver.
Bengt Cortin, Pilze in Farbe
1
Es kann kein Zufall gewesen sein, daß wir ausgerechnet dort und in diesem Moment Stinkmorcheln fanden. Ich erinnere mich an die phallusartigen Fruchtkörper, den widerlichen Leichengeruch und Madeleines unterdrücktes, lockendes Lachen. Ich erinnere mich an den Schauer, der mich durchlief. Ein Schauer aus Begehren, Übelkeit und Haß.
Mein Vater war der charismatische Pilzkenner Holger Haglund. In seinem Schatten aufzuwachsen war nicht leicht, und das bitte ich euch zu bedenken, ehe ihr über mich urteilt.
Meine Mutter gehörte zu den Menschen, die das Meer lieben. Sie stammte von einer Insel in Bohuslän, ihre Familie lebte seit Generationen vom Fischfang. Als junge Frau war sie nach Göteborg gezogen, sie hatte eine Stelle als Bürokraft in einer Importfirma gefunden.
Mein Vater konnte das Meer nicht ausstehen. »Das Määär«, wie er zu sagen pflegte. Er sprach es mit einem lang gezogenen, nasalen Ä aus und ließ das Kinn fallen, er glich dann einer blökenden Ziege. So drückte er seine Verachtung für die hochnäsigen Meermenschen aus. Das Meer war ja so vornehm. Wer es sich leisten konnte, baute ein Sommerhaus am Meer. Der frische Wind, der weite Horizont. »Ja, ja«, schnaubte Vater.
Mein Vater liebte den Wald. Wann immer er konnte, nahm er das Auto und floh vor Mutter, mir und der Wohnung in der Stadt. Ins Landesinnere. Weg vom Meer. Wenn die Pflichten als Familienvater ihm zu anstrengend wurden, flüchtete er in die tiefen Tannenwälder wie andere Männer in die Kneipe. »Im Wald ist die Freiheit«, erklärte er. »Diese Quallen haben keine Ahnung, was Freiheit ist. Sie wissen nicht, was es bedeutet, in einem Wald zu ertrinken. Sich zwischen den Stämmen zu bewegen, immer tiefer hinein in den Wald, bis man sich beinahe verirrt.«
Recht bald führten die Kontroversen in der Meer-oder-Wald-Frage zur Scheidung. Ich war damals sechs Jahre alt.
Ich stellte mich ganz auf die Seite meines Vaters. Ich konnte Salzwasser nicht leiden und liebte morastige Waldseen. Die Tanne war mein Lieblingsbaum. Und schon in jungen Jahren übten auch auf mich die Pilze eine dunkle Anziehungskraft aus. Ich war, fand ich, ganz der Sohn meines Vaters.
Vater und ich zogen in eine Kate im Wald, sie bestand aus einer Küche und einer Stube im Erdgeschoß. Das Dachgeschoß war nicht bewohnbar, aber Vater ließ es isolieren und zwei Schlafzimmer und ein Bad einbauen.
Die Kate lag sehr einsam, weit weg vom nächsten Ort. Man erreichte sie durch eine enge Öffnung zwischen zwei Felsblöcken. Von weitem ähnelten sie zwei riesigen Frauenschenkeln, worauf Vater jedesmal hinwies. Nach dem Frauenschenkeltor ging es einen steilen Hügel hoch, dann kamen ein paar Kilometer gewundene Schotterstraße, die von Tannenwald und Holzstapeln mit gelbroten, duftenden Schnittflächen gesäumt war. Die Abzweigung zur Kate konnte man leicht verfehlen, wenn man sie nicht kannte.
Der Schulbus fuhr natürlich nicht dort vorbei, ich mußte also mit Vater fahren. Er fing um sieben an zu arbeiten, die Schule begann jedoch nicht vor acht, und so stand ich oft lange wartend und frierend auf dem Schulhof herum.
Wir hatten einen Nachbarn, den alten Utbom, aber mit ihm hatten wir keinen Umgang. Er wurde der Axtmörder genannt, der Name erschreckte mich natürlich, aber mein Vater sagte, daß man den Namen nicht wörtlich nehmen dürfe. Utbom war nur ein bißchen merkwürdig und konnte sehr ärgerlich werden, wenn man ihm zu nahe kam. Er verließ sein Haus eigentlich nur, um Holz zu hacken. Sah man ihn, dann mit einer Axt in der Hand. Er hatte einen Schäferhund, der tagein, tagaus angeleint und nur durch eine erbärmliche Hundehütte vor Regen und Kälte geschützt war. Der eingeschränkte Lebensraum hatte die Sinne des Hundes geschärft. Er hatte ein fast übernatürliches Gehör und schlug an, wenn ein Auto sich näherte, lange bevor man ein Motorengeräusch vernehmen konnte.
Hätte es die Pilze nicht gegeben, wären Vater und ich in unserer Kate ziemlich isoliert gewesen. Andererseits wohnten wir wegen der Pilze dort im Wald.
Mein Vater hielt Pilzkurse ab. Zwischen Juli und November stand er Sonntag für Sonntag auf der Eingangstreppe und empfing seine Kursteilnehmer. Sie kamen aus dem ganzen Land. Die Pilzkurse meines Vaters waren berühmt, für seine Kenntnisse wurde er überall hoch angesehen.
Normalerweise arbeitete er als Lagerverwalter bei einem Regiment der Armee, wo er sich um die Post kümmerte und Ausrüstung und Kleidung an die Wehrpflichtigen ausgab.
Da er freien Zugang zum Lager hatte, konnte er unbemerkt alles an sich nehmen, was er brauchte: wasserabweisende Hosen und Pullover, winddichte Jacken, Gummistiefel, Regenkleider, Mützen und Ohrenschützer – alles sehr nützlich im Wald.
Seine Arbeit war nicht sehr anspruchsvoll. Wenn er die Post verteilt hatte, saß er in seiner Kammer und wartete. Wartete darauf, das Lager aufzuschließen, wenn etwas gebraucht wurde. Er nahm schmutzige Kleidung entgegen, gab neue aus und führte Buch über alles. Ich glaube, er hat diese Arbeit sehr bewußt gewählt. Sie paßte ihm ausgezeichnet: freier Zugang zu Ausrüstung gepaart mit einer Beschäftigung, die ihn nicht weiter anstrengte, so daß er seine Kräfte fürs Wochenende sparen konnte.
Ich habe ihn ein paar Mal an seinem Arbeitsplatz besucht. In dieser fast ausschließlich männlich geprägten Umgebung kamen seine Talente nicht zu ihrem Recht, und ich hatte das Gefühl, daß er ein bißchen zu lässig und herablassend behandelt wurde.
Ein Klassenkamerad, dessen Mutter als Köchin beim Regiment arbeitete, hatte mir berichtet, daß die Wehrpflichtigen meinen Vater den »Unterhosenklauer« nannten. Für mich war das der blanke Neid (was war eine einfache Köchin gegen meinen Vater?), aber als ich später meinen Wehrdienst bei einem Regiment im Norden ableistete – nicht sehr erfolgreich und vorzeitig beendet –, mußte ich selbst erfahren, wie rauh der Ton war und wie man sich über Mitarbeiter mit einfachen Tätigkeiten lustig machte.
Aber mein Vater schien es mit Gleichmut zu nehmen. Er hatte das lächerliche Spiel des Karrierestrebens schon lange durchschaut, und die zurückhaltende Rolle, die er die Woche über spielte, schien ihm zu gefallen. Er saß in seiner fensterlosen Bude und plante sein Wochenende: die vorbereitende Tour am Samstag und die Exkursion mit den Teilnehmern am Sonntag. Sein richtiges Leben fand am Wochenende statt.
Ausgenommen die Wintermonate, wenn es keine Pilze gab, verbrachte er die Wochenenden von morgens bis abends im Wald. Einmal, es war ein phantastisches Steinpilz-Jahr, ging er mit voller Ausrüstung – Zelt, Schlafsack, Tütensuppen, er hatte sogar einen Kocher herausgeschmuggelt – in den Wald und verbrachte dort mehrere Tage.
Aber am wohlsten fühlte er sich, wenn er von einer Schar weiblicher Kursteilnehmer bewundert wurde.
Ich erinnere mich gut an die Sonntage, wenn man schon früh am Morgen das Bellen von Utboms Hund hören konnte, an die Autos, die auf den Hof fuhren und an das Gemurmel vor unserem Häuschen.
Vater schlenderte lässig in der Küche umher, blätterte in einem Pilzbuch und tat, als hätte er die Menschenansammlung da draußen nicht bemerkt. Aber seine Wangen hatten schon die frische Röte, die sie in der gesunden Waldluft bekamen, und seine braunen Augen leuchteten mit diesem speziellen Glanz, den so viele Frauen vergeblich zu beschreiben versuchten.
Dann warf er einen gespielt überraschten Blick auf die Wanduhr, schlug das Buch zu und trat auf die Treppe hinaus. Ich hielt mich meist im Hintergrund. In meiner Windjacke und mit dem Pilzkorb am Arm stand ich in der herbstlichen Morgensonne und betrachtete die Kursteilnehmer: junge Mädchen mit festen Brüsten unter großen Wollpullovern, reifere Frauen mit breiten Hüften und zähe Tanten im Rentenalter. Ich war oft der einzige Mann in der Gruppe (außer Vater natürlich).
Die Frauen waren aufgeregt und voller Erwartung. Einige waren richtig attraktiv.
Als diese Geschichte ihren Anfang nahm, war ich gerade zweiundzwanzig geworden. Ich hatte mich in verschiedenen Berufen versucht, aber keiner schien so recht zu mir zu passen. Eine ordentliche Ausbildung hatte ich nicht, ich war nicht praktisch veranlagt und hatte bis dahin keine besondere Begabung für irgend etwas gezeigt. Ich war seit einiger Zeit arbeitslos und vertrödelte die Tage damit, vor dem Fernseher zu sitzen und in einem Männermagazin zu lesen, das ich abonniert hatte. Wenn Vater es nicht sah, blätterte ich in seinen Pilzbüchern. Mein Traum war es, wie er ein herausragender Pilzkenner zu werden, aber der Weg dorthin war lang, und ich glaubte nicht so recht an meine Berufung. Wenn ich sah, wie Vater auf der Treppe stand, im Zentrum weiblicher Aufmerksamkeit, schien ich sehr weit vom Ziel meiner Träume entfernt. Würde ich je dorthin kommen?
»Carl von Linné haßte Pilze, habt ihr das gewußt?« rief Vater von der Treppe herunter. »Er bekam sie in seinem System nicht unter und bezeichnete sie als umherziehendes Pack. Schließlich ordnete er sie widerwillig im Tierreich ein. Unterabteilung Chaos.«
Die Kursteilnehmer kicherten.
Vater machte eine Pause und schaute die Frauen an, die plötzlich ernst wurden. Mit gesenkter, beinahe flüsternder Stimme richtete er eine Frage an sie:
»Was ist eigentlich ein Pilz?«
Und während die Teilnehmer noch über die Frage nachdachten, lief Vater schnell die Treppe herab und führte seine Schar mit einer militärischen Armbewegung in den dunklen Tannenwald.
Ich ging ganz am Schluß. Ich grübelte über Vaters Frage. Ich hatte sie schon so oft gehört. Von der Treppe herab an eine große Schar von Verehrerinnen gerichtet. Aber auch gemurmelt während unserer einsamen Abende im Häuschen, wenn er einen frisch gepflückten Pilz in seiner erhobenen Hand betrachtete.
Die immer wiederkehrende Frage: »Was ist ein Pilz?«
Auf diese Frage schien es keine Antwort zu geben. Aber ich brauchte mich ja nur im Wald umzusehen, um zu begreifen, daß die Pilze bei den Frauen etwas auslösten. Wie sonst sollte man die berühmte Ausstrahlung meines Vaters erklären? Wie konnte ein einfacher Lagerarbeiter, klein von Wuchs, gedrungen, mit Stiernacken und abstehenden Ohren eine solche Macht über Frauen haben?
Ich selbst war hochgewachsen und gut gebaut. Ich war jung, blond und stark. Ein richtiger Wikinger. Aber nie hatte eine Frau mich auch nur angeschaut. Es war, als trüge ich eine Tarnkappe. Vaters Gegenwart war so stark. Ein Gift, das meine eigene Existenz zerfraß.
Warum fühlten die Frauen sich von ihm angezogen und nicht von mir, dachte ich bitter. Weil er so viel über Pilze wußte? Stand er in einer geheimnisvollen Verbindung mit den Pilzen?
Über ihm lag ein gewisser Zauber, und wenn er da auf der Lichtung stand, grün angezogen, klein und untersetzt, einen Pilz betrachtend, dann glich er tatsächlich einem Zwerg aus dem Märchen. Wenn er sich über ein besonderes Exemplar begeisterte, wurde sein Gesicht rot bis über beide Ohren. Vater begann zu glühen. Eine geheimnisvolle Energie schien ihn aufzuladen.
Ich dachte über die unterirdische Verbindung nach, die Pilze mit Bäumen eingehen können, das hatte Vater mir erzählt. Daß die Wurzelspitzen der Bäume sich vollständig mit den Myzelfäden der Pilze vereinigen und man nicht mehr ausmachen kann, ob das Gewebe vom Pilz oder vom Baum stammt. Und daß durch diese Verbindung ein Austausch von Nahrung und Energie stattfindet. »Ein ständiges Geben und Nehmen, das da im Verborgenen passiert«, wie Vater sich auszudrücken pflegte.
Die Pilze koppeln sich an das Lebensnetz des Baums an und bekommen über dessen Zweige und Blätter Kontakt mit Regen, Wind und Sonne. Und der Baum schließt sich an das unterirdische Netz des Pilzes mit seinen weit verzweigten Myzelfäden an, die sich in Steine und Felsen bohren können. (Doch, wirklich: Steine und Felsen!)
»Alles steht miteinander in Verbindung, unter unseren Füßen und über unseren Köpfen«, um noch einmal Vater zu zitieren.
War auch er an dieses Energienetz angeschlossen? Bezog auch Vater seine Energie aus Erde, Luft und Stein? War das sein Geheimnis?
2
Den Tag, an dem Madeleine in Vaters Pilzkurs auftauchte, werde ich wohl nie vergessen.
Sie stand nicht bei den übrigen Bewunderern, die sich schon früh am Morgen murmelnd vor dem Häuschen versammelten. Sie kam sogar ein wenig zu spät.
Vater stand auf der Treppe und beendete gerade seine Einführung, als er von Utboms Hund übertönt wurde. Kurz darauf raste ein offener Sportwagen auf unseren Hof, die Kursteilnehmer stoben auseinander wie eine aufgeschreckte Hühnerschar, und das Auto bremste kurz vor der Treppe. Am Steuer saß eine Frau. Sie trug einen Safarihut und einen Overall. Sie stieg nicht aus, sondern blieb bei laufendem Motor sitzen, warf einen skeptischen Blick auf die Gruppe, dann auf Vater, der immer noch auf der Treppe stand, als überlege sie, ob sie bleiben oder gleich wieder wegfahren solle.
Dann schaute sie meinen Vater an und fragte:
»Ist das der Pilzkurs von Holger Haglund?«
Ihre Stimme war schmelzend zart, aber sehr bestimmt.
Vater nickte kurz, und ihre Blicke trafen sich.
Ich hatte viel von meinem Vater geerbt: seine abstehenden Ohren, seine Sehnsucht nach dem Wald, sein Interesse für Pilze, aber seine Augen hatte ich nicht geerbt.
Vaters Augen waren klein und schnell. Braun wie ein Waldtümpel. Die Augen eines Tiers. Eines Wiesels oder Eichhörnchens. Ich hatte blaue Augen. »Meeresaugen«, sagte Vater verächtlich. »Du hast die Meeresaugen deiner Mutter geerbt.«
Wie oft hatte ich vor dem Spiegel gestanden und meine unschuldigen blauen Kinderaugen verflucht, sie geschlossen und langsam wieder geöffnet, in der eitlen Hoffnung, daß sie jetzt waldbraun wären und von rätselhaftem Glanz.
Madeleine schaute in Vaters Tieraugen, und sie muß etwas in ihnen gesehen haben, was sie zu einem Entschluß brachte, denn plötzlich lächelte sie, ein vieldeutiges Lächeln.
»Das ist der Kurs«, sagte Vater. »Sie sind hier richtig. Bitte parken Sie Ihr Auto dort drüben. Es geht gleich los.«
Während der Exkursion ging Madeleine ständig an Vaters Seite. Ich blieb auf meine unsichtbare Art in ihrer Nähe, lauschte ihren Gesprächen und versuchte, so viel wie möglich zu lernen.
Vater wußte so viel über Pilze und Frauen. Er könne einen Waldchampignon von einem Wiesenchampignon und eine willige Frau von einer unwilligen auf zwanzig Meter unterscheiden, sagte er. Ich kannte mich inzwischen ein wenig mit Pilzen aus, aber über Frauen wußte ich immer noch recht wenig.
»Ich habe so viel Gutes über Ihre Kurse gehört«, sagte Madeleine. »Ich habe gehört, daß es dabei nicht nur um Pilze geht.«
»Bei Pilzen geht es nie nur um Pilze«, antwortete Vater. »Das ist ja das Faszinierende. Sehen Sie den Täubling da drüben?«
Madeleine schob die Krempe des Safarihuts hoch und starrte zwischen die Tannen. Erst schaute sie nur verwirrt, dann ging ein Strahlen über ihr Gesicht.
»Ich sehe ihn, ich sehe ihn!« rief sie und wollte schon loslaufen und ihn holen, als Vater sie am Arm packte.
»Falsch!« zischte er. »Sie sehen nicht den Täubling. Sie sehen nur einen Bruchteil vom Täubling. Der viel größere Teil des Täublings ist unter Ihren Füßen.«
Madeleine starrte verblüfft auf ihre Wanderstiefel.
»Da unten verzweigt sich das Myzel – kleine zarte Fäden, die tief in die Erde eindringen. Da, in der Unterwelt, lebt der Pilz gewissermaßen sein alltägliches Leben. Arbeitet, ißt, wächst. Tag für Tag, jahrelang, manchmal jahrhundertelang. Unsere überirdische Welt besucht er jedes Jahr nur für eine kurze Zeit, um sich zu vermehren. Wenn es soweit ist, wartet er, reif und bereit, und nach dem ersten Regenschauer oder einer feuchten Nacht bricht er durch die Erde, mit einer Kraft, die so stark ist, daß er Steine anheben und Asphalt durchdringen kann.«
»Aha«, sagte Madeleine.
»Nur hier oben können die Sporen sich lösen und vom Wind verbreitet werden. Schauen Sie hier.«
Vater bückte sich, brach den Täubling am Fuß ab und zog Madeleine zu sich, damit sie den Pilz besser sehen konnte.
»Hier drin«, Vater klopfte leicht auf den gelben Hut, »hier drin gibt es keine Nahrung wie in den Samen von Pflanzen. Keinen Nahrungsvorrat, mit dessen Hilfe die Pilze sich zu einem großen selbständigen Wesen entwickeln können. Der Pilz soll sich nicht entwickeln, er ist kein selbständiges Wesen. Er ist ein kleiner Teil eines größeren unsichtbaren Organismus. Hier drinnen«, er klopfte wieder auf den Hut, »sind die Sporen.«
Vater drehte den Pilz, um Madeleine die weißen Lamellen unter dem Hut zu zeigen.
»Nein, man kann sie nicht sehen, dafür braucht man ein Mikroskop. Aber sie sind da. Und beim kleinsten Windhauch«, er blies ein wenig Luft in Richtung von Madeleines Hals, »gibt der Pilz sie in einer leichten Wolke ab.«
Madeleine lachte nervös.
»Man könnte sagen, daß wir nur die Geschlechtsorgane des Pilzes sehen.«
»Oh«, sagte Madeleine.
»Man nennt es Fruchtkörper.«
»Fruchtkörper«, wiederholte Madeleine langsam und schien das Wort zu kosten. »Wie hübsch das klingt.«
Vater reichte ihr den Täubling, und sie nahm ihn vorsichtig entgegen.
»Von uns aus betrachtet, leben die Pilze in einer verkehrten Welt«, fuhr er fort. »So wie wir Menschen bei unseren sexuellen Begegnungen für einen kurzen Moment die Unterwelt besuchen, scheinen die Pilze für ihren Sexualakt unsere Welt zu brauchen. Für sie ist die Welt hier oben vielleicht genau so geheimnisvoll und mythenreich wie die Welt da unten für uns.«
Ich sah, wie Madeleine jede Silbe in sich aufsog. Vater hatte ganz offensichtlich ihre Erwartungen erfüllt.
»Daran könnt ihr denken, wenn euch das Leben mal wieder trist und grau vorkommt: daß ihr in der Unterwelt, in der Welt der Pilze seid«, fügte er mit einem Lächeln hinzu.
Madeleine nickte andächtig.
Plötzlich streckte sie Vater die Hand hin und stellte sich vor. Sie erzählte, sie sei in der Nähe von Borås geboren, habe jedoch mehrere Jahre in Frankreich gelebt und einen Franzosen geheiratet. Jetzt sei sie Witwe und in ihre Heimat zurückgekehrt, um ihre Wurzeln zu suchen.
Sie sprach schnell und war ein wenig verlegen.
Ich betrachtete sie heimlich. Madeleine war eine sehr attraktive Frau, obwohl sie sicher auf die vierzig zuging. Sie hatte ein dreieckiges, katzenartiges Gesicht und einen breiten, wohlgeformten, eigenartig beweglichen Mund mit einem kleinen Muttermal auf der Oberlippe. Ihre Augen hatten die gleiche Farbe wie starker Tee. Solche Frauen hatte ich bisher nur auf Bildern gesehen.
Als Vater sich entfernte, um die Funde von anderen Kursteilnehmern zu inspizieren, schloß ich zu ihr auf, streckte die Hand aus und stellte mich vor:
»Gunnar Haglund. Ich bin Holgers Sohn.«
Sie sah mich zerstreut an.
»Wirklich? Ich hätte nie gedacht, daß ihr verwandt seid.«
Der Weg war schmal, wir gingen sehr dicht nebeneinander, und ich sah zum ersten Mal ihre Augen aus der Nähe. Ich bemerkte, daß die eigenartige Farbe durch kleine goldene Sprengsel hervorgerufen wurde. In der Iris glänzten winzige Schuppen wie aus Blattgold.
Ich versuchte, genauso anregend über Pilze zu sprechen wie mein Vater. Aber sie nickte nur und schwang rastlos ihren roten Eimer.
Ja, sie hatte tatsächlich einen Eimer dabei. Keinen Korb wie die anderen, sondern einen knallroten Plastikeimer. Mit Deckel! So etwas hatte ich noch nie gesehen. Wenn sie einen Pilz entdeckte, ließ sie mich einfach stehen und lief in den Wald hinein. Mit einer blitzschnellen Handbewegung packte sie den Pilz, hob den Deckel des Eimers an, warf den Pilz hinein und verschloß ihn dann wieder sorgfältig, als hätte sie Angst, der Pilz könnte ihr entwischen.
Ich erklärte ihr, daß ihr Eimer eigentlich zum Beerenpflücken gedacht war und daß Pilze in einem luftdichten Gefäß verdarben. Beim nächsten Mal sollte sie einen Korb nehmen. Und jetzt wenigstens den Deckel abnehmen. Die Pilze würden schon nicht weglaufen.
»Sie sind nicht lebendig«, sagte ich lachend.
Madeleine lachte auch, ich spürte ihr Lachen wie einen kleinen Windhauch in meinem Gesicht.
Aber kaum hatte ich meine wohlmeinenden Ratschläge ausgesprochen, da tauchte Vater an Madeleines anderer Seite auf und mischte sich in unser Gespräch.
»Sei da mal nicht sicher«, sagte er leise. »Pilze sind ausgesprochen lebendig.«
»Aber nicht beweglich«, wandte ich ärgerlich ein.
Es war ein schmaler Pfad für zwei Personen, und zu dritt konnte man gar nicht nebeneinander gehen. Mir war klar, daß einer von uns zur Seite gedrückt werden würde, und ich war fest entschlossen, nicht derjenige zu sein. Ich ging mit bestimmten, konzentrierten Schritten und bemerkte plötzlich, daß ich allein war. Vater und Madeleine waren hinter mir stehengeblieben.
Ich drehte mich um und hörte, wie Vater vom Schleimpilz erzählte. Ja, genau. Der bewegliche Schleimpilz! Wieso hatte ich nicht daran gedacht, von diesem faszinierenden Phänomen in der Welt der Pilze zu erzählen! Wie oft hatte ich Vater über den Schleimpilz reden gehört und gesehen, welche Mischung aus Angst und Begeisterung das bei seinen Zuhörerinnen hervorrief.
Madeleine bekam große Augen, als Vater von diesem merkwürdigen Wesen erzählte, das sich gegen alle botanischen und zoologischen Prinzipien wie eine große Amöbe vorwärts bewegt, wie ein Raubtier die Sporen von anderen Pilzen verschlingt und eine Spur glänzenden Schleims hinterläßt.
»Er hat also keinen ... Fruchtkörper?« fragte Madeleine.
»Doch«, fuhr Vater fort. »Wenn es zu trocken ist oder keine Nahrung vorhanden, dann bewegt der Schleimpilz sich nicht