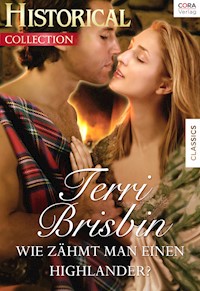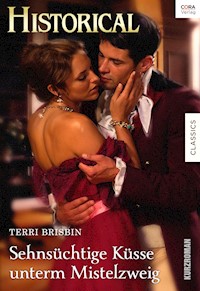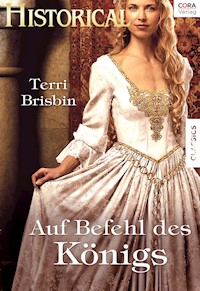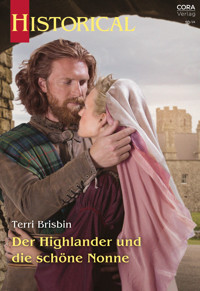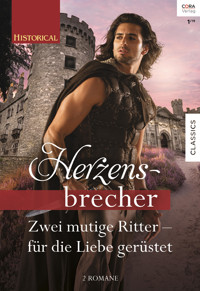5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CORA Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historical Exklusiv
- Sprache: Deutsch
GEHEIMNISVOLL VERTRAUTER FREMDER von HERRIES, ANNE
Entführt von Korsaren, in die Sklaverei verschleppt … Tausend heiße Tränen hat Kathryn schon um ihren Kindheitsfreund Richard geweint! In Venedig hofft sie, endlich einen Hinweis auf Richards Verbleib zu finden. Kann ihr Lorenzo Santorini dabei helfen? Der Venezianer mit dem auffallend blonden Haar und den hellen Augen weckt in Kathryn verwirrende Gefühle - und seine Küsse wirken geheimnisvoll vertraut …
DIE SCHÖNE UND DER BASTARD von BRISBIN, TERRI
Langsam hebt der normannische Ritter Soren Fitzrobert das Schwert. Ein Hieb - dann würde Lady Sybilla ihr Leben aushauchen. Doch etwas hindert ihn, den tödlichen Schlag gegen die Tochter seines Feindes auszuführen. Ihre Schönheit? Oder das Wissen, dass sie vorübergehend erblindet ist? Soren lässt das Schwert sinken und ändert seinen Entschluss: Er wird Sybilla nicht töten - er wird sie zur Frau nehmen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 814
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Anne Herries, Terri Brisbin
HISTORICAL EXKLUSIV BAND 73
IMPRESSUM
HISTORICAL EXKLUSIV erscheint in der HarperCollins Germany GmbH
Neuauflage in der Reihe HISTORICAL EXKLUSIVBand 73 - 2018 by HarperCollins Germany GmbH, Hamburg
© 2005 by Anne Herries Originaltitel: „Ransom Bride“ erschienen bei: Mills & Boon, London Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l. Übersetzung: Birgit Schwarz Deutsche Erstausgabe 2010 by CORA Verlag GmbH & Co. KG, Hamburg,in der Reihe HISTORICAL, Band 274
© 2011 by Theresa S. Brisbin Originaltitel: „His Enemy’s Daughter“ erschienen bei: Harlequin Enterprises, Toronto Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l. Übersetzung: Ralph Sander Deutsche Erstausgabe 2014 by CORA Verlag GmbH & Co. KG, Hamburg,in der Reihe HISTORICAL, Band 305
Abbildungen: Harlequin Books S. A., alle Rechte vorbehalten
Veröffentlicht im ePub Format in 10/2018 – die elektronische Ausgabe stimmt mit der Printversion überein.
E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 9783733734015
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten. CORA-Romane dürfen nicht verliehen oder zum gewerbsmäßigen Umtausch verwendet werden. Sämtliche Personen dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
Weitere Roman-Reihen im CORA Verlag:BACCARA, BIANCA, JULIA, ROMANA, TIFFANY
Alles über Roman-Neuheiten, Spar-Aktionen, Lesetipps und Gutscheine erhalten Sie in unserem CORA-Shop www.cora.de
Geheimnisvoll vertrauter Fremder
1. KAPITEL
Kathryn stand hoch oben auf dem Kliff und blickte hinunter auf das Meer, das weit unter ihr gegen die Felsen brandete. Der Wind riss an ihrem Haar, fing sich in ihrem Umhang und peitschte von allen Seiten auf sie ein, während sie zum fernen Horizont blickte. Wie immer, wenn sie hierherkam, kehrten ihre Gedanken zu jenem Tag in ihrer Kindheit zurück – zu dem Tag, an dem der Mut ihres Begleiters ihr das Leben gerettet hatte. Sie würde niemals vergessen, wie sie in direkter Missachtung der väterlichen Ermahnungen gemeinsam hinunter in die kleine Bucht gegangen waren – und wie ihre Neugier auf das fremde Schiff dort unten Unheil über sie gebracht hatte.
Kathryns Wangen waren nass, als sie sich mit dem Handrücken die Tränen fortwischte. Es hatte keinen Sinn, jetzt noch darüber zu weinen. Dickon war weit fort von ihr, weit fort von seiner Familie. Er war von den Korsaren geraubt worden, die an Land gekommen waren, um nach Wasser und Vorräten zu suchen. Es schien, als hätten einige der Dorfbewohner mit jenen Männern Handel getrieben, die die Ozeane unsicher machten und sich manchmal bis an die Küsten Englands und Cornwalls vorwagten. Wie oft hatte sie bedauert, dass sie ihren Gefährten dazu überredet hatte, hinunterzugehen und das unbekannte Schiff zu untersuchen.
Mit einem Schaudern erinnerte sich Kathryn daran, wie die wilden Piraten sich plötzlich auf sie stürzten, als sie in aller Unschuld an die Stelle gegangen waren, wo die Seeräuber mit einem skrupellosen Dorfbewohner Handel getrieben hatten. Der Mann hatte das Dorf inzwischen längst verlassen, denn da Kathryn den Fängen der Freibeuter entkommen war, musste er davon ausgehen, dass sie von ihren Erlebnissen berichten würde. Aber Dickon konnte nicht fliehen. Er hatte sie hinter sich geschoben und sie angewiesen, Hilfe zu holen, während er sich furchtlos gegen die Angreifer zur Wehr setzte. Oben auf der Klippe hatte sie innegehalten und sich umgewandt. Sie konnte sehen, wie die Männer Dickon an Bord des Beiboots trugen, mit dem sie an Land gekommen waren. Allem Anschein nach war er bewusstlos.
Kathryn war so schnell sie vermochte zum Haus ihres Vaters gerannt und hatte atemlos von der Entführung und dem Verrat erzählt. Aber als ein Trupp von Männern an den Strand kam, hatten sie keine Spur von dem unerschrockenen Burschen gefunden, der sich dem brutalen Gegner entgegengestellt hatte. Er war erst fünfzehn gewesen, doch Kathryn wusste, dass er wahrscheinlich als Sklave verkauft worden war, vielleicht um in den Küchen irgendeines Herrschers des Vorderen Orients zu arbeiten. Oder möglicherweise war er, weil er groß und kräftig für sein Alter war, in einer der Galeeren der Angreifer an ein Ruder gekettet worden.
Bittere Tränen hatte sie geweint, denn sie hatte Dickon geliebt. Er war ihr Freund und Seelenverwandter, und obwohl ihre Familien einige Meilen voneinander entfernt lebten, hatten sie sich gut gekannt. Kathryn glaubte, dass es der Wunsch ihrer beiden Väter war, dass sie eines Tages, wenn das neunzehnte Lebensjahr erreicht hatte, heiraten sollten. Jetzt war sie beinahe so alt, und bald würde ihr Vater Vorbereitungen für ihre Hochzeit mit irgendeinem anderen treffen. Aber in ihrem tiefsten Herzen gehörte sie nur Richard Mountfitchet – ihrem geliebten Dickon.
„Dickon …“, flüsterte Kathryn. Ihre Worte wurden vom Wind fortgerissen und von den Schreien der Möwen und dem Tosen der Wellen gegen die felsige Küste Cornwalls erstickt. „Vergib mir. Niemals hätte ich mir vorstellen können, dass so etwas passieren würde. Ich wusste bis zu jenem Tag nicht, dass es derart niederträchtige Männer überhaupt gibt. Ich vermisse dich. Ich liebe dich immer noch. Ich werde dich immer lieben.“
Es war jetzt auf den Tag genau zehn Jahre her, dachte Kathryn, und jedes Jahr zur selben Zeit kam sie an diese Stelle, stets in der Hoffnung, Dickon wiederzusehen. Wenn sie dann den leeren Strand erblickte, betete sie, dass er zu ihr und zu seiner Familie zurückkehren würde. Und doch wusste sie, dass es unmöglich war. Sein Vater wie auch ihr eigener hatten Männer ausgesandt, um auf den Sklavenmärkten in Algier nach ihm zu suchen. Sie hatten Kontakt zu Freunden auf Zypern, in Venedig und Konstantinopel aufgenommen, der Stadt, die die Türken jetzt Istanbul nannten, die in der christlichen Welt aber immer noch unter ihrem alten Namen bekannt war. Es gab ständig Unruhen zwischen den Türken und den Christen; Kriege und religiöse und kulturelle Unstimmigkeiten machten es schwer, im Osmanischen Reich eine Suche durchzuführen. Sultan Selim II. war ständig dabei, die Grenzen seines Reiches zu erweitern, und er hatte verkündet, dass er eines Tages sogar siegreich in Rom stehen würde. Dennoch gab es ein paar Männer, die in der Lage waren, in diesen unruhigen Zeiten zu helfen, und einer von ihnen war Suleiman Bakhar.
Suleiman war mit einer Engländerin verheiratet. Er galt als ein kluger, gebildeter Mann, reiste unermüdlich umher und trieb Handel. Sein Anliegen war es, Verbindungen zu der Welt jenseits des Osmanischen Reiches zu knüpfen. Dabei hoffte er, den Frieden voranzutreiben, auch wenn es unter den Völkern so viel Hass und eine derart lange Geschichte voller Konflikte gab, dass es schien, als wären die Differenzen unüberbrückbar.
Kathryn wusste, dass Suleiman Bakhar sich gerade in England befand. Er hatte versprochen, Erkundigungen für Lord Mountfitchet einzuziehen, aber soweit sie wusste, hatte er noch nichts herausgefunden, was ihnen hätte weiterhelfen können. Sir John Rowlands und Lord Mountfitchet waren nach London gereist, um mit ihm zu sprechen. Da sie dort noch andere Geschäfte zu erledigen hatten, über die Kathryn nichts wusste, passte es ihnen gut, sich zum selben Zeitpunkt mit Suleiman zu treffen. Aber für den heutigen Tag wurde ihre Rückkehr erwartet, und Kathryn spürte einen aufkeimenden Hoffnungsschimmer, als sie auf das schöne alte Herrenhaus zuging, das ihr Heim war. Einst war es befestigt gewesen, um Angriffe vom Meer her abzuwehren, aber unter der Herrschaft von Queen Elizabeth, die auf Frieden setzte, war es einfach nur noch das Zuhause einer Familie und keine Burg mehr. In den letzten Jahren waren viele Umbauten durchgeführt worden, um es komfortabler zu gestalten.
Als sie vor dem Gebäude ankam, sah sie, dass eine leicht sperrige und ausladende Reisekutsche in den Hof eingefahren war, und mit rasendem Herzen rannte sie los. Vielleicht würde es dieses Mal Neuigkeiten von Dickon geben …
Lorenzo Santorini stand auf den Stufen seines Palazzos. Das Gebäude war am Ufer des Canale Grande erbaut worden, der riesigen Wasserstraße, die sich durch die Lagune und unter den vielen Brücken Venedigs hindurchwand. Die Stadt hatte mit muslimischen Regenten östlich des Mittelmeers Handelsvereinbarungen getroffen, die ihr vor Hunderten von Jahren dazu verhalfen, eine der mächtigsten seefahrenden Nationen zu werden. Von hier aus war der venezianische Händler Marco Polo zu seinen Reisen aufgebrochen, die ihn bis an den Hof des Mongolen Kublai Khan geführt haben sollten, dessen Reich von China bis zum Irak reichte. Die bekannte Welt wurde dadurch um viele Regionen erweitert. Doch die Eroberungs- und Angriffskriege der Türken und die dadurch entstandenen Unruhen der letzten Jahre hatten die Vorherrschaft der Republik an der Adria nach und nach unterminiert.
Die venezianischen Galeeren waren aber immer noch den Kriegsschiffen anderer Länder weitaus überlegen. Aus diesem Grund hatten sie nach wie vor eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Die venezianischen Händler waren äußerst wohlhabend und einflussreich – und Lorenzo Santorini war einer der mächtigsten unter ihnen. Seine Galeeren waren berühmt für ihre Schnelligkeit, und die Männer, die sie ruderten, zeichneten sich durch ihre Kampfeskünste und ihre Disziplin aus. Unter seinen Ruderern, und das beförderte Santorinis Stärke, befanden sich keine Sklaven.
Er runzelte die Stirn, als er sah, wie die Galeere auf den kleinen Landungssteg zusteuerte, auf dem er wartete. Sie gehörte zu der Flotte, die er unterhielt, um seine Handelsschiffe zu beschützen, und sie kehrte verspätet von einer Fahrt nach Zypern zurück. Eigentlich sollte auf der Mittelmeerinsel nur Wein eingekauft und nach Venedig transportiert werden – eine reine Routineangelegenheit. Als sie sich jedoch näherte, sah er, dass der Segler an einem Kampf teilgenommen haben musste – was nur bedeuten konnte, dass sie entweder von einer türkischen Galeere oder von Korsaren angegriffen worden war.
„Willkommen zu Hause, Michael“, rief Lorenzo, als der Kapitän die Stufen zum Anlegesteg anvisierte. Der Händler streckte die Hand aus und half Michael, auf die Treppe zum Palazzo zu springen. „Ich vermutete schon, dass es Ärger gegeben hat – war es wieder Rachid?“
„Ist es nicht immer Rachid?“, entgegnete Michael dei Ignacio, wobei er eine Grimasse schnitt. „Er hasst uns und wird unsere Schiffe angreifen, wann immer er die Gelegenheit dazu bekommt. Glücklicherweise verließ ich Zypern zusammen mit drei anderen Galeeren und dem Schiff, das deinen Wein an Bord hat. Wir haben eine der Kriegsgaleeren verloren, aber das Handelsschiff ist in Sicherheit. Es ist nur eine Stunde hinter uns und wird von den restlichen Seglern begleitet. Wir haben einen schnelleren Kurs eingeschlagen, weil wir einige verwundete Männer an Bord haben.“
„Die Ärzte werden sich um sie kümmern“, sagte Lorenzo mit gerunzelter Stirn. „Und sie werden alle für ihre Qualen entschädigt werden, die sie erlitten haben.“ Auf Lorenzos Galeeren wurden die Männer für ihre Arbeit bezahlt und nicht an die Ruder gekettet wie die elenden Gefangenen auf jenen Kriegsbooten, die in den Gewässern am meisten gefürchtet wurden. Die Korsaren oder Berberpiraten, wie manche sie nannten, machten die Meere zwischen Tanger im Westen und Tripolis im Osten gefährlich. Sie waren Furcht einflößende Männer, die ihre eigenen Gesetze aufstellten und niemandem Gehorsam schuldeten, auch wenn manche von ihnen dem Osmanischen Reich Tribut zahlten.
„Ich werde mich darum kümmern“, versprach Michael. Lorenzos Untergebene konnten sich kaum einen besseren Dienstherrn vorstellen, doch den meisten war er ein Rätsel. Nur wenige wussten etwas über sein Leben. Michael hatte in Erfahrung gebracht, dass Lorenzo von jenem Mann als Sohn angenommen wurde, dessen Namen er trug. Aber über das, was davor passiert war, konnte er nichts sagen, genauso wenig wie auch jeder andere.
„Ich weiß, dass ich ihr Wohlergehen in deine Hände legen kann“, sagte Lorenzo. Seine Augen hatten die Farbe von Veilchen, sie waren dunkelblau mit einem violetten Schimmer und ebenso undurchdringlich wie seine Gedanken. Er trug sein dichtes, kräftiges Haar, das die Farbe von reifem Weizen hatte und an den Spitzen von der Sonne hell gebleicht war, länger als es die Mode der Zeit verlangte; und es lockte sich im Nacken. „Ich breche am kommenden Morgen nach Rom auf. Ich wurde dieser Piraten wegen zu einer Versammlung einberufen.“ Er verzog voller Verachtung den Mund, denn für ihn gehörten dazu auch die Türken, die den venezianischen Händlern in den letzten fünfzig Jahren so viele Sorgen bereitet hatten und jetzt die Dreistigkeit besaßen, dem Dogen Zypern abzuverlangen – eine Forderung, die bei den Venezianern auf erbitterten Widerstand stieß. „Wie du weißt, ist die Rede davon, eine Streitkraft zu sammeln, um Selim Einhalt zu gebieten, bevor er noch weiter nach Europa vorstößt. Der römisch-deutsche Kaiser ist besorgt und hofft, dass er Spanien und noch weitere Verbündete dafür gewinnen kann, die Macht der Türken zu brechen.“
Michael nickte, denn er wusste, dass einige einflussreiche Männer im Heiligen Römischen Reich seinen Freund für einen wichtigen Mann hielten. Lorenzo besaß neben seiner Flotte aus vier Handelsschiffen noch zwanzig Kriegsgaleeren, und man würde ihn mit Sicherheit bitten, der Streitkraft beizutreten, die versuchen sollte, die türkischen Eindringlinge von den Meeren zu verdrängen. Es gab den weitverbreiteten Glauben, dass die Korsaren viel von ihrer eigenen Stärke einbüßen würden, wenn es gelänge, die Bedrohung des Osmanischen Reiches ein für alle Mal zu beenden.
„Man muss gegen die Angreifer vorgehen“, stimmte Michael zu. „Übrigens haben wir einen von Rachids Ruderern gefangen genommen. Als wir eine von seinen Galeeren versenkten, konnten wir ihn aus dem Wasser ziehen. Er war immer noch an das Stück Holz gekettet, das sein Ertrinken verhindert hatte. Wir werden sehen, welche Informationen wir ihm über die Festung seines Herrn entlocken können.“
„Ich werde nicht zulassen, dass er gefoltert wird“, wandte Lorenzo ein. „Es ist mir einerlei, ob er Türke und unser Feind ist, er soll wie ein Mensch behandelt werden. Wenn er bereit ist, uns zu helfen, werden wir ihm Arbeit in der Mannschaft anbieten. Wenn er sich weigert zu kooperieren, werden wir sehen, ob man bei seiner Familie Lösegeld für ihn einfordern kann.“
Lorenzo rieb an einem der breiten Lederbänder, die er stets um die Handgelenke trug. Seine Augen waren so dunkel wie die tiefsten Wasser des Mittelmeeres und genauso unergründlich.
„Ich glaube nicht, dass er türkischen Ursprungs ist“, erwiderte Michael. „Er antwortet nicht, wenn man ihn anspricht, obwohl er die Sprache seiner Herren versteht, ebenso wie etwas Französisch und, wie ich glaube, Englisch.“
Lorenzo sah ihn einen Augenblick lang schweigend an. „Dieser Mann darf nicht schlecht behandelt werden“, beharrte er noch einmal. „Überlass es mir, ihn nach meiner Rückkehr zu befragen, wenn es dir recht ist, mein Freund. Und nun musst du dich ausruhen und die Vorzüge deines Heimes und deiner Familie genießen. Du hast es dir verdient. Wir sehen uns wieder, wenn ich aus Rom zurückkehre.“
„Wie du befiehlst“, antwortete Michael, während er zusah, wie sein Freund einer kleinen Gondel ein Zeichen gab. Sie würde ihn zu seiner persönlichen Galeere bringen, die weiter draußen in der Lagune vor Anker lag. Er war neugierig, warum sein Kommandant plötzlich beschlossen hatte, den Gefangenen persönlich zu befragen, aber er würde Lorenzos Befehl gehorchen. Der Grund warum Michael, der selbst einer guten Familie entstammte, sich dazu entschieden hatte, für Lorenzo Santorini zu segeln, war sein Respekt für ihn. Lorenzo war ein gerechter Mann, und keineswegs konnte man ihn als grausam bezeichnen, einzig Ungehorsam duldete er nicht.
Lorenzo war nachdenklich, als er an Bord der Galeere ging. Sie war das Flagschiff seiner Flotte, das schnellste und neueste Kriegsboot in seinem Besitz, und hatte als besonderen Vorteil drei Segel, die bei schönem Wetter eingesetzt werden konnten und den Ruderern somit die Gelegenheit gaben, sich auszuruhen. Solche Galeeren waren immer noch viel wendiger und leichter manövrierbar als die schwerfälligen Galeonen, die die Spanier vorzogen. Selbst für die kleineren, leichteren Ruderschiffe der englischen Händler und Abenteurer, die nicht zu unterschätzen waren, würde es nicht einfach sein, mit dieser Galeere mitzuhalten. Türkische Kriegsschiffe griffen seine nur selten an – sie wussten, dass sie es bei ihm mit einer enormen Kraft und Gewalt aufzunehmen hatten.
Sein eigentlicher Feind jedoch war Rachid, der den Beinamen „der Gefürchtete“ trug. Er war ein Mann von solcher Brutalität, dass diese Bezeichnung wohlverdient war. Die erbärmlichen Kreaturen, die in seiner Flotte am Ruder ausharren mussten, waren wahrhaft bemitleidenswert, und nur wenige von ihnen überlebten die Schläge und die Folter mehr als drei Jahre lang.
Lorenzos Augen verdunkelten sich, als er sich an eines jener erbarmungswürdigen Subjekte erinnerte, an einen Mann, der nur durch Zufall überlebt hatte. Lorenzo würde nicht eher ruhen, bis Rachid seine gerechte Strafe bekam, egal ob durch den Strick oder das Schwert. Er hatte es am Totenbett des Mannes geschworen, der ihn adoptiert hatte, und eines Tages würde er seinen Eid erfüllen.
Er bedauerte, dass er bei dem letzten Kampf eine seiner Galeeren verloren hatte, denn sicherlich waren dabei einige Männer gestorben, selbst wenn ihre Kameraden so viele wie möglich retteten. Rachid hatte ebenfalls Männer und Galeeren verloren, aber er schätzte Menschenleben gering. Er würde die fehlenden Ruderer auf den Sklavenmärkten von Algier ersetzen oder einfach auf eine der Ägäis-Inseln auf Raubzug gehen, um dort Männer, Frauen und Kinder gefangen zu nehmen. Die Männer würde er auf seinen Galeeren anketten, die Frauen und Kinder gewinnbringend als Haussklaven verkaufen – ein Handel, den gute Christen verabscheuten.
Es interessierte ihn, bald zu hören, welche Pläne in Rom gefasst wurden, denn Lorenzo hieß jeden Kampf willkommen, durch den Männer wie Rachid zur Strecke gebracht wurden. „Der Gefürchtete“ zahlte dem Sultan des Osmanischen Reiches Abgaben und erkaufte sich damit das Recht, zu plündern und zu morden wie es ihm gefiel. Wenn die Macht der Türken begrenzt werden konnte, so würde das Lorenzos Feind sehr viel angreifbarer machen.
Und selbst wenn er in Rachids Festung eindringen musste, um seinen Schwur zu erfüllen, dies würde ihn nicht davon abhalten. Eines Tages würde er den Mann, den er hasste, finden und töten.
„Es tut so gut, Euch zu sehen, Sir.“ Kathryn küsste den Neuankömmling auf die Wange. Sie liebte Lord Mountfitchet beinahe ebenso sehr wie ihren eigenen Vater, und sie sah seinen Besuchen stets voller Freude entgegen. Sie waren ohnehin selten geworden, seit Dickon vor all jenen Jahren geraubt worden war. „Seid Ihr dem Mann begegnet, von dem mein Vater mir erzählt hat – Suleiman Bakhar?“
„Ja, wir haben lange mit ihm gesprochen“, erwiderte Lord Mountfitchet mit einem Seufzer. „Aber es gibt keine Neuigkeiten. Da sein Einfluss weit reicht, konnte er Nachforschungen für uns anstellen, doch er hat nichts herausfinden können. Aber noch gibt er die Hoffnung nicht auf – obwohl er sagt, dass es ungewöhnlich wäre, wenn ein Mann so lange auf einer Galeere überlebt. Es hängt alles davon ab, was mit Richard geschah, nachdem man ihn verschleppte. Wurde er als Haussklave verkauft … könnte er sich überall aufhalten.“
„Wir müssen beten, dass dem so ist“, sagte Kathryns Vater und schüttelte den Kopf über diese wenig tröstliche Nachricht. „Ansonsten …“ Er wirkte betrübt. Was ihn anging, so glaubte er, dass Richard Mountfitchet längst nicht mehr am Leben war. Aber sein Freund hatte sich geweigert, die Suche nach seinem Kind aufzugeben, und er konnte ihn gut verstehen. Wenn es sich um seinen eigenen Sohn gehandelt hätte oder – Gott behüte – um Kathryn, so hätte er wahrscheinlich nicht anders gehandelt.
„Ich glaube nicht, dass Dickon tot ist“, sagte Kathryn. „Ich bin mir sicher, dass ich das hier drinnen gespürt hätte.“ Sie drückte ihre ineinander verschränkten Hände wie im Gebet auf die Brust. „Ihr müsst einfach weiter nach ihm suchen, Sir.“
„Ja, Kathryn.“ Lord Mountfitchet lächelte sie an. Sie war wunderschön mit ihrem dunkelroten Haar und den grünen Augen, und um ihren Mund lag ein Zug, der ihr sanftes Wesen widerspiegelte. Doch wichtiger als all das war, dass sie ihm dabei half, nie den Glauben zu verlieren, dass er seinen Sohn eines Tages zurückbekommen würde. „Aus diesem Grund werde ich auch eine Weile bei euch bleiben. Ich trage mich mit dem Gedanken, nach Venedig und Zypern zu reisen. Wie du weißt, habe ich vor kurzem begonnen, Wein aus Zypern und Italien nach England zu importieren. Ich fing an, mich für diese Gegenden zu interessieren, als ich Nachforschungen anstellte, um Richard ausfindig zu machen. Momentan spiele ich mit dem Gedanken, mich dort niederzulassen.“
„Ihr wollt England verlassen?“ Kathryn starrte ihn überrascht an. Sie hatte bisher noch nichts davon gehört. „Aber was ist mit Eurem Anwesen?“
„Mein Haus und meine Ländereien kann ich unbesorgt meinen Verwaltern überantworten. Ich schließe nicht aus, dass ich eines Tages wieder zurückkehren möchte, aber im Augenblick gibt es hier nicht viel für mich. Katholiken wie dein Vater und ich haben zurzeit ein paar Schwierigkeiten in England. Ich will nicht respektlos erscheinen, denn ich weiß, dass die Königin den Rat ihrer Minister befolgen muss, und diese leben in ständiger Angst vor einem katholischen Komplott gegen sie. Ich habe mich nie an derlei Verschwörungsplänen beteiligt und würde es auch in Zukunft nicht tun, denn sie ist unsere rechtmäßige Herrscherin – aber dennoch hält mich hier nichts mehr. Wenn Dickon noch lebt, muss er irgendwo in jenem östlichen Teil der Welt sein – vielleicht in Algier oder Konstantinopel.“
„Wir werden Euch vermissen“, sagte Kathryn, und sie musste bei der Vorstellung, dass sie ihn vielleicht nie mehr sehen würde, Tränen herunterschlucken. „Woher sollen wir dann wissen, ob es etwas Neues von Dickon gibt?“
„Ich würde dir natürlich schreiben“, erwiderte er und lächelte sie an. „Außerdem werde ich bei meinem Vorhaben einen guten Freund brauchen, der meine Angelegenheiten im Auge behält. Ich habe Sir John gefragt, ob er sich an dem Geschäft, Weine nach England zu importieren, beteiligen würde, und er war so gütig zuzustimmen.“
Kathryn blickte ihren Vater an, der seine Zufriedenheit mit dem Arrangement bestätigte. „Dann werden wir wenigstens hin und wieder von Euch hören.“
Lord Mountfitchet nickte und sah sie nun nachdenklich an. „Dein Vater ist zu beschäftigt, um mich auf dieser Entdeckungsreise zu begleiten, Kathryn, aber es wäre mir lieb, wenn er aus erster Hand über das erfahren könnte, was ich dort vorhabe. Er schlug vor, dass du diese Aufgabe übernehmen könntest. Meine Schwester, Lady Mary Rivers, wurde vor einigen Monaten zur Witwe und hat zugestimmt, gemeinsam mit mir die Reise anzutreten. Sie braucht Ablenkung, und so können wir uns auf unsere alten Tage gegenseitig Gesellschaft leisten.“
„Ihr seid noch kein alter Mann, Sir!“
„Nein, da hast du recht – aber mit der Zeit werden wir alle alt, Kathryn. Mary und ich kommen gut miteinander aus, und ich habe nicht den Wunsch, wieder zu heiraten. Sie glaubt, ich sei ein Narr, weil ich immer noch nach Dickon suche, beißt sich aber in dieser Sache lieber auf die Zunge, als etwas zu sagen. Sie wird dir auf dieser Fahrt als Anstandsdame dienen, und ich bin mir sicher, dass wir auch für die Rückreise einen passenden Beschützer für dich finden werden – es sei denn, du lernst jemanden kennen, den du heiraten möchtest.“
„Oh …“ Kathryn sah ihren Vater an, die Wangen leicht gerötet.
„Ich hatte die Absicht, mich nach einem passenden Ehemann für dich umzusehen, meine Tochter“, sagte ihr Vater und hielt dann inne. „Aber Lord Mountfitchet hat recht. Dieser Tage ist es für Katholiken in unserem Land nicht ganz einfach. Solltest du auf dieser Reise zufällig auf einen Mann treffen, der dir gefällt, so würde ich mich freuen. Ich weiß, dass Mary und Charles auf dich Acht geben werden und dafür Sorge tragen, dass der Bewerber deiner würdig ist, bevor sie mich unterrichten. Tritt der Fall ein, dass du keinem passenden Heiratskandidaten begegnest, werde ich mich selbst auf die Reise begeben, um dich wieder nach Hause zu holen. Wenn ich im Augenblick nicht so viel zu tun hätte, würde ich euch wirklich gern begleiten. Und sollte das anhalten, dann wäre da noch dein Bruder Philip. Er wird nächstes Jahr aus Oxford zurückkehren und könnte sich dann an meiner Statt um dich kümmern. Ich weiß, dass er sich nichts sehnlicher wünscht, als mehr von der Welt zu sehen.“
„Ja, das stimmt.“ Kathryn wurde es warm ums Herz, als sie an ihren Bruder dachte, den sie über alles liebte. „Würde es dir wirklich nichts ausmachen, wenn ich Lord Mountfitchet und Lady Mary begleite?“
„Ich würde dich vermissen, Kathryn“, erwiderte ihr Vater, und sein Blick war warm vor Liebe. „Wäre deine Mutter noch am Leben, so wäre es mir vielleicht möglich gewesen, dich schon früher mit einem Mann bekannt zu machen, der dir gefallen könnte. Ich war zu beschäftigt, um daran zu denken, und außerdem glaube ich, dass du eine Frau brauchst, die dir dabei hilft, diese Entscheidung zu treffen. Als Lady Mary mir sagte, dass sie Charles begleiten wird, dachte ich, es wäre eine ausgezeichnete Gelegenheit für dich, aus Cornwall herauszukommen und Erfahrungen zu sammeln. Ich fürchte, dass du dich zu oft einsam gefühlt haben musst, seit deine liebe Mutter uns verlassen hat.“
Kathryn lächelte, aber es war durchaus wahr. Sie hatte gute Freunde, Nachbarn und die ältliche Amme, die sie rührend umsorgte. Aber die Zeit, die sie gemeinsam mit ihrer Mutter mit Gesprächen und Näharbeiten verbracht hatte, vermisste sie sehr. Das Fieber hatte sie ihr vor mittlerweile neun Jahren genommen, nur ungefähr ein Jahr, nachdem Dickon geraubt worden war.
„Wo wollt Ihr zuerst hingehen, Sir?“, fragte sie und sah mit ihren klaren grünen Augen Lord Mountfitchet an.
„Wir würden erst zu meiner Schwester nach London reisen“, erwiderte er. „Von dort ginge es nach Dover, dann weiter nach Venedig. In dieser Lagunenstadt habe ich Kontakte zu einem Händler geknüpft, einem reichen und sehr mächtigen Mann, bei dem ich in den letzten drei Jahren hervorragende Weine gekauft habe. Er war es auch, der mich dazu ermutigte, meine Geschäfte auszudehnen. Ich werde mich mit ihm beraten, bevor ich meine endgültige Wahl treffe, obwohl ich glaube, dass mir Zypern eher zusagt als Italien selbst. Ich trage mich mit dem Gedanken, auf der Insel ein Weingut aufzubauen.“
„Darf ich ein wenig darüber nachdenken und Euch morgen meinen Entschluss mitteilen?“
„Ja, natürlich. Ich weiß, dass es eine schwere Entscheidung ist – es würde bedeuten, dass du viele Monate lang fern deiner Heimat wärest.“
„Ich glaube, ich kenne meine Antwort bereits, aber ich würde gern darüber nachdenken“, erwiderte Kathryn und lächelte ihn an. „Wenn Ihr mich jetzt entschuldigen wollt, Sir, werde ich euch beide alleine lassen, denn ich habe noch einige Dinge zu erledigen.“
„Bis morgen früh, meine Liebe.“ Lord Mountfitchet verbeugte sich vor ihr, als sie wegging.
„Sie ist ein gutes Mädchen“, sagte Sir John Rowlands, als sie die Tür hinter sich schloss, und seufzte voller Bedauern. „Ihre Gefühle für Dickon waren tief, und sie hat ihn nie vergessen. Ich glaube, dass sie gemeinsam irgendeinen kindischen Pakt geschlossen haben, aber sie hat mir nichts Genaues erzählt. Ich glaube, bevor sie nicht akzeptiert, dass es keine Hoffnung mehr für Dickon gibt, wird sie sich gegen die Vorstellung einer Heirat mit einem anderen wehren.“
„Es wäre schändlich, wenn sie ihr Leben verschwendet“, erwiderte Lord Mountfitchet. „So sehr ich hoffe, dass wir in Venedig irgendetwas über ihn in Erfahrung bringen, so arg wäre es mir, wenn Kathryn ewig um meinen Sohn trauern würde. Sie ist jung, und ihr Äußeres ist ebenso schön wie ihr Wesen. Sie verdient es, glücklich zu sein.“
„Nimmst du an, dass dieser Händler, von dem du gesprochen hast, Neuigkeiten hat?“
„Ich bete, dass dem so ist. Suleiman Bakhar kennt ihn gut. Er sagte mir, dass Lorenzo Santorini zahlreichen Sklaven geholfen hat, denen es gelungen ist, ihren Herren zu entkommen. Er kauft manchmal welche auf den Märkten von Algier, damit sie für ihn als freie Menschen auf seinen Galeeren arbeiten. Oder er löst Korsarenkapitäne, die er in Gefechten gefangen genommen hat, gegen Galeerensklaven ein. Erst vor ein paar Monaten soll er zehn Sklaven gegen einen solchen Mann eingetauscht haben. Er gibt ihnen die Möglichkeit, für ihn zu arbeiten, und manchmal bringt er sie sogar zu ihren Familien zurück. Gelegentlich verlangt er ein Lösegeld, aber ich für mein Teil würde das gern bezahlen, sollte ich dadurch meinen Sohn wiederbekommen.“
„Er klingt wie ein Mann, den man nicht unterschätzen sollte!“
„Das sollte man keineswegs. Suleiman bewundert ihn – sie respektieren sich gegenseitig, glaube ich, obwohl Santorini nichts für Korsaren oder Türken übrig hat. Ich habe sogar gehört, dass er sie hasst.“
„Und doch nennt Suleiman Bakhar ihn seinen Freund.“
„Suleiman ist ein aufgeklärter Mann, wie du weißt. Er hat nur eine Frau, Eleanor, obwohl ihm seine Religion erlaubt, mehrmals zu heiraten, und er betet sie an. Sie reisen gemeinsam, und obgleich sie muslimische Kleidung trägt, wenn sie in seiner Heimat sind, folgt sie in unserem Land der englischen Mode. Suleiman sagt, wenn irgendjemand Dickon finden kann, so ist es Santorini.“
Sir John nickte. „Und das ist der eigentliche Grund, warum du willst, dass Kathryn dich begleitet, nicht wahr? Du gehst davon aus, dass Dickon sowohl dich als auch sie braucht, wenn er gefunden wird.“
„Wie wird er inzwischen sein, sollte er überlebt haben?“, fragte Lord Mountfitchet. Sein Gesicht war grau vor Schmerz. Die Erinnerung an die Entführung seines Sohnes hatte ihn all die langen Jahre verfolgt und ihm keine Ruhe gelassen. „Er muss furchtbar gelitten haben. Er wird Pflege und Zuwendung benötigen, wenn er lernen soll, wieder in Freiheit zu leben.“
„Ja, ich fürchte, du hast recht“, stimmte Sir John zu. „Vielleicht ist Kathryn die Einzige, die ihm helfen kann. Sie waren sich als Kinder so nah.“
„Ich habe dies vorhin nicht angesprochen“, sagte Charles Mountfitchet. „Es könnte ihr das Gefühl geben, dass es ihre Pflicht sei, uns zu begleiten. Ich möchte jedenfalls, dass sie nur mitkommt, wenn sie es wirklich selbst will.“
„Ja, sie muss tun, was sie möchte“, erwiderte Sir John. „Ich würde es nicht anders wollen. Doch wenn sie den Wunsch haben sollte zu heiraten …“
„Dann werde ich dir sofort schreiben“, versprach sein Freund. „Mary wird auf sie Acht geben. Wir werden nicht zulassen, dass irgendein skrupelloser Mitgiftjäger sie verführt.“
„Ihr Vermögen ist angemessen, aber nicht riesig“, entgegnete Sir John. „Ich muss auch an meinen Sohn denken. Wie du bereits sagtest, haben Katholiken momentan kaum die Chance, Karriere zu machen. Philip wird keine Position bei Hofe bekommen, so wie ich, als Mary noch Königin war.“
„Deswegen tust du gut daran, dich an meinem Unternehmen zu beteiligen“, sagte Lord Mountfitchet. „Wir können Handel treiben, wo wir wollen, denn die Welt ist größer als England.“
„Es ist richtig, was du sagst“, bemerkte Sir John, „auch wenn ich nur ungern von hier fortgehen würde, so wie du es tust.“
„Vielleicht hätte ich ebenso gedacht wie du, wenn …“ Lord Mountfitchet seufzte und schüttelte den Kopf. „Es bringt nichts, mit dem Schicksal zu hadern. Wenn Santorini mir keine Hoffnung machen kann, werde ich vielleicht endlich akzeptieren, dass ich meinen Sohn nie wiedersehen werde.“
Kathryn betrachtete sich in ihrem kleinen Handspiegel. Er hatte früher einmal ihrer Mutter gehört und war in Venedig hergestellt worden. Sie berührte den glatten Silbergriff mit den Fingerspitzen. Die venezianischen Händler waren berühmt für die Qualität ihrer Waren. Auch die schöne Glaskaraffe mit den dazugehörigen Gläsern, die ihre Mutter so hoch geschätzt hatte, stammte aus der Lagunenstadt.
Es war für sie ein großes Abenteuer, mit Lord Mountfitchet und Lady Mary zu reisen. Sie hatte nie erwartet, je die Ufer ihres Heimatlands zu verlassen, denn ihr Vater reiste nicht viel. Doch sie hatte viel in den seltenen und wertvollen Büchern und Manuskripten in seiner Bibliothek gelesen, die Geschichten über andere Länder erzählten, und ihr Geist war offen für Neues. Und natürlich war Venedig ein berühmtes Zentrum, was den Buchdruck betraf, besonders bei Dichtungen und großen Geschichtswerken war es gegenüber anderen Nationen führend. Sie hatte sich überlegt, dass sie es aufregend finden würde, fremde Länder und unbekannte Orte kennenzulernen – und es gab dabei immer die Möglichkeit, etwas über Dickons Verbleib herauszufinden.
Ihr Haar hing ihr lose um die Schultern, es war eine dunkelrote gelockte Pracht, die wie Feuer glühte, als der Schein der Kerzen darauf fiel. Sie stand auf, ging zum Fenster hinüber und blickte in die Dunkelheit hinaus. Sie konnte nur sehr wenige Umrisse ausmachen, denn in dieser Nacht erhellte kein einziger Stern den Himmel. Ihr Vater hatte gesagt, dass sie vielleicht jemanden finden könnte, den sie heiraten wollte – aber wie sollte das je geschehen, wo ihr Herz doch Dickon gehörte? Sie hatte ihm als Mädchen ein Versprechen gegeben, und er hatte sein Messer genommen und den Anfangsbuchstaben ihres Namens auf die Rückseite seines Handgelenks geritzt. Der Schnitt blutete stark, und sie hatte erschrocken aufgeschrien und ihm ein Spitzentaschentuch gegeben, um die Wunde zu verbinden.
„Tut es sehr weh?“ Er hatte gelacht und sie mit kühnem Blick angesehen, als sie ihn das fragte.
„Es ist nichts, denn ich weiß, dass dieses Blut dich für immer an mich bindet.“
Da hatte sie die Wunde geküsst und sein Blut geschmeckt, und sie hatte gewusst, dass sie ihn immer lieben würde. Sie würde sich jedem Versuch widersetzen, beabsichtigte man sie mit einem Mann zu vermählen, den sie nicht liebte. Auf der Reise würde sie sich sittsam verhalten und auf Lady Marys Rat hören, aber sie würde nicht zulassen, dass man sie mit einem Mann verband, dem sie nicht Respekt oder wenigstens etwas Zuneigung entgegenbrachte. Vielleicht würde sie eines Tages in ihrem Herzen fühlen, dass Dickon tot war. Wenn das geschah, konnte sie vielleicht über eine Heirat nachdenken. Wenn nicht …
Ihre Gedanken liefen ins Leere, denn sie wusste nicht, was sie tun würde, wenn Dickon nie zu ihr zurückkehrte. Es gab für eine Frau ihres Standes keine Alternative zur Ehe – außer vielleicht, sie wollte sich in ein Kloster zurückziehen. Frauen heirateten oder wurden Nonnen, es sei denn, ihre männlichen Verwandten hatten Verwendung für sie. Vielleicht würde Philip ihr ein Leben in seinem Haushalt ermöglichen, wenn sie zu alt war, um noch für eine Ehe infrage zu kommen.
Es war eine traurige Aussicht, aber was gab es sonst für sie? Kathryn legte den Spiegel auf einen Tisch und ging zu ihrem Bett hinüber, einem schweren Kastenbett mit einem aus Holz geschnitzten Himmel. Es war ein schön gearbeitetes Stück mit mehreren weichen, mit Gänsedaunen gefüllten Matratzen, um die harten Bettlatten nicht zu spüren. Kathryn schlüpfte unter die luxuriösen Seidendecken und fragte sich, wie das Leben an Bord eines Schiffes wohl war.
Doch sie würde mit Vorliebe jede Unannehmlichkeit in Kauf nehmen, wenn sie dafür nur am Ende der Reise den Mann fand, den sie liebte.
Es kommt alles in Bewegung, dachte Lorenzo, als er die Versammlung verließ. Man hatte schon lange darüber gesprochen ein Bündnis zu schließen, um die Türken zu bekämpfen, aber jetzt sah es endlich so aus, als könnte es tatsächlich noch im selben Jahr so weit sein. Papst Pius V. hatte sich mit Spanien und Venedig zur Heiligen Liga zusammengeschlossen, und es bestand Hoffnung, dass auch andere ihre Schiffe beisteuern würden, um zu helfen, die Bedrohung zu bekämpfen, die das Mittelmeer und die Straße von Messina so lange heimgesucht hatte. Viele hatten angenommen, die Gespräche und Verhandlungen würden sich hinziehen. Doch nach diesen letzten Drohungen gegen Zypern und sogar gegen Rom selbst schien es, als wäre seine Heiligkeit fest entschlossen, den Feind zu schlagen, der lange die christlichen Nationen bedroht hatte.
Lorenzo war in Gedanken versunken, als er den Palast verließ. Seine Überlegungen kreisten nicht um die Versammlung, sondern um einen Brief, den er kurz vor seiner Abreise aus Venedig erhalten hatte. Er stammte von einem Engländer, mit dem er schon in der Vergangenheit geschäftlich in Kontakt getreten war. Der Mann hatte ihm mitgeteilt, dass er nach Venedig kommen würde. Zugleich hatte er ihn gebeten, ihm bei der Suche nach einem jungen Mann zu helfen, der vor über zehn Jahren von der Küste seines Heimatlands entführt worden war.
Lorenzo runzelte die Stirn, denn es war eine undankbare Aufgabe. Er wusste ebenso gut wie jeder andere, wie unwahrscheinlich es war, dass der junge Mann überlebt hatte.
Er würde natürlich alles tun, was in seiner Macht stand, um Lord Mountfitchet zu helfen, denn obwohl sie sich nie begegnet waren, hatte er nur Gutes über ihn gehört. Sein Vater, Antonio Santorini, hatte England einst besucht und davon erzählt, dass er Lord Mountfitchet getroffen hätte, und dass dieser sowohl ehrenhaft als auch anständig war. Deswegen würde Lorenzo ihm helfen. Aber einen Mann aufzuspüren, der vor so langer Zeit von Korsaren geraubt worden war …
Lorenzos Instinkte blieben wachsam, auch während er sich mit diesen Problemen beschäftigte. Er spürte, dass er verfolgt wurde. So war er vorbereitet, als er angegriffen wurde. Als er sich umwandte, zog er seinen Degen, um den drei Raufbolden entgegenzutreten, die aus der Dunkelheit auf ihn zustürmten.
„Kommt, meine Freunde“, lud er sie mit einem kalten Lächeln ein, das seinen eisigen Blick unterstrich. „Wollt ihr meinen Beutel? Kommt, nehmt ihn, wenn ihr könnt!“
Einer der drei Männer war kühner als die anderen und nahm ihn beim Wort. Die Degen der beiden Kontrahenten klirrten in erbittertem Kampf aufeinander, doch der Schurke hatte dem meisterhaften Fechter nichts entgegenzusetzen und rief seine Kameraden zu Hilfe. Die zwei anderen Gauner traten vorsichtig auf Lorenzo zu, denn sie hatten gesehen, dass er keine leichte Beute war. Obwohl die Angreifer zahlenmäßig überlegen waren, hielt er ihnen einige Minuten lang stand. Er schlug nach links und rechts, als seine Gegner ihn nacheinander attackierten, wich zur Seite aus, sprang zurück und wieder vor, während er mit der Geschicklichkeit und Kraft kämpfte, die er sich in all den Jahren als Befehlshaber einer Kriegsgaleere angeeignet hatte. Trotzdem sah es nicht gut für ihn aus, und am Ende wäre es ihm womöglich schlecht ergangen, wenn sich nicht noch ein Neuankömmling ins Getümmel gestürzt und Lorenzo mit seinem Können und seinem Wagemut unterstützt hätte.
Lorenzos Waffe setzte schließlich einen der drei Halunken außer Gefecht. Als sie feststellten, dass die gegnerischen Seiten jetzt ausgeglichen waren und sie zurückgedrängt wurden, ergriffen die beiden übrigen Schurken die Flucht und rannten davon, während sich der Verwundete noch gegen eine Mauer lehnte und seinen Arm umklammerte. Durch seine Finger troff Blut.
Lorenzo steckte seinen Degen in die Scheide, als die anderen fortliefen, doch der Fremde, der ihm zu Hilfe gekommen war, hielt seine Waffe immer noch fest und betrachtete den erfolglosen Meuchelmörder nachdenklich.
„Sollen wir ihn töten?“, fragte er Lorenzo. „Der Hund verdient es – oder wollt Ihr ihn befragen?“
„Er beabsichtigte mich auszurauben“, antwortete Lorenzo mit einem gleichgültigen Schulterzucken. „Lasst ihn zu seinen Kumpanen – es sei denn, er zieht einen schnellen Tod vor?“ Er legte die Hand vielsagend an den Griff seines Degens.
Der Mann schrie vor Angst und brachte plötzlich die Kraft auf, seinen Kameraden zu folgen. Dem Fremden entfuhr ein bitteres Lachen, und er wandte sich Lorenzo zu.
„Ihr seid sehr gnädig, Signore. Ich glaube, er hätte Euch getötet, wenn er die Gelegenheit dazu bekommen hätte.“
„Daran habe ich keinen Zweifel.“ Lorenzo lächelte. „Ich danke Euch für Eure Hilfe, Señor. Ich bin …“
„Ich kenne Euch, Signor Santorini“, unterbrach ihn der Fremde, noch bevor Lorenzo weitersprechen konnte. „Ich bin Pablo Dominicus. Man hat mich bei der Versammlung, an der wir beide teilnahmen, auf Euch aufmerksam gemacht. Ich bin Euch gefolgt, weil ich mit Euch sprechen wollte.“
„Dann ist mir das Glück heute wahrlich hold“, sagte Lorenzo. „Wenn Ihr geschäftliche Angelegenheiten mit mir bereden möchtet, sollten wir uns vielleicht eine Taverne suchen, wo wir uns hinsetzen können?“
„Ich habe zweierlei Dinge, die mich beschäftigen“, erklärte Pablo Dominicus. „Und das hat damit zu tun, dass ich einerseits Abgesandter seiner Heiligkeit des Papstes bin und andererseits ein Mann, dem nach Rache dürstet. Ich glaube, wir haben einen gemeinsamen Feind.“
„Tatsächlich?“ Lorenzos Augen verengten sich. Der Fremde schien Spanier zu sein. Er mochte diese Landsleute nicht besonders, denn die Inquisition war etwas Furchtbares. Viele betrieben sie im Namen der katholischen Kirche, wobei sie in Spanien mächtiger als in den meisten anderen Ländern war. Und es war bekannt, dass diese Nation Venedig seine Unabhängigkeit missgönnte und der Meinung war, einigen Venezianern würde die Aufmerksamkeit der Inquisition durchaus guttun. Es gab auf Lorenzos Galeeren Männer, die wussten, was es bedeutete, unter den Händen der Fanatiker, die die kirchlichen Orden beherrschten, Folter und Schläge zu erleiden. Doch es lag nur ein höflicher, fragender Unterton in Lorenzos Stimme, als er sagte: „Bitte erzählt mir mehr, Señor. Ich würde gern wissen, wie ich Euch zu Diensten sein kann.“
„Hattet Ihr nicht vorhin vorgeschlagen, einen Ort aufsuchen, wo wir ungestört sprechen können, Signor Santorini? Ich habe eine Bitte Seiner Heiligkeit vorzutragen, denn Euer Name ist dem Papst wohlvertraut – und ich habe noch ein weiteres Anliegen, das nur mich selbst betrifft.“
„Eine Straße von hier entfernt ist eine Taverne, die ich kenne“, erwiderte Lorenzo. „Wenn Eure Geschäfte geheim sind, können wir dort ein Privatzimmer nehmen und so sicher sein, dass niemand lauscht.“
Lorenzo trank nur wenig von dem schweren Rotwein, den Dominicus bringen ließ, während er sich die Bitte anhörte, die ihm vorgetragen wurde. In der Dunkelheit hatte er Don Pablos Gesicht nicht gut wahrnehmen können, aber jetzt sah er, dass er einen Mann mittleren Alters vor sich hatte. Er wirkte grobschlächtig und trug einen kleinen Spitzbart, sein Haar war kurz und wurde an den Schläfen dünn. Er schien sich ein wenig unbehaglich zu fühlen, wie Lorenzo mit Interesse feststellte.
„Seine Heiligkeit bittet Euch, unsere Sache zu unterstützen“, erklärte Don Pablo. „Eure Galeeren zählen zu den besten, Eure Männer sind stark und kühn, und wie ich erfahren habe, sind sie Euch treu ergeben. Wenn Ihr uns in der Liga beisteht, werden andere sicherlich Eurem Beispiel folgen.“
„Ich hatte vor, meine Unterstützung anzubieten, sobald ich mich mit meinen Kapitänen besprochen habe“, erwiderte Lorenzo. Sein Blick war nachdenklich, als er den anderen Mann musterte. Warum hielt er ihn für nicht ganz so ehrlich, wie er auf den ersten Blick zu sein schien? „Ich werde mich Eurer Sache anschließen, denn sie ist auch die meine, aber die Männer, die unter mir dienen, dürfen selbst entscheiden. Ich glaube jedoch, dass mir die meisten folgen werden, denn sie haben guten Grund, die Türken und ihre Verbündeten zu hassen.“ Manche von ihnen hassten die Spanier ebenso sehr, aber das sagte er nicht laut. „Vielleicht würdet Ihr jetzt so freundlich sein, mir den wahren Grund zu verraten, warum Ihr Euch dazu entschlossen habt, mir heute Abend zu folgen?“
Don Pablo lächelte. „Mir wurde bereits zu verstehen gegeben, dass Ihr klug seid. Ich werde Eure Intelligenz nicht beleidigen, indem ich weiter behaupte, im Auftrag des Papstes hier zu sein. Diese Aufgabe wird möglicherweise anderen überlassen, aber ich weiß, dass Seine Heiligkeit beabsichtigt, sich an Euch zu wenden. Ich bin Euch gefolgt, weil ich glaube, dass Ihr Rachid verachtet – ihn, den sie ‚den Gefürchteten‘ nennen. Ich habe gehört, dass Ihr in ihm Euren größten Feind seht. Gern würdet Ihr ihn lieber tot als lebend wissen.“
Lorenzo schwieg einen Augenblick lang. „Was hat Rachid Euch angetan?“
„Vor drei Monaten haben seine Galeeren eines meiner Handelsschiffe angegriffen und gekapert“, erwiderte Don Pablo und ballte seine Hände auf dem Tisch zu Fäusten. Es war offensichtlich, dass ihn heftiger Zorn auf Rachid durchfuhr. „Das hat mich eine große Menge Geld gekostet – und unter den Männern, die er tötete, war mein Schwiegersohn.“
„Ich bedaure Euren Verlust, Señor.“
„Meine Tochter und meine Enkelkinder leben auf Zypern“, fuhr Don Pablo fort, und seine Hand zitterte dabei. „Immacula will mit ihren Kindern nach Spanien zurückkehren. Ich würde selbst Schiffe aussenden, um sie zu holen, aber ich habe in letzter Zeit noch andere Verluste erlitten. Diese verfluchten englischen Freibeuter haben meine restlichen Schiffe auf ihrem Rückweg aus der Neuen Welt geplündert.“
„Ihr bittet mich, Eure Tochter zu Euch zu bringen?“ Lorenzo hob die Augenbrauen, während er in dem Gesicht seines Gegenübers forschte.
„Ich bin natürlich bereit, Euch für die Zeit, die Ihr benötigt, zu bezahlen.“ Don Pablo senkte unter Lorenzos durchdringendem Blick die Augen.
„Meine Galeeren sind für den Krieg bestimmt, sie sind nicht für eine Frau und Kinder geeignet. Ich glaube, Ihr müsst Euch andernorts nach einer Eskorte umsehen, Señor Dominicus.“
„Ihr missversteht mich. Immacula wird selbstverständlich auf unserem eigenen Schiff reisen. Ich bitte lediglich um eine Eskorte, um sie sicher nach Spanien zu bringen.“
„Ihr wollt, dass meine Galeeren Euer Schiff begleiten?“ Lorenzo nickte. Seine Augen verengten sich, als er den Spanier betrachtete. Irgendetwas stimmte an der Sache nicht. Seine Intuition riet ihm, auf der Hut zu sein, und sie irrte sich selten. „Meine Männer arbeiten nur für mich. Man kann sie nicht mieten.“
„Sicherlich würden sie Euren Anweisungen Folge leisten?“ Don Pablos Augen waren dunkel vor unterdrückter Wut, aber da war noch etwas anderes – etwa Angst? Lorenzo war sich nicht sicher, aber er spürte, dass dieser Mann mehr verbarg, als er durchblicken ließ. „Ich dachte, Ihr seid der Befehlshaber. Erzählt mir nicht, dass jene, die Euch dienen, Euch sagen, was Ihr zu tun habt, denn ich würde es Euch nicht glauben!“
Lorenzos Mundwinkel hoben sich zu einem seltsam abweisenden Lächeln, das seinem Begleiter einen Schauer über den Rücken jagte. „Vergebt mir, wenn ich deutliche Worte spreche, Don Pablo. Einige meiner Männer haben unter der spanischen Inquisition gelitten. Sie würden Euch eher ins Gesicht spucken, als für Euch zu kämpfen.“
Don Pablos Gesicht wurde dunkelrot vor Wut. Er sprang auf die Beine, als wollte er in seinem Ärger losschlagen. „Ihr lehnt ab? Ich hatte gehört, dass Ihr ein Geschäftsmann seid. Sicherlich ist mein Gold ebenso gut wie das von jedem anderen?“
„Was mich betrifft, so würde ich Euer Gold nehmen“, erwiderte Lorenzo. Sein Gesicht war eine steinerne Maske, die nichts über seine Gedanken verriet. „Aber ich kann nicht von meinen Männern erwarten, für einen Spanier zu kämpfen.“ Er stand auf und neigte den Kopf. „Es tut mir leid, aber ich glaube, Ihr werdet andere finden, die bereit sind, Euch zu helfen.“
„Ihr könnt Euren Preis selbst bestimmen.“ Don Pablo rief ihm die Worte hinterher. Er schien verzweifelt zu sein. „Ich flehe Euch an, mir zu helfen, Signore!“
„Meine Antwort bleibt die gleiche, Don Pablo.“ Lorenzo wandte sich um und blickte ihn mit kalter Entschlossenheit an. Jetzt war er sich sicher, dass sein Gespür ihn nicht getäuscht hatte. Dies war nicht einfach nur eine geschäftliche Angelegenheit. „Wenn Ihr Euch dazu entschließen solltet, mir die Wahrheit zu sagen, könnte ich es mir noch einmal überlegen, Señor – doch bis dahin, lebt wohl.“
Die Augen des Spaniers spiegelten eine Mischung aus Angst und Entsetzen wider, und einen Augenblick lang schien es, als wollte er sprechen. Doch er schüttelte nur den Kopf, und kurz darauf hatte Lorenzo bereits die Tür hinter sich geschlossen.
Seine Instinkte hatten ihm wie immer gute Dienste geleistet. Er vermutete, dass die Attacke auf ihn geplant gewesen war. Eine List, um Dominicus dankbar zu sein – damit Lorenzo in freundschaftlicher Verbundenheit den angebotenen Auftrag annahm. Lorenzo hatte in einer harten Schule gelernt, dass nur wenigen Männern zu trauen war.
Hinter diesem Spiel steckte mehr, als auf Anhieb zu erkennen war, und es war auf alle Fälle ein falsches Spiel. Wenn seine Feinde ihm eine Falle stellen wollten, so mussten sie den Köder schon geschickter auslegen.
2. KAPITEL
Das war also Venedig! Kathryn sah sich gespannt um, als das Schiff in der großen Lagune vor Anker ging. Sie waren zu weit außerhalb, um die Küste genau erkennen zu können, aber die großen Paläste der reichen Händler und Adligen glänzten im Licht der Sonne, und das Wasser des Adriatischen Meeres schwappte über die Stufen, neben denen an Holzpfählen leuchtend bunte Gondeln vertäut waren.
„Wie gefällt dir Venedig, mein Kind?“, fragte Lady Mary, als sie neben das Mädchen trat. „Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast?“
„Es ist wunderschön. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich habe ein Pastell vom Canale Grande und den umliegenden Palazzi gesehen. Aber die Wirklichkeit übertrifft die Vorstellungskraft des Künstlers bei Weitem. Diese Paläste scheinen beinahe zu schwimmen.“
Lady Mary lachte. Sie war eine kräftig gebaute, gutmütige Dame, die in ihrer Jugend hübsch ausgesehen haben musste – noch jetzt waren ihre schönen Gesichtszüge zu erkennen. Ihr warmes Lächeln war voller Zuneigung, hatte sie Kathryn während der Reise doch sehr ins Herz geschlossen. Einige Monate waren sie schon miteinander unterwegs, hatten zusammen das Jahr 1571 erlebt, und inzwischen war der Frühling gekommen. In England, davon konnte man ausgehen, herrschten sicherlich noch sehr kühle Temperaturen, aber hier war es viel wärmer, und die Sonne färbte das Wasser leuchtend blau.
„Ja, die Stadt übt eine magische Anziehungskraft aus, nicht wahr? Mein verstorbener Gemahl ist in seiner Jugend mit Begeisterung gereist. Er erzählte mir von seinem Besuch in Venedig. Wir müssen unbedingt den Markusplatz besuchen und uns den Dogenpalast ansehen, während dein Onkel seinen Geschäften nachgeht, Kathryn.“
Sie hatten beschlossen, dass Kathryn ihre liebenswürdigen Freunde als Tante Mary und Onkel Charles betrachten sollte.
„Wir mögen keine Blutsverwandten sein“, hatte Charles Mountfitchet ihr zu Beginn ihrer gemeinsamen Reise mitgeteilt, als sie sich in London auf den Weg machten, um Lady Mary zu treffen. „Aber wir werden einige Zeit lang wie eine Familie zusammenleben, und aus diesem Grund sollten wir uns miteinander wohlfühlen.“
Kathryn war sehr gern dazu bereit gewesen, ihn als Onkel ehrenhalber anzunehmen, denn sie fühlte sich ihm schon seit Kindertagen eng verbunden. Und in all den Jahren nach Dickons Entführung hatten sie sich gegenseitig Trost gespendet. Sie liebte ihn mehr als sonst jemanden, abgesehen von ihrem Vater und ihrem Bruder.
„Oh, ich will alles mit Euch teilen“, sagte sie jetzt. Ihre Augen glühten vor Begeisterung, und es war ihr anzusehen, dass sie derartige gemeinsame Erlebnisse vermisst hatte. Schon während der Überfahrt leuchteten ihre Augen, und sie hatte nicht unter der Seekrankheit gelitten wie Lady Mary. „Und du wirst dich viel besser fühlen, wenn du erst wieder an Land bist, Tante“, tröstete sie ihre „neue“ Verwandte.
„Oh ja, das werde ich. Ich wünschte nur, ich müsste nicht noch weiter“, erwiderte Lady Mary nachdrücklich. „Ich ahne, dies ist nur ein vorübergehender Aufschub. Da mein Bruder aller Voraussicht nach auf Zypern eine Bleibe finden möchte, so müssen wir wohl oder übel noch einmal in See stechen.“
„Ich weiß, er hat vor, seinen eigenen Wein anzubauen“, erwiderte Kathryn. „Aber wer weiß? Vielleicht ändert er seine Pläne.“
„Du denkst natürlich an Richard.“ Lady Mary runzelte die Stirn. „Du und Charles, ihr beide hofft auf ein Wunder, aber ich schätze, dass ihr sehr enttäuscht werdet.“
„Aber etwas, das unwahrscheinlich erscheint, kann doch Wirklichkeit werden“, beharrte Kathryn. „Suleiman Bakhar hat meinem Onkel gesagt, dass Sklaven manchmal befreit oder ihren Herren abgekauft werden. Wenn Dickon als Haussklave veräußert wurde, besteht immerhin die Möglichkeit, dass wir ihn finden und gegen ein Entgeld von seinen Diensten erlösen können.“
„Mein Bruder hat versucht, seinen Sohn zu finden“, sagte Lady Mary mit einem tiefen Seufzer. Sie glaubte nicht, dass die Suche irgendeinen Erfolg haben würde und befürchtete, daraus würden nur neue Schmerzen entstehen. „Seit Jahren hat er einflussreiche Männer gebeten, ihm bei seinen Nachforschungen zu helfen, alles ohne Erfolg. Ich glaube, dass Richard tot ist. Es tut mir leid, aber ich bin mir sicher, dass wir irgendeine Spur von ihm gefunden hätten, wenn er wirklich noch leben sollte.“
„Ich weiß, dass das, was du sagst, vernünftig ist“, antwortete Kathryn. Ihre Augen ließen erkennen, wie sehr sie anderer Meinung war. „Aber ich spüre, dass er lebt. Hier in meinem Innersten.“ Sie drückte die Hände auf ihre Brust. „Ich kann es nicht erklären, und es muss sich närrisch anhören, aber wenn Dickon gestorben wäre, dann wäre auch ein Teil von mir gestorben.“
Lady Mary schüttelte den Kopf, sagte aber nichts mehr. Ihrer Meinung nach machte Kathryn sich falsche Hoffnungen. Selbst wenn ihr Neffe irgendwie überlebt hatte, würde er nicht mehr derselbe sein. Ein Mann, der jahrelang die Sklaverei ertragen hatte, konnte nicht mehr der Gleiche wie einst sein. Er konnte hart und verbittert geworden sein, vielleicht hatte man auch seinen Geist gebrochen. In jedem Fall war Kathryn dazu verurteilt, enttäuscht zu werden. Es schien fast besser, wenn nie eine Spur von Richard gefunden wurde, denn mit der Zeit würde sie sicherlich lernen, einen anderen zu lieben.
Das Mädchen war unter Lady Marys Zuwendung aufgeblüht. Während ihres Aufenthalts in London hatten die beiden Seidenhändler aufgesucht und Stoffe gekauft, um Kleider anfertigen zu lassen, die sich besser für das wärmere Klima eigneten. Lady Mary hatte es Freude bereitet, die junge Frau umherzuführen und mit ihren Freunden bekannt zu machen, ihr eine Vorstellung davon zu geben, wie das Leben sein konnte. Die Wandlung, die Kathryn in kurzer Zeit vollzog, hatte ihr gefallen. Kathryn war jetzt viel heiterer als früher, und ihr Lachen war warm und ansteckend, obwohl unter ihren guten Manieren eine trotzige Ader lauerte. Doch sie hatte den traurigen Zug abgeschüttelt, der ihr schönes Gesicht überschattet hatte, und sich als bezauberndes, intelligentes Mädchen herausgestellt.
Lady Mary machte sich große Hoffnungen, einen passenden Ehemann für ihren Schützling zu finden, bevor es für Kathryn an der Zeit war, nach Hause zurückzukehren.
„Ich glaube, dies ist die Gondel, die uns an Land bringen soll“, sagte Kathryn, als sie sich zu ihrer Begleiterin umwandte. „Wir werden zu dem Gebäude gebracht, das Onkel Charles für uns gemietet hat. Er selbst hat sich sofort mit diesem Freund verabredet. Ich glaube, er sprach von einem Signor Santorini.“
„Ich bin mir sicher, dass er auf Neuigkeiten hofft.“ Lady Mary unterdrückte ein Seufzen. „Nun, zumindest bekommen wir dadurch die Möglichkeit, uns in Ruhe einzugewöhnen. Männer sind in solchen Momenten immer nur im Weg.“
Kathryn lächelte, antwortete aber nicht. Hätte sie die Wahl gehabt, so hätte sie sich gewünscht, mit ihrem Onkel dem Treffen beizuwohnen. Aber sie war nicht gefragt worden. Mit Sicherheit war sie Lady Mary eine wesentlich größere Hilfe – dennoch konnte sie ihre Ungeduld kaum verbergen, wartete doch auch sie auf aktuelle Meldungen.
„Ich hoffe, Ihr hattet eine angenehme Reise, Sir?“ Lorenzo erhob sich, um seinem Besucher entgegenzutreten. Er hatte einen der kleineren Salons rechts von der großen Eingangshalle gewählt, um seinen Gast zu empfangen, denn der Raum war anheimelnder und trug zu einer persönlichen Atmosphäre bei. „Es ist mir eine Freude, Euch endlich kennenzulernen, Lord Mountfitchet.“
Seine Worte klangen offen und ehrlich. Er ließ seinen Blick über den älteren Mann wandern und stellte fest, dass er sich auf eine Art und Weise zu ihm hingezogen fühlte, wie es unter Fremden nicht oft vorkam. Er sah Spuren von Leid im Antlitz des anderen, graues Haar an seinen Schläfen und in seinem Bart. Es war ein Gesicht, das vor seiner Zeit alt geworden war, das Gesicht eines Mannes, der große Trauer empfunden hatte. Aus irgendeinem Grund stimmte sein Leid Lorenzo leicht schwermütig, obwohl der Mann für ihn ein Fremder war.
„Kommt, Sir, wollt Ihr nicht ein Glas Wein mit mir trinken? Bitte, setzt Euch.“ Er deutete auf den bequemsten Stuhl im Salon, einer in England unüblichen Art von Sessel mit einem gut gepolsterten Sitz und einem komfortablen, niedrigen Rücken, der so geformt war, dass ein Mann bequem Platz darin hatte. „Ich vermute, Ihr seid müde von der Reise?“
„In der Tat, ein Glas Wein wäre mir sehr genehm, Signor Santorini“, erwiderte Charles Mountfitchet, als er seinen Platz einnahm. „Meine Schwester und meine Nichte wollten, dass ich sie in unsere Unterkunft begleite und erst einen Tag ausruhe, aber ich konnte es nicht erwarten, mich mit Euch zu treffen.“
„Unglücklicherweise habe ich keine Neuigkeiten von Eurem Sohn“, sagte Lorenzo. „Aber es gibt einen Mann, den ich Euch gern vorstellen würde, Sir. Er wurde vor zwei Monaten von einer Korsarengaleere befreit, doch bislang war er zu krank, um befragt zu werden. Wir glauben, dass er Engländer sein könnte, obwohl er noch kaum ein Wort gesprochen hat.“
„Wie sieht er aus?“, fragte Charles. Er war kaum in der Lage, seine Aufregung zu verbergen. „Welche Farbe haben sein Haar und seine Augen?“
„Welche Farbe hatte das Haar Eures Sohnes? Hatte er irgendwelche besonderen Merkmale?“ Lorenzo Santorini wollte eine Beschreibung von Lord Mountfitchet.
Charles dachte einen Augenblick lang nach. „Es schmerzt mich, das zu sagen, aber ich habe Richards Gesicht nicht mehr vor Augen. Sein Haar war hell – dunkler als das Eure, aber von ähnlicher Beschaffenheit. Seine Augen waren blau …“ Er runzelte die Stirn. „Meine Beschreibung würde auf tausend Männer passen. Ich fürchte, ich helfe Euch nur wenig, Sir. Aber so leid es mir tut, das zuzugeben, ich verbrachte nur wenig Zeit mit meinem Sohn, als er jung war. Er war da, und ich nahm mein Glück als selbstverständlich hin. Erst als ich ihn verlor, verstand ich, was er mir bedeutet hat.“ Seine Stimme brach, als er von seinen Gefühlen überwältigt wurde.
„Ja, ich glaube, so ist es oft“, antwortete Lorenzo. Er war sich nicht sicher, warum Lord Mountfitchets Geschichte ihn so berührte, denn er neigte nicht zu Sentimentalität. „Wir alle nehmen das, was wir haben, als selbstverständlich hin. Mein Vater starb vor einigen Monaten, und ich vermisse ihn schmerzlich. Ich war oft fort, und im Nachhinein bedauere ich, dass ich ihm gegenüber nicht mehr Dankbarkeit zeigte.“
„Es traf mich sehr, von Antonios Tod zu hören. Wir begegneten uns nur zweimal, das war, als er England besuchte, aber wir fühlten uns einander verbunden.“ Charles zögerte, bevor er fortfuhr. „Mir war damals nicht bewusst, dass er einen Sohn hatte.“
„Ich wurde vor einigen Jahren adoptiert“, erklärte Lorenzo und offenbarte damit mehr als üblich. „Mein Vater war ein guter und großzügiger Mann. Ich verdanke ihm viel. Er war nicht wohlhabend, und so sah ich es als meine Aufgabe an, unser Los zu verbessern. Ich bin froh, dass ich es ihm ermöglichen konnte, zum Schluss unbeschwert zu leben.“
„Er hatte Glück, Euch als Sohn zu haben. Ich kümmerte mich mit all meiner Kraft um mein Anwesen, immer in der Hoffnung, dass Richard es doch einmal übernehmen könnte. Aber es wäre mir eine große Erleichterung gewesen, ihn in meiner Nähe zu wissen. Ich fürchte, ich werde langsam alt, und die Tage erscheinen mir einsam.“ Sein Blick war von Trauer umwölkt, die Jahre der vergeblichen Suche hatten tiefe Spuren in sein Gesicht gegraben.
„Der Mann, den ich Euch vorstellen möchte, hat blaue Augen“, sagte Lorenzo mit gerunzelter Stirn. „Was sein Haar angeht – es ist bei all dem, was er durch seine Entführer ertragen hat, grau geworden. Ich muss Euch warnen, denn dieser Mann hat furchtbare Narben auf dem Rücken, auf Armen und Beinen.“
„Der arme Teufel“, erwiderte Charles, und seine Hände zitterten, als er seinen Wein trank. Er nahm einen tiefen Atemzug, während er versuchte, die Bilder aus seinen Gedanken zu vertreiben – Bilder, die ihn in seinen Träumen seit Jahren verfolgt hatten, von seinem Sohn, wie er geschlagen und gefoltert wurde. „Dieser Wein ist ausgezeichnet.“ Mit diesem Themenwechsel unternahm er eine große Anstrengung, seine Albträume zu besiegen. „Eine neue Sorte, wenn ich nicht irre? Ihr habt mir diesen Wein bisher noch nicht geschickt, nicht wahr?“
„Er stammt von einem Weingut auf Zypern“, bestätigte Lorenzo. „Ich probiere ihn erst, bevor ich ihn in mein Sortiment aufnehme.“ Er füllte den Becher seines Gastes erneut. „Ich werde selbst mit dem Mann sprechen, den ich erwähnte, und ihn fragen, ob er Euch sehen will.“ Er sah die Überraschung im Blick des anderen Mannes. „Er ist nicht mein Gefangener. Er wurde vom Wrack einer Galeere gerettet, und wir haben ihn gepflegt, als wir ihn vollkommen schwach fanden. Nun, da es ihm wieder gut geht, wird er die Wahl haben. Er kann als freier Mann für mich arbeiten oder in seine Heimat zurückkehren. Wenn er mich bittet, ihm zu helfen seine Familie zu suchen, so werde ich ihn unterstützen.“
„Verlangt Ihr ein Lösegeld für ihn?“
„Wenn seine Familie es sich leisten kann. Ich bin Geschäftsmann, Sir.“
„Und wenn er keine Familie hat?“
„Dann hat er die Freiheit hinzugehen, wo er will – oder bei mir zu bleiben.“ Für einen Moment verdunkelten sich Lorenzos Augen. Er hob herausfordernd den Kopf. „Ich habe ihm sein Leben zurückgegeben. Was wollt Ihr mehr?“
„Nichts, was Ihr ihm nicht schon gegeben habt“, erwiderte Charles. „Was mich betrifft, so wäre ich glücklich, für die Rückkehr meines Sohnes zu bezahlen.“
„Ich wünschte, ich könnte Euch mehr Hoffnungen machen“, sagte Lorenzo. „Aber lasst uns über andere Dinge sprechen. Ihr habt die Absicht, Euch auf Zypern niederzulassen?“
„Ich denke über ein eigenes Weingut nach.“
„Dann kann ich Euch in dieser Angelegenheit vielleicht eine größere Hilfe sein“, antwortete Lorenzo. „Kommt morgen Abend zum Essen. Bringt Eure Schwester und Eure Nichte mit. Vielleicht kann ich bis dahin diesbezüglich einige Erkundigungen für Euch einziehen.“
„Danke. Das ist sehr freundlich von Euch.“