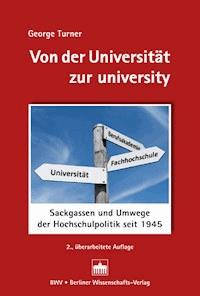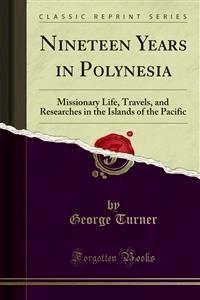69,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Duncker & Humblot
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Die Debatte um eine Reform der Universitäten begann schon bald nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Ende der 1960er wurde Hochschulpolitik ein zentrales Thema der Politik. Seither wird an den Hochschulen reformiert, die Reform korrigiert, diese erneut novelliert usw. Die Hochschulen und ihre Mitglieder sind permanent Änderungen, politischen Modeerscheinungen, parteigefärbten Eintagsfliegen und damit ständig wechselnden Vorgaben unterworfen. Das kann nicht verwundern, wenn man bedenkt, wer alles Interesse am tertiären Bildungsbereich hat und dies auch lautstark kundtut. Damit werden unterschiedliche Vorstellungen und Forderungen an den Gesetzgeber gestellt und die Hochschulen zentrifugalen Kräften ausgesetzt. Ein Manko bei Novellierungen ist oft, dass nur ein gesondertes Problem gelöst wird, ohne dass Folgen und Nebenwirkungen in verschiedenen Bereichen bedacht werden. Solche Zusammenhänge verdeutlicht die vorliegende Darstellung und ist damit für die Beurteilung aktueller Gegebenheiten ein unverzichtbares Hilfsmittel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
GEORGE TURNER
Hochschulreformen
Hochschulreformen
Eine unendliche Geschichte seit den 1950er Jahren
Von George Turner
Duncker & Humblot · Berlin
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten © 2018 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Satz: Konrad Triltsch GmbH, Ochsenfurt Druck: buchbücher.de gmbh, Birkach Printed in Germany
ISBN 978-3-428-15424-1 (Print) ISBN 978-3-428-55424-9 (E-Book) ISBN 978-3-428-85424-0 (Print & E-Book)
Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706 ♾
Internet: http://www.duncker-humblot.de
„Kaum eine Landesregierung kann der Versuchung widerstehen, nach jeder Wahl das geltende Hochschulgesetz zu novellieren. So entsteht ein verwirrender Zickzack-Kurs.“
George Turner
Vorwort
Mit der Veröffentlichung „Hochschule zwischen Vorstellung und Wirklichkeit“, erschienen im Jahr 2001, habe ich den Versuch unternommen, die Geschichte der Hochschulreform im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts darzustellen. Inzwischen sind mehr als 17 Jahre vergangen und neue Begriffe wie „Bologna“ und „Exzellenzinitiative“ beschäftigen die Fachleute und erhitzen die Gemüter. Deshalb war eine Fortschreibung angebracht.
Der vorliegende Band geht über eine Überarbeitung als 2. Auflage hinaus. Die Gliederung folgt anderen Kriterien. Auch in dem neuen Titel kommt die Eigenständigkeit zum Ausdruck. Die Entwicklung des Hochschulwesens bis zum Jahr 2000 in sehr detaillierter Form wird nicht in gleicher Weise fortgesetzt. Dies schien für die Anfänge geboten, um die Art der Auseinandersetzung, aber auch das Bemühen vieler Akteure um Lösungen deutlich zu machen. Für die Zeit nach der Jahrtausendwende wird nur versucht, die wesentlichen Linien und Entscheidungsalternativen darzustellen, um den Text nicht mit zu vielen Einzelheiten zu befrachten.
Es bestand nicht die Absicht, ein Handbuch zu verfassen, das alle Erscheinungen des Hochschulwesens darstellt. Vielmehr soll gezeigt werden, wie wechselhaft Hochschulpolitik war und ist und wie wenig feste Grundlagen als allgemein verbindlich anerkannt sind. Manches scheint, chronologisch dargestellt, womöglich zu sehr aus der seinerzeitigen Perspektive betrachtet. So finden viele Personen Erwähnung, die keine dauerhaften Spuren in der Bildungspolitik hinterlassen haben. Das entspricht dem Anliegen, die Irrungen und Wirrungen in der deutschen Hochschulpolitik offen zu legen. Hier kam es darauf an zu zeigen, was zu den verschiedenen Zeiten als wichtig empfunden wurde. Insofern ist es weiter eine „Geschichte der Hochschulreform“. Dazu findet sich ansonsten kaum etwas in der Literatur. Es soll auch erklärt werden, was die Öffentlichkeit erreicht hat und wie vieles davon zu relativieren ist. Daraus kann die Erkenntnis gewonnen werden, dass auch heute vehement diskutierte Themen schnell erledigt sein können: ein Beleg für die Aussage, dass zu viele Moden oder Gags eine Rolle spielen und es an einem „Hauptnenner“ in der Hochschulpolitik fehlt.
Die Debatte um eine Reform der Universitäten begann schon bald nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Ende der 1960er wurde Hochschulpolitik ein zentrales Thema der Politik. Seit über 50 Jahren wird an den Hochschulen reformiert, die Reform korrigiert, diese erneut novelliert, wieder reformiert, usw. Die Hochschulen und ihre Mitglieder sind permanent Änderungen, politischen Modeerscheinungen und parteigefärbten Eintagsfliegen und damit ständig wechselnden Vorgaben unterworfen. Im Allgemeinen fühlt sich jede Landesregierung bemüßigt, zu Beginn einer Le[8]gislaturperiode zunächst einmal das Hochschulrecht in mehr oder weniger grundsätzlichen Punkten zu novellieren. Dabei gibt es erhebliche Unterschiede in der Ausgestaltung. Das kann nicht verwundern, wenn man bedenkt, wer alles Interesse am tertiären Bildungsbereich hat und dies auch lautstark kund tut: Parteien, Bundesund Länderministerien, Fraktionen und Ausschüsse in den Parlamenten, Kultusministerkonferenz, Wissenschaftsrat, Rektorenkonferenz, Rechnungshöfe und Interessenverbände aller Art wie Hochschul- und Lehrerverbände, Organisationen der Wirtschaft, Gewerkschaften usw. usw. Das lässt erkennen, welche unterschiedlichen Vorstellungen und Forderungen an den Gesetzgeber gestellt werden und welchen zentrifugalen Kräften die Hochschulen ausgesetzt sind. Ein Manko bei Novellierungen ist oft, dass nur ein gesondertes Problem gelöst wird, ohne dass Folgen und Nebenwirkungen in verschiedenen Bereichen bedacht werden. Das ist bei fast allen Gegenständen von Reformen zu beobachten. Um solche Zusammenhänge zu verdeutlichen, sind inhaltliche Wiederholungen im Text gelegentlich unvermeidbar.
Die Gründe für ein breites Interesse der Öffentlichkeit an den Hochschulen liegen auch darin, dass die Zahl der Studierenden an der gleichaltrigen Bevölkerung innerhalb von etwas mehr als 50 Jahren von 300 Tsd. auf rund 2,85 Mill. bzw. von 5% auf über 50% der relevanten Altersgruppe gestiegen ist und damit viel größere Bevölkerungskreise an dem Anteil nehmen, was an den Hochschulen geschieht. Wer den Zick-Zack-Kurs der Hochschulpolitik begreifen, wer manche Ungereimtheiten verstehen will, die das Ergebnis von Kompromissen waren, wer sich ein eigenes Urteil über die vielfältigen Aspekte der Hochschulpolitik bilden möchte, kann das nur, wenn er die unterschiedlichen Interessenlagen in dem Gewirr von Entwürfen erkennt und dabei die eigentlichen Aufgaben der Hochschule nicht aus dem Blick verliert.
Der Autor ist seit Mitte der 1960er in verschiedenen Funktionen mit Problemen des Hochschulwesens befasst. Dies hat zu einer großen Zahl schriftlicher Äußerungen geführt, auf die in den Fußnoten hingewiesen wird. Insoweit ist der vorgelegte Band auch eine Art persönlicher Rechenschaftslegung.
Herrn Dr. Stefan, Kaufmann, MdB, und Frau Brigitte Goebbels-Dreyling, stellvertretende Generalsekretärin der Hochschulrektorenkonferenz, danke ich für mannigfache sachliche Anregungen und Hinweise, meiner Frau Edda für die Durchsicht des Manuskripts und Unterstützung bei der Anlage der Register.
Berlin, im Januar 2018
George Turner
Inhaltsverzeichnis
A.
Zur Entwicklung des Hochschulwesens in Deutschland
I.
Die Ausgangslage nach dem Zweiten Weltkrieg
II.
Die „goldenen“ Fünfzigerjahre
III
Die Ausbildungsrevolution
1.
Bildungsnotstand
2.
„1968“
a)
Die Bewegung
b)
Wirkungen
IV.
Vom Reformkonsens zur Konfrontation
V.
Stabilitätspolitik und Ernüchterung
B.
Die Reformprojekte – Gegenstände der Hochschulpolitik
I.
Ausbau der Hochschulen
1.
Chancengleichheit
a)
Quantitative Aspekte
b)
„Bildung“
2.
Öffnung der Hochschulen
3.
Bewältigung der Überlast
4.
Die „Pakte“
II.
Neuordnung
1.
Gruppenuniversität
a)
Demokratisierung
b)
Drittelparität
c)
Grenzen der Mitbestimmung
d)
Leitungsstruktur
aa)
Professionalisierung
(1)
Rektorats-/Präsidialverfassung
(2)
Kollegiale Leitung
(3)
Schranken einerseits, fehlende Orientierung andererseits
(4)
Prämierung
bb)
Hochschulräte
e)
Bilanz
2.
Mandat der verfassten Studentenschaft
3.
Ordnungsrecht
III.
Schule – Studium – Beruf
1.
Oberstufenreform
a)
Abschaffung der Gliederung nach Schultypen/Kurssystem
b)
Studierfähigkeit
c)
Ringen um Reform der Reform
d)
„Baustelle“ Gymnasium
2.
Dauer der Schulzeit
a)
Die „neuen Bundesländer“ als Impulsgeber
b)
Bedenken aus unterschiedlichen Interessen
c)
Kompromissvorschläge
d)
„Zurück auf Los“
3.
Zulassungsbeschränkungen
a)
Bedarf an Studienplätzen
b)
Bürokratische Regelungen
c)
Eingangsprüfungen
d)
Medizin als negatives Musterbeispiel
4.
Hochschulzugang ohne Reifezeugnis
a)
Entwertung des Abiturs?
b)
„Aufstieg durch Bildung“
c)
Widersprüchliches Handeln
5.
Studiengebühren
a)
Abschaffung als Teil der Bildungsexpansion
b)
Versuche der Wiedereinführung
aa)
Strafgebühr
bb)
Einschreib- bzw. Rückmeldegebühr
cc)
Überraschende Initiative
dd)
Vorstoß der HRK und Reaktionen
c)
Das latente Problem
6.
Ausbildungsförderung
a)
Vom Honnefer Modell zum BaföG
b)
Anpassungen
aa)
Darlehnsformen
bb)
Bestandsaufnahme
cc)
Modelle
dd)
Lösungsversuche
ee)
Kleine BaföG-Reform
ff)
Weitere Versuche
7.
Organisation des Studiums
a)
Versuche zur Studienzeitverkürzung
aa)
„Entrümpelung“
bb)
Freischuss
cc)
Zwangsmittel
dd)
Kurzstudium
ee)
Konsekutive Studiengänge
(1)
Anglo-amerikanisches System?
(2)
Ausbau der Fachhochschulen
(3)
Übergänge
b)
Bachelor/Master
8.
Akademikerbedarf
a)
Prognosen
b)
Akademikerwahn
c)
Kontraproduktives Verhalten
9.
Weiterbildung
IV.
Das Verhältnis von Staat und Hochschulen
1.
Finanzierung
2.
Autonomie
3.
Flexibilisierung/Globalhaushalt
4.
Deregulierung und Föderalismus
V.
Wettbewerb
1.
Interner Wettbewerb
a)
Personalstruktur/Nachwuchsförderung
aa)
Assistenzprofessur
bb)
Hilfskonstruktionen
cc)
Habilitation
dd)
Unvollkommene Folgenbeseitigung
b)
Vergütungssystem
aa)
Leistungsorientierte Besoldung
bb)
Lösungsversuche
cc)
Derzeitiger (Zwischen-)Stand
c)
Mittelverteilung und Verwendung
d)
Evaluation der Lehre und Qualitätssicherung
2.
Externe Konkurrenz
a)
Ranking
aa)
Kriterien
bb)
Gewichtung
cc)
Falsche Signale
dd)
Entscheidungsgrundlagen
b)
Exzellenzinitiative
aa)
Auswahlverfahren
(1)
Sieger der 1. Runde
(2)
Blankoscheck
(3)
Ländergefälle
(4)
Die 2. Runde
bb)
„Nebenwirkungen“
(1)
„Trittbrettfahrer“
(2)
Das böse Erwachen
cc)
Der „Rest“
(1)
Sortierung
(2)
Verdeckte Absicht: Fehlerbereinigung
dd)
Fortführung des Programms
(1)
Position des Wissenschaftsrats
(2)
Die Imboden-Kommission
(3)
Die Entscheidung
c)
Private Hochschulen
aa)
Beispiele
(1)
Laufende Vorhaben
(2)
Gescheiterte Versuche
bb)
Modellcharakter?
cc)
Eliteschmieden?
dd)
Konzentration?
VI.
Struktur des tertiären Bereichs
1.
Hochschularten neben Universitäten
a)
Gesamthochschule
b)
Fachhochschulen
aa)
Ursprünglicher Auftrag
bb)
Streben nach Gleichwertigkeit mit Universitäten
cc)
Fehlsteuerungen
c)
Berufsakademien
d)
Pädagogische Hochschulen
e)
Ressorthochschulen
2.
Strukturreformen
C.
Ergebnis: Perspektive
I.
Universität der Zukunft
II.
Hierarchisierung
III.
Anfälligkeit für Reformen
Literatur- und Quellenverzeichnis
Personenverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
(nicht aufgenommen sind gängige, allgemein bekannte Abkürzungen und Erklärungen von Abkürzungen im Text)
a.a.O.
am angegebenen Ort
APO
Außerparlamentarische Opposition
ASTA
Allgemeiner Studentenausschuss
BA
Berufsakademie
B. A.
Bachelor of Arts
BAföG
Bundesausbildungsförderungsgesetz
BAK
Bundesassistentenkonferenz
Bd.
Band
BDA
Bundesverband der Deutschen Arbeitgeberverbände
BDI
Bundesverband der Deutschen Industrie
BerlHG
Berliner Hochschulgesetz
BFW
Bund Freiheit der Wissenschaft
BGBI.
Bundesgesetzblatt
BLK
Bund/Länder-Kommission
BVerfG
Bundesverfassungsgericht
BVerfGE
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
BW
Baden-Württemberg
CHE
Centrum für Hochschulentwicklung GmbH (Gütersloh)
CV
Cartellverband der katholischen Studentenverbindungen
DFG
Deutsche Forschungsgemeinschaft
DGB
Deutscher Gewerkschaftsbund
DHV
Deutscher Hochschulverband
DIHT
Deutscher Industrie- und Handelstag
DÖV
Die Öffentliche Verwaltung
dpa
Deutsche Presse-Agentur
DSW
Deutsches Studentenwerk
DUZ
Deutsche Universitätszeitung
DZHW
Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung
e.V.
eingetragener Verein
EWG
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
FAZ
Frankfurter Allgemeine Zeitung
FH
Fachhochschule
Fn.
Fußnote
FR
Frankfurter Rundschau
fzs
freier Zusammenschluss von StudentInnenschaften
GEW
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
GWK
Gemeinsame Wissenschaftskommission
HambHG
Hamburgisches Hochschulgesetz
[16] HB
Handelsblatt
HIS
Hochschul-Informations-System (Hannover)
HRG
Hochschulrahmengesetz
Hrsg.
Herausgeber
hrsg.
herausgegeben
HRK
Hochschulrektorenkonferenz (seit 5.11.90 anstelle von WRK)
IAB
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-Forschung der Bundesanstalt für Arbeit (Nürnberg)
i.d.F.
in der Fassung
IM
Inoffizieller Mitarbeiter (des Ministeriums für Staatssicherheit)
i.V.m.
in Verbindung mit
JUSO
Jungsozialisten
KMK
Kultusministerkonferenz
LHG
Landeshochschulgesetz
LHO
Landeshaushaltsordnung
MittAB
Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
MittHV
Mitteilungen des Hochschulverbands
MPI
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
m.w.N.
mit weiteren Nachweisen
n.c./N.C.
numerus clausus
No ./Nr.
Nummer
o.ä.
oder ähnliches
OECD
Organization for Economic Cooperation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)
Phys. Bl.
Physikalische Blätter
RAF
Rote Armee Fraktion
RCDS
Ring christlich demokratischer Studenten
SDS
Sozialistischer Deutscher Studentenbund
SfH
Stiftung für Hochschulzulassung
Stasi
Staatssicherheit
StZ
Stuttgarter Zeitung
SZ
Süddeutsche Zeitung
UGBW
Universitätsgesetz Baden-Württemberg
VDS
Verband Deutscher Studentenschaften
vgl.
vergleiche
VOP
Verwaltung, Organisation, Personal: Die Zeitschrift für erfolgreiches Verwaltungsmanagement
WamS
Welt am Sonntag
WG
Wohngemeinschaft
WHU
Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung
WissR
Wissenschaftsrecht
WR
Wissenschaftsrat
WRK
Westdeutsche Rektorenkonferenz (seit 5.11.90 HRK)
WZB
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
Zit.
Zitat
zit.
zitiert
ZVS
Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (Dortmund)
A. Zur Entwicklung des Hochschulwesens in Deutschland
I. Die Ausgangslage nach dem Zweiten Weltkrieg
Bereits im Herbst 1945 wurden an einigen Universitäten wieder Lehrveranstaltungen durchgeführt. Das Bild wurde bestimmt durch die zurückgekehrten Kriegsteilnehmer, die Flüchtlinge aus dem Osten und die allgemeine schlechte materielle Lage mit dem Existenzkampf zum Überleben. Die Studentenzahlen an den Universitäten in den drei westlichen Besatzungszonen überstiegen schon bis 1948 die Zahlen in der Weimarer Republik (100.000). Die Ausrichtung der Universitäten folgte Vorstellungen der Zeit vor dem Nationalsozialismus und knüpfte bewusst an die klassische Universität an. Dies geschah nicht zuletzt deshalb, weil die Alliierten sich nicht auf einen gemeinsamen Plan zur Re-Education einigen konnten1. Da viele der jüngeren Professoren als politisch belastet entlassen wurden2, hielten vor allem ältere Kollegen den Betrieb aufrecht, viele bereits vor 1933 tätig, von denen manche aus politischen oder rassistischen Gründen zwischenzeitlich aus dem Hochschuldienst entfernt worden waren3. Sie orientierten sich an ihren Erfahrungen aus jener Zeit und an den Prinzipien der Humboldtschen Idee der Universität4. Diese war Ausdruck preußisch-protestantischer Kritik an einem mehr oder minder schulmäßigen Lehr- und Lernbetrieb im Zeitalter der Aufklärung gewesen. Sie wurde das prägende Vorbild für alle deutschen Universitäten im 19. und 20. Jahrhundert. Die Idee der Universität bedeutet den Übergang von der doctrina zur Forschung oder, wie Wilhelm v. Humboldt es selber definiert hat: den Übergang zur „Wissenschaft, die noch nicht ganz gefunden ist“. Als mit der Universität zutiefst verbunden wurde begriffen: „an Forschung teilzunehmen“. Das aber war nicht gleichgesetzt mit der Vorbereitung für einen Beruf, in dem Wissenschaft zur Anwendung gelangte, sondern meinte allgemein „Bildung“5. Grundwerte dieser Universitätsidee waren die Freiheit der Studiengestaltung und die „Einsamkeit der forschenden Arbeit“. Es galt als selbstverständlich, diese Werte als Vorbildung für Berufe fruchtbar zu machen, aber nicht in der Weise, dass die Universität ausgerichtet sein sollte als „Berufs[18]schule“, die nur den Fachmann hervorbringt. Ausbildung für Berufe hat fraglos auch die klassische Universität betrieben. Doch galt ihr dies nur als Teilaspekt, im Extremfall als Nebenprodukt der eigentlichen wissenschaftlichen Bemühungen6.
Die deutschen Universitäten galten als Muster und Beispiel für ihre hervorragenden akademischen Leistungen, ihre Autonomie, trotz der Finanzierung durch den Staat, ihren elitären Charakter und die herausragende Position und Macht der auf Lebenszeit berufenen Professoren, der Ordinarien. Zusammenfassend beschreibt Hans-Peter Schwarz die Situation7: „Jede Disziplin bewegte sich in die Nachkriegswelt in der Mitte des letzten Jahrhunderts mit jener Vielfalt der Ansätze, Methoden, Doktrinen hinein, die sich weitgehend in der Zeit vor dem „Dritten Reich“ gebildet hatten. Neben der Vielfalt in den Fächern wirkte im Umkreis der einzelnen Lehrstühle das durchaus noch erfolgreiche Bestreben der Ordinarien, ihre Studenten im Sinn der wissenschaftlichen Auffassungen zu prägen, die sie für die allein angemessenen hielten. Tatsächlich gelang es ihnen vielfach, durch ihre Vorlesungen, Seminare und Veröffentlichungen jene Studenten nachhaltig zu beeinflussen, die sich auf das Studium bei ihnen einließen oder einlassen mussten. Die Strenge war meist größer als die Liberalität; aber es gab beides. Vielen war schon damals bewusst, dass die Institutionen und die geistigen Grundlagen der deutschen Universität auf schwankendem Boden standen.“ Stimmen, dass die Ausrichtung an der Zeit vor 1933 zu eng sei, gab es bereits zu Beginn. So äußerte sich Karl Jaspers in seinem berühmt gewordenen Vortrag „Erneuerung der Universität“ schon im August 1945 in Heidelberg, dass es um nichts weniger gehen müsse als um eine „Erneuerung“, einen Neubeginn, der kein „einfaches Anknüpfen an den Zustand vor 1933“ sein könne8. In den folgenden Jahren erschienen eine Reihe von Gutachten und Vorschlägen zur Organisationsreform, die alle nicht umgesetzt wurden9.
Repräsentanten der Universitäten betonten bis in die 1960er Jahre und gelegentlich auch noch später, dass Wissenschaft ihren Zweck allein in sich selbst trage, insbesondere in Gestalt der nur der reinen Erkenntnissuche verpflichteten Grundlagenforschung. Soweit es Reaktionen auf die ideologische und machtpolitische Indienstnahme der Wissenschaft während des „Dritten Reichs“ von 1933 bis 1945 und auf die Entwicklung in der DDR waren, erschien dies verständlich10. Während im sowjetischen Einflussgebiet Deutschlands das Bildungswesen dem „Aufbau des Sozialismus dienen“ sollte und bis zum Ende der DDR im Sinn des Klassenkampfes instrumentalisiert und zentral organisiert wurde, begannen die Deutschen in der Bundesrepublik, eine ihnen aus der Zeit vor dem Nationalsozialismus vertraute [19] Gesellschaft und deren Institutionen in ihren wesentlichen Zügen wieder zu errichten. Das Herkömmliche hatte seine Chance11.
Die Jugendlichen der 50er Jahre zeichnete eine Absage an die Romantik, ein privater Personenbezug und eine Pseudo-Erwachsenheit aus12. Für die spätere Entwicklung ist von Bedeutung, dass den Ländern für zwei Jahrzehnte in „Wiederaufnahme föderalistischer Traditionen“13 die Zuständigkeit für das Bildungswesen allein übertragen wurde. Eine gewisse Koordination erfolgte bei den Universitäten durch die 1948 gegründete Westdeutsche Rektorenkonferenz (WRK) und unter den Ländern durch die Kultusministerkonferenz (KMK). Die Beschlüsse dieser 1949 geschaffenen Arbeitsgemeinschaft der Länder hatte allerdings nur Empfehlungscharakter. Der Bund erhielt erst 1969 begrenzte Kompetenzen, zu einer Zeit, als die öffentliche Debatte um die Universitäten längst eingesetzt hatte. 37 Jahre später, im Jahr 2006, sind im Zuge der sog. Föderalismusreform die Befugnisse der Länder wieder gestärkt und der Bund fast völlig aus der Zuständigkeit für die Hochschulen entlassen worden. Inzwischen ist auch diese Reform reformiert worden14.
II. Die „goldenen“ Fünfzigerjahre
In den ersten eineinhalb Jahrzehnten nach Ende des Krieges sind noch einmal drei Generationen im Geist der alten deutschen Universität geformt worden: Einmal die Studierenden der ersten Nachkriegsgeneration. Sie hatten am Krieg teilgenommen oder den Krieg unmittelbar miterlebt, ebenso wie den Zusammenbruch der Weltanschauung, in der sie erzogen worden waren. Teilweise befanden sie sich bereits weit in den Zwanzigern, zeigten eine bemerkenswerte geistige Aufgeschlossenheit, einen ausgesprochenen Gestaltungswillen und strebten nach schneller beruflicher Sicherung. Nachdem diese Studentengeneration die Universitäten verlassen hatte, folgten diejenigen, die zwar unter der nationalsozialistischen Herrschaft aufgewachsen waren, ihre Hochschulreife aber erst später erworben hatten. Sie suchten nach neuer Orientierung. Schließlich kam die darauf folgende Generation an die Hochschulen, noch Kinder in der Nachkriegszeit und während des wirtschaftlichen Wiederaufbaus. Sie sahen das Studium vor allem als Basis für die spätere berufliche Tätigkeit15.
Die Ausbildung in den überkommenen Formen war allerdings nur deshalb möglich, weil die Zahl der Studenten überschaubar blieb, wenngleich sich auch zu jener Zeit das Massenphänomen bereits abzeichnete. Überfüllte Hörsäle und ein zu [20] geringer Bücherbestand in den Bibliotheken wurden als wesentliche Beeinträchtigungen beim Studium empfunden.
Die durchschnittliche deutsche Universität oder Technische Hochschule in der ersten Hälfte der fünfziger Jahre hatte zwischen 4.000 und 6.000 Studenten16. München, die größte Universität, zählte rund 11.000, klassische Universitäten wie Tübingen, Marburg oder Göttingen etwa 5.000. Der Anteil weiblicher Studierender betrug 25 %, wobei es Unterschiede zwischen den Fächern gab. An den höheren Schulen machten 1950 nur rund 3 Prozent eines Jahrgangs das Abitur. Die Bildungsinhalte an den Schulen in den Bundesländern waren im Wesentlichen dieselben. Auch in diesem Bereich war es der letzte Zeitabschnitt, in dem ein einigermaßen homogenes Wissen nach weitgehend einheitlichen Lehrplänen von annähernd gleichwertig ausgebildeten Lehrern vermittelt wurde. Die vergleichsweise breite Allgemeinbildung, mit der die Studenten zum Studium kamen, hatte immerhin noch ein gewisses Interesse an einem studium generale zur Folge. Geistig rege Studenten haben sich damals oft nicht auf ein reines Fachstudium beschränkt. Manche orientierten sich eine Zeitlang an jenen Professoren, die über ihre Disziplin hinaus wirkten und von denen es an den meisten Universitäten einige gab17.
Die überschaubaren Größenordnungen an den Universitäten in den frühen und mittleren fünfziger Jahren ermöglichten ein lebendiges interdisziplinäres Gespräch, gekennzeichnet durch intensive Bemühungen um die Klärung von Grundsatzfragen und eine überall noch ziemlich stark traditionelle Ausrichtung. Kaum eine Spur von Traditionsbruch war festzustellen, allerdings Merkmale von institutioneller Schwerfälligkeit. Eine Diskussion etwa um die Stellung der Universität und ihrer Mitglieder in der Gesellschaft nach 1933 fand nicht statt18. Die Professoren blieben bei solchen Themen „zugeknöpft“; allenfalls wurde auf abgeschlossene Entnazifizierungsverfahren verwiesen. Es blieb späteren Studentengenerationen überlassen, danach zu fragen, wie einzelne sich während der Zeit des Nationalsozialismus verhalten haben, gepaart mit Unverständnis darüber, warum nicht schon früher Antworten eingefordert worden seien. Treffend schreibt Hartmut Boockmann19: „Die Kinder derer, die nach 1945, ernüchtert und erleichtert angesichts des zu Ende gehenden Schreckens, in den Hörsälen saßen, sollten 25 Jahre später ihren Eltern vorwerfen, damals nicht erst jahrelang Grundsatzdebatten geführt zu haben, bevor sie sich ans Studium und an die Erarbeitung jener komfortablen Lebensumstände machten, unter denen sie, die Kinder, nun litten.“
[21] Ohne dass es den Professoren und Studenten jener Jahre bewusst war, erlebten sie damals die „Abendröte der alten deutschen Universität“20.
III. Die Ausbildungsrevolution
1. Bildungsnotstand
„Das Mandarinentum der deutschen Ordinarien“ ging mit den fünfziger Jahren zu Ende.21 Vereinzelt schon ausgangs jenes Jahrzehnts, vor allem aber am Anfang der sechziger Jahre wurden in der Bundesrepublik kritische Stimmen laut, welche auf gewisse Unzulänglichkeiten, unter anderem bei den Lehrmethoden, und auf die oligarchische Verfassung der Universitäten hinwiesen. Beobachter der Entwicklung wussten damals schon, dass eine Entscheidung zu fällen war, ob in Zukunft die vorhandenen Universitäten und Technischen Hochschulen ausgebaut oder neue Einrichtungen gegründet werden sollten.22
Der Warnruf des Pädagogen Georg Picht von der Bildungskatastrophe,23 ist wohl das markanteste Datum für den Beginn der modernen Diskussion über Hochschule und Gesellschaft24. Er setzte den Bildungsnotstand mit wirtschaftlichem Notstand gleich und prophezeite ein rasches Ende des eingetretenen wirtschaftlichen Aufschwungs, wenn qualifizierte Nachwuchskräfte fehlten, ohne die im technischen Zeitalter kein Produktionssystem etwas leisten könne. Die Zahl der Abiturienten sei das geistige Potenzial eines Volkes, und von diesem seien in der modernen Welt die Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft, die Höhe des Sozialprodukts und die politische Stellung abhängig.25 Aus dem im Vergleich zu anderen Industrienationen geringeren Anteil der Bildungsausgaben am Bruttosozialprodukt der Bundesrepublik leiteten neben Picht auch weitere Kritiker eine nachrangige, unterwertige Rolle der Bildung auf der nationalen Prioritätenliste ab.26 Den quantitativen Mangel sah man darin, dass es zu wenige Abiturienten, zu wenige Lehrer und überfüllte Hochschulen gäbe.27 Als qualitativ unzureichend galten das „veraltete“ Bildungssystem, worunter die innere [22] Verfassung der Hochschulen verstanden wurde, überlange Studienzeiten28 und die scharfe soziale Auslese beim Zugang zu einer höheren Ausbildung.29
Solche Überlegungen mussten auch in der Öffentlichkeit Anklang finden: Die Berufszugehörigkeit spielte bei der Schichtenzuordnung und damit bei Ansehen und Prestige eine wesentliche Rolle; mit der Ausbildung waren in der Regel Berufs- und Einkommensstatus verbunden. Vor allem die Ausbildung trat als statusbestimmende Determinante wieder voll in ihre Funktion ein. Die rund zwei Prozent erwerbstätigen Deutschen mit Universitätsabschluss gehörten sowohl nach subjektiven wie nach objektiven Maßstäben zur Oberschicht und zur oberen Mittelschicht.30 Zwar war die deutsche Gesellschaft seit der Zeit des Kaiserreichs für begabten und leistungswilligen Nachwuchs aus unteren Schichten bis zu einem gewissen Grad offen. So umfasste die Oberschicht auch eine Gruppe sozialer Aufsteiger. Insgesamt rekrutierte sie sich aber überwiegend aus den eigenen Reihen oder aus der benachbarten Mittelschicht von Angestellten, Beamten und besser situierten Selbständigen. Die Kinder aus den oberen Schichten absolvierten, wenn möglich, ebenfalls ein Universitätsstudium.
Die sogenannte Bildungsbarriere für Kinder aus der Arbeiterschaft war einer breiten Öffentlichkeit bis dahin noch nicht als Politikum erschienen. Fachleute hatten sich dieser Frage aber bereits Mitte der fünfziger Jahre angenommen.31 Die große Ausbildungsrevolution, die Mitte der sechziger Jahre zu einem Zentralthema der Innenpolitik wurde, ist von den Bildungsspezialisten unterschiedlicher ideologischer Herkunft zehn Jahre lang vorbereitet worden. Es ist falsch, wenn behauptet wird, erst der kulturrevolutionär wirkende Studentenprotest habe auf die Mängel des deutschen Hochschulsystems aufmerksam gemacht und damit die Reformpolitik erzwungen und eingeleitet.32 Tatsächlich sind z. B. die Arbeiten des 1957 von Bund und Ländern für die Hochschulen eingerichteten Wissenschaftsrats mit den Empfehlungen zur Reform der Hochschulen fünf bis zehn Jahre älter als der Höhepunkt des Studentenprotests im Jahr 1968. Die längst fällige Reform war allerdings so überfällig geworden, dass sie in Revolution ausarten musste.33 Im Nachhinein ist es müßig, darüber zu spekulieren, ob die Umsetzung früherer Reformvorschläge dazu hätte beitragen können, später erhobene extensive Forderungen und deren Verwirklichung zu verhindern. Das gilt auch für das Versagen von Professoren und Ministerien34 hinsichtlich der Einleitung erforderlicher Reformen.
[23] Auffällig ist das Fehlen von Bildungspolitikern in den Parlamenten und Parteien Ende der fünfziger Jahre. Von elf amtierenden Kultusministern gehörten fünf nicht den Parlamenten eines Landes an. Auch die Zahl der Parteilosen unter ihnen (drei) war bemerkenswert. Bis dahin hatte es in keinem anderen Ressort Minister gegeben, die parteilos waren. Auch Bundeskanzler Brandt entschied sich 1969 bei der Besetzung seines ersten Kabinetts für den parteilosen Hochschulprofessor Hans Leussink als Minister für Bildung und Wissenschaft. Und eine weitere Besonderheit war festzustellen: die Zahl „landfremder“, also aus einem anderen Bundesland Berufener.35 Hierin mag ein Grund liegen, dass es an der Möglichkeit fehlte, erkannte Notwendigkeiten auch durchzusetzen. Die Bildungspolitik war nicht so fest in die Parlaments- und Parteiarbeit eingefügt, dass ihre Anliegen mit Priorität behandelt wurden. Der fehlende Rückhalt von Experten der Bildungspolitik in Parlament, Kabinett oder Partei konnte erst durch das Echo in der öffentlichen Meinung ausgeglichen werden.
Die Zeit einer scheinbar definitiven Entideologisierung war vor allem unter Intellektuellen und Studenten einem neuen Bedürfnis nach ideeller Kritik und veränderten Wertvorstellungen gewichen. „Wie ein Fieber“ brach die Reformdiskussion aus.36 Die Kritiker gingen über die pragmatische Politikauffassung der bundesrepublikanischen Aufbaugeneration hinaus. Indem sie diese anklagten, stellten sie zugleich ein Vakuum an Zukunftsvorstellungen fest und brandmarkten eine unzureichende „Bewältigung der Vergangenheit“, die sie rigoros und demonstrativ einforderten. Immer spürbarer trat dies in der belletristischen Literatur und in den Sozialwissenschaften hervor sowie im neuen Ton eines Generationskonflikts, der sich in stürmisch anwachsenden Studenten- und Jugendprotesten äußerte.37 Auf diesem Hintergrund sind auch Aussagen von damaligen Regierungsmitgliedern zu werten wie die: „Bildungsfragen sind … Machtfragen, Interessenfragen, Klassenfragen … Bei der Demokratisierung unseres Bildungswesens geht es letztlich um Klasseninteressen“.38
2. „1968“
In der Wahrnehmung vieler, nicht zuletzt wegen manch verklärter Berichte, erscheint die Jahreszahl 1968 als einschneidende Zäsur für die Reform. Für viele ist es ein Mythos. Was nicht alles den sog. „68ern“ zu verdanken sei! Beteiligte bekommen leuchtende Augen, wenn sie sich an eigene oder fremde „Heldentaten“ erinnern. Betroffene sehen dies weniger begeistert. Für manche sind die 68er an allem schuld. Wie aber sieht der Versuch einer nüchternen Bilanz aus?
[24] Als 68er bezeichnet man Personen, die sich mit den Zielen und Vorgehensweisen der vor allem im Jahr 1968 politisch regen Studenten identifizierten39. Um nicht nur Mitläufer oder Sympathisant zu sein, musste ein Engagement in einer linken Gruppe oder zumindest die Beteiligung an Aktionen der studentischen Linken dazukommen40. Von Berkeley/Californien, wo der Protest sich gegen den Vietnam-Krieg richtete, ergoss sich die Welle über Paris nach Berlin. Dies scheint kein Zufall gewesen zu sein. Wegen des Viermächte-Status unterlagen Einwohner von Berlin (West) nicht der Wehrpflicht. Das zog Wehrdienstverweigerer und „Linke“ in besonderem Maße an. Als am 2.6.1967 der Student Benno Ohnesorge von einem Polizisten beim Besuch des Schahs von Persien anlässlich einer Demonstration erschossen wurde41, war dies ein Auslöser für Gewalttätigkeiten und Straßenschlachten mit der Polizei42. Gewalt gegen Personen und Sachen war die Folge.
In der zweiten Hälfte der sechziger Jahre wurde von der jungen Generation das Erstarken der Bundesrepublik in den zwanzig Jahren nach Ende des Zweiten Weltkriegs zunehmend kritischer betrachtet43. Den wirtschaftlichen Erfolg bewertete man angesichts eines Konjunktureinbruchs lediglich als temporäres Produkt, dem kapitalistischen Wirtschaftssystem wurde ein baldiges Ende vorhergesagt. An den sozialwissenschaftlichen Fakultäten der Universitäten kam es zu einer Wiederbelebung des Marxismus. Allmählich entwickelte sich eine Außerparlamentarische Opposition, APO genannt. Als ein Grund dafür wird auch die Tatsache angesehen, dass es im Bund eine Große Koalition gab und damit keine der sog. Volksparteien als Opposition wirkte. Die APO war im Grunde eine antiparlamentarische Bewegung. Sie hatte ihre prägenden Kräfte im Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS), von dem sich die SPD bereits 1961 getrennt hatte.
a) Die Bewegung
Die Vorstellung, es habe ein theoretisch geschlossenes Selbstverständnis oder klare Ziele „der 68er“ gegeben, ist irreführend. Es war eher eine nicht an bestimmten Bereichen orientierte Suche, die um 1968 zu Innovationen, Differenzierungen, aber auch Radikalisierungen führte. Theorien hatten innerhalb der Bewegung nur eine kurze Lebensdauer. Sie wurden aufgegriffen, hin und her gewendet und wieder verworfen. Es gibt also keine fest umrissenen „68er Ideen“. Eher bestand eine nicht [25] näher definierte Sehnsucht, ohne dass klar wurde, was konkret gemeint war. Man sprach zwar von „konkreten Utopien“; was darunter verstanden wurde, blieb nebulös. Dies wird deutlich, wenn man sich erinnert, dass z. B. Rudi Dutschke, einer ihrer Exponenten, es mit Nachdruck ablehnte, eine konkrete Alternative zur kapitalistischen Gesellschaft zu formulieren. Die Möglichkeiten der Gesellschaftsveränderung sollten offen bleiben. Allenfalls orientierte man sich an marxistischen Vorstellungen. Personelle Leitfiguren waren u. a. Theodor W. Adorno, Ernst Bloch, Max Horkheimer, Herbert Marcuse und Jürgen Habermas. Sie gelten als die geistigen Väter der Bewegung44.
Man kann darüber streiten, ob die zum Teil verschwommenen Vorstellungen eine Art von Programm oder als das Fehlen von Zielvorstellungen zu bezeichnen sind. So äußerte sich die „Bewegung“ in erster Linie in einer Kritik an den bestehenden Verhältnissen, und zwar in jeder denkbaren Hinsicht. Sie war nicht konstruktiv, sondern destruktiv. Alles wurde in Frage gestellt: Religion, Weltanschauung, wissenschaftliche Erkenntnisse, Pflichten der Bürger, sämtliche als Tugenden bezeichneten Einstellungs- und Verhaltensweisen.
Die Haltung, „gegen“ etwas zu sein, kam in den drei Grundüberzeugungen zum Ausdruck45: Antifaschismus, Antikapitalismus und Antiimperialismus. Die erste richtete sich gegen die bislang nicht stattgefundene Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit, die zweite gegen die bestehende Wirtschaftsordnung, die als ausbeuterisch und sozial ungerecht empfunden wurde, und die dritte gegen die angebliche Unterjochung der Länder der Dritten Welt. Diese Gegnerschaft bildete gewissermaßen den Hauptnenner aller Gruppierungen: SDS (Sozialistische Deutscher Studentenbund), APO (Außerparlamentarische Opposition), dogmatische und undogmatische Linke, zum Teil sogar konstruktiv reformerische Kräfte. Jedenfalls waren auf diesem Hintergrund breite Mobilisierungen und Aktionen möglich.
Man versuchte, die Universitäten als Ausgangsstätten für die erstrebte Revolution zu nutzen. Wegen der aktuellen Probleme, die zunächst ins Visier genommen wurden, fanden „Aktionen“ durchaus die Sympathie der Mehrheit der Studenten. Die explodierenden Studentenzahlen, als mangelhaft empfundene Betreuung und die als „Herrschaft der Ordinarien“ gegeißelte Organisationsstruktur führten zu Solidarisierungen unter dem Beifall der Kommilitonen, die sich an Protestveranstaltungen mannigfacher Art beteiligten46. Die Situation steigerte sich zu Meinungsterror und Bedrohung wissenschaftlicher Freiheit. Vorlesungsstörungen, die Androhung und auch die Verwirklichung von Gewalt gegen Sachen und Personen waren keine Einzelerscheinungen47. Das Bild von den Studenten änderte sich radikal. Veränderte [26] Lebensgewohnheiten, die demonstrative Geringschätzung konventioneller Formen, „Kommunen“ genannte Wohngemeinschaften, Rücksichtslosigkeit gegenüber Vermietern, die bewusste Vernachlässigung von Äußerlichkeiten wie Kleidung und Frisur machten den „linken“ Studenten für weite Bevölkerungskreise zu einem Bürgerschreck. Studentische Funktionäre forderten ein „Studentengehalt“48 für alle, weil es im Interesse des Staats sei, dass die Studenten ihre Zeit in Form des Studiums für dessen Interessen durch spätere Verwertung ihres Wissens einsetzten. Die andersartigen Formen des Auftretens und Verhaltens haben andauernde Wirkungen entfaltet, weil viele bis dahin gültige Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens fortan unbeachtet blieben. Dabei sind gewiss auch manche „alte Zöpfe“ abgeschnitten worden, um die es nicht schade ist. Auf der Strecke blieben aber auch Regeln und Usancen, die man als Voraussetzung für ein zivilisiertes Zusammenleben rechnen darf.
Die Zahl der Aktivisten war gering. An den Demonstrationen nahmen je nach Zielsetzung zwischen 8 bis 35 % der Studierenden teil, die wenigsten an denen gegen die Ordinarienuniversität, die meisten an den großen „Demos“ gegen die Notstandsgesetze49. Zwar verdoppelte sich die Mitgliederzahl des SDS, sie lag aber auch im Herbst 1967 bei nicht mehr als 2.50050. Die linksradikale Politik des SDS wurde nur von einer kleinen Minderheit geteilt51.
Eindeutig kriminell waren „Aktionen“ wie Besetzungen von Hörsälen, Verwüstung von Bibliotheken bis hin zu Bombenanschlägen auf politisch missliebige Professoren. So konnten einige Hochschullehrer ohne Gefahr für Leib und Leben die Universität nicht mehr betreten, Vorlesungen fielen wochenlang aus, weil sie „bestreikt“ wurden. Mit dem teilweisen oder geschlossenen Fernbleiben der Studenten von Vorlesungen und anderen Lehrveranstaltungen, im Grunde ein Boykott und kein Streik, sollten Forderungen gegenüber der Hochschulleitung oder der Wissenschaftsverwaltung durchgesetzt und/oder ein allgemeiner Protest bekundet werden. Zugleich bemühte man sich um Solidarität mit der Arbeiterschaft – u. a. durch die Verwendung des Begriffs „Streik“.
Der Rückzug des SDS in die Universitäten setzte ein, weil der Versuch, die Bevölkerung, vor allem die Arbeiterschaft, zu gewinnen, erfolglos blieb. An den Universitäten begann eine Entwicklung, sie zu Ausgangsstätten für die zukünftige [27] Revolution „umzufunktionieren“ – so lautete ein zuerst in einschlägigen Kreisen benutzter, dann aber auch in den allgemeinen Sprachgebrauch eingehender Begriff.
Das Ziel, den liberalen Staat als angeblichen Interessenvertreter des Kapitals und der Repression zu zerschlagen, hatte die APO nicht erreicht. Gelungen war es ihr indessen, mannigfachen politischen und sozialen Wandel von nicht geringem Ausmaß in Gang zu bringen, der zu weitgehenden Veränderungen im öffentlichen und individuellen Bewusstsein führte. Dieser Vorgang wurde von einem erstaunlich anpassungsfähigen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen System angenommen. Seine Folgen wirken eigenständig oder sekundär in vielerlei Formen weiter52.
Ein großes Problem stellte das Sympathisantentum mit dem Terrorismus dar53. Darunter verstand man das vornehmlich aus Intellektuellen bestehende Umfeld vielfach von den Hochschulen kommender Terroristen der Roten-Armee-Fraktion (RAF), das deren Aktionen duldete oder sie sogar aktiv unterstützte.
Die Täter nahmen für sich in Anspruch, dass es bei der Gewaltanwendung auf die Motive ankomme. Da politisch motivierte Taten zum Besten der Gesellschaft geschähen, seien sie gerechtfertigt54. Wer eine „normale“ Straftat begehe, sei schuldig, wer dies aus politischen Beweggründen tue, verdiene eine andere Beurteilung.
Die Grundsätze zur Beschäftigung von verfassungsfeindlichen Personen im öffentlichen Dienst, geregelt im sog. Extremisten-Beschluss der Regierungschefs von Bund und Ländern aus dem Jahre 1972, betraf linke wie rechte Verfassungsfeinde in gleicher Weise. Aktuell wurde die Frage jedoch nur in Bezug auf Exponenten der Linken. Dies hing damit zusammen, dass die APO und ihre Nachfolgegruppierungen, insbesondere die K-Gruppen, das Ziel verfolgten, einen „Marsch durch die Institutionen“ anzutreten. „K-Gruppen“ war ein Sammelbegriff für die zahlreichen linksradikalen Gruppierungen, die sich im Gefolge der Studentenbewegung der späten sechziger Jahre gebildet hatten und deren Name meist mit einem „K“ (für kommunistisch) begann. Sie bekannten sich überwiegend zum Marxismus-Leninismus in maoistischer Ausprägung und wandten sich nicht nur gegen die bürgerliche Gesellschaft, sondern auch gegen das damals in der UdSSR verwirklichte Herrschaftsmodell. Zu ihnen zählten etwa der KBW (Kommunistischer Bund Westdeutschlands), die KPD (Kommunistische Partei Deutschlands), die KPD/ML (KPD/ Marxisten-Leninisten), die MLD (Marxisten-Leninisten Deutschlands) oder der KABD (Kommunistischer Arbeiterbund Deutschlands). Schon in den siebziger Jahren waren einige der K-Gruppen von Spaltungs- und Auflösungserscheinungen betroffen. Das Scheitern des Kommunismus in den osteuropäischen Ländern und der DDR hat später den Einfluss und die Bedeutung dieser Gruppen weiter zurückgedrängt.
[28] Bewerber mit einschlägigen Biographien um Positionen im öffentlichen Dienst wurden durch die Anwendung des sog. Radikalen-Erlasses daran gehindert, eine Unterwanderung des Systems zu erreichen. In Überzeichnung und Verdrehung der Situation sprach man in diesen Fällen von „Berufsverboten“. Tatsächlich fehlte es an einer Voraussetzung für die Einstellung, nämlich an dem Merkmal der Verfassungstreue55.
b) Wirkungen
Wenn der Eindruck erweckt wird, die 68er-Bewegung hätte eine positiv zu bewertende Reform an den Universitäten in Gang gesetzt56, bedarf das der deutlichen Relativierung57.
Experten meinten, dass die Hochschulrevolte „nicht hätte kommen müssen“, wenn die Chance einer Hochschulreform nach 1945 nicht vertan worden wäre58. Es ist oft spekuliert worden, dass die Umsetzung der Positionen des Verbands Deutscher Studentenschaften (VDS) Ende der fünfziger Jahre dazu hätte beitragen können, später erhobene extensive Forderungen und deren Verwirklichung zu verhindern. Allerdings trifft wohl zu, dass es des Umwegs über massive Proteste bedurfte, weil sonst verkrustete Strukturen nicht hätten aufgebrochen werden können. Ebenso richtig ist, dass es Exzesse gab und dauerhafte Beschädigungen gibt.
Der „Marsch durch die Institutionen“59 über den Journalismus, die Lehrerschaft, Kirche, Justiz und Verwaltung bis zu einflussreichen Positionen ist zum Teil durchaus geglückt. Die rot-grüne Bundesregierung von 1998 bis 2005 ist ein markantes Beispiel: Hier waren Joschka Fischer, zwar nicht ehemaliger Student, aber der Bewegung zugerechnet, und Jürgen Trittin, früher Student in Göttingen und Mitglied des Kommunistischen Bundes (KB), die auffälligsten Vertreter. Mit leichtem Zynismus kann man sagen, dass die Universität eine Art Übungsstätte für künftige Politiker darstellte, die oft gar keinen „bürgerlichen“ Beruf ausgeübt haben und außer Schule, Hochschule und Parlament beruflich keinen anderen Lebensraum als eigenes Betätigungsfeld kennen.
„68“ ist eine Chiffre für die Studentenbewegung. Die Jahreszahl wird als eine Art Scheidewand zwischen zwei Epochen verstanden. Bis dahin sei die Bundesrepublik [29] ein restauratives Land gewesen, bestenfalls eine angepasste Demokratie; nunmehr sei das Land gekennzeichnet durch „mehr Demokratie“ und Partizipation.
Für die Entwicklung der studentischen Subkultur war die Studentenrevolte von entscheidender Bedeutung, da die konventionelle bürgerliche Lebensart in Frage gestellt und neue, antiautoritäre Lebensstilkonzepte entwickelt wurden, die, anders als die damals vertretenen politischen Utopien, inzwischen in vielen Bereichen Eingang in die Gesellschaft gefunden haben60. „1968“ war nicht zuletzt ein Medienereignis. Die bewusst provokativen Regelverletzungen, Happenings mit zum Teil entwaffnender Komik und nicht ohne Hintersinn erregten eine außergewöhnliche mediale Aufmerksamkeit61.
Ein wichtiges Resultat jener zum Teil dramatischen Entwicklung war, dass die alte Universität als europäische Bildungsanstalt auf der Strecke blieb und unter dem konzentrierten Zugriff von Revolutionären und Bürokraten zerbrach. Die außerparlamentarische Opposition hatte ein Machtvakuum an der Universität aufgedeckt, das nun die Staatsverwaltung mit ihren Mitteln füllte. Die traditionelle Wissenschaftsuniversität, sachlich einseitig, aber politisch wirksam als „Ordinarienuniversität“ angeklagt, und ihre Exponenten reagierten verunsichert und mit einer gewissen Hilflosigkeit. Die Auseinandersetzungen zeigten auch in erschreckendem Maße die Distanz zwischen Universität und Öffentlichkeit. Aber es ist nicht zu verkennen, dass die Funktion der Hochschule in der Gesellschaft sich ebenso verändert hatte wie diese Gesellschaft selbst62.
Sieger blieb in dieser Entwicklung die Bürokratie63, deren überproportionale Stärke die durch Regulierungen verordnete Schwäche der reformierten Universitäten noch erheblich vervielfachte. Die Hochschule wurde unmittelbar und distanzlos Einrichtung des Staates64.
Gewiss hat „68“ Einfluss auf die Lebensstile und Umgangsformen gehabt. Dies wurde – in Grenzen – auch von Kritikern als akzeptabel anerkannt. Auf jeden Fall waren die Wirkungen zwiespältig65. Tiefe Gräben sind aufgerissen worden. Es sah eine Zeit, etwa kurz vor der Wiedervereinigung, so aus, als könne man beide Lesarten akzeptieren, wobei in der Rückschau von den einen manches weniger verklärt, von den anderen manches nicht mehr ganz so kritisch gesehen wurde. Dies änderte sich, nachdem die DDR ihr Ende gefunden hatte. Das Scheitern des kommunistischen Systems führte dazu, dass „linke“ Ideen und Ziele erheblich abgewertet wurden. Ob dies nicht nur eine zeitweilige Erscheinung war, scheint angesichts des zwischenzeitlichen Erstarkens der Partei „Die Linke“ nicht unwahrscheinlich. Es wurde zu[30]gleich deutlich, welche Folgen und „Nebenwirkungen“ „68“ mit sich gebracht hatte: Verlust von Autorität, Werteverfall und das Fehlen von allgemein gültigen Maßstäben. Aber gewiss kann man nicht sämtliche tatsächlichen oder angeblichen Verfallserscheinungen der Gegenwart auf „die 68er“ zurückführen.
IV. Vom Reformkonsens zur Konfrontation
Ab Ende der 1960er entstand ein neues Gebilde: die „Gruppenuniversität“, in der Begriffe wie Mitbestimmung, Demokratisierung und Transparenz die zentrale Rolle spielen sollten. Das betraf die Verfassung der Hochschulen – durch stärkere Beteiligung der Nichtordinarien, des Mittelbaus, der Studierenden und der sonstigen Mitarbeiter.66 Fakultäten wurden in Fachbereiche umorganisiert, eine stärkere Differenzierung der einzelnen Wissensgebiete führte weg vom alten (inzwischen wieder erstrebten) Ideal der interdisziplinären Forschung.67 Eine quantitative Ausweitung des höheren Bildungswesens wurde in Gang gesetzt. Dazu gehörten solche Aktionen wie „Student aufs Land“, um Bildungsreserven zu wecken und zu mobilisieren, womit auch das viel zitierte „katholische Mädchen vom Land“ erreicht werden sollte. Eindeutig und offenbar unwiderruflich hatte der Trend eingesetzt, dass unabhängig von der demographischen Entwicklung der jeweilige Jahrgangsanteil an Schülern,68 der Ausbau höherer Schulen wuchs und die Mehrheit der Abiturienten auch ein Studium aufnehmen wollte.69 In der Expansion des Hochschulwesens dokumentieren sich zwei säkulare internationale Trends: die „Demokratisierung“ im Sinne der Öffnung der Sekundar- und Hochschulbildung sowie die Verwissenschaftlichung in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft.70 Zu den Konsequenzen der sog. Demokratisierung gehörten flankierende Maßnahmen wie z. B. finanzielle Förderung.71 Auch gebot die Konkurrenz zum anderen deutschen Staat, den Zugang zur Hochschule „sozial“ zu ermöglichen.72
Die strukturelle Reformierung zielte darauf ab, Gesamthochschulen einzuführen und eine Verkürzung des Studiums zu erreichen. Weitere Schlagworte lauteten: neue Lehrkörperstruktur, Modernisierung und Stärkung der Hochschulselbstverwaltung.
Zur Erreichung dieser Ziele sollte der Bund zum ersten Mal eine Grundsatz- und Rahmenkompetenz für das gesamte Bildungswesen erhalten, die es ihm ermöglichte, die gesamtstaatlichen Strukturdaten für die Entwicklung in quantitativer, qualitati[31]ver, finanzieller und organisatorischer Hinsicht festzulegen.73 Die dafür nötige Grundgesetzänderung erfolgte 1969 noch zur Zeit der Großen Koalition von CDU/ CSU und SPD.
Die Beweggründe für die Reform beruhten nicht zuletzt auch auf ökonomischen Überlegungen. Standen bereits in den fünfziger Jahren wegen der zu beobachtenden Engpässe Fragen des Bedarfs an hochqualifizierten Arbeitskräften im Vordergrund, so beschäftigte man sich später, motiviert von der Ost/West-Auseinandersetzung beider Wirtschaftssysteme, mit dem Problem einer ökonomisch orientierten Bildungspolitik, deren Ziel es sein sollte, die bis 1970 vorgegebenen Wachstumsraten zu erreichen. Wirtschaftliches Wachstum wurde als Bedingung und Resultat der Kulturpolitik verstanden.74 Stärker betonte demgegenüber vor allem Dahrendorf den individuellen Ansatz des Bürgerrechts auf Bildung.75
Die vielfältigen Forderungen trafen auf eine breite Zustimmung und wurden zum größten Teil auch politisch, mit im Lauf der Zeit veränderten Mehrheiten, umgesetzt. Die wichtigsten Beispiele dafür sind:
Das Abkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung eines Wissenschaftsrats (1957) für den Hochschulbereich;
das Verwaltungsabkommen über die Errichtung des deutschen Bildungsrats (1965) für den Schulbereich;
die Einführung des neuen Hochschultyps Fachhochschule (1968) durch einen Staatsvertrag der Länder;
die Ergänzung des Grundgesetzes (1969) durch Art. 74 Nr. 13 Abs. 1 Nr. 1a, Art. 91a, Art. 91b u. a. mit der Ermöglichung der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau;
das Hochschulbauförderungsgesetz (1969);
die Schaffung der Bund/Länder-Kommission (BLK) für die Bildungsplanung und Forschungsförderung (1970);
das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 1971 mit dem Anspruch auf individuelle Ausbildungsförderung für eine der Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung, wenn dem Auszubildenden die erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen;
sowie einige Jahre später unter schon veränderten Vorzeichen
[32] das Hochschulrahmengesetz (HRG) von 1976, u. a. mit den Aufgaben der Neuordnung des Hochschulwesens (§ 4), der Errichtung von Gesamthochschulen (§ 5), der Studienreform (§ 8), der Schaffung einer neuen Personalstruktur (§§ 36 ff.) und Vorgaben für die Organisation und Verwaltung (§ 58) sowie die Hochschulplanung (§ 67 f.).
Die Bildungspolitik der sechziger Jahre – vor der Studentenrevolte – war maßgeblich von zwei Kultusministern geprägt worden, die der CDU angehörten: Paul Mikat in Nordrhein-Westfalen und Wilhelm Hahn in Baden-Württemberg. Die gängigen Forderungen aber waren Gemeingut der fortschrittlichen Bildungspolitiker aller Parteien.76 Irgendwelche Reformen wollten Ende der sechziger Jahre nahezu alle.77
In Brandts Regierungserklärung des ersten sozial-liberalen Koalitionskabinetts 1969 stand die Bildungspolitik an der Spitze der Reformen.78 Dies bedeutete keinen Einschnitt, sondern vielmehr die Bestätigung eines laufenden Prozesses. Das Pathos des (vermeintlichen) Neuanfangs erhöhte allerdings den Erwartungsdruck. Vor allem aber förderte die noch wachsende Bewertung der Bildungsreform als Grundlage der Gesellschaftsveränderung die parteipolitische Polarisierung und Ideologisierung der Bildungspolitik.79 Aus dem anfänglich zu beobachtenden Zusammenraufen wurde immer mehr ein Auseinanderstreben der Bildungspolitiker von Regierung und Opposition.
Es hatte allerdings einige Zeit gedauert, ehe die Bildungsdiskussion eindeutig parteipolitisch kanalisiert war. Zu Anfang hatten Wissenschaftler die Auseinandersetzung bestimmt. Parallel zur allgemeinen politischen Polarisierung machte man die Hochschulen auch verstärkt zum Objekt parteipolitischen Streits im Einzelnen. Dies wurde am deutlichsten in den Ländern, wenn es um die Einschätzung von Entwicklungen und Vorhaben an bestimmten Institutionen ging. Die Auseinandersetzungen um die Universitäten Konstanz80 und Heidelberg81 zu Anfang der siebziger Jahre sind Beispiele dafür. Breit diskutierte man in der Öffentlichkeit auch die Verhältnisse an den Universitäten in Berlin, Bremen, Hamburg und Marburg und Frankfurt/Main.
Die Abkehr vom Konsens82 in der Bildungspolitik vollzog sich in einem Hin und Her zwischen Vorstößen der sozialliberalen Mehrheit auf Bundes- und Länderebene [33] einerseits und dem Ausbau der Gegenpositionen auf beiden Ebenen durch CDU und CSU andererseits. Dabei trugen die Versuche der Bundesregierung, ihre neuen Mitwirkungsmöglichkeiten im Bildungsbereich, u. a. in der Bund/Länder-Kommission, offensiv wahrzunehmen, dazu bei, die Konsensgrundlagen des bildungspolitischen Aufschwungs zu gefährden.
Die Bildungspolitik wurde zu einem der Politikbereiche, die es mit anderen und in Konkurrenz dazu „zu verkaufen“ galt. Dies führte zur Akzentuierung von „Expansion“, „Modernisierung“, „Strukturreform“ und „Demokratisierung“ als bildungspolitische Ziele der sozial-liberalen Koalition. Aber besonders die Überlegungen der beiden „politischen Grundwellen“ der „weltweiten Bildungsreform-Debatte“ – Demokratisierung der Strukturen und Ausbau der Hochschulen – war nicht ohne Gefahr.83 Die CDU/CSU-Opposition betonte demgegenüber zunehmend die Grenzen der Finanzierbarkeit. Die Schärfe der Auseinandersetzung in den Jahren 1970 bis 1973 beruhte wesentlich auf einer von Regierung und Opposition bewusst betriebenen Konfrontation ideologischer Art.84 Wenn es trotzdem immer wieder ein Aufeinanderzugehen gab, war dies ein Jahrzehnt lang, von Mitte der 70er bis Mitte der 80er Jahre, im Wesentlichen ein Verdienst der „Bürokraten“, nämlich Eberhard Böning für den Bund, Ulrich Kleiner für die Seite der sog. A-Länder (d. h. SPDregiert) und Paul-Harro Piazolo für die B-Länder (CDU-regiert).85
Reformen waren nunmehr oft von einem Zickzackkurs gekennzeichnet: War ein Vorhaben umgesetzt, wurde es nach einem Regierungswechsel wieder aufgehoben und durch ein anderes ersetzt usw. Dies wird bei Behandlung der verschiedenen Bereiche, die Gegenstand der Hochschulpolitik sind, im folgenden Teil B. in den einzelnen Kapiteln dargestellt.
V. Stabilitätspolitik und Ernüchterung
Die Reformpolitik hatte ihre Grenze in der Stabilitätspolitik. Dies deutete sich bereits früh, 1970/71, an.86 Nicht einkalkulierte Ereignisse, wie die Ölkrise des Jahres 1973, führten zu einer Verknappung der Geldmittel auch an den Universitäten. [34] Zugleich wurden die Abhängigkeiten und Anfälligkeit der modernen Industriegesellschaft und ihres Wohlstands deutlich.87
Seit der Mitte des Jahrzehnts machte sich eine Stagnation der Ausgaben beim Hochschulbau, bei Personalstellen und im Sachmittelbereich bemerkbar. Die zunehmende Knappheit der öffentlichen Mittel und eine veränderte Prioritätensetzung zum Nachteil des Bildungssektors ließen die Veränderung der Rahmenbedingungen deutlich erkennen.
Der schrittweise Stimmungswandel setzte sich bis zum Ende der siebziger Jahre immer deutlicher fort. Verschiedene Folgen der Expansions- und Reformphase riefen Kritik und Ernüchterung hervor.88 Die knapper gewordenen Finanzmittel waren gelegentlich ein willkommener Anlass, als überzogen eingestufte Reformvorhaben zu bremsen oder rückgängig zu machen. Ein entscheidendes Signal war die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1973 zum niedersächsischen Vorschaltgesetz. Dabei ging es um die Frage, ob die Professoren durch die Neuregelung der Zusammensetzung der Kollegialorgane, Kommissionen und Ausschüsse an den wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Niedersachsen bzw. die Mitwirkung von Vertretern der verschiedenen Gruppen von Hochschulangehörigen in diesen Organen in ihren Rechten aus Art. 5 Abs. 3 GG auf funktionsgerechte Mitsprache verletzt seien.89
Die veränderte politische und wirtschaftliche Großwetterlage erschütterte die Fortschrittsgläubigkeit und Wissenschaftsorientierung der sechziger Jahre. Nach der Aufschwungphase und der Hochkonjunktur zwischen 1967 und 1970 folgte die Phase der sozial-liberalen Euphorie und des reformerischen Aktivismus von 1969 bis 1974, schließlich der Versuch der technokratischen Akkomodation 1974 bis 1980: insgesamt ein Bildungskonjunkturzyklus.90
Eines der Zeichen für die Ernüchterung im politischen Bereich war – nach dem Rücktritt Brandts im Mai 1974 – die Besetzung des Bundeskabinetts durch den Nachfolger Helmut Schmidt. Sogenannte intellektuelle Hochflieger wie die Minister Ehmke und v. Dohnanyi mussten zu Gunsten der Vertreter der Mitte des politischen Spektrums wie Matthöfer und Rohde weichen. Damit kam eine Abkehr von ideologischen, visionären Höhenflügen zum Ausdruck;91 für manche sogar ein antiakademischer Unterton.92 Im Wahlkampf 1976 war eine deutliche Zurückhaltung der Intellektuellen zu spüren, die sich 1969 und 1972 begeistert in Wählerinitiativen für Brandt eingesetzt hatten.
[35] Die Regierungserklärung von Helmut Schmidt nach dem Wahlsieg 1976 verdeutlichte das Ende der Reformpolitik. Die Aussagen zum Bildungswesen wirkten desillusionierend.93 Da die Reformpolitik auf wirtschaftlichen Zuwachs gebaut hatte, musste die eingetretene Verschlechterung der ökonomischen Rahmenbedingungen zu Konsequenzen führen. So reagierte auch die CDU in ihrem Grundsatzprogramm von 1978 nicht nur auf die sozial-liberale Reformpolitik, sondern auch auf frühere Reformeuphorie in den eigenen Reihen. Besonders sichtbar wurde dies am Begriff der Chancengerechtigkeit im Bildungswesen, der die noch 1971 aufgestellte Forderung nach Chancengleichheit ablöste.94
Zum Ende der Kanzlerschaft von Helmut Schmidt im Jahr 1982 konnte man feststellen: Die Mehrheit der Wähler wollte nichts mehr von Reformen wissen. Vieles erschien allem ungestümen emanzipatorischen Drang zum Trotz als Dirigismus des Staates und wurde so verstanden, dass er über die Bedürfnisse der Bürger hinweg seine technokratischen Ziele verfolgte. Die Bildungspolitik beflügelte nicht mehr die Phantasie der Zukunftsgestaltung, sondern ächzte unter der Last des täglichen Problemdrucks: nicht zuletzt der Bewältigung von Folgen der vergangenen Euphorie. Der Bund zog sich aus dem Gehege der Länderhoheit weitgehend wieder zurück. Die Reformgesetzgebung im Bereich der Hochschulausbildung wurde mit dem Hochschulrahmengesetz von 1976 unter Mühen zum Abschluss gebracht.95 Es sollte die Experimentierphase nach rund 10 Jahren beenden, damals noch mit dem Fernziel des Ausbaus aller Hochschulen zu Gesamthochschulen bzw. der Koordinierung der verschiedenen Hochschularten.96
Das HRG von 1976 war ein Novum in der deutschen Hochschulgeschichte.97 Neben einer Reihe anderer Bestimmungen wurden darin Grundsätze und Verfahrensregelungen für die Studienreform aufgeführt, so zur Neuordnung des Studienangebots mit dem Ziel, überlange Studienzeiten zu verkürzen. Obwohl das Gesetz detaillierte Regelungen über Studienordnungen und -gänge enthielt, hat es keine durchgreifende Änderung bewirkt.
Bis Ende der siebziger Jahre mussten die Länder ihr Hochschulrecht an das HRG anpassen, wobei ihnen ein gewisser Spielraum für eigene Akzente blieb.98 Kritischen Beobachtern galt das HRG von 1976 als kleinster gemeinsamer Nenner aller politischen Kräfte99 und als Zeichen von Resignation.100
[36] Nach und nach zeigte sich eine deutliche Abkehr von Folgerungen, die früher im Konsens aller politisch Verantwortlichen gezogen worden waren, und zwar unter wechselnden Mehrheiten. Das belegen
die Auflösung des Deutschen Bildungsrats (1975);
der Streit um die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau (1981) und um die Graduiertenförderung (1983);
das Scheitern der Fortschreibung des 1969 von der sozial-liberalen Regierung eingeführten Bildungsgesamtplans (1982);
die Umstellung des BAföG auf Volldarlehen (1982);
die Reform des Hochschulrahmengesetzes (1985, mit der Streichung des Ziels Gesamthochschulausbau
101
);
die partielle Auflösung der Bund/Länder-Kommission (keine weiteren Bildungsgesamtpläne).
Mit dem Ende der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau durch die Föderalismusreform erledigte sich die Aufgabe des Wissenschaftsrats, Empfehlungen zu den Rahmenplänen abzugeben.
Die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) wurde im Jahr 2007 durch die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) ersetzt. Sie ist zuständig für den Wissenschaftssektor, nicht für die schulische und berufliche Bildung.
1Burtscheidt, Humboldts falsche Erben, S. 65 mit weiteren Nachweisen; Klein, Christine-Irene, in: Brandt, S. 10 Fn. 11.
2Ritter, Über Deutschland, S. 35.
3 So hatten die Briten Namenslisten von wieder einzusetzenden Professoren verfügbar (Ruegg, Bd. 4, S. 83).
4Jarausch, Das Humboldt-Syndrom, S. 61.
5Gadamer, Die Idee der Universität, S. 2 f.
6Schluchter, Auf der Suche nach der verlorenen Einheit, S. 257, 265.
Der von Bernd Henningsen im Jahr 2007 herausgegebene Sammelband „Humboldts Zukunft“ enthält Darstellungen zur Idee der Humboldtschen Universität und ihrer Bedeutung in Gegenwart und Zukunft.
7Schwarz, Die Ära Adenauer 1949–57, S. 417 f.
8Jaspers, Erneuerung der Universität.
9 Näher Burtscheidt, S. 68 ff.
10Führ, Deutsches Bildungswesen seit 1945, S. 14 ff.
11Ellwein, Die deutsche Universität vom Mittelalter bis zur Gegenwart, S. 239.
12Jarausch, Deutsche Studenten 1800–1970, S. 223.
13Führ, Bildungswesen, S. 2.
14 s. u. B. IV. 4.
15Kleifeld, Wende zum Geist, S. 59.
16 Der Begriff „Studenten“ wurde zu jener Zeit geschlechtsneutral gebraucht. Erst später setzte sich als Ausweichform für die Doppelnennung Studentinnen und Studenten der Plural Studierende immer mehr durch.
17Schwarz, S. 418 f.
18Jarausch, Das Humboldt-Syndrom, S. 63.
19 Göttingen – Vergangenheit und Gegenwart einer europäischen Universität, S. 64.
20 So Schwarz, S. 420.
21Schwarz, S. 417.
22 Näher Ellwein, S. 244 ff.
23Picht, Die deutsche Bildungskatastrophe, 1964.
24Teichler, Hochschulstrukturen im Übergang, S. 282.
25 Die Sorge der Einzelnen, in der internationalen Konkurrenz nicht mithalten zu können, nimmt Bude, Bildungspanik, zum Ausgang für seine 2013 veröffentliche Analyse der aktuell betroffenen Elterngeneration.
26 So Edding, Internationale Tendenzen in der Entwicklung der Ausgaben für Schulen und Hochschulen, in: Kieler Studien, 1958, S. 23.
27Edding, Bildung und Politik, opuscula, (1965) 25, S. 15; s. auch Anrich, Die Idee der deutschen Universität und die Reform der deutschen Universitäten, 1962.
28Dahrendorf, Bildung ist Bürgerrecht, 1965, S. 102 f.
29Hamm-Brücher, Ansätze zum bildungspolitischen Umdenken, S. 81.
30Schwarz, S. 403.
31Schwarz, S. 404.
32Lübbe, Die Universität im Geltungswandel der Wissenschaften, S. 124, spricht in diesem Zusammenhang von einem universitätshistorischen Mythos, der in Publizistik und Politik seine Gläubigen hat; s. auch Lübbe, Gruppenuniversität. Revision eines „Demokratisierungsprogramms“, S. 13 ff.; Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, S. 311.
33Eigen, Die deutsche Universität – Vielfalt der Formen, Einfalt der Reformen, S. 92 f.
34 Dies bemängelte besonders Schelsky, Abschied von der Hochschulpolitik, S. 134.
35 s. dazu näher Eschenburg, Zur politischen Praxis in der Bundesrepublik, 1964, S. 81 ff.
36Führ, Bildungswesen, S. 204.
37Bracher, Die Bewährung der zweiten Republik, S. 10.
38 So v. Dohnanyi, vgl. Bulletin der Bundesregierung Nr. 148, S. 1475, 16. 11. 1973.
39Fels, Der Aufruhr der 68er, S. 12 f.; Kraushaar, Achtundsechzig, passim. Zur Definition des Begriffs s. Seiffert, „Marsch durch die Institutionen?“, S. 11 f. Einen Überblick über studentische Opposition „gestern und heute“ vermittelt Schlicht, Vom Burschenschafter zum Sponti.
40Dahms/Sommer, 1968 in Göttingen, S. 10.
41 Das Gericht hat dem Polizisten ein Handeln in Notwehr zugebilligt.
42 Welchen Verlauf die Geschichte genommen hätte, wenn man gewusst hätte, dass der Polizist Kurras inoffizieller Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes der DDR (IM) war, wie im Mai 2009 bekannt wurde, bleibt Spekulation.
43 Zu den Quellen s. Becker/Schröder, Die Studentenproteste der Sechziger Jahre.
44Fels, S. 11.
45Fels, S. 18, 24, 35.
46Jarausch, Deutsche Studenten, S. 234.
47 Die Gründung des Bundes Freiheit der Wissenschaft im November 1970 von konservativen und liberalen Hochschullehrern war eine Reaktion auf entsprechende Vorkommnisse (Wehrs, Der Protest der Professoren. Der „Bund Freiheit der Wissenschaft in den 1970er Jahren“). In Berlin hatte bereits Ende der 60er Jahre die Notgemeinschaft für eine Freie Universität sich die Abwehr kommunistischer Gefahren an der Freien Universität zum Ziel gesetzt.
48Fels, S. 15.
49 Die Notstandsgesetze wurden am 30. Mai 1968 vom Bundestag verabschiedet, begleitet von massiven Protesten der so genannten außerparlamentarischen Opposition. Die Notstandsgesetze änderten das Grundgesetz und fügten eine Notstandsverfassung ein, welche die Handlungsfähigkeit des Staates in Krisensituationen (Naturkatastrophe, Aufstand, Krieg) sichern soll.
50Hardtwig, Studentische Politik an der humboldtschen Universität, S. 152.
51Siegfried, Auf dem Weg zu einer zivilen Kultur, S. 258.
52Hildebrand, Von Erhard zur Großen Koalition 1963–69, S. 375.
53Fels, S. 233.
54 Vgl. Schneider, Politische Kriminalität, S. 596.
55 Ein prominentes Beispiel ist der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Wegen der Mitgliedschaft in einer kommunistischen Studentengruppe wurde er zunächst nicht als Lehrer eingestellt. Ein positives Votum des Präsidenten der Universität, an der er studiert hatte (Hohenheim) führte schließlich zur Aufnahme in den Schuldienst (s. Stuttgarter Zeitung v. 19. 3. 2015, S. 3).
56 Vgl. Bocks, Mehr Demokratie gewagt? S. 274 f.
57 s. o. Fn. 30, 31.
58Dahms, Die Universität Göttingen, S. 436, mit Hinweis auf Helmut Becker.
59 Vgl. die gleichnamige Darstellung von Seiffert mit dem Untertitel „Die „68er“ in der SPD“.
60Böttiger, Wertewandel durch die 68er-Generation, passim.
61Siegfried, S. 258.
62Ellwein, S. 253.
63Winkler, Der lange Weg nach Westen, S. 282.
64Ellwein, S. 257.
65Wolfrum, Die Bundesrepublik Deutschland von 1949–1990, S. 329.
66Ellwein, S. 253.
67Führ, Bildungswesen, S. 205 f.
68 Die Begriffe „Schüler“ und „Abiturienten“ wurden wie „Studenten“ geschlechtsneutral gebraucht, s. o. Fn. 16.
69Ellwein, S. 250.
70Führ, Bildungswesen, S. 204.
71Führ, S. 205.
72Ellwein, S. 253.
73 s. dazu die in den Fn. 24–26 genannten Autoren Edding, Dahrendorf und Hamm-Brücher; weitere Hinweise bei Turner, Hochschulreformpolitik, Versuch einer Bilanz. Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament“ B 3–4/84, 21. 1. 1984, S. 25, Fn. 16–19.
74 OECD, Bildungswesen: mangelhaft. BRD-Bildungspolitik im OECD-Länderrahmen, 1973, S. 9.
75Dahrendorf, S. 23.
76Jäger, Die Innenpolitik der sozial-liberalen Koalition 1969–1974, Bd. V/I, S. 130.
77Böning, Hochschulreform – Illusion und Wirklichkeit, S. 133.
78Jäger, S. 129; s. auch Bocks, Mehr Demokratie gewagt?
79Jäger, S. 130.
80 dpa – Dienst für Kulturpolitik – v. 9.10., 13.11., 20.11. und 11. 12. 1972.
81 dpa v. 20.11., 27.11., 11.12. und 18. 12. 1972.
82 Als Vertreter einer Konsenslinie galten die Kultus- bzw. Wissenschaftsminister und späteren Ministerpräsidenten ihrer Länder Bernhard Vogel, CDU, (Rheinland-Pfalz) und Johannes Rau, SPD, (Nordrhein-Westfalen). Einen späteren, allerdings vergeblichen Versuch einer Abstimmung zwischen den beiden Genannten hat es noch einmal gegeben, als der Thüringische Ministerpräsident Vogel den Bundespräsidenten Rau bat, die vom Bundestag beschlossene Änderung des HRG zu stoppen (dpa 50/2001, S. 17). Die Änderungen wurden anschließend vom BVerfG kassiert (26. 1. 2005, 2 BvF 1/03); s. u. S. 236.
83Führ, Bildungswesen, S. 204.
84Hüfner/Naumann/Köhler/Pfeffer, Hochkonjunktur und Flaute: Bildungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland 1967–1980, S. 202. Die Erwartung, dass es Anfang des neuen Jahrhunderts vielleicht zu einem „Abschied von der Ideologie“ kommt (Schlicht, Der Tagesspiegel v. 28. 1. 2000, S. 34) ist nicht eingetreten.
85 Böning war Ministerialdirektor, später Staatssekretär im zuständigen Bundesministerium, Kleiner und Piazolo waren Amtschefs der betreffenden Länderministerien.
86Jäger, Die Innenpolitik der sozial-liberalen Koalition 1974–1982, Bd. V/II, S. 47.
87Jäger, S. 109.
88Habermas, Die Idee der Universität – Lernprozesse, S. 147. H. sah in der Krise der öffentlichen Haushalte das wesentliche Rezessionsphänomen der Bildungsplanung, nicht so sehr in einer Neuorientierung der Bildungspolitik durch von ihm sogenannte Neokonservative.
89 Urteil v. 29.5.1973 (BVerfGE 35, 79).
90Hüfner/Naumann/Köhler/Pfeffer, Hochkonjunktur und Flaute, S. 19, 30 ff., 200 ff.
91Jäger, Bd. V/II, S. 10.
92Wehrs, in: Brandt, S. 214.
93Jäger, Bd. V/II, S. 67.
94Jäger, Bd. V/II, S. 124.
95Jäger, Bd. V/II, S. 263.
96Führ, Bildungswesen, S. 221.
97Führ, S. 206 f.
98Führ, S. 207.
99Jäger, Bd. V/II, S. 263.
100Arnold/Martz, Einführung in die Bildungspolitik, 1979, S. 22.
101Führ, Bildungswesen, S. 221.
B. Die Reformprojekte – Gegenstände der Hochschulpolitik
Mitte der sechziger Jahre hatte das Thema Bildung allgemeines Interesse in Öffentlichkeit und Politik gefunden. Der Druck auf die politischen Entscheidungsträger, Regeln festzulegen, wurde immer stärker.
Die elf (alten) Bundesländer setzten um das Jahr 1970 ihre Hochschulgesetze in Kraft. Diese wurden seither im Schnitt jeweils sieben bis zehn Mal novelliert. Zählt man das Rahmengesetz des Bundes mit seinen Änderungen und die seit dem Einigungsvertrag in den neuen Bundesländern geschaffene Gesetzgebung hinzu, so kommt man auf ca. 200 Gesetzesfassungen, kleinere Änderungen ausgenommen, die irgendwann einmal länger oder kürzer für die jeweiligen Universitäten gegolten haben. Neu ins Amt gekommene Landesregierungen machen sich meist daran zunächst einmal das Hochschulrecht zu novellieren1.
Das Kräftefeld der Hochschulpolitik ist gekennzeichnet durch unterschiedliche Interessen und politisch kontroverse Standpunkte. Das gilt vor allem für folgende Sektoren:
Zulassung zum Studium (Eingangsprüfungen/Zugang für Berufstätige ohne Reifeprüfung); Zugangsbeschränkungen (numerus clausus); Studiengebühren; BAföG (Zuschuss oder Darlehen); Finanzierung (Global- oder Einzelhaushalt); Organisation des Studiums (Bachelor und Master); Prüfungswesen; Leitung der Hochschule auf zentraler und dezentraler Ebene (Präsidial- oder Rektoratsverfassung, Befugnisse der Dekane); Mitwirkung der Gruppen (sog. Paritäten, Quorum bei Wahlen); Hochschulrat (als Aufsichtsgremium mit externen Mitgliedern); Mittelverteilung (sog. Gießkanne oder nach Leistungskriterien); Berufungswesen (Rechte des Staates gegenüber Vorschlägen der Universitäten); Autonomie der Hochschule (Rechts- oder Fachaufsicht des Staates); verfasste Studierendenschaft; Personalvertretung (Zuständigkeit, Inkompatibilität mit Gremienmitgliedschaft).
Diese Elemente können durch Gesetze sehr verschieden ausgestaltet werden; die konkrete Handhabung bestehender Normen ermöglicht u. U. weiter divergierende Erscheinungen. Im Gesetzgebungsverfahren kann es aufgrund der jeweiligen politischen Konstellation zu sehr unterschiedlichen Lösungen kommen, je nachdem, wer die Mehrheit stellt oder ob die Entscheidungen von Koalitionen unterschiedlicher Zusammensetzung gefällt werden. Das Ergebnis sind in aller Regel Kompromisse, bei denen auch sich widersprechende Lösungen in den gesetzlichen Regelungen [38] nebeneinander stehen können. Ebenso kann es vorkommen, dass politisch kontroverse Positionen in ein und demselben Gesetz ihren Niederschlag finden.
Das verdeutlicht, dass es kaum Zufriedenheit mit dem jeweils Erreichten geben wird, weil kein Gesetz „aus einem Guss“ ist. Selbst wenn in einem Bundesland eine der großen Parteien über die absolute Mehrheit verfügte, war sie doch wegen des Rahmengesetzes, seinerseits das Ergebnis eines Kompromisses, gehindert, einen politisch „lupenreinen“ Standpunkt umzusetzen. In der Vergangenheit ist das Rahmengesetz mit seinen zwingenden Regelungen als Vorteil verstanden worden, weil auf diese Weise ein gewisses Maß an Übereinstimmung und Vergleichbarkeit gewährleistet schien. Je deutlicher es aber wurde, dass es eine Illusion war, von einem einigermaßen einheitlichen Niveau in der Ausbildung und im Abschluss auszugehen, desto mehr verlor auch die Position an Boden, die – formal – die Einheitlichkeit des Hochschulwesens de iure erhalten wollte.
Schon mit der Novellierung des HRG im Jahr 1998 wurde den Ländern ein größerer Gestaltungsraum gegeben, erst recht nach der Aufhebung des Gesetzes.2 Welche Folgen die unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten haben, erweist sich in der Praxis: Wettbewerb und Vielfalt oder Beliebigkeit und Unübersichtlichkeit. Dies ist anhand der einzelnen Gegenstände der Hochschulpolitik, die alle mehr oder weniger Objekte von Reformen waren oder sind, zu messen und zu beurteilen.