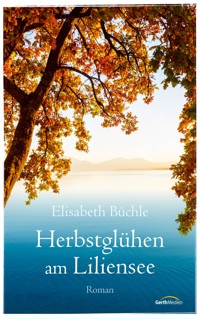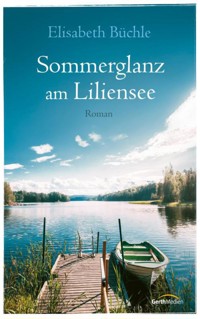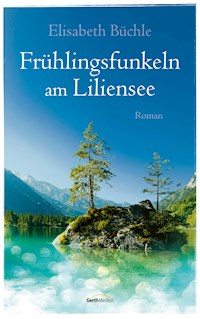9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Die Meindorff-Triologie
- Sprache: Deutsch
Während der Erste Weltkrieg seinen unheilvollen Lauf nimmt, versucht die junge Demy in Berlin weiter unermüdlich, sich und ihre Schützlinge durch die schwere Zeit zu bringen. Als sie unter der Last zusammenbricht, steht ihr Philippe Meindorff unverhofft zur Seite. Doch dann erhält die Familie eine niederschmetternde Nachricht, die alles erneut ins Wanken bringt ... Der dritte Band der großen Meindorff-Familiensaga, die in vergangene Zeiten und an spannende Schauplätze wie Berlin, St. Petersburg und Deutsch-Südwestafrika entführt. Band 1: Himmel über fremdem Land, 5516750 Band 2: Sturmwolken am Horizont, 5516921 Band 3: Hoffnung eines neuen Tages, 5516927
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 715
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Über die Autorin
Elisabeth Büchle hat bereits mehrere sehr erfolgreiche Romane veröffentlicht. Ihr Markenzeichen sind spannende Liebesgeschichten, die in gründlich recherchierte historische Zusammenhänge eingebettet sind.
www.elisabeth-büchle.de
Elisabeth Büchle
Hoffnungeines neuen Tages
Die Meindorff-Saga, Band 3
Für Berta und Friedrich Büchle
Personenregister
Familie van Campen, Holland:
Erik, Vater, 1908 gestorben
Tilla, älteste Tochter aus erster Ehe (mit einer Meindorff) 1915 gestorben
Anki, zweite Tochter aus erster Ehe (mit einer Meindorff)
Demy, erste Tochter aus zweiter Ehe
Rika, zweite Tochter aus zweiter Ehe
Erik Feddo, Sohn aus zweiter Ehe
Familie Meindorff, Berlin
Joseph Senior, Familienpatriarch, Inhaber von Meindorff-Elektrik
Joseph Junior, erster Sohn (Ehemann von Tilla)
Hans (Hannes), zweiter Sohn
Albert, dritter Sohn
Philippe, Pflegesohn der Meindorffs, Sohn einer Familienangehörigen des französischen Meindorff-Zweigs
Großbürgertum, Berlin
Anton Daul, früherer Schlafbursche bei Peter, Willi und Lieselotte
Lina Daul, geb. Barna, Freundin von Demy
Margarete Groß, geb. Pfister, Freundin von Demy
Martin Willmann, erfolgreicher Jungunternehmer, früherer Geliebter von Tilla
Petrograd1, Russland
Familie Chabenski:
Ilja Michajlowitsch, Arbeitgeber von Anki, gestorben 1915
Oksana Andrejewna, Arbeitgeberin von Anki, gestorben 1915
Nina Iljichna, älteste Tochter
Jelena Iljichna, zweite Tochter
Katja Iljichna, dritte Tochter
Jenja Iljichna, jüngste Tochter
Weitere Personen in Petrograd:
Ljudmila Sergejewna Zoraw, Freundin Ankis
Oskar Busch, jüngerer Bruder von Robert
Raisa Wladimirowna Osminken, Freundin von Nina
Wladimir Pawlowitsch Osminken, Raisas Vater
Demys »Gäste«
Edith, mit den Töchtern Luisa und Leni, Hannes’ Familie
Irma und Pauline, beim Betteln angetroffen
Monika Lisrep und ihr Sohn Markus, flüchtete vor ihrer Mutter
Peter und Willi, Zwillingsbrüder von Lieselotte
Viktor Müller, ehemaliger Patient von Marias Ehemann
Grete, von Philippe aufgefunden
Hannes’ Zug, Westfront
Otto Waldmann, Feldwebel
Eisenburg, Dahn, Lasswitz; Unteroffiziere
»Bubi« August Butzmann, lange Zeit das Nesthäkchen des Zugs
Hillgart, Ulrich Unzer, Adrian Oettinger, Wolfgang Göke; Soldaten
Sonstige
Bernhard Walther, Missionar in Deutsch-Südwestafrika (Namibia)
Cecelia Klein, Hilfsschwester bei Edith im Lazarett
Karl Roth/Clément Rouge, ehemaliger Unteroffizier unter Philippe in Afrika, Doppelspion für Deutschland und Frankreich
Lieselotte Scheffler, ältere Schwester von Peter und Willi, erste Freundin Demys in Berlin.
Theodor Birk, ehemaliger Kadettenkollege und Trauzeuge von Hannes
John Howell, britischer Freund von Philippe
Julia Romeike, langjährige Geliebte von Joseph Jr.
Udako, verstorbene Verlobte von Philippe aus Deutsch-Südwestafrika
1 Weil die russische Hauptstadt St. Petersburg einen deutschen Namen trug, nannte Zar Nikolaj II. sie kurz nach Kriegsbeginn in Petrograd um.
Vorwort
Die Lage … in Russland, zu Beginn des Jahres 1917
Russland besaß weder die finanziellen noch die technischen Ressourcen, um den Krieg gegen das Deutsche Reich länger durchzuhalten und hatte in diesem bereits mehr Soldaten verloren als in allen vorherigen Kriegen zusammen. Vielen der Soldaten fehlte es nicht nur an Nahrungsmitteln, Munition, Kleidung und Ausrüstungsgegenständen, sondern auch an Waffen. In den russischen Städten verhungerten die Menschen. Streiks, Protestmärsche und Aufstände standen auf der Tagesordnung – und wurden gnadenlos niedergeknüppelt.
Die Elite des Landes hatte 1916 Rasputin ermordet, in der Hoffnung, dass der Zar nach Rasputins Tod seine Politik ändern und längst überfällige politische, wirtschaftliche und soziale Veränderungen herbeiführen würde. Doch Nikolaj II behielt seinen Kurs bei und schlug alle Warnungen in den Wind, selbst den Wunsch der Duma, zumindest eine konstitutionelle Form der Regierung einzuführen. Dies führte zu Plänen der einflussreichen Klasse, eine Palastrevolution durchzuführen, um einem gefährlichen Aufstand der unzufriedenen und aufgepeitschten Massen zuvorzukommen.
Der 3. März (18. Februar lt. julianischem Kalender. Dieser wurde bis 1918 in Russland geführt – deshalb auch der Begriff »Februarrevolution«) begann mit Streiks der Arbeiter im Putilow-Werk, dem damals größten Industriebetrieb Russlands. Am 8. März (24. Februar) schlossen sich den Streikenden Zehntausende von Frauen an, die gegen den Hunger, den Krieg und den Zar demonstrierten. Petrograd (St. Petersburg) befand sich im totalen Ausnahmezustand.
Zar Nikolaj II mobilisierte seine gefürchteten Kosaken, doch die verbrüderten sich mit den Demonstranten.
Am 11. März (27. Februar) befahl der Autokrat der Petrograder Garnison, den Aufstand niederzuschlagen. Einige Arbeiter starben, doch allmählich verbündeten sich auch Teile dieser Soldaten mit dem Volk und weigerten sich, auf ihre Verwandten, Frauen und Kinder zu schießen.
Zu diesem Zeitpunkt löste der Zar die Duma auf. Die Abgeordneten bestätigten das Auflösungsdekret, hielten aber im »Privaten« eine Versammlung ab, aus der heraus das Provisorische Komitee zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung entstand.
Ab dem 12. März (28. Februar) war die Revolution nicht mehr aufzuhalten. Nach und nach verbrüderten sich die Regimenter mit den Aufständischen, die Regierung sah ihre Machtlosigkeit ein und trat zurück. Etwa zu dieser Zeit bildete sich das Provisorische Exekutivkomitee des Arbeiterdeputiertenrats, sodass bereits am 13. März. (29. Februar) ein Arbeiter- und Soldatenrat (Sowjet) in Petrograd gewählt wurde.
Lenin und seine kommunistischen Mitstreiter kehrten unter Mithilfe der Deutschen Obersten Heeresleitung aus der Schweiz über das Gebiet des Kriegsgegners Deutschland und über Schweden und Finnland nach Russland zurück. Lenin erreichte im April 1917 den Finnischen Bahnhof in Petrograd. Dort propagierte er die Revolution zur Machtübernahme der Arbeiter, Bauern und Soldaten, forderte umfangreiche Enteignungen und den Sturz der liberalen Übergangsregierung unter Kerenski, die sich schließlich in der Oktoberrevolution vollzog.
… im Deutschen Kaiserreich zu Beginn des Jahres 1917
In seiner Neujahrsbotschaft an die Truppen rief Kaiser Wilhelm II die erschöpften und in eiskalten, schlammigen Schützengräben ausharrenden Soldaten zum unverminderten Kampf gegen die Feinde auf. Wenig später wurde die Bevölkerung durch die Presse aufgerufen, keine Jammerbriefe an die Front zu schicken, um die Soldaten nicht zu demoralisieren. In dieser Zeit entschlüsselte der amerikanische Geheimdienst ein Bündnisangebot Deutschlands an Mexiko – für den Fall, dass die USA dem Deutschen Kaiserreich den Krieg erklären sollten. Dies förderte die Bereitschaft der USA, in den auf dem europäischen Kontinent herrschenden Krieg einzutreten. Dennoch forderte Präsident Woodrow Wilson einen Frieden ohne Sieger, doch die deutsche Regierung lehnte die Friedensbotschaft ab. Als Folge – und wegen des uneingeschränkten U-Boot-Kriegs – brachen die USA Anfang Februar die diplomatischen Beziehungen mit dem Kaiserreich ab.
Unterdessen litten die Bürger unter einer anhaltenden Hungersnot, was in Berlin zur Gründung eines Ministeriums für Lebensmittelversorgung führte. Sogar Fünf-Pfennig-Münzen aus Kupfer wurden für Kriegszwecke eingezogen und durch Münzen aus Aluminium ersetzt; wegen des Kohle- und Holzmangels schlossen im Februar sämtliche Berliner Schulen. Somit hatte der Krieg in jeden noch so kleinen, bisher von seinem Einfluss verschont gebliebenen Winkel des Landes Einzug gehalten.
»Jede Kanone, die gebaut wird, jedes Kriegsschiff, das vom Stapel gelassen wird, jede abgefeuerte Rakete bedeutet letztlich einen Diebstahl an denen, die hungern und nichts zu essen bekommen, denen, die frieren und keine Kleidung haben. Eine Welt unter Waffen verpulvert nicht nur Geld allein. Sie verpulvert auch den Schweiß ihrer Arbeiter, den Geist ihrer Wissenschaftler und die Hoffnung ihrer Kinder.«
Dwight D. Eisenhower (1890 – 1969, 34. Präsident der USA)
Prolog
1918
Dichte Wolkenberge zogen wie graue Fabelwesen über die Gebäude und ließen die kühle Nacht noch unwirtlicher und bedrohlicher wirken. Schattengestalten, darum bemüht, nicht gesehen zu werden, huschten in dunkle Hauseingänge und unter Hinterhoftorbögen. Das Rascheln ihrer Kleidung und ihre verhaltenen, wie ein Flüstern anmutenden Schritte blieben der einsamen Gestalt nicht verborgen.
Die Stadt war im Aufruhr, die Menschen schwankten zwischen Freude und Demütigung, Hoffnung und Hass. Doch die Triebfeder der einen Person, die über das nasse Pflaster hastete, war eine völlig andere: Angst.
Ein kühler Luftzug erfasste sie und verdeutlichte, dass sie sich wiederum einem Gewässer näherte. Dann sah sie ihn! Er betrat die Brücke über den Fluss, noch immer wie ein Jäger an die Fährte seines hilflosen, womöglich sogar ahnungslosen Opfers geheftet.
Auch die einsame Gestalt war zum Verfolger geworden; sie erkor den Jäger zu ihrer Beute.
Etwa in der Mitte der Brücke hatte sie ihn eingeholt, rief ihn an und forderte eine Erklärung. Der Mann drehte sich um. Ein Messer blitzte bläulich im Mondlicht auf, das sich einmal mehr einen Weg durch Wolken gekämpft hatte.
Sie spürte den Schmerz. Einmal. Zweimal. Dreimal. Doch ihr Wille blieb ungebrochen. Nun, da er zu ihrem Gegner geworden war, versetzte sie ihm einen kräftigen Stoß und entrang ihm das Messer. Rasend vor Zorn, da sie seine Pläne durchkreuzte, stürzte er sich versehentlich in dieses.
Seine weit aufgerissenen Augen starrten sie an. Verwundert, wie es ihr schien. Sie nutzte die letzte ihr verbliebene Kraft und stieß den Mann über die niedrige Steinbrüstung. Vom Mond goldfarben beleuchtet schlugen die Fluten über seinem Körper zusammen. Das Klatschen der Wellen hatte etwas beruhigend Endgültiges an sich. Also hob sie trotz ihrer Schmerzen und des aus ihr fließenden Lebens den Kopf und sah, wie die dritte Gestalt im Schutz der Häuserzeilen aus ihrem Blick entschwand, ohne dem Geschehen in ihrem Rücken irgendeine Bedeutung beizumessen. Der Jäger war tot, das Opfer entkommen. Erleichtert seufzte die zurückbleibende Person auf.
Teil 1
Kapitel 1
Berlin, Deutsches Reich, März 1917
Sie war jung, süß und unschuldig – und eine Gefahr für ihn, denn sie war eine van Campen. Karl Roth lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und musterte Rika ungeniert. Die junge Frau bewegte sich auf der Tanzfläche elegant, fast schon beschwingt, allerdings bei Weitem nicht so erotisch wie ihre Landsmännin Mata Hari.
Karl schluckte hörbar. Er war nie an die schöne Mata Hari herangekommen, obgleich er ihr mehrmals begegnet war. Nun besagten die Gerüchte, dass sie in Frankreich verhaftet worden sei. Offenbar war man inzwischen endgültig von ihrer Spionagetätigkeit überzeugt. Ob die Franzosen es wagen würden, eine so schöne und zudem bekannte Frau wie Mata Hari hinzurichten?
Er zuckte mit den Schultern. Es war ihm gleichgültig, denn sie bedeutete ihm nichts. Vielleicht wäre es anders, hätte sie seinen Avancen nachgegeben, doch die ehemalige erotische Tänzerin war zu verwöhnt gewesen, was ihre Liebhaber anbelangte. Oder verschenkte sie ihre Gunst ausschließlich an ranghohe Militärs und Regierungsangehörige, bei denen sie neben Geld, Schmuck und Kleidern auch Informationen für die Gegenseite erwarten konnte? Er jedoch war nur ein unbedeutendes Rad im französischen Geheimdienst gewesen. Unwichtig und unterdessen aussortiert.
Wütend ballte er seine Hände zu Fäusten. Wieder einmal war er wegen einer Nachlässigkeit vor die Tür gesetzt worden. Und wie schon so oft hatte Philippe Meindorff, der Ziehsohn des Berliner Industriellen Joseph Meindorff, dabei eine bedeutende Rolle gespielt. Wie auch damals in Deutsch-Südwestafrika2, als Leutnant Philippe Meindorff dafür gesorgt hatte, dass man Karl unehrenhaft aus der Armee entließ.
Karls Unterkiefer knackte, während er eine eigentümliche Mundbewegung ausführte, die die Sperre in seinem Kiefergelenk lösen sollte. Dieses Problem hatte er sich als Jugendlicher zugezogen, damals in der Provence, kurz vor dem Tod seiner Pflegemutter, als er sich wieder einmal mit einigen Jungs geprügelt hatte.
Am Nebentisch lachte eine blonde Schönheit fröhlich auf. Karls Blick wanderte von Rika zu dieser zweiten, absolut aufregenden Frau. Sie hieß Julia, so viel hatte er bereits herausgefunden. Vermutlich wartete sie hier auf einen Mann, der sich jedoch verspätete oder sie versetzt hatte. Ein unverzeihlicher Fehler, wie Karl, aber auch andere Männer fanden, die der schönen Frau vergeblich ein Getränk spendieren oder ihr ihre Gesellschaft anbieten wollten.
Die Musik aus dem Grammophon wurde flotter. Karl, der froh war, keine Marschmusik hören zu müssen, suchte Rika und lächelte anzüglich, als er sah, dass ihr geschlitzter Rock durch ihre schwungvollen Bewegungen großzügige Einblicke auf ihre Beine gewährte. Mit sieben Paaren, die alle piekfein gekleidet waren – die Damen mit kecken Hüten auf dem modisch gekürzten Lockenhaar –, war die Tanzfläche zwischen den schwarzen Stühlen und mit Spitzentischdecken verzierten, runden Tischen überfüllt. Demzufolge pressten sich Rika und ihr uniformierter Tanzpartner unanständig eng aneinander. Schmucklose Lampen verbreiteten über den Tänzern ein helles Licht, wohingegen die Nischen weiter hinten im Raum umso schummriger und lauschiger ausfielen.
Rika lachte ihren Tanzpartner an, doch das ausgelassene Strahlen auf dem mädchenhaften Gesicht verflog so plötzlich, als habe jemand einen Lichtschalter ausgedreht. Ihre blauen Augen weiteten sich entsetzt. Sie befreite sich aus dem Arm ihres verdutzten Verehrers, einem schneidigen Fliegerleutnant.
Karl folgte ihrem Blick und zog sich sofort die Mütze tiefer in die Stirn. Unter der zu grellen Deckenbeleuchtung stand unverkennbar Demy van Campen, Rikas ältere Schwester.
Seit ihrem Zusammentreffen im Sommer 1914 in Paris war Demy deutlich schmaler geworden. Offenbar gingen die Hungerjahre auch an ihr nicht spurlos vorüber. Damals hatte er ihr eine Nachricht an seinen deutschen Spitzelkollegen zugesteckt. Dank einer rührseligen Geschichte von seiner angeblichen Verlobten, von der er sich nicht mehr habe verabschieden können, hatte er sie in sein gefährliches Spionagespiel hineingezogen. Demy van Campen war naiv genug gewesen, ihm die Geschichte zu glauben, sodass er zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen hatte: Zum einen hatte er eine der Töchter seines verhassten ehemaligen Kompagnons Erik van Campen in Schwierigkeiten, wenn nicht sogar in Lebensgefahr gebracht, denn die Geheimdienste ließen nicht mit sich spaßen, und gleichzeitig war er seinen Verfolgern entkommen. Damit war gewährleistet gewesen, dass er noch über mehrere Monate hinweg seine Doppelspionagetätigkeit aufrechterhalten konnte. Aber selbst an diesem Tag hatte Meindorff ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht und Demy vor den Häschern des französischen Geheimdienstes gerettet.
Philippe Meindorff! Seit vielen Jahren funkte er ihm immer wieder empfindlich dazwischen und Karls Groll auf ihn wuchs beständig.
Demy erreichte die Tanzfläche und packte ihre jüngere Schwester am Handgelenk, gleichzeitig bedachte sie deren Tanzpartner mit einem wütenden Blick. Diese Frau hat Mumm, stellte Karl fest, der nur zu gut wusste, dass die meisten Offiziere aus dem Adel, einige andere aus dem reichen Großbürgertum stammten.
»Was soll ich davon halten?«, fuhr Demy Rika an.
Rika zog einen Schmollmund und erwiderte den Blick der deutlich größeren Demy wütend. »Heute ist mein zwanzigster Geburtstag, da darf ich wohl mal feiern!«, protestierte Rika aufgebracht. »Es ist schrecklich hier! Dieser Krieg, der Verzicht auf alles was Freude bereitet. Du weißt doch genauso gut wie ich, wie sich das anfühlt!«
Karl sah, wie auf Demys gerader Nase kleine Falten entstanden, aber ihr Blick wurde milder.
»Es ist meine Schuld, Demy!«, mischte sich zu Karls Verwunderung nun der Uniformierte ein. »Ich habe Rika hierher eingeladen.«
»Albert, du weißt, dass diese Clubs zwar nicht verboten sind, aber misstrauisch beäugt werden. Wie willst du der hungernden Bevölkerung da draußen klarmachen, dass hier …«
»Fräulein van Campen?« Zu Karls Überraschung wusste auch diese Julia, wen sie da vor sich hatte. »Ich hätte Sie nicht erkannt, wäre da nicht Ihr ungewöhnlicher Vorname.«
Die beiden Frauen maßen sich mit abschätzenden Blicken; Rika und ihr Begleiter sahen sich fragend an.
»Fräulein Romeike?« Die Falten auf Demys Nase vertieften sich, was der aufmerksame Beobachter als Missbilligung interpretierte.
»Mir gehört dieser Club anteilig und ich verspreche Ihnen, dass wir hier nichts ausschenken, das nicht auch in anderen Wirtshäusern zu finden ist.«
»Von denen aber die meisten geschlossen haben, da nicht genug Lebensmittel vorhanden sind.«
Julia zog in einer anmutigen Bewegung die rechte Schulter nach oben und wandte sich Rika und ihrem Begleiter zu. »Mein Name ist Julia Romeike. Fräulein van Campen und ich haben uns auf der Hochzeit von Tilla und Joseph Meindorff kennengelernt. Ich höre viel Gutes über Fräulein van Campen, und da Sie beide noch sehr jung zu sein scheinen, möchte ich Sie bitten, ihrem Wunsch nachzukommen, dass Sie dieses Etablissement verlassen.«
Karl grinste. Diese Julia wollte einen Aufruhr verhindern, da die geschwisterliche Zwistigkeit bereits unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich zog.
»Leider konnten wir einander bei Josephs Vermählung nicht vorgestellt werden, da ich in Groß-Lichterfelde3 zur Offiziersausbildung war. Mein Name ist Albert Meindorff.« Der Fliegerleutnant verneigte sich wie ein geübter Galan.
Karl presste die Zähne zusammen, bis sie knirschten und sein Kiefer erneut dieses grässliche Knacksen von sich gab. Ein Meindorff! Ein Mitglied der Familie, die Philippe aufgenommen, verhätschelt und großgezogen hatte. Der Hass auf diesen Mann und seine Sippe quoll in ihm hoch wie überkochende Milch auf dem Herd. Nur mühsam zwang er sich, still sitzen zu bleiben, denn Demy durfte ihn nicht sehen. Die Gefahr, von ihr als ein gewisser Clément Rouge aus Paris wiedererkannt zu werden, war zu groß.
»Wir gehen«, befahl Demy mit hartem Tonfall, doch Julia wandte sich mit ihrem einnehmenden Lächeln bereits Meindorff zu.
»Sie sind ein Bruder von Joseph?«
»Der Jüngste seiner drei Brüder, ja.«
»Richtig. Da gibt es noch Hans, der eine Arbeiterfrau heiratete.« Ihr Blick huschte für einen Augenblick zu Demy, der ehemaligen Verlobten von Hannes. »Wurde er nicht enterbt? Und natürlich Sie, Albert.« Wieder schenkte sie dem Mann ihr strahlendes Lächeln und dieser starrte die Frau hingerissen an.
Demy griff mittlerweile nach Rikas Hand, als wolle sie ihre Schwester gewaltsam hinter sich her aus dem Lokal zerren.
»Philippe, so heißt der Vierte im Bunde, nicht wahr?«
Albert tat seine Zustimmung durch ein Nicken kund.
»Ein Zögling des Familienpatriarchen, gebürtig von einer Frau aus der französischen Linie der Familie. Sind Sie nicht seit geraumer Zeit mit Philippe verlobt, Fräulein van Campen?«
»Albert, würdest du bitte das Geburtstagskind hinausbegleiten?«, bat Demy in einem Tonfall, der eher einem Befehl gleichkam, obwohl Albert älter war als sie. In jedem Fall aber gehörte er der Familie an, bei der Demy angestellt war.
Karl registrierte alle diese Details aufmerksam. Nicht umsonst war er während seiner Geheimdiensttätigkeit dahingehend geschult worden.
Der jüngste Spross der Meindorffs, noch immer mit einem hingerissenen Lächeln auf dem Gesicht, verabschiedete sich von Julia, bot Rika den Arm und zwängte sich mit ihr an den Tanzenden vorbei in Richtung Ausgang.
Kaum, dass das Paar außer Hörweite war, baute Demy sich vor Julia auf, die unverbindlich lächelte. »Entschuldigen Sie bitte, Fräulein van Campen. Ich wusste nicht, wer die bezaubernde Dame und ihr Begleiter waren, als sie in Gesellschaft einiger anderer Gäste hier eintrafen.«
»Was wäre geschehen, wenn Sie es gewusst hätten?«
»Vermutlich hätte ich Sie telefonisch informiert oder die beiden angesichts des jugendlichen Alters Ihrer Schwester gebeten, den Club zu verlassen.«
»So?«
»Fräulein van Campen, ich schätze Sie wirklich sehr.«
»Das kann ich mir schwer vorstellen. Joseph wird nicht gerade gut über mich sprechen.«
»Joseph?« Julia lachte. »Nein, das tat er nie. Aber falls es Sie tröstet: Er hatte für niemanden ein freundliches Wort übrig. Wir haben ohnehin kaum miteinander gesprochen, wenn Sie verstehen …«
»Ich verstehe sehr gut.«
»Dann sind Sie tatsächlich erwachsen geworden.« Wieder lachte Julia, und Karl fragte sich, ob sie sich über ihre Gesprächspartnerin lustig machte.
Demy schätzte die Situation wohl ähnlich ein, denn die Falten auf ihrer Nase vertieften sich nochmals, und sie stemmte die Hände in die schlanke Taille.
»Liesl sprach immer sehr gut über Sie«, fuhr Julia fort, ohne auf Demys Geste einzugehen. »Sie erinnern sich sicher an Ihre Freundin aus dem Scheunenviertel? Wenn ich richtig informiert bin, hat sie ihre Zwillingsbrüder bei Ihnen abgegeben, weil sie sich nach dem Tod der Mutter nicht um sie kümmern konnte – oder wollte.«
Von Demy kam lediglich ein nichtssagendes Nicken, was Karl bedauerte, da ihn alle Informationen zum Hause Meindorff brennend interessierten. Immerhin war er auf Rache aus.
»Ich hoffe, Joseph geht es gut?« Julias Frage schien Demy zu überraschen. Auch Karl fragte sich, in welcher Beziehung der Meindorff-Erbe zu dieser Schönheit stand.
»Joseph?«, stammelte Demy, ehe sie sich wieder fasste. »Ich bin davon ausgegangen, dass Sie ihn gelegentlich treffen. Außer auf der Beerdigung meiner Schwester – seiner Ehefrau –, und eines kurzen Besuchs im letzten Winter haben wir ihn nicht zu Gesicht bekommen, seit er an der Front ist.«
»Ich habe Joseph nicht mehr gesehen, seit er ausgerückt ist.«
»Aber …« Demy zögerte und betrachtete ihre Hände, die sie schließlich unsicher hinter ihrem Rücken verschränkte. »Bisher hatte ich angenommen, er kümmere sich um die Geschäfte rund um seine Bierbrauerei, wenn er Sie besucht.«
Julia schüttelte den Kopf und beugte sich zu Demy hinüber. Auch Karl rutschte auf seinem Stuhl nach vorn und missachtete dabei die Gefahr, in die er sich brachte.
Mit Mühe erlauschte er, wie Julia Demy zuflüsterte: »Es geht das Gerücht, dass Joseph die Brauerei verloren hat. Und um Meindorff-Elektrik steht es ebenfalls schlecht.«
Karls Gesicht verzog sich zu einem breiten Grinsen. Diese Informationen sagten ihm zu. Er konnte Philippe Meindorff nicht nur körperlich schaden, sondern er würde ihn zuvor auch noch auf andere Arten quälen. Immerhin war er verlobt! Und bald würde Philippe, ganz ohne sein Zutun, sogar der Grundlage beraubt sein, die ihn so hochmütig machte: die Finanzkraft und Macht der Meindorffs.
Als Demy den Club verließ und Julia durch eine Hintertür verschwand, rieb Karl sich zufrieden die Hände. Eines Tages würde er es Philippe Meindorff heimzahlen, dass er ihm Udako, dieses bezaubernde Nama-Mädchen weggenommen hatte. Sie war dann versehentlich im Kugelhagel der Männer umgekommen, die Karl angeheuert hatte – statt dass, wie geplant, Philippe ein Opfer der Schützen geworden war!
Bald schon würde Philippe für all die Schmähungen und Benachteiligungen bezahlen, die Karl hatte erleiden müssen: in Afrika, später in Frankreich und überhaupt sein ganzes Leben lang. Dieses ungewöhnliche Zusammentreffen zwischen Demy van Campen und Julia Romeike, dessen Zeuge er geworden war, erwies sich für ihn als sehr wertvoll. Es hatte ihm Informationen über die geschäftlichen Belange der Meindorffs geliefert, samt der Tatsache, dass sein ehemaliger Vorgesetzter in der Schutztruppe Deutsch-Südwestafrikas offenbar erneut sein Herz an eine Frau verschenkt hatte: an Demy van Campen.
***
Albert, der nach seinem Heimaturlaub zurück nach Metz musste, um dort seine letzte Jagdpilotenprüfung abzulegen, trennte sich noch in der Innenstadt von den beiden Frauen, was Demy erleichterte. Es war nicht alltäglich für sie, dass sie einem Meindorff Befehle erteilte. Vermutlich war es nur seiner guten Erziehung und dem Wunsch, in dem Etablissement nicht negativ aufzufallen, zu verdanken, dass er widerspruchslos darauf eingegangen war.
Nachdem Albert sie verlassen hatte, stapfte Rika auf ihrem langen Weg durch den Tiergarten schmollend neben Demy her. Diese störte sich nicht daran. Sie war damals, als sie mit 13 Jahren und gegen ihren Willen von ihrer älteren Schwester Tilla nach Berlin gebracht worden war, ebenso unglücklich gewesen wie Rika heute. Doch während Rika zunehmend amouröse Abenteuer suchte und gegen alles und jeden aufbegehrte, war Demy aus dem Hause Meindorff mit seinen starren Regeln ausgebrochen, wann immer es ihr möglich war. Sie hatte eine Freundschaft mit Lieselotte und ihren Geschwistern aus dem heruntergekommenen Scheunenviertel begonnen, drei Arbeiterkindern Unterricht erteilt und eine Geburt mitten auf der Straße miterlebt.
Ein sanftes Lächeln umspielte Demys Lippen. Die van Campen-Geschwister waren nun einmal alle grundverschieden. Ihre älteste Halbschwester Tilla, die ein Jahr zuvor nach einer Abtreibung verstorben war, war immer auf Ansehen und Erfolg aus gewesen und hatte das leichte Leben im Wohlstand genossen. Anki, ebenfalls eine Halbschwester von Demy, Rika und Feddo, lebte nun schon seit über 10 Jahren in Russland. Sie zeichnete sich durch Verantwortungsbewusstsein und ein fast ängstliches Sicherheitsbestreben aus. Deshalb hatte Demy Ankis Entscheidung, praktisch von einem Tag auf den anderen mit einer russischen Adelsfamilie nach St. Petersburg zu ziehen, lange nicht nachvollziehen können. Bis zu dem Tag, als Tilla ihr auf dem Sterbebett von den Übergriffen ihres Vaters auf seine Töchter erzählt hatte …
Im Augenblick bereitete allerdings Rika Demy Kummer. Tillas Verdacht, dass sie zu spät nach Koudekerke in den Niederlanden zurückgekehrt war, um die jüngste Schwester vor den sexuellen Begierden ihres eigenen Vaters zu schützen, hatte Rika nie bestätigt. Ob aber ihr Hang, Männer zu bezirzen, nicht dafür sprach? Tilla jedenfalls hatte auf die Übergriffe des Vaters genau gegenteilig reagiert. Männer waren für sie beinahe zu einem Feindbild geworden.
Und Feddo? Der Junge war mittlerweile 16 Jahre alt und wusste offensichtlich nicht, was er mit seinem Leben anfangen sollte. Aber wen verwunderte dies? Er war nach dem plötzlichen Tod seines Vaters seinem Zuhause entrissen worden und in einem Haushalt gestrandet, in dem er, wie auch seine Schwestern, als lästiger Anhang von Tilla angesehen wurde. Zwar ging er noch zur Schule, doch seit Kriegsbeginn fand der Unterricht nur unregelmäßig statt, und von Demy ließ er sich inzwischen nicht mehr unterrichten. Er drohte ihr zu entgleiten, ebenso wie Rika.
»Rika?«
Sie ignorierte Demy und zog an dem weit herunterhängenden Ast einer Trauerweide, deren Blätter nach diesem kältesten Winter des noch jungen Jahrhunderts nicht einmal als zarte Knospen zu erahnen waren. Der Ast schnalzte zurück und fuhr über die zaghaft hervorbrechenden, gelben Blüten einer Forsythie.
»Es tut mir leid, Rika, dass ich dir den Spaß verdorben habe. Aber du gehörst nicht in so ein Lokal. Ich weiß nicht, was Albert eingefallen ist, dich dorthin zu schleppen.«
»Ich wollte feiern und tanzen.«
»Wir können heute Abend zu Hause …«
»Zu Hause? Unser Zuhause ist in Koudekerke! Schon vergessen? Wenn ich es hier aushalten soll, möchte ich zumindest die Vorteile genießen, die diese Stadt mir bietet.«
»Du redest wie Tilla«, brummte Demy, der an diesem Tag jegliche Kraft für ein anstrengendes Gespräch fehlte. Dennoch sah sie sich gezwungen, es zu führen.
»Und du wie der alte Meindorff: Du darfst das nicht, dies ist verboten und jenes schickt sich nicht!«
»Dieses Thema haben wir bereits genügend ausgeschöpft, dachte ich.« Demy seufzte. Die Verantwortung für ihre Geschwister, die Angestellten im Haus, den kranken Hausherrn und die Personen, die es im Laufe der Kriegsjahre zu ihnen gespült hatte, wog schwer auf ihren Schultern. »Liebst du Albert?«
Rika sah sie mit aufgerissenen Augen an, ehe sie schallend lachte. »Ob ich Albert liebe?«
»Was gibt es sonst für einen Grund, dich in der Weise an ihn zu pressen, wie du es beim Tanzen getan hast?«
»Meine Güte, in welchem Jahrhundert lebst du?«, spottete Rika.
»Was spielt das Jahrhundert für eine Rolle, wenn es darum geht, dass Frau und Mann einander mit Bedacht und Respekt begegnen? Ich halte es für ungesund, wenn eine Frau einem Mann mehr anbietet, als sie ihm nachher geben kann und will.«
»Woher willst du wissen, was ich ihm später noch gegeben hätte?«, forderte Rika sie mit einem frechen Grinsen heraus.
»Hoffentlich nichts, das nicht in den geschützten Rahmen einer Ehe gehört.«
Wieder lachte Rika, legte dabei den Kopf in den Nacken und blickte zum wolkenverhangenen Himmel hinauf. »Und das sagt ausgerechnet die Verlobte von Philippe Meindorff! Wie lange ist es jetzt her, seit er Berlin den Rücken gekehrt hat? Mehr als zehn Jahre? Und noch immer tuschelt man hier in Berlin über ihn und seine Frauengeschichten.«
Mit geballten Fäusten starrte Demy in Richtung Schloss Charlottenburg. Es thronte, eingebettet in einen wunderschönen Park, am vorderen Ende der Straße, in der das Haus der Meindorffs stand. »Philippes und meine Verbindung spielt sich in einem Rahmen ab, der …«
»Du könntest ihn an mich abtreten, diesen Philippe! Er ist so männlich und aufregend! Du bist es ja gewohnt, die verprellte Braut eines Meindorff-Sohnes zu sein.«
Ein Schmerz, fast so stechend wie die sie seit Tagen plagenden Halsschmerzen, ergriff von Demys Herzen Besitz und ließ sie in Schweigen verfallen. Da war es wieder: ihr Stigma. Seit sie Hannes und Edith mit einer Scheinverlobung zu Hilfe gekommen war, galt sie in der Gesellschaft Berlins als versetzte Braut. Aus verschiedenen Gründen, unter anderem um nicht aus ihrem letzten Zufluchtsort – dem Haus Meindorff – geworfen zu werden, hatte sie vor drei Jahren einer Verlobung mit einem weiteren Meindorff zugestimmt. Auch diese Verbindung war eine Farce, weshalb sie Philippe getrost an Rika hätte abtreten können, hätte sie nicht gewusst, dass ihre flatterhafte Schwester ihre Schwärmerei für den Ingenieur und Piloten ohnehin bald vergessen haben würde.
»Es entsteht so viel Unglück, wenn die Ehe als unwichtig erachtet wird, liebe Schwester«, murmelte Demy. Wieder lachte Rika und Demy verstummte erneut.
Rika hatte nie erfahren, dass Tilla nicht nur an den Übergriffen ihres Vaters zerbrochen war, sondern auch an der Ungeduld ihres Mannes und seinem Beharren auf dem Verhältnis mit Julia Romeike. Zuletzt hatte Tilla sich auf einen anderen Mann eingelassen, einen früheren Geschäftspartner ihres Schwiegervaters, und war von ihm schwanger geworden. Bei dem Versuch, dieses Kind zu beseitigen, hatte Tilla den Tod gefunden.
Die Schwestern durchquerten den Schlosspark mit seinen Wasserläufen, dem Teich und der sprudelnden Spree und bogen in die Schlossstraße ein. Rika umgab sich noch immer mit einer Mauer aus Trotz und Demy spürte, dass sie mit jedem weiteren Wort alles nur verschlimmern würde. Sie wünschte sich, Anki wäre nicht unerreichbar weit von ihr entfernt in einem Land, das mit dem Deutschen Kaiserreich im Krieg lag, sondern würde ihr bei der Erziehung der jüngeren Geschwister helfend zur Seite stehen.
Sie traten durch das Tor vor dem Anwesen und schon stürmte ihnen Ediths und Hannes’ älteste Tochter Luisa entgegen. Die Achtjährige wedelte aufgeregt mit den Händen und rief mit sich überschlagender Stimme: »Tante Demy, Tante Demy, komm schnell! Feddo und Peter prügeln sich!«
»Wo?«, stieß Demy mit heiserer Stimme hervor.
»Im Garten!«
»Rika, nimm bitte Luisa mit hinein.« Ohne darauf zu warten, ob Rika zumindest dieser Anweisung nachkam, raffte Demy ihren grauen Faltenrock und stürmte am Haus vorbei in den rückwärtig gelegenen Garten. Inmitten der frisch umgegrabenen Beete, auf denen sie seit einigen Jahren versuchten, Lebensmittel anzubauen, rangen die zwei Gleichaltrigen miteinander, wobei Feddo tüchtig einstecken musste.
Peter, der Unzugänglichere der Scheffler-Zwillinge, hatte durch seine Vergangenheit auf dem Land und in den gefährlichen Gassen des Scheunenviertels weitaus mehr Kraft und wohl auch Erfahrung, was handgreifliche Auseinandersetzungen anbelangte.
Hilfe suchend sah Demy sich um, doch nicht einmal Peters Zwilling Willi hielt sich in der Nähe auf. Also stapfte sie durch die feuchte, schwer an ihren Schuhen klebende Erde zu den Burschen. »Aufhören! Hört sofort auf damit«, versuchte sie vergeblich, sich Gehör zu verschaffen.
Peter holte aus und ließ seine kräftige Faust mitten in Feddos Gesicht krachen. Blut schoss aus dessen Nase. Dennoch kämpfte er mit zusammengebissenen Zähnen und grimmigem Gesicht weiter und bemühte sich darum, wieder die Oberhand zu gewinnen, was ihm auch gelang. Er wand seinen rechten Arm aus Peters Umklammerung und holte zum Schlag aus.
Demy sprang hinzu und griff in seine Armbeuge. Der Faustschlag ging zwar ins Leere, doch die Wucht, mit der er ausgeführt wurde, riss Demy mit. Sie landete auf den Knien, und lag gleich darauf unter den Streithähnen, die sich über sie hinwegrollten. Sie bekam einige heftige Stöße von Ellenbogen und Knien ab und schrie vor Schmerz und Zorn zugleich auf. Aber die Kämpfenden ignorierten sie, bis sie plötzlich von zwei starken Händen, die keine Gegenwehr zuließen, von ihr fortgerissen wurden. Beide Burschen fanden sich links und rechts von Demy auf der nassen Erde wieder.
Verwirrt richtete Demy sich auf. Sie war über und über mit nasser Erde beschmutzt. Selbst ihre langen schwarzen Locken hingen ihr strähnig und mit Erdklumpen verklebt in das nicht minder verdreckte Gesicht. Aus dem Augenwinkel sah sie, dass Feddo erneut auf seinen Gegner zustürmen wollte. Ein harscher Befehl ließ ihn jedoch innehalten. Mit geballten Fäusten verharrte er nur einen Schritt von ihr entfernt. Demy hörte seinen keuchenden Atem.
Peter kauerte noch auf der Erde und wirkte so teilnahmslos wie meist.
Nun erst wandte Demy sich ihrem Helfer zu – und schrak zusammen. Vor ihr stand nicht wie erwartet Bruno, der Kutscher, sondern Philippe. In dem alten Pullover, den er unter seiner Fliegerjacke trug und unter der schräg aufgesetzten Soldatenkappe, den bei Piloten beliebten Schal um den Hals geschlungen, grinste er sie breit an, ehe er sich mit ernstem Gesicht an die beiden Raufbolde wandte: »Seid froh, dass ich vorbeigekommen bin. Fräulein Demy hätte euch in den Boden gestampft!«
Demy öffnete den Mund, brachte aber keinen Ton heraus. Von Feddos Seite kam ein prustendes Auflachen, während Peter ihr einen Blick zuwarf, der sie wohl um Verzeihung bitten sollte.
»Sie und ihr Spott haben mir gerade noch gefehlt«, knurrte Demy und setzte sich auf. Eilig zerrte sie ihren Rock zurecht, der unschicklich weit über ihre Knie gerutscht war und dort von der nassen Erde festgeklebt wurde.
»Ihre Dankbarkeit ist einmal mehr überwältigend«, konterte Philippe, streckte ihr allerdings die Hand entgegen. Einen Moment war Demy versucht, das Hilfsangebot rundweg auszuschlagen, aber die nasse Erde hing zentnerschwer an ihr. Also ergriff sie seine Rechte und ließ sich von ihm auf die Füße ziehen. Er tat dies mit so viel Schwung, dass sie förmlich gegen ihn taumelte. Bestürzt über seine Nähe wich sie zurück, jedoch ließ er ihre Hand nicht los.
»Sie sind nur noch ein Fliegengewicht! Essen Sie überhaupt etwas? Ihre kleine Anpflanzung hat doch eine ordentliche Ernte eingebracht?« Besorgt glitt sein Blick über ihr schmales Gesicht, und sie nutzte die Gelegenheit, um ihm endlich ihre Hand zu entwinden und sich nach den beiden Übeltätern umzusehen.
Peter und Feddo standen gut drei Meter voneinander entfernt da. Während ihr Bruder keineswegs schuldbewusst aussah, musterte Peter mit gewohnt finsterer Miene seinen Gegner.
»Herr Oberleutnant, ich esse durchaus«, sagte Demy, mehr an die Jungs als an Philippe gerichtet. »Aber Tage wie der heutige rauben mir eine Menge Energie«.
»Es kommt schon mal vor, dass Jungen sich prügeln«, meinte Philippe.
Demy wirbelte zu ihm herum. »Vielen Dank für Ihre wertvolle erzieherische Unterstützung!«
»Gern!«, erwiderte Philippe gelassen und wollte ihr doch tatsächlich einige Erdklumpen aus den Haaren ziehen. Sie schlug seine Finger energisch beiseite, woraufhin er seine Hände hinter dem Rücken verschränkte und sie amüsiert angrinste.
»Was war los?«, wandte sie sich an die Jungen.
Peter senkte den Kopf und begann, mit seinem ohnehin schon halb kaputten Schuh in der Erde zu bohren; Feddo zuckte lediglich mit den Schultern.
»Ich bestehe auf einer Antwort. Und zwar von beiden.«
Noch immer beschäftigte sich der eine Junge mit dem Erdboden, dem anderen verging zumindest das Grinsen.
Demy verschränkte die Arme vor der Brust und blickte über ihre gerümpfte Nase hinweg von Feddo zu Peter.
»Na wunderbar!«, stieß sie schließlich hervor. »Ich finde ja, schon allein dafür, wie ihr mich zugerichtet habt, verdiene ich eine Erklärung. Nun gut. Ihr zwei werdet euch jetzt Gartengeräte holen und dieses Beet in seinen vorherigen Zustand zurückversetzen. Anschließend putzt ihr eure Schuhe und wascht eure Kleidung, danach euch selbst. Ihr könnt euch in der Küche eine Scheibe Brot holen und dann verschwindet ihr für den Rest des Tages auf eure Zimmer.«
»Ja, Demy!«, murmelte Peter.
»Dürfte ich einen anderen Vorschlag unterbreiten?«, mischte Philippe sich ein.
Wieder wirbelte Demy zu ihm herum, wobei ein Schwindelgefühl, das sie völlig unvorbereitet überfiel, sie beinahe niederwarf. Nur mühsam gelang es ihr, aus dem Strudel zu entkommen, der sie in die Tiefe ziehen wollte. Sie bedachte Philippe mit einem aufgebrachten Blick. Was fiel diesem Luftikus ein, sich in ihre verzweifelten Bemühungen einzumischen, den Jungen die Flausen auszutreiben?
»Sie gehen wohl lieber ins Haus und …«, begann Demy, wurde von Philippe aber unterbrochen.
»Nicht, ehe Sie sich nicht bei mir bedankt haben. So viel gute Kinderstube müsste aus Fräulein Cronbergs Unterricht sogar bei Ihnen hängen geblieben sein.«
Wieder hörte sie Feddo leise lachen und selbst Peter gab einen belustigten Laut von sich.
»Was halten Sie davon, wenn die beiden mir von ihren Differenzen berichten und wir uns gemeinsam eine Bestrafung ausdenken?«, schlug Philippe vor.
Zuerst wollte Demy widersprechen, als sie jedoch den hoffnungsvollen Blick von Peter sah, überlegte sie es sich anders. Peters und Willis Vater hatte seine Kinder häufig mit dem Gürtel gezüchtigt. Womöglich war das einer der Gründe, weshalb der Junge so unzugänglich und verschlossen war, aber ihren Anweisungen aufs Wort folgte. Vielleicht würde es ihm guttun, einmal mitzuerleben, wie Erwachsene respektvoll mit Kindern umgingen?
»Kann ich Sie mit den Streithähnen allein lassen oder muss ich befürchten, dass Sie ihnen erlauben, ihre Auseinandersetzung erneut mit den Fäusten auszutragen?«
»Wir haben in dieser Welt genug Krieg, liebe Demy. Gehen Sie sich in aller Ruhe den Schmutz vom Gesicht kratzen, ich kläre das hier.«
Sie ermahnte die Jungen mit einem vorwurfsvollen Blick, den Mann mit einem nicht minder aufgebrachten, und stapfte zur Hintertür. Dort hatten sich inzwischen Willi und Demys Pflegesohn Nathanael eingefunden, und sie wusste nicht zu sagen, wem von beiden das breitere Grinsen im Gesicht stand. Sie wichen jedoch respektvoll zurück, um sie einzulassen. Ausgelaugt lehnte Demy sich an die geschlossene Tür, stützte den Hinterkopf an das Holz und schloss müde die schmerzenden Augen. Sie fühlte sich schwach, ja fiebrig, und die Halsschmerzen, die sie seit Tagen plagten, wurden allmählich unerträglich.
In ihrem desolaten Zustand kam sie nicht umhin, Dankbarkeit für Philippes überraschendes Auftauchen und sein Eingreifen zu empfinden. Eben noch hatte sie sich unendlich allein und überfordert gefühlt, und nun hatte er ihr eine unliebsame Aufgabe abgenommen. »Und dabei mag ich ihn gar nicht«, flüsterte sie halblaut vor sich hin.
In diesem Augenblick gaben ihre Beine nach, und sie rutschte an der Tür entlang zu Boden, wo sie kraftlos liegen blieb. Jede Bewegung, ja jeder Atemzug schien ihr unsäglich schwerzufallen.
Wenig später näherten sich ihr Schritte, und Maria stieß erschrocken hervor: »Demy? Was ist mit Ihnen? Sie sehen fürchterlich aus.« Die Frau ging neben ihr in die Hocke und umfing ihr Gesicht mit ihren Händen, zog sie aber ruckartig wieder zurück. »Sie glühen ja! Sie haben hohes Fieber!«
2 Heute: Namibia. Von 1884–1915 deutsche Kolonie.
3 In Groß-Lichterfelde war von 1878 bis 1920 die Königliche Preußische Hauptkadettenanstalt.
Kapitel 2
Petrograd, Russland, März 1917
Schwarze Wolkenberge türmten sich über der Stadt, als wollten sie die Paläste, Brücken und Kanäle unter sich begraben und zerquetschen. Vom Finnischen Meerbusen her fegte ein beißend kalter Wind durch die Straßen und Gassen und blähte die roten Flaggen an den Fenstern der Peter und Paul-Festung auf wie wütende, Feuer speiende Drachen.
Robert Busch wechselte seine Arzttasche in die linke Hand und blickte sich besorgt um, ehe er die Nikolaj-Brücke4 betrat. Seine Schritte wurden zunehmend schneller, beunruhigte ihn doch das durch die Straßen des Admiralitäts-Rajon5 dröhnende, dumpfe Knallen abgefeuerter Waffen. Er hatte lange genug in einem Frontlazarett gearbeitet, um die Geräusche richtig zu deuten – bevor er von den Russen gefangen genommen, nach Sibirien verschleppt und erst mithilfe von Dr. Botkin, dem Leibarzt der russischen Zarenfamilie, wieder befreit worden war. Für einen Moment verweilten seine Gedanken bei der Zariza, ihren vier Töchtern und dem kranken Zarewitsch. Ob sie in Zsarskoje Selo6 vor den Übergriffen der aufständischen Bürger in Sicherheit waren? Oder waren sie im Alexanderpalais Gefangene im eigenen Haus? Würde man sie töten, wenn man ihrer habhaft wurde?
Der Deutsche erreichte das Ufer. Die goldene Nadel auf der Admiralität bohrte sich drohend in die tief hängenden Wolken, ohne die grauen und schwarzen Gebilde beeindrucken zu können oder sie davon abzuhalten, auch noch einen Schneesturm über der Stadt abzuladen, die aufgrund der Revolution ohnehin schon brodelte wie ein Hexenkessel.
Robert eilte weiter in den Newskij Prospekt, denn sein Ziel war das Palais der Chabenskis an der Mojka. Dort hoffte er seine Ehefrau Anki und ihre vier Schützlinge anzutreffen, die Töchter der verstorbenen Fürstenfamilie. Ein paar Männer hinter einer Barrikade aus zusammengeschobenen Möbeln und einer Kutsche hielten ihn auf.
»Halt!«, brüllte ihm ein bärtiger Kerl entgegen. In seiner Rechten hielt er eine Pistole, in der Linken einen Besenstiel, an dem ein roter Stofffetzen im Wind knatterte. Wie seine Kameraden trug auch er das rote Band der Revolution um den Oberarm.
Roberts Hand, mit der er seine Tasche umklammerte, wurde schweißnass. Er hatte in russischer Gefangenschaft erlebt, wie gnadenlos Menschen reagieren konnten, wenn man einem Befehl nicht unverzüglich nachkam. Acht Männer, vier von ihnen bewaffnet, musterten ihn mit grimmigen Mienen. Robert widerstand der Versuchung, die Kerle darauf hinzuweisen, dass die Waffen, die sie gegen ihre eigenen Landsleute richteten, den Soldaten an der Front bitter fehlten.
»Wer bist du?«, wurde er von dem Bärtigen angeschnauzt. Offenbar galt er als Wortführer dieser kleinen Revolutionskeimzelle.
Robert zögerte. Als Deutscher wollte er sich ungern zu erkennen geben, ebenso wenig seine guten Beziehungen zu Dr. Botkin offenlegen. Also erwiderte er ausweichend, während ihm trotz der Kälte der Schweiß über den Rücken lief: »Ein Arzt.«
»Wo willst du hin?«
»Dahin, wo ich helfen kann!«, gab er zurück und dachte dabei vor allem an Anki. Welche Ängste musste sie wohl aushalten? Sein Blick verdüsterte sich, als er mehrere Rauchsäulen entdeckte, die über den Dächern aufstiegen und sich mit dem Schwarz der Wolken verbanden.
Zündete das geschundene, im Taumel des erfolgreichen Aufstands überschäumende Volk die Häuser des Adels an? Seine Furcht um Anki wuchs. Sie war zwar nur das Kindermädchen der Chabenskis, aber ihre Schützlinge gehörten als Fürstinnen dem Hochadel an und seine Frau würde sich in jedem Fall schützend vor die Mädchen stellen – und notfalls für sie sterben!
»Er redet seltsam«, brummte einer der Bewaffneten und musterte ihn unter hochgezogenen Augenbrauen. »Deutscher, was?«
Dem Arzt blieb nichts anderes übrig, als zu nicken, woraufhin zwei der Männer ihre Waffen unmissverständlich auf seinen Kopf richteten. Robert kniff die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen. Es war nicht das erste Mal, dass er in die Mündung einer Waffe blickte. Aber heute durfte er nicht sterben. Nicht, bevor er nicht alles versucht hatte, um Anki vor dem Mob zu retten. Zorn keimte in ihm auf.
Der Bärtige zischte seine Mitstreiter unwillig an. »Lasst ihn. Ich hörte, dass die Deutschen uns helfen wollen. Und wir können einen Arzt in unseren Reihen gebrauchen! Sascha, gib ihm eine Armbinde und lass ihn durch.«
Der Junge, den er Sascha gerufen hatte, eilte herbei und reichte Robert über ein zertrümmertes Klavier hinweg eine rote Armbinde. Robert band sie sich um den Ärmel seines Mantels und wartete, bis einige ineinander verkeilte viktorianische Stühle mit blassblauem Bezug beiseitegeräumt waren, damit er sich durch die Lücke zwängen konnte. Er wollte sich schnell davonmachen, doch der Bärtige hielt ihn am Arm zurück und flüsterte: »Meiner Frau geht es wieder gut. Und jetzt verschwinden Sie und lassen Sie die Armbinde unter allen Umständen gut sichtbar dran!«
Es gelang ihm nicht, den Mann mit einer ehemaligen Patientin in Verbindung zu bringen. Mit einem verwirrten Nicken eilte er den Prachtboulevard entlang.
Fahnen schwingende, laut singende Jugendliche kamen ihm entgegen. Die Scherben zersprungener Schaufenster lagen wie Tautropfen auf den eisigen Steinen vor den geplünderten Geschäften des Prospekts. Die Spuren des mehrtägigen Aufstands und der Schusswechsel ließen sich nicht verhehlen.
Robert warf einen kritischen Blick an den Himmel und runzelte die Stirn. Dies lag nicht an den düsteren Wolkengebilden, sondern an der zunehmenden Zahl der Rauchsäulen, die ihm verrieten, dass er sich dem Distrikt mit den meisten Adelshäusern näherte.
Heiße Schauer durchliefen seinen Körper. Waren die Plünderer auch in den Palast der Chabenskis eingedrungen? Zerstörten sie in ihrer Wut nicht nur die Einrichtung und nahmen die Wertgegenstände mit, sondern taten auch den Bewohnern des Hauses Übles an?
»Anki!«, stöhnte er und fiel, obwohl er eigentlich nicht auffallen wollte, erneut in einen schnellen Laufschritt. Er bog am Mojka-Kanal ab und rannte in eine Gruppe junger Menschen, die soeben aus einem Haus stürmten. Sie waren mit Schmuck und wertvoller Abendgarderobe behängt. Zwei von ihnen trugen sogar je ein goldgerahmtes Gemälde. Ein Mädchen, Robert vermutete in ihr eine Studentin, zuckte erst zurück, presste dann aber ihren schlanken Körper an seinen, sodass er rückwärtstaumelte und mit dem Rücken gegen die Hausfassade prallte.
»Was für ein hübscher Kerl!«, stieß sie aus und drückte ihre rot geschminkten Lippen auf die seinen. Sie roch nach Alkohol und Zigaretten und war ganz offensichtlich nicht nur trunken von den revolutionären Umtrieben.
»Fräulein, ich …«, stammelte Robert und verstummte perplex, als er die Hand des Mädchens in seinem Schritt spürte. Grob stieß er sie von sich, sodass sie rücklings zwischen ihre Freunde taumelte. Diese lachten, halfen der Betrunkenen auf die Beine und trollten sich.
Schwer atmend strich Robert seine widerspenstigen Haare aus dem Gesicht und bückte sich nach seiner Tasche, die ihm vor Schreck entglitten war. Dieser blindwütige, siegessichere Taumel der Revolution lockte die widerwärtigsten Seiten der Menschen zum Vorschein, nun, da sie sich von der Knechtschaft der herrschenden Klasse befreit glaubten. Falls einige Männer sich bei Anki …
Robert brachte den Gedanken nicht zu Ende. Mit wütend zusammengekniffenen Lippen und einem Aufruhr im Herzen, größer noch, als er in den Straßen dieser Stadt tobte, stürmte er vorwärts.
Die gelbweiße Fassade des Jussupow-Palasts kam in sein Sichtfeld. Die Fensterscheiben waren unversehrt, was Roberts rasenden Pulsschlag ein wenig verlangsamte. Waren die marodierenden Horden noch nicht bis hierher vorgedrungen? Oder fielen sie von der anderen Seite an der Mojka ein? Hier galt es niemandem beizustehen, denn Fürst Jussupow war mit seiner Familie nach dem Rasputin-Attentat nach Kursk verbannt worden, und so rannte Robert weiter.
Der Wind blähte seinen Mantel auf und biss ihm mit eisiger Kälte in das vom Laufen erhitzte Gesicht. Seinen Hut hatte er längst verloren, vermutlich bei dem Zusammenstoß mit dem Mädchen. Doch das war alles nebensächlich. Wichtig war nur, den Chabenski-Palast und somit Anki vor den Roten oder dem von ihnen aufgestachelten Volk zu erreichen. Endlich sah er vor sich das orangefarbene Vordach, getragen von den weißen dorischen Säulen. Gleich würde er dort sein. Bei Anki!
***
Anki Busch drehte sich einmal um sich selbst. Sie war nie mutig oder abenteuerlustig gewesen, und so fühlte sie sich inmitten der johlenden Menschenmenge, dem Meer aus roten Fahnen und dem offen gezeigten Hass gegen alles, was einen Adelstitel oder Polizeikleidung trug, zutiefst verunsichert. Dennoch schob sie sich entschlossen zwischen den Protestierenden und Feiernden hindurch. Sie musste Nina finden und nach Hause bringen. In Zeiten wie diesen gehörte eine Familie zusammen. Zudem hatte sie der Sechzehnjährigen verboten gehabt, das Haus zu verlassen.
Zorn und Angst mischten sich in Ankis Herzen mit der Liebe, die sie für die Chabenski-Töchter empfand, deren Kindermädchen die Deutsch-Niederländerin seit nunmehr zehn Jahren war.
Anki drückte sich hinter einem Treppenaufgang an eine Hauswand, als ihr eine weitere Horde laut johlender Menschen entgegenströmte. Sie kamen aus der Straße, in der das Haus der Osminkens stand.
Raisa Wladimirowna Osminken, mit ihren 20 Jahren und dank des unkonventionellen Erziehungsstils ihres Vaters ein großes, aber nicht unbedingt positives Vorbild für Nina, war Anki schon lange ein Dorn im Auge. Dass die Baroness es am heutigen Tag gewagt hatte, Nina zu sich zu bestellen, brachte das Kindermädchen noch mehr gegen sie auf.
»Was stehst du da mit trübem Gesicht herum, Hübsche? Komm und feiere mit uns!«
Anki starrte entsetzt den Burschen an, der wie aus dem Nichts vor ihr aufgetaucht war. Sie wollte an ihm vorbei, ohne ihm zu antworten, doch der Kerl packte sie an beiden Handgelenken und hinderte sie so an ihrem Vorhaben. »Nun sei doch nicht so prüde!«
»Bitte, lass mich!«, flehte Anki leise.
»Du hast einen süßen Akzent! Wo kommst du her?« Der Bursche, wohl einige Jahre jünger als sie selbst, trat näher und schaute sie mit seinen grünen Augen interessiert an.
»Niederlande!«, lautete die Antwort, die Robert ihr eingeschärft hatte.
Bei dem Gedanken an ihren Ehemann drohte es ihr den Magen umzudrehen. Vor drei Tagen hatte man ihn zu einem Universitätsprofessor gerufen, der von seinen Studenten verletzt worden war, und seitdem hatte sie nichts mehr von ihm gehört. Was mochte Robert aufgehalten haben? Die Unruhen? War er womöglich als Günstling von Dr. Botkin, der der Zarenfamilie nahestand, erkannt und gefangen genommen, gar getötet worden?
Petrograd war dabei, im Chaos zu versinken. Schon lange lag eine Ahnung in der Luft, wie jetzt die düsteren, schneebeladenen Wolken, dass sich die Frustration des Volkes eines Tages entladen könnte. Dennoch hatten der plötzliche Ausbruch und die Vehemenz, mit der die Revolution über die Stadt hereingebrochen war, alle unvorbereitet getroffen. Eine kleine Flamme – die Streiks der Frauen am Weltfrauentag7 – hatte ausgereicht, um eine ganze Stadt in Brand zu setzen und auf die umliegenden Gemeinden überzugreifen … Und was würde übrig bleiben? Schutt und Asche? Tod und Verderben? Eine bessere, gerechtere Regierung? Ein Wandel im Denken der Mächtigen und Reichen?
»Interessant!« Der aufdringliche Kerl beugte sich ihr entgegen. Anki, die keineswegs gewillt war, sich noch länger aufhalten zu lassen, trat ihm kräftig mit dem Stiefel gegen das Schienbein.
»Bist du nicht ganz bei Trost?«, keuchte der Bursche und lockerte seinen Griff.
»Lass mich auf der Stelle los!« Anki beherrschte es noch, dieses Aufrichten, das Heben und leichte Drehen des Kopfes, das man ihr beigebracht hatte, um Überlegenheit zu demonstrieren und unliebsame Gesprächspartner in die Schranken zu weisen.
Der Bursche wich zurück und sie hörte im Weitergehen, wie er seinen Freunden verunsichert zurief: »He, ich glaube, das ist eine Adelige!«
Anki lief schneller. Sie raffte den schmal geschnittenen Rock höher und sah endlich das schmucke, wenn auch für das Domizil eines Barons ungewöhnlich kleine Haus mit mintfarbenem Anstrich vor sich liegen. In dem Augenblick, als sie die Stufen erreichte, zerplatzte über ihr eine Fensterscheibe. Scherben regneten auf sie herab. Ein Sessel streifte schmerzhaft ihre Schulter und zwang sie in die Knie. Aus dem Inneren drangen die Schreie zweier Frauen.
***
Anki krabbelte die Stufen hoch und richtete sich unter Zuhilfenahme ihrer Hände mühsam an der Holztür auf. Ihre Schulter schmerzte und dies erlaubte ihr den linken Arm nur mit Bedacht zu bewegen. Ohne den Klopfer oder die Klingel zu benutzen öffnete sie die Tür und taumelte in den quadratischen Flur, der mit kostbaren Teppichen, exquisiten Möbeln, wertvollem Kristall und einer Flut an Bildern und Ikonen vollgestopft war, offenbar um Besuchern einen Wohlstand zu demonstrieren der, so lauteten die Gerüchte, gar nicht vorhanden war. Selbst Nina hatte einmal angedeutet, dass viele der Zimmer in dem ohnehin nicht geräumigen Haus leer standen.
Der Eingangsbereich wirkte unberührt und ordentlich, was Anki mit Erleichterung wahrnahm. Wären Plünderer eingefallen, hätten sie wohl gleich hier mit dem Stehlen und Zerstören von Wertgegenständen begonnen.
Eilig lief sie in das schmale, verlassen vor ihr liegende Treppenhaus. Womöglich hatten die Angestellten bei Ausbruch der Unruhen die Stellung bei ihrem gelegentlich gewalttätigen Dienstherrn aufgegeben und sich den Protestmärschen angeschlossen. Wo aber hielt sich der Hausherr auf?
Er verfügte weder über einen Ministerposten in der zaristischen Regierung noch über einen militärischen Rang, sodass seine Anwesenheit weder in einem der Gremien gefordert war, die nun unter Hochdruck arbeiteten, noch bei seiner Garnison.
Wieder erhob sich im ersten Stock lautstarkes Geschrei. Die weibliche Stimme klang jetzt viel mehr keifend als ängstlich. Anki folgte den Stimmen und trat in den Türrahmen eines vollkommen mit Kleidern und Hutschachteln überfüllten Raums. An einer Wand stapelten sich eine unüberschaubare Menge von Schuhen, Spazierstöcken, Regenschirmen und unachtsam abgelegten Handschuhen aller Couleur. In diesem Ankleidezimmer sorgte schon lange keine Zofe mehr für Ordnung, stellte Anki fest, während sie ihren Blick auf Raisas Rücken richtete.
Die Baroness stand ihrem eng geschnittenen Rock zum Trotz breitbeinig da und hielt etwas mit beiden Händen fest, das Anki nicht sehen konnte. Einige Meter entfernt presste sich Ankis Schützling Nina mit vor Angst aufgerissenen Augen an die Wand neben dem zertrümmerten Fenster. Ob Raisa mit dem Stuhl nach ihrer Freundin geworfen hatte?
»Nein!«, kreischte Raisa in diesem Augenblick und bewegte sich zur Seite.
Anki schnappte nach Luft. Die Baroness hielt ein langes, im Licht der Deckenlampe blau schimmerndes Schwert in den Händen. Mit diesem drohte sie in Ninas Richtung.
»Ich bin deine Familie! Das haben wir doch oft genug besprochen, kleine Nina! Zumal deine Eltern tot sind und diese Njanja8 deine jüngeren Geschwister nur verdirbt. Du gehörst zu mir.«
»Lass mich bitte gehen«, flehte Nina. »Ich möchte zu meinen Schwestern. Unmöglich darf ich sie in diesem Durcheinander alleinlassen.«
»Ich bin deine Schwester!«, schrie Raisa und ließ das Schwert zu Boden sausen, sodass die Spitze im Parkett stecken blieb.
Anki, die vermutete, dass die Waffe dem Mädchen auf Dauer zu schwer war, wagte sich einen Schritt in das Zimmer. Nina entdeckte sie sofort, und die Erleichterung über ihre Anwesenheit war ihr im Gesicht abzulesen. Aber auch Raisa wirbelte herum, wobei sie ihre Waffe wie eine Sense seitwärts führte. Nur durch einen schnellen Sprung rückwärts entkam Anki der blitzenden Klinge. Furcht ergriff sie. Da Raisa ebenso jähzornig war wie ihr Vater, musste sie sich in Acht nehmen.
»Du?«, stieß die Baroness hervor und ihre stahlblauen Augen, denen ihres Vater sehr ähnlich, blitzten Anki kalt an.
»Sind Sie allein im Haus zurückgeblieben, Baroness?«, versuchte Anki mit zittriger Stimme und weichen Knien der chaotischen Situation Herr zu werden. »Dann begleiten Sie Nina und mich zu den Chabenskis. Sie sollten jetzt wirklich nicht allein sein.«
»Sag es ihr, Njanja! Sag Nina, dass ich ihre Familie bin. Du hast das damals selbst zu mir gesagt!«
»Ich sagte damals auf Ninas Geburtstagsfeier, dass Sie herzlich im Hause der Chabenskis willkommen waren und dass Sie dort ein Stück weit das Familienleben erleben durften, das Ihnen, allein mit Ihrem viel beschäftigten Vater, fehlte.«
»Es war aber nie so!«, kreischte Raisa und aus ihrem linken Mundwinkel troff ein Speichelfaden auf ihre Bluse hinab.
»Sie missachteten gewisse Regeln, Baroness Raisa Wladmirnovna. Innerhalb einer Familie geht man rücksichtsvoll miteinander um. Und liebevoll. Sie aber wollten einen Keil zwischen Nina und ihre Eltern, später auch zwischen Nina und ihre jüngeren Schwestern treiben. Dies durften weder das Fürstenpaar noch ich zulassen.«
»Ja, du bist schuld!«, schrie Raisa unbeherrscht. »Du hast dich unaufhörlich in die Familie gedrängt und erreicht, dass die alte Fürstin dir die Erziehung der Kinder überließ, nachdem Ninas Eltern gestorben waren!« Raisa trat näher, die Waffe drohend erhoben, doch ihre Hände zitterten. Die verwöhnte junge Frau war es nicht gewohnt, ein schweres Schwert in ihren zarten Händen zu führen. Dennoch wich Anki wieder einen Schritt zurück. Ein scharfes Schwert war auch in den Händen einer schwachen Frau eine Gefahr.
Der Blick des Kindermädchens huschte zur Fensterseite. Der Platz, an dem Nina eben noch gestanden hatte, war leer. Erleichterung durchflutete Anki. Jetzt musste sie nur noch auf sich selbst achten und versuchen, die Baroness zur Vernunft zu bringen.
»Du hast Angst, nicht, Njanja? Gut so. Die habe ich jeden Tag aushalten müssen.«
»Angst, Baroness?«
»Mein Vater versprach mir Reichtum und Ansehen, sobald wir erst nach Petersburg gezogen seien. Aber er verlor von beidem immer mehr. Irgendwann werden wir nichts mehr haben. Diese Angst meine ich!«
»Aber Baroness …«
»Die Chabenskis schwimmen in Geld, Macht und Ansehen. Sie verkehren mit der Zariza und dem Zaren, mit den Hofdamen am Zarenhof, mit der einzigen Nichte des Zaren und mit ihrem Mann Jussupow. Da wollte ich hin«, brach es aus Raisa heraus. Wieder trat sie einen Schritt nach vorn. Inzwischen ruhte das Schwert auf ihrer linken Schulter, als wolle sie sich ihre Kräfte für den einen entscheidenden Schlag einteilen.
Anki wich in den Flur zurück. Sie spürte bereits die Wand in ihrem Rücken. Ihr Atem ging stoßweise und sie hörte ihren eigenen Herzschlag wie dumpfe Paukenschläge in ihren Ohren. Robert kam ihr in den Sinn. Und die Chabenski-Mädchen. Sie musste doch für sie sorgen! Sie hatte es der sterbenden Fürstin versprochen!
»Wäre Nina ein Mann, hätte ich sie heiraten können!«
»Baroness, selbst wenn Nina ein Prinz wäre, wäre sie noch immer erst sechzehn Jahre alt! Lassen Sie uns jetzt gemeinsam das Haus verlassen. Es sind so viele Menschen auf den Straßen unterwegs, die eine Gefahr darstellen. Sogar die Gefängnisse sind geöffnet worden. Nicht nur die mit den politischen Gefangenen, sondern die, in denen die wirklich üblen Verbrecher inhaftiert waren.«
Die verstörte junge Frau hörte ihr gar nicht zu. »Ja, sechzehn! Genau das Alter, in dem der Fürst für Nina eine gute Partie gesucht hätte. Ebenfalls einen Fürsten, vielleicht sogar ein Mitglied der Romanow-Familie? Mein Plan war, über Nina in Kontakt mit einem Großfürsten zu treten. Ich hätte ihn schon auf meine Seite gezogen und er hätte mich geheiratet!« Raisas Stimme wurde schriller. Den letzten Satz spuckte sie dem Kindermädchen förmlich entgegen. Anki schrie in Gedanken zu Gott um Hilfe.
»Jetzt bricht alles auseinander. Aber es gibt familiäre Bande der Chabenskis und Romanows. In England, in Dänemark, sogar in diesem grässlichen Deutschen Kaiserreich! Sie werden Nina aufnehmen und damit auch mich. Und du wirst das nicht verhindern!« Raisa sprang nach vorn. Der Stahl des Schwertes blitzte hell auf.
***
Anki war nicht im Chabenski-Palast! Obwohl sein Innerstes rebellierte, blieb Robert äußerlich ruhig. Sie war zu dieser verzogenen Raisa unterwegs, um Nina zurückzuholen. Er hatte einige unangenehme Zusammenstöße mit fanatischen Russen hinter sich und dabei Beobachtungen gemacht, die ihn bei allem Verständnis für den Befreiungsschlag des Volkes wünschen ließen, alles würde wieder so sein wie zuvor. Auf den Straßen gab es keine Ordnung, kein Gesetz, keinen Anstand mehr. Alles schien erlaubt, die Vernunft schien außer Kraft gesetzt.
Gehetzt wandte Robert sich an die beiden Anwesenden: »Jakow, Nadezhda, wir müssen die Prinzessinnen aus der Stadt schaffen. Ich habe auf dem Weg hierher eine Anzahl Paläste und Häuser einflussreicher Bürger in Flammen aufgehen sehen. Die Gefahr erscheint mir eklatant.«
»Die Chabenskis besitzen ein Landhaus in Zsarskoje Selo«, schlug Jakow vor, vollführte mit seiner von Altersflecken übersäten Hand aber eine abwertende Bewegung.
Roberts Mundwinkel zuckten unwillig. Das Sommerhaus wäre ein angemessener Aufenthaltsort für die Fürstinnen, bis sich die Unruhen in der Stadt gelegt hatten und abzusehen war, in welche Richtung die Weichen des Landes gestellt würden. Allerdings machte die Nähe zum Alexanderpalast, der langjährigen Heimat der Zarenfamilie und nun wohl ihr Gefängnis, diese Fluchtmöglichkeit zunichte.
Anki liebte das Sommerhaus. Würde sie die Kinder dort suchen, falls sie getrennt wurden? Auch Robert erinnerte sich gern an das für ein Adelshaus bescheidene Bauwerk, eingebettet in einen bezaubernd schönen Park. Dort hatte er Anki das erste Mal in den Armen gehalten und geküsst …
Ein schneidender Schmerz, als habe ihm jemand ein Schwert in den Leib gerammt, durchfuhr ihn. Die Angst um seine Ehefrau wuchs rasant an und raubte ihm für einen Moment die sonst so typische Ruhe und Gelassenheit. Fahrig fuhr er sich mit beiden Händen über das Gesicht und die Haare. Anki strich ihm gern diese frech in seine Stirn fallende Strähne zurück. Wo war sie wohl in diesem Moment? Bei den Osminkens? Befand sie sich dort in Sicherheit vor dem tobenden Mob in den Straßen? Eine innere Stimme drängte ihn, sie sofort zu suchen, sie zu beschützen – vor welcher Gefahr auch immer. Seine Gedanken formten ein Gebet um Schutz für Anki. Mehr konnte er im Moment nicht für sie tun, sosehr es ihn auch dazu drängte.
»Dr. Busch, meine Schwester wohnt in Aleksandrovskaya.« Nadezhda sah ihn fragend an, und er runzelte nachdenklich die Stirn.
Aleksandrovskaya lag in der Nähe von Gorskaja, einer Hafenstadt am Finnischen Meer, nicht allzu weit von Petrograd entfernt, also durchaus erreichbar. Dort könnten sie erst einmal Unterschlupf finden und abwarten.
»Sie nimmt uns bestimmt für eine Weile auf. Es gibt bei ihr ein Wohnhaus und einen Stall.« Die ältere Bedienstete betrachtete zweifelnd das in einem Blumenmuster angelegte, mehrfarbige Parkett, die wertvollen Gemälde an den mit Brokattapeten bezogenen Wänden, die Kronleuchter und die erlesenen Möbel.
»Dein Angebot ist sehr freundlich. Ich denke, wir werden es annehmen«, sagte Robert. »Informiere bitte Marfa. Die Zofe soll die Kinder zum Aufbruch vorbereiten. Mitnehmen können sie nichts. Sie soll darauf achten, dass die Mädchen einfache Kleidung tragen, am besten einen älteren Mantel. Ihre Herkunft darf ihnen nicht anzusehen sein.«
Nadezhda nickte und eilte zur Treppe, die auf die Galerie führte. Diese spannte sich sowohl über das Foyer als auch über den Ballsaal. Von dort gingen die Türen zu den Privaträumen der Fürstenfamilie ab.
»Ich suche Pjotr, den Kutscher«, brummte Jakow. »Alex wäre Anki wohl lieber, aber der Kerl ist seit Beginn der Unruhen verschwunden. Vermutlich heckt er mit seinen roten Freunden weitere Schandtaten aus.« Der Butler schlurfte mit kleinen, müden Schritten davon.
Robert blieb allein zurück. Zerfressen von der Sorge um Anki knetete er seine Hände. Anki hatte schon früh den Verdacht gehegt, dass Alex einer der im Untergrund agierenden Aufständischengruppen angehörte, und er hatte es ihr offen eingestanden, nachdem sie in einen inszenierten Brotaufstand geraten waren. Allerdings sei er kein Befürworter von Gewalt, hatte er beteuert. Ganz anders als Oskar … Gequält von dem Gedanken ballte er die Hände zu Fäusten. Sein Bruder gehörte einer radikalen Studentenvereinigung an, die sich nicht zu schade war, Aufruhr innerhalb der Bevölkerung zu inszenieren und friedliche Bürger aufzustacheln. Als Anki damals den Tod eines kleinen Jungen mit ansehen hatte müssen, war Oskar dabei gewesen. Er und zwei seiner Freunde hatten die geduldig wartenden Frauen und Kinder erst auf den Gedanken gebracht, man könne sich die knapp bemessenen Lebensmittel mit Gewalt holen. Seit diesem Tag hatten weder Anki noch Robert Oskar wiedergetroffen. Er war wie vom Erdboden verschluckt. Ob er untergetaucht war, um mit seinen Kameraden auf ihre große Stunde zu warten? Diese war jetzt gekommen! Oder hatte die Ohrana9 ihn verhaftet und eingekerkert? In dem Fall würde er jetzt freikommen.
Mehrere Schüsse und die Detonation eines größeren Geschosses ganz in der Nähe des Chabenski-Palastes ließen die Scheiben in den Fassungen klirren. Robert eilte beunruhigt an ein Fenster und schob den elfenbeinfarbenen, golddurchwirkten Vorhang beiseite, um zum Kanal zu schauen. Rote Fahnen, vom auffrischenden Wind aufgebläht und vor den dunklen Wolkengebilden deutlich abgehoben, ergriffen Besitz von der Straße. Der Heimweg für Anki und Nina war versperrt.
Jakow trat neben ihn, blickte hinaus und runzelte missbilligend die Stirn. Der alte Diener hatte zeitlebens bei den Chabenskis in Diensten gestanden und war von ihnen immer gut behandelt worden. Entsprechend missfiel ihm das Tun der Roten.
»Pjotr spannt hinten den Landauer an.«
»Er soll das Wappen von den Schlägen kratzen.«
»Das sagte ich ihm bereits«, stieß Jakow zwischen zusammengepressten Lippen hervor.