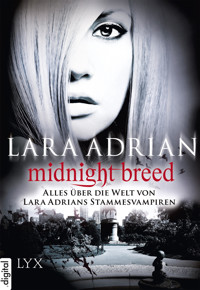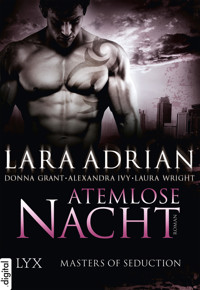9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
EINE UNERBITTLICHE JAGD, EINE SCHICKSALHAFTE LEIDENSCHAFT
Der Stammesvampir und ehemalige Jäger Razor hat den Auftrag, Laurel Townsend, die frühere Geliebte eines alten Freundes, zu beschützen. Als die junge Frau in Gefahr gerät, will er ihr zu Hilfe eilen. Doch er kommt zu spät und findet nur noch die abgebrannte Hütte und eine Leiche vor. Entschlossen, die Mörder zur Rechenschaft zu ziehen, begibt er sich auf die Jagd nach ihnen. Dabei trifft er völlig unerwartet auf Laurels Zwillingsschwester Willow, die sich ihm anschließt. Schon bald wird klar, dass auch Willows Leben bedroht ist. Ein düsteres Netzwerk hat es einmal mehr auf die Stammesvampire und ihre Verbündeten abgesehen. Und so muss Razor alles daransetzen, nicht nur seine Leute, sondern auch die Frau zu retten, die eine nie gekannte Leidenschaft ihn ihm erweckt hat.
»Lara Adrians Vampire gehören zu den heißesten, die jemals geschrieben wurden.« KATSBOOKCORNERREADS
Band 4 der Hunter-Legacy-Reihe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Epilog
Die Autorin
Die Romane von Lara Adrian bei LYX
Impressum
LARA ADRIAN
Hunter Legacy
BEGEHREN DER NACHT
Roman
Ins Deutsche übertragen von Firouzeh Akhavan-Zandjani
Zu diesem Buch
Der Stammesvampir und ehemalige Jäger Razor hat den Auftrag, Laurel Townsend, die frühere Geliebte eines alten Freundes, zu beschützen. Mithilfe einer Drohne beobachtet er daher seit einem Jahr Laurels einsame Hütte in Colorado. Auch wenn er ihr nie persönlich gegenüberstand und ihm klar ist, dass er sich von ihr fernhalten muss, fasziniert ihn die junge Frau. Als Laurel in Gefahr gerät, begibt Razor sich so schnell er kann nach Colorado. Doch er kommt zu spät und findet nur noch die schwelenden Überreste der Hütte und inmitten der Asche eine Leiche vor. Razor schwört, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und begibt sich auf die Jagd nach ihnen. Nicht weit von der zerstörten Hütte trifft er völlig unerwartet auf die tot geglaubte Laurel. Schnell stellt sich jedoch heraus, dass es sich um deren Zwillingsschwester Willow handelt. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach Laurels Mördern und stoßen dabei auf eine Verschwörung, die weitere Kreise zieht, als sie jemals geahnt hätten. Ein düsteres Netzwerk hat es einmal mehr auf die Stammesvampire und ihre Verbündeten abgesehen. Und so muss Razor alles daransetzen, nicht nur seine Leute, sondern auch die Frau zu beschützen, die eine nie gekannte Leidenschaft ihn ihm erweckt hat.
1
Es war später Nachmittag, in der warmen Bergluft hing der Geruch von verbranntem Holz.
Obwohl Razor Helm und Kleidung trug, die ihn vor ultraviolettem Licht schützten, nahm er mit seinen hochempfindlichen Stammesvampirsinnen den Geruch wahr und zuckte zurück. Das Feuer, das vorhin hier gewütet hatte, war nun erloschen. Von der Hitze, die es ausgestrahlt haben musste, war nichts mehr zu spüren, der Rauch war verweht. Doch das bedeutete nur, dass er nicht rechtzeitig gekommen war. Das Schlimmste war eingetreten.
Verflucht.
Razor ignorierte den Geruch, der seine Kehle bei jedem Atemzug reizte, und rannte die bewaldete Anhöhe noch schneller hinauf. Nachdem er dreißig Stunden gebraucht hatte, um von Florida in diesen abgelegenen Winkel Colorados zu gelangen, zitterte er vor unterdrückter Ungeduld. Er hatte sein Motorrad auf einem holprigen Sandweg in einer Meile Entfernung stehen gelassen, denn er hatte bei seiner Ankunft keine unnötige Aufmerksamkeit auf sich lenken wollen. Davon abgesehen legte er als Stammesvampir den Rest des Weges ohnehin zu Fuß schneller zurück.
Seine Stiefel wühlten den lehmigen Boden auf, als er auf die kleine Hütte zurannte, die er die vergangenen Monate mithilfe einer Drohne beobachtet hatte. Er hatte den Ort überwacht, um einem alten Freund einen Gefallen zu tun, doch die Furcht, die ihn jetzt erfüllte, hatte etwas Persönliches.
Etwas zu Persönliches.
Er wusste nicht, wie es dazu gekommen war, dass er sich von der Aufgabe so sehr hatte vereinnahmen lassen, doch der stechende Schmerz, der ihm förmlich die Brust zerriss, war nicht zu leugnen, als sein Blick auf die kleine Lichtung mit der Hütte fiel.
Oder eher, was von der Hütte übrig geblieben war. Von den Wänden und dem Ständerwerk aus Holz war nur noch Asche zu sehen. Der aus Flusssteinen gemauerte Schornstein ragte schwarz verkohlt empor und markierte die Stelle, wo früher ein Haus gestanden hatte. Die Überreste von Metall, die mal Möbelstücke gewesen waren, glühten noch in der Asche.
Alles war so restlos zerstört, dass man kaum von einem Unfall ausgehen konnte.
Die Bäume, die die Lichtung einrahmten, waren praktisch unbeschadet aus dem Feuer hervorgegangen, doch bei der Zerstörung der Hütte war jemand mit äußerster Präzision vorgegangen … und ohne Erbarmen.
Razor trat näher. Unter den Absätzen seiner Stiefel knirschten die verkohlten Trümmer.
Der Gestank von Benzin und Feuer erstickte ihn fast, doch es war der unverwechselbare Geruch nach Tod, der ihn die Zähne zusammenbeißen und Furcht in ihm aufsteigen ließ. Sein schwerer, kalter Herzschlag dröhnte in seinen Ohren, als er einen Blick auf eine bis zur Unkenntlichkeit verkohlte Leiche erhaschte, die ziemlich genau in der Mitte der Brandstätte lag.
Ein tiefes Knurren kam aus seiner Brust.
Die Frau, die er holen und in Sicherheit hatte bringen sollen, war tot.
Verdammt. Er war zu spät gekommen.
Er hatte seinen alten Freund enttäuscht.
Und die unschuldige Frau hatte er ebenfalls im Stich gelassen.
Razor verdankte Theo Collier buchstäblich sein Leben. Deshalb hatte Razor sich auch ohne zu zögern bereit erklärt, ein schützendes Auge auf Laurel Townsend, Theos frühere Geliebte, zu haben.
Er hatte immer noch Theos angstvolle Stimme im Ohr, als dieser ihn gestern angerufen und ihm gesagt hatte, dass er Razor für mehr als nur ein bisschen Überwachung brauchte. Er wollte, dass Razor so schnell wie möglich persönlich für Laurels Schutz sorgte. Er hatte behauptet, dass die Sache zu sehr drängte und zu gefährlich wäre, als dass er ihm mehr am Telefon sagen könnte, und hatte Razor gebeten, ihm zu vertrauen.
Wann immer du Hilfe brauchst, bekommst du sie von mir. Ich stelle keine Fragen.
Das hatte Razor dem Menschen Theo gelobt, als dieser ihm vor etwa zwanzig Jahren das Leben gerettet hatte. Dieses Versprechen schmeckte jetzt wie Asche, als er sich der Stelle näherte, wo das Feuer gewütet hatte.
Dass Laurels Wagen nicht neben der abgebrannten Hütte stand, hatte Razor leise hoffen lassen. Er hatte gedacht, dass sie es vielleicht geschafft hatte, dem Inferno zu entkommen.
Doch diese Hoffnung war jetzt genauso zerstört wie die Hütte.
Ihr Gesicht erschien vor Razors innerem Auge. Er besaß stundenlange Videoaufzeichnungen von der abgelegenen Hütte, aber nur ganz wenige Male war darauf die schöne, zurückgezogen lebende braunhaarige Frau zu sehen, die dort wohnte.
Vor seinem inneren Auge zog sofort eine Folge von Momentaufnahmen vorbei – ihr reizendes Gesicht mit den hellen Sommersprossen und den hellgrünen Augen, dem langen dunklen Haar, das über ihren Rücken schwang, während sie in einem schwarzen offenen Jeep zur Hütte hochfuhr, um dann die Papiertüten mit den Lebensmitteln hineinzutragen.
Sie hatte so entzückend weiblich mit ihren weichen Rundungen, der kragenlosen, hauchdünnen weißen Bluse und den ausgeblichenen Jeans ausgesehen. Ihr Anblick hatte ein ungebetenes Verlangen in Razor ausgelöst, das er selbst jetzt nicht wahrhaben wollte.
Vor allem jetzt nicht.
»Verfluchter Mist.«
Es war schon schlimm genug, dass er die Frau eines alten Freundes heimlich, ohne ihr Wissen, beobachtet hatte. Aber dazu hatte er sie auch noch insgeheim begehrt.
Diese Sünde genauer zu ergründen stand irgendwann an.
Früher oder später würde er sich mit Theo Collier in Verbindung setzen und die schreckliche Nachricht überbringen müssen. In welcher Gefahr Theo Laurel auch gewähnt haben mochte – eine Gefahr, die er als so ernst empfand, dass er Razor angerufen und förmlich angefleht hatte, so schnell wie möglich zu ihr zu fahren –, sie war nun in ihrer schlimmsten Form eingetreten.
Jetzt war es Razor, der Antworten haben wollte.
Sobald er in Erfahrung gebracht hatte, von wem Laurel Townsend umgebracht worden war – und warum –, würde er die Mistkerle finden und dafür bezahlen lassen, was sie getan hatten.
Seine Reißzähne waren leicht hervorgetreten, als er mit den Zähnen knirschte und die verkohlten Überreste anschaute. Ihr Schädel wies ein großes Loch mit unregelmäßigem Rand auf. Jemand hatte ihr aus kurzer Distanz in den Kopf geschossen. Jemand, der hatte sichergehen wollen, dass sie tot war. In dem Feuer wäre sie auf jeden Fall umgekommen, aber die Kopfwunde hatte ihr Ende besiegelt.
»Verdammt! Verdammt! Verdammt!«, zischte Razor leise. Es war nicht an ihm, um die Frau zu trauern, aber trotzdem bohrte der Schmerz ein tiefes Loch in seine Brust, als er sich vorstellte, welches Entsetzen sie am Ende ihres Lebens erfüllt haben musste. Sie hatte es nicht verdient, so zu sterben.
Er konnte sie nicht mehr retten, aber sein Entschluss, sie zu rächen, stand fest.
Und zwar nicht für seinen Freund, sondern weil er selbst darauf gierte.
Was die Leiche anging, wollte er diese nicht den Aasfressern aus dem Wald oder den Naturelementen aussetzen.
Die Hoffnung, an diesem Ort der Verwüstung eine Schaufel zu finden, um ein Loch zu graben, konnte er wohl getrost vergessen. Andererseits war er natürlich auch ohne Werkzeug in der Lage, die Aufgabe zu erledigen. Jeder Stammesvampir besaß von Geburt an eine besondere Fähigkeit, die ihn von allen anderen unterschied – dieses Merkmal hatte ihm auch seinen Namen eingebracht. Razor – die Klinge.
Er brauchte gedanklich nur den Befehl zu geben, und schon traten scharfe schwarze Krallen aus seinen Fingerspitzen hervor.
Er entfernte sich ein paar Meter von den schwelenden Überresten der Hütte, um nach einer geeigneten Stelle zu suchen, wo er die Frau begraben konnte. Ein mit Gras bewachsenes Schattenplätzchen neben einigen Wildblumen war das Beste, was er finden konnte. Razor begann zu graben. Die allen Stammesvampiren eigene Kraft und Geschwindigkeit ließen ihn die Aufgabe schnell erledigen. Nachdem er die Grube ausgehoben hatte, ging er zum Brandherd zurück und hob vorsichtig Laurel Townsends Überreste aus der Asche.
Als er sie ins Grab legte, bemerkte er die zarte Goldkette, die sie trug. Die Kette und der kleine Anhänger waren vom Ruß geschwärzt und von der Hitze des Feuers verbogen. Eins der Kettenglieder brach, als er die Kette anhob, um sie genauer zu betrachten.
Mit dem Daumen wischte er den Ruß von dem verformten Anhänger, der ein halbes Herz darstellte.
Der Anhänger würde eine grausige Erinnerung für seinen Freund sein, doch Razor beschloss, dass Theo selbst entscheiden sollte, ob er das Schmuckstück behalten wollte, denn Laurel brauchte es nicht mehr.
Razor steckte die Kette ein, während er weiter neben dem offenen Grab kniete. Ihm fielen keine passenden Worte ein, die er ihr jetzt noch mitgeben konnte. Ihn erfüllten nur Wut und Bedauern – Gefühle, die einfach nicht weichen wollten – und eine verbissene Entschlossenheit, es demjenigen heimzuzahlen, der für die niederträchtige Tat verantwortlich war.
Er warf einen letzten Blick auf das, was von der strahlenden Schönheit übrig geblieben war, die die letzten Monate wie ein schwer zu fassender Traum seine Gedanken beherrscht hatte.
»Es tut mir leid«, knurrte er mit hervorgetretenen Fängen. »Es tut mir leid, dass ich zu spät hier war.«
Diese Schuld würde er den Rest seines Lebens mit sich herumtragen. Ebenso würde ihn bis ans Ende seiner Tage die Erinnerung an den liebreizenden, schönen Geist verfolgen, den er nicht in der Weise hätte begehren dürfen, wie er es getan hatte. Genauso wenig wie er das Recht hatte, jetzt zu trauern.
Mit einem deftigen Fluch begann er, sie mit der ausgehobenen Erde zu bedecken. Als das erledigt war, zog er die Krallen wieder ein und kam hoch, ehe er seine Kleidung abklopfte und säuberte.
Die Sonne ging gerade unter. Er zog es vor, bei Nacht zu fahren, aber der Gedanke, zum Dunklen Hafen in Florida zurückzukehren, hatte sich zusammen mit Laurels Hütte in Luft aufgelöst. Stattdessen würde er die einsetzende Dunkelheit nutzen, um sich in die kleine Stadt am Fuße des Berges zu schleichen und nach Informationen zu suchen.
Irgendjemand da unten musste etwas wissen. Das Feuer war nicht nur vorsätzlich gelegt, sondern auch fachmännisch gelöscht worden, ehe es auf die umliegenden Bäume hatte übergreifen können.
Aber wer hätte so etwas tun sollen? Und warum?
Nicht nur die Städter würden ein paar Erklärungen abgeben müssen. Auch Theo Collier verheimlichte Razor etwas. Bei ihrem letzten Gespräch hatte er ihn nicht bedrängt, aber jetzt würde er Antworten von ihm verlangen.
Er würde erst gehen, wenn alle Fragen, die ihm durch den Kopf gingen, geklärt waren.
Er lief den Berg hinunter, holte sein Motorrad und fuhr damit bis zum Fuß der gewundenen Straße, die ihn bis an den Stadtrand führte.
Die Hauptstraße, die von ein paar Geschäften und Cafés gesäumt wurde, war in Zwielicht getaucht. Razor blieb am Stoppschild am Ende des Bergpasses stehen und beobachtete die Pick-ups und die paar Autos, die in das kleine Stadtzentrum fuhren oder herauskamen.
Er wollte gerade in die Hauptgeschäftsstraße abbiegen, als sich ein schwarzer Jeep der Zufahrt des Passes näherte.
Ein schwarzer offener Jeep mit einer hübschen dunkelhaarigen Frau hinter dem Steuer.
Was zum Teufel hatte das zu bedeuten?
Ihr langes Haar wehte im Fahrtwind, und ihre Lippen bewegten sich; offenbar sang sie einen alten Popsong, der im Radio gespielt wurde, mit.
Er konnte nicht glauben, was er sah.
Ganz offensichtlich halluzinierte er, denn für ihn bestand nicht der Hauch eines Zweifels daran, dass dies die Frau war, die er über Monate beobachtet hatte.
Niemand stand hinter ihm – also ließ er den Seitenständer herunter und stieg ab, als sie in die Passstraße einbiegen wollte.
Er hatte Fragen, auf die er Antworten wollte.
Er würde gleich hier und jetzt und bei Laurel Townsend höchstpersönlich damit anfangen.
2
Sie wollte gerade in die Straße einbiegen, die den Berg hinaufführte, als ein Verrückter von seinem Motorrad sprang und sich ihr in den Weg stellte.
Die Reifen ihres Jeeps quietschten, als sie auf die Bremse trat und nur zwei Sekunden, bevor sie den Mann angefahren hätte, zum Halten kam. Sie nahm an, dass der Riese, der jetzt vor ihr stand, ein Mann war. Entweder ein Mann oder ein Yeti, der von Kopf bis Fuß in einer schwarzen Lederkluft steckte und einen ebenso schwarzen Helm mit dunklem Visier trug, welcher seine Gesichtszüge komplett verbarg.
Außer sich riss sie die Hände hoch. »Sind Sie verrückt geworden? Ich hätte Sie beinahe angefahren.«
Er trat um die Motorhaube des Wagens, der jetzt im Leerlauf war, und näherte sich der Fahrerseite. Himmel, warum hatte sie sich heute nicht die Zeit genommen, die Türen ihres Jeeps wieder einzusetzen? Normalerweise liebte sie es, mit offenem Wagen zu fahren, aber als der dunkle Fremde neben ihr stehen blieb, fühlte sie sich plötzlich schutzlos und ausgeliefert. Zwar konnte sie seine Augen hinter dem schimmernden dunklen Visier nicht sehen, aber sie spürte die Hitze seines schweigenden Blicks wie eine auf sie gerichtete Taschenlampe.
Nur mühsam widerstand sie dem Impuls, den tiefen Ausschnitt ihrer weißen Bluse etwas höher zu ziehen und zu versuchen, ihr vom Wind zerzaustes dunkles Haar zu bändigen. Sie trug eine locker sitzende abgeschnittene Jeans und abgewetzte Cowboystiefel, aber so wie seine Augen hinter dem Visier brannten, hätte sie auch völlig nackt im Auto sitzen können.
Das fröhliche Lied, bei dem sie mitgesungen hatte, während sie durch die Stadt fuhr, störte jetzt auf irritierende Weise. Sie wagte es nicht, den Blick von dem riesigen, bedrohlich wirkenden Mann abzuwenden, der keinen Meter von ihr entfernt stand, als sie die Hand ausstreckte und das Radio ausstellte.
»Haben Sie sich verfahren?« Sie stellte die Frage nur, um das unangenehme Schweigen zu überbrücken und um nicht den Eindruck zu erwecken, dass er sie völlig aus der Fassung brachte. »Verstehen Sie, was ich sage?«
»Laurel Townsend.« Zwei Worte, die mit tiefer, rauchiger Stimme aus dem dunklen Helm drangen.
Allmächtiger. Verdammt.
Sie konnte nur mühsam schlucken, während in ihrem Kopf die Alarmglocken losgingen.
Wer war dieser Mann?
Woher zum Teufel kannte er den Namen ihrer Zwillingsschwester?
Willow schlug das Herz fast bis zum Hals, sodass sie sich unwillkürlich fragte, ob er es womöglich hören konnte. Sie hatte das Gefühl, als klebe ihre Zunge am Gaumen.
Denk nach, verdammt noch mal!
Ihre Schwester hatte ihr, als sie vor sechs Monaten nach Colorado gekommen war, gesagt, dass sie in Schwierigkeiten steckte. Laurel hatte sich jedoch geweigert, mehr zu erzählen, weil sie Angst hatte, dass auch Willow in Gefahr geraten könnte, wenn sie zu viel wusste.
Willow war davon ausgegangen, dass Laurels Angst etwas mit ihrem Leben in Montreal zu tun hätte. Jetzt fragte sie sich auf einmal, ob die Gefahr, vor der Laurel weggelaufen war, von diesem Mann ausging. Aber so oder so würde sie ihm nichts erzählen.
Wenn ihr nichts anderes übrig blieb, würde sie versuchen müssen, ihn von dem Berg wegzulocken, ehe er zu ihrer Schwester gelangte. Gegebenenfalls würde sie den Köder spielen müssen.
Ohne noch etwas zu sagen, legte Willow den Rückwärtsgang ein und trat aufs Gaspedal.
Der Motor heulte auf, und die Reifen quietschten, aber der Wagen bewegte sich nicht. Sie drückte das Gaspedal bis zum Boden durch und zuckte zusammen, als ihr der Gestank von verbranntem Gummi in die Nase stieg, ohne dass sie sich von der Stelle rührte.
Dann sah sie nach rechts und sah den Grund dafür. Allerdings ergab der Grund überhaupt keinen Sinn.
Der Fremde hielt den Wagen fest. Er stand breitbeinig auf dem Asphalt, und seine starken Hände hatten den Jeep mit schier unmenschlicher Kraft gepackt.
Mit überirdischer Kraft.
Oh, verdammt. Nein.
War er etwa …?
Der Furcht einflößende Gedanke hatte keine Zeit, Fuß zu fassen, als ein verrosteter Pritschenwagen von hinten angepoltert kam und stehen bleiben musste, weil sie den Weg versperrte. Der alte Mann, der hinter dem Steuer saß, hupte ungeduldig, weil er in die Passstraße abbiegen wollte.
»Drum herum fahren«, befahl die tiefe Stimme neben ihr.
Doch der alte Mann hupte weiter und zeigte den Mittelfinger, als er den Arm aus dem Fenster streckte. Willow beobachtete das alles durch den Rückspiegel und war hin- und hergerissen – sollte sie ihn vor dem Verrückten warnen, den er gerade provozierte, damit er die Flucht ergreifen konnte, oder sollte sie aus dem Jeep springen und schreien, damit der alte Mann ihr half? Doch so verzweifelt sie auch darauf aus sein mochte, sowohl ihre Schwester als auch sich selbst zu retten, durfte sie dabei doch niemand anderen in Gefahr bringen.
Also saß sie nur da und war noch schockierter, als ihr Wagen nicht mehr versuchte, rückwärtszufahren, sondern von ganz allein in den Leerlauf schaltete.
Nein, nicht von ganz allein.
Der schwarz gekleidete Mann hatte dafür gesorgt. Denn er war kein normaler Mann … er war ein Stammesvampir.
Erneut ertönte die Hupe des Pritschenwagens. Es war ein lang gezogenes Dröhnen, das in den Ohren wehtat. Der graubärtige Fahrer lehnte sich mit dem halben Oberkörper aus dem Fenster. »Macht den verdammten Weg frei, ihr Idioten!«
Der große Vampir nahm seine Hand von dem Jeep. Als sie sich bewegte, hätte Willow schwören können, scharfe schwarze Krallen an den Fingerspitzen gesehen zu haben. Er hob den Arm und riss sich den Helm vom Kopf, sodass man sein Gesicht und die langen weiß schimmernden Fänge hinter den wütend hochgezogenen Lippen sehen konnte.
Seine bedrohliche Miene traf den alten Knacker im Pritschenwagen mit voller Wucht.
Die Hupe verstummte. Dann wurde der Rückwärtsgang eingelegt, und der Wagen schoss in die entgegengesetzte Richtung davon.
Willow hätte gern das Gleiche getan.
Wäre sie auch nur eine Sekunde lang der Meinung gewesen, sie hätte die Möglichkeit zur Flucht, hätte sie es versucht.
Der Stammesvampir drehte sich wieder zu ihr um. »Ich werde Ihnen nichts tun, Laurel.«
Ein sengender Blick aus goldbraunen Augen unter einem zerzausten Schopf karamellfarbener Haare traf sie. Seine Fänge glitzerten wie Diamanten zwischen den wohlgeformten Lippen. Das Gesicht war kantig mit einem ausgeprägten Kinn, was zusammen irgendwie einen harmonischen Gesamteindruck ergab. Sie hätte ihn wohl für gut aussehend gehalten, wäre er kein Blut trinkendes Monster.
Ein Monster, das offensichtlich entschlossen war, ihre Schwester aufzuspüren.
»Ich heiße Razor.«
Passt, dachte sie und warf noch einmal einen Blick auf seine Hände. Aus seinen Fingerspitzen ragten jetzt jedoch keine Krallen mehr hervor. Es waren einfach nur große, starke Hände, deren Handrücken mit einem Gewirr faszinierender Dermaglyphen bedeckt waren, jenen Hautmustern, die den Stammesvampiren eigen waren.
»Was wollen Sie eigentlich?«, wollte Willow wissen und hatte fast Angst, diese Frage zu stellen.
»Theo Collier hat mich geschickt.«
Sie hob den Kopf und sah ihm ins Gesicht. »Theo?«
Sie kannte den Namen von Laurels ehemaligem Freund und Kollegen. Er war ein guter Mann, soweit Willow das wusste. Laut ihrer Schwester war Theo einer der wenigen, denen sie vertraute. Aber jeder konnte von dieser Beziehung wissen – vor allem jemand wie das gefährliche Geschöpf, das neben ihrem Jeep stand.
»Wo ist Theo jetzt?«
»Ich weiß es nicht. Das ist unwichtig.«
»Für mich ist es aber wichtig«, erwiderte sie, nachdem sie den Mut dazu aufgebracht hatte. »Woher kennen Sie ihn? Können Sie es beweisen?«
Er runzelte die Stirn. »Sie stellen zu viele Fragen.«
Trotz ihrer Angst gab Willow ein höhnisches Schnauben von sich. »Das sagt nur einer, der keine glaubwürdigen Antworten geben kann.«
»Ich sage die Wahrheit.« Sein Gesicht verzog sich erneut vor Verärgerung, als er sichtlich ungeduldig wurde. »Dafür haben wir jetzt keine Zeit, Laurel.«
Es störte sie, dass er sie ständig mit dem Namen ihrer Schwester anredete. Und was meinte er damit, sie hätten keine Zeit? Was zum Teufel hatte das alles zu bedeuten?
Ein weiteres Auto näherte sich, das in die Passstraße abbiegen wollte, entfernte sich aber schnell wieder, als Razor dem Fahrer einen finsteren Blick zuwarf und seine langen Fänge aufblitzen ließ. Mittlerweile begannen sie die Aufmerksamkeit anderer vorbeifahrender Autos auf sich zu ziehen. Vielleicht war das sogar gut. Wenn sie den Stammesvampir lange genug aufhielt, sodass die halbe Stadt von seiner Anwesenheit erfuhr, war das vielleicht die beste Möglichkeit, ihn vom Berg und der Hütte ihrer Schwester fernzuhalten.
»Ich will, dass Sie mit mir mitkommen, Laurel. Für Sie ist es hier nicht mehr sicher.«
Er legte seine Hand auf Willows Unterarm, und sofort schlug ihr das Herz bis zum Hals. Seine Berührung war wie ein Stromschlag. Der Kontakt schickte einen heißen, beunruhigend intimen Schauer durch ihren Körper.
Sie entzog sich ihm mit einem Ruck. »Fassen Sie mich nicht an. Ich gehe nirgends mit Ihnen hin.«
Okay, der Versuch, ihn hinzuhalten, war also keine so gute Idee. Dann war es wohl am besten, ihr Heil in der Flucht zu suchen.
Hektisch versuchte Willow erneut, den Gang einzulegen, aber die verdammte Karre blieb einfach im Leerlauf. Razor hielt sie weiter mit seiner übernatürlichen Kraft und der Macht seiner Gedanken zurück.
Ihr war nur zu wohl bewusst, dass er viel Schlimmeres tun konnte, wenn er wollte.
Also … warum tat er das nicht?
Wollte er sie erst woanders hinbringen, ehe er sie umbrachte? Oder war er ein Kopfgeldjäger, der für jemand anderen die Drecksarbeit erledigte? War eine Belohnung auf Laurel ausgesetzt worden?
Doch egal, was es war – in Bezug auf Theo Collier log der Stammesvampir. Er konnte ihn gar nicht kennen. Laut Laurel war Theo ein lebensferner Bücherwurm, ein Mann der leisen Töne, der in einer kleinen Hofgemeinschaft in Québec lebte. Er war ein schüchterner, ernsthafter Student gewesen, als er und Laurel sich an der Universität kennengelernt hatten. Nach dem Abschluss hatten beide sofort eine Stelle im selben Forschungsinstitut in Montreal bekommen. Wie sollte ein introvertierter Mensch wie Theo je in Kontakt mit einem so gefährlich aussehenden Stammesvampir wie Razor gekommen sein?
Willows Verwirrung wuchs in gleichem Maße wie ihr Misstrauen.
»Wenn das, was Sie sagen, stimmt, dann rufen Sie Theo jetzt sofort an, damit ich mit ihm sprechen und mich vergewissern kann, dass Sie die Wahrheit sagen.«
Ein geknurrter Fluch kam über die viel zu sinnlichen Lippen, die von den glitzernden Fängen eingerahmt wurden. »Sie können mit ihm reden, nachdem ich Sie an einen sicheren Ort gebracht habe. Je länger wir zögern, desto größer ist die Gefahr, in der Sie schweben, Laurel. Die dürfen nicht mitbekommen, dass Ihnen nichts passiert ist.«
Die Art und Weise, wie er sich ausdrückte, ließ ihr das Blut gefrieren. Die warnenden, rätselhaften Worte deuteten an, dass bereits etwas Schreckliches passiert war. Und das sorgte dafür, dass sich ihr die Nackenhaare aufstellten.
»Wovon reden Sie überhaupt? Und wer sind die?«
»Das weiß ich nicht, aber ich bin entschlossen, es herauszufinden.«
Sagte er wirklich die Wahrheit? Sie hätte seine Worte zwar liebend gern in Zweifel gezogen, aber der Ernst, der in seinem düsteren Blick lag, raubte ihr den Atem. Sie mochte die Furcht nicht, die sie auf einmal erfasste – das Gefühl, dass sich der Boden gleich unter ihr öffnen und sie verschlucken würde.
»Kennen Sie Theo tatsächlich?«
Er nickte. »Wir sind uns das erste Mal begegnet, als wir noch Kinder waren.«
Willow schluckte. »Und jetzt hat er Sie hergeschickt … warum?«
»Weil er um Ihr Leben fürchtet und er weiß, dass ich besser als jeder andere dafür geeignet bin, für Ihren Schutz zu sorgen. Und weil ich ihm vor langer Zeit ein Versprechen gegeben habe.«
»Was für ein Versprechen?«
»Das spielt jetzt keine Rolle. Einzig und allein, dass ich Sie an einen sicheren Ort bringe, ist jetzt wichtig.«
»Wo ich vor was sicher bin?«, fragte Willow fast im Flüsterton. »Sicher vor wem?«
Razor sah sie lange an. Ein Nerv zuckte an seinem kantigen Kinn. »Vor dem, der vor ein paar Stunden Ihre Hütte niedergebrannt hat.«
3
Sollte Razor Zweifel gehegt haben, dass die Frau, die er die letzten paar Monate beobachtet hatte, dem Anschlag auf die Hütte hatte entkommen können, dann lösten sich diese jetzt, da er im Dämmerlicht neben ihrem Jeep stand, auf.
Er hätte ihr Gesicht überall wiedererkannt. Die großen grünen Augen, die weichen Rundungen von Wangen und Kinn, die hellen Sommersprossen, die den Rücken ihrer leicht nach oben gebogenen Nase bedeckten. Ihren rosigen Mund, der seine Männlichkeit so stark berührte, dass sich bei ihm alles vor Verlangen zusammengezogen hatte, wann immer er sie auf den Überwachungsvideos gesehen hatte.
Verfluchter Mist.
Sie war es tatsächlich. Jedes Detail ihres Gesichts hatte sich beim ersten Blick in sein Gehirn eingebrannt. Und hier war sie nun. Es kam ihm wie ein Wunder vor, dass sie direkt vor ihm saß. Gesund und munter und so schön wie eh und je.
Und ihr war offensichtlich überhaupt nicht klar, wie knapp sie heute dem Tod entkommen war.
Verwirrt und fassungslos zugleich starrte sie ihn an, nachdem er ihr von dem Anschlag auf ihr Haus berichtet hatte.
»Wovon reden Sie überhaupt?« Sie hatte die Augenbrauen zusammengezogen, und abgrundtiefe Furcht trat in ihren Blick. »Die Hütte ist …« Sie öffnete die Lippen, als sie tief einatmete. »Nein, Sie lügen.«
Er wollte es ihr so schonend wie möglich beibringen, aber zarte Umschreibungen waren nicht seine Art. Und Zeit hatte er dafür auch nicht, selbst wenn er dazu in der Lage gewesen wäre. »Ich bin gerade dort gewesen, Laurel. Die Hütte besteht nur noch aus Schutt und Asche. Außerdem lag in den Trümmern eine Leiche. Wer war die Frau, die im Haus geblieben ist, während Sie heute unterwegs waren?«
Alle Farbe wich aus ihrem Gesicht. Sie schluckte, gab aber keine Antwort.
»Haben Sie sie gekannt?«, wollte Razor wissen. »Könnte es sein, dass der, der den Anschlag auf Ihr Haus verübt hat, dachte, bei der Frau handele es sich um Sie?«
»Nein, das kann nicht stimmen.« Sie sackte auf dem Fahrersitz zusammen. Ein leiser, schmerzerfüllter Laut kam über ihre Lippen. »Nichts von dem, was Sie sagen, stimmt. Das darf einfach nicht sein!«
Sie schüttelte den Kopf, doch es wirkte eher wie ein Reflex denn wie eine bewusste Bewegung. Ihr verstörter Blick wurde auf einmal leer, als stünde sie selbst plötzlich mit einem Fuß im Grab.
»Aus dem Weg«, sagte sie leise und mit brechender Stimme. »Lassen Sie mich vorbei. Ich muss mir das mit eigenen Augen ansehen.«
»Das ist eine ganz schlechte Idee«, mahnte Razor sie grimmig zur Vorsicht. »Von Ihren Sachen ist nichts mehr übrig.«
Sie atmete zitternd ein. »Ich muss hin. Ich muss sie sofort sehen!«
Verdammt. Er kam kein bisschen weiter, auch wenn er versuchte, ihr die Situation zu erklären. Ihm standen wirkungsvollere Möglichkeiten zur Verfügung, um mit diesem Problem fertigzuwerden. Sie in Trance versetzen. Ihr Fahrzeug in Beschlag nehmen und sie an einen sicheren Ort bringen, ehe er Theo mitteilte, wo sie sich befand, womit er dann sein vor über zwanzig Jahren gegebenes Versprechen eingelöst hätte.
Von dem unerwünschten Reiz, den sie auf ihn ausübte, selbst wenn sie ihn anstarrte, als hielte er in der einen Hand einen Benzinkanister und in der anderen ein brennendes Streichholz, wollte er erst gar nicht reden.
»Mir ist klar, dass Sie Angst haben, aber Sie müssen mir vertrauen.«
»Nein, das muss ich nicht«, fuhr sie ihn an. »Ich glaube kein Wort von dem, was Sie sagen, Vampir.«
Na großartig. Sie regte sich nur noch mehr auf. Der aufgewühlte Ausdruck in ihrem Blick sagte ihm, dass sie kurz vor einer Panikattacke stand und alles tun würde, um von ihm wegzukommen und den Berg hochzufahren.
»Laurel, ich werde das jetzt nur einmal sagen: Rutschen Sie auf den Beifahrersitz, damit ich mich hinters Steuer setzen und Sie von hier wegbringen kann.«
»Zur Hölle mit Ihnen!« Sie trat das Gaspedal durch und stöhnte, als der Motor aufheulte, die Räder sich aber keinen Millimeter bewegten. Frustriert schlug sie mit der flachen Hand aufs Lenkrad. »Lassen Sie mich gehen, verdammt noch mal! Sie könnte tot sein!« Sie schluchzte auf. »Sie müssen mich zu ihr lassen. Sie müssen mich zumindest versuchen lassen, sie zu retten!«
Versuchen, sie zu retten? Wovon redete sie überhaupt?
Etwas anderes, was sie gesagt hatte, sorgte dafür, dass es in seinem Kopf Klick machte. Allmächtiger.
Er hatte sich geirrt. Erst nachdem sie es ausgesprochen hatte, war ihm das Offensichtliche klar geworden. Die Erkenntnis traf ihn mit der Wucht eines Presslufthammers.
»Sie sind gar nicht Laurel Townsend. Die Tote, die ich in der Hütte gefunden habe … das war sie.«
Grüne Augen sahen ihn mit trostlosem Blick an. »Sie ist meine Schwester. Laurel ist meine Zwillingsschwester.«
Razor wich zurück und fuhr sich mit einer Hand durchs Haar. »Verfluchter Mist.«
Und weil es eigentlich gar nicht schlimmer kommen konnte, hielt jetzt auch noch ein Streifenwagen der örtlichen Polizei mit grellem Scheinwerferlicht direkt hinter dem Jeep an.
Razor stieß einen unterdrückten Fluch aus. »Bleiben Sie, wo Sie sind«, befahl er Laurels Zwillingsschwester mit rauer Stimme. »Ich regle das.«
Die beiden Polizisten, die in dem dunklen Wagen saßen, schauten durch die Windschutzscheibe in die langsam heraufziehende Dunkelheit. Der Fahrer – der größere von den beiden – sagte etwas zu seinem Kollegen, der daraufhin den Strahler einschaltete, der auf seiner Seite des Wagens montiert war. Der grelle Strahl blendete Razor, da seine nicht menschlichen Augen äußerst empfindlich auf Licht reagierten, doch viel mehr Sorge bereitete ihm, dass jemand die Frau an seiner Seite identifizieren könnte.
»Nicht umdrehen.«
Aber seine Warnung kam zu spät. Sie hatte sich auf ihrem Sitz bereits so weit gedreht, dass die Polizisten ihr Gesicht durch das grellweiße Licht deutlich sehen konnten. Beide Männer schienen sie weitaus eingehender zu mustern als den bedrohlich aussehenden Mann, der neben ihrem Jeep stand.
Das konnte nichts Gutes bedeuten.
Mit seinem übernatürlich empfindlichen Gehör folgte er dem Gespräch der beiden Männer, die immer noch in ihrem Auto saßen.
»… dachte, du hättest dich um alles gekümmert«, sagte der Fahrer.
»Ich habe mich um alles gekümmert, Hank.«
»Ach ja?« Das wütende Gesicht des größeren Mannes, Hank, der hinter dem Steuer saß, war durch die Windschutzscheibe deutlich zu erkennen. »Und wie zum Teufel erklärst du dann, bitte schön, dass sie da vorn in dem Wagen sitzt?«
Sein Partner starrte sie eine Sekunde lang wie vor den Kopf gestoßen an, ehe er Razors flammendem Blick begegnete. Er stieß einen Fluch aus. »Heiliger Bimbam. Der Typ, der neben ihr steht, ist ein Stammesvampir.«
Razor hatte genug gehört. Die beiden Cops waren böse und korrupt. Sie würden gleich tot sein.
Und zwar nachdem sie ihm alles erzählt hatten, was er über Laurel Townsends Ermordung wissen musste.
»Sie bewegen sich nicht vom Fleck«, sagte er und näherte sich dann den beiden Polizisten, um sie zur Rede zu stellen.
Der größere der beiden schaltete das im Wagen integrierte Megafon an. »Bleiben Sie, wo Sie sind, Vampir. Halten Sie Ihre Hände so, dass wir sie sehen können. Sofort.«
Razor ignorierte den Befehl. Er ging weiter auf das Polizeiauto zu und blieb noch nicht einmal stehen, als Hank mit gezogener Waffe hinter dem Lenkrad hervorkam.
Hanks Partner stieg jetzt ebenfalls eilig aus dem Wagen.
Hinter Razor heulte der Motor des Jeeps auf, und dann hörte man das Quietschen der Reifen auf dem Asphalt, als der Wagen sich seinem mentalen Griff entzog. Er durfte den Wagen nicht länger festhalten; denn er musste sich jetzt erst einmal um das größere Problem kümmern. Außerdem wollte er nicht, dass Laurels Zwillingsschwester ins Kreuzfeuer geriet.
Denn eins war abzusehen – gleich würde es unschön werden.
Seine Fänge traten hervor, als Hanks Partner begann, auf den Jeep zu schießen. Mit einem gewaltigen Satz und zu schnell, als dass einer der beiden Menschen ihn hätte treffen können, katapultierte er sich durch die Luft und riss den Cop zu Boden. Mit einem kurzen Ruck brach er ihm das Genick. Er ließ von der Leiche ab und wandte sich dem anderen Polizisten zu.
Schüsse hallten durch die Nacht, als Hank einen Schuss nach dem anderen abgab, bis seine Dienstwaffe leer war. Den meisten Kugeln hatte Razor ausweichen können, doch als er seinen Arm entlangschaute, sah er, dass er von einer Kugel am Oberarm getroffen worden war.
Angewidert verzog er das Gesicht und bleckte seine gewaltigen Fänge, als er den Polizisten ansah. »Damit haben Sie mich nur noch wütender gemacht.«
Alle Farbe wich aus Hanks Gesicht. Hektisch versuchte er, die Waffe zu ziehen, die er auf der anderen Seite der Hüfte trug, doch dafür reichte die Zeit nicht mehr. Kein Herzschlag verging, als Razors Reißzähne sich auch schon in die fleischige Kehle des Mannes bohrten.
Eigentlich hatte er den Tod der beiden in die Länge ziehen und so schmerzvoll wie möglich gestalten wollen – eine kleine Vergeltung für das, was sie Laurel Townsend angetan hatten –, aber er war bereits ein zu großes Risiko eingegangen. Es war äußerst leichtsinnig von ihm gewesen, sie zwar im Schutz der aufziehenden Dämmerung, aber doch in aller Öffentlichkeit anzugreifen. Um sich selbst machte er sich wegen der beiden toten Polizisten keine Sorgen, aber er machte sich Gedanken darüber, was für Folgen das für Laurels Schwester haben könnte.
Er musste zu ihr.
Zwar war es bei dem Feuer auf dem Berg nicht um sie gegangen, doch allein durch die Verbindung zu ihm hatte er ihr Leben jetzt möglicherweise in Gefahr gebracht. Jeder, der sie am Fuß des Passes hatte stehen sehen, würde sie, was den Tod von Hank und seinem Partner betraf, als Verdächtige betrachten.
Und das bedeutete, dass Razor die Stadt so schnell wie möglich verlassen musste – und er würde Laurels Schwester mitnehmen.
Razor trat an den Toten vorbei, beschwor die außerordentliche Fähigkeit herauf, die ihm als Stammesvampir gegeben war, und raste durch den Wald den Berg hinauf. Er hörte den Motor des Jeeps, mit dem Laurels Schwester zur Hütte hochfuhr, wenige Meilen vor sich auf der Passstraße.
Die roten Rücklichter blitzten zwischen den Baumstämmen auf, als Razor eine felsige Ausbuchtung umrundete. Er hoffte, ihr den Weg abschneiden zu können, ehe sie den Ort der Verwüstung erreichte.
Sie kam nur einen kurzen Moment früher als er an. Der Wagen war noch gar nicht richtig zum Halten gekommen, als sie auch schon heraussprang, ohne den Motor abzustellen, und zur Hütte rannte.
Razor packte sie von hinten, schlang die Arme um sie und ließ sie nicht näher an den grauenvollen Ort heran. Sie schrie und fing an, sich mit aller Kraft zu wehren, um sich loszureißen.
»Alles gut«, knurrte er dicht an ihrem Ohr. »Ich werde Ihnen nichts tun.«
»Wie sind Sie … Die Cops …«
»Das waren böse Menschen«, sagte er. »Die werden niemandem mehr etwas tun.«
»Sie haben sie umgebracht?« Sie gab einen panischen Laut von sich. »Oh mein Gott.« Sie wehrte sich noch heftiger gegen ihn. »Lassen Sie mich los! Ich muss zu meiner Schwester.«
»Nein.« Die Erinnerung an den Anblick der Leiche würde ihn nie wieder verlassen, und er wollte ihr das Gleiche ersparen. »Sie ist tot.«
»Lassen Sie mich los!« Der Absatz ihres Cowboystiefels traf seinen Fuß mit voller Wucht.
Razor fluchte, nahm den Schmerz aber kaum wahr. »Hören Sie, Lady, ich versuche, Ihnen zu helfen.«
»So wie Sie Laurel geholfen haben? Hol Sie der Teufel, Vampir!«
Sie widersetzte sich weiter seinem Griff, obwohl es sinnlos war. Razor setzte noch nicht einmal seine ganze Kraft ein, um sie festzuhalten. Wenn überhaupt, dann versuchte er dafür zu sorgen, dass sie sich nicht selbst wehtat. Er verlagerte seinen Griff und drehte sie um, sodass sie ihn ansah, während er sie weiter an den Oberarmen festhielt.
Sie stierte ihn mit unstetem Blick an, bebend vor Kummer. Sie war eine Kämpferin, aber Schmerz und Leid hatten sie erstarren lassen. Ihr leerer Blick zeigte ihm, dass sie innerlich zerbarst. Unerklärlicherweise wollte Razor sie an sich ziehen und die Arme um sie schlingen – und sei es nur, um einen Teil des Schmerzes verschwinden zu lassen, der sich in ihre zarten Züge eingegraben hatte. Aber deshalb war er nicht hier.
»Ihre Schwester ist tot. Die beiden Cops unten am Berg hatten etwas damit zu tun. Wissen Sie, warum sie Laurel haben umbringen wollen?«
Langsam, ohne ein Wort zu sagen, schüttelte sie den Kopf. Sie schluckte mühsam. »Bitte. Ich muss sie sehen. Ich kann ihr helfen. Ich muss versuchen, sie zu retten!«
Das war schon das zweite Mal, dass sie so beharrlich darauf hinwies, ihre Schwester vielleicht retten zu können. Saß der Schock so tief, dass sie nicht erfasste, was sie hörte oder sah? Eigentlich schien sie ihm bei klarem Verstand zu sein, warum weigerte sie sich also, die Wahrheit zu akzeptieren?
»Keiner kann mehr etwas für Ihre Schwester tun. Ich habe es versucht, war aber ein paar Stunden zu spät hier. Jemand hat ihr in den Kopf geschossen und dann die Hütte mit ihr darin niedergebrannt. Sie ist tot.«
Tränen standen in ihren Augen. »Ich will sie sehen.«
»Nein, das wollen Sie nicht. Glauben Sie mir. Nachdem ich ihre Leiche in den Überresten der Hütte gefunden hatte, habe ich sie beerdigt. Ich konnte sie nicht einfach so liegen lassen.« Er hatte sie nicht liegen lassen können, weil er gedacht hatte, dass die Frau unter Schutt und Asche die wäre, die ihn jetzt ansah – die Schönheit, von der er förmlich besessen gewesen war, so wie irgendein erbärmlicher Stalker. »Ich habe mit bloßen Händen ein Grab geschaufelt und sie hineingelegt.«
Laurels Schwester wankte in seinen Armen, aber zumindest wehrte sie sich nicht mehr gegen ihn. Ob nun aus Erschöpfung oder Kummer oder einer Mischung aus beidem, konnte er nicht erkennen. Doch sie stützte sich jetzt so schwer auf seine Arme, als hielte nur er sie noch aufrecht. »Wo ist sie?«
Er wies mit dem Kinn in die Richtung. »Da drüben … im Schatten der Pinien.«
Ihr Blick ging an ihm vorbei zu dem kleinen Hügel aus frisch umgegrabener Erde, den er hinterlassen hatte. Razor beobachtete, wie sie das Bild der Verwüstung in sich aufnahm. Er brauchte nicht hinzuschauen, um zu wissen, was sie im fahlen Mondlicht sah. Die verkohlten Überreste der Hütte. Den geisterhaft aufragenden, geschwärzten Schornstein. Schutt und Asche, die von der Gewalt sprachen, die ihrer Schwester in den letzten Momenten ihres Lebens angetan worden war.
Das lange, entsetzte Schweigen von Laurels Schwester war für Razor kaum zu ertragen, aber er wusste nicht, was er hätte sagen oder tun sollen. Er war hundsmiserabel unfähig, wenn es um Mitgefühl und andere zarte Gefühle ging. Das war nur ein Teil der negativen Auswirkungen der Art und Weise, wie er aufgezogen und zum Jäger ausgebildet worden war.
Selbst jetzt kannte er nichts anderes als Töten und Vergeltung für längst vergangene Morde.
Schon bald würde er sich wieder um das kümmern, was er am besten konnte. Aber jetzt hatte er es mit einem größeren Problem zu tun. Finster verzog er das Gesicht, als diese großen grünen Augen ihn in der Dunkelheit wieder ansahen.
Ihr ganzer Kampfgeist war erloschen. Ihr Blick wirkte verwirrt und leer. Da war nur Schmerz.
»Wie heißen Sie?«, fragte er.
Sie blinzelte verwirrt, dann schluckte sie, und es hörte sich an, als wäre ihre Kehle ganz trocken. »Willow. Willow Valcourt.«
Razor nickte einmal kurz. »Wenn Sie leben wollen, Willow Valcourt, müssen Sie mit mir mitkommen.«
4
Sie wollte es nicht glauben.
Ihre Zwillingsschwester – ihre beste Freundin – durfte nicht tot sein. Nicht so. Auch wenn sie bis vor ein paar Monaten Tausende von Meilen getrennt hatten, war Laurel für Willow ihr ganzes Leben lang wie ein Signalfeuer gewesen. Sie durfte einfach nicht für immer fort sein. Ihr Herz wollte das nicht akzeptieren.
Willow sah in Razors ernstes Gesicht und schüttelte den Kopf. »Warum sollte ich Ihnen glauben? Beweisen Sie es. Beweisen Sie mir, dass es meine Schwester war, die Sie begraben haben.«
Seine Miene wurde noch ernster. »Wollen Sie damit sagen, dass ich sie wieder ausgraben soll?«
Himmel, nein. In ihrem Innern zog sich bei dem Gedanken alles zusammen. So etwas könnte sie nicht ertragen. Die Vorstellung, Laurel so zu sehen, wie Razor es angedeutet hatte, drehte ihr fast den Magen um. Sie glaubte nicht, dass sie in der Lage sein würde, Entsetzen und Schmerz beim Anblick der Überreste ihrer Schwester zu verkraften.
Der ruhige Blick, mit dem Razor sie jetzt ansah, schien zu sagen, dass auch er nicht glaubte, sie könnte es verkraften.
»Ich habe etwas von ihr.« Er griff in die Tasche seiner schwarzen Hose und zog eine angesengte Goldkette mit Anhänger heraus. Ein zartes halbes Herz baumelte am Ende der Kette. Die Hitze hatte es verbogen, trotzdem erkannte Willow es sofort.
»Das hatte sie um, als ich sie fand«, erklärte Razor und hielt ihr die Kette hin. »Es sieht so aus, als könnte es ein Geschenk von Theo gewesen sein. Ich wollte ihm die Kette geben, wenn ich ihn sehe.«
»Sie gehört ihm nicht.« Willow nahm den beschädigten Anhänger und legte ihn vorsichtig auf ihre flache Hand. »Ich habe die Kette Laurel geschenkt, als wir Kinder waren. Ich habe die andere Hälfte des Herzens. Wir haben die Ketten nie abgenommen.«
Tatsächlich trug Willow unter der weich fließenden Bluse ihren Teil des Anhängers.
Razor sah sie unter seinen dichten Augenbrauen mit durchdringendem Blick an. »Brauchen Sie noch einen weiteren Beweis?«
Sie schüttelte schwach den Kopf, auch wenn sie sich noch nicht ganz sicher war, ob sie ihm trauen konnte. Obwohl ihr Herz sich vor Kummer und Schmerz zusammengezogen hatte, wirbelten Erinnerungen und Fetzen von Unterhaltungen, die sie in den letzten Monaten mit Laurel geführt hatte, durch ihren Kopf. Die Angst ihrer Schwester war also doch gerechtfertigt gewesen. Vor was sie sich auch versteckt haben mochte, es hatte sie in schrecklichster Weise eingeholt.
Und dann waren da noch die rätselhaften Anweisungen, die Laurel Willow gegeben hatte – das Versprechen, das sie ihr abgerungen hatte, sollte das Schlimmste passieren.
Willow hatte inständig gehofft, dass dieser Tag niemals kommen würde.
Sie wusste nicht, was sie erwartete, wenn sie den Schwur einlöste, zu dem Laurel sie gedrängt hatte.
Sie wusste noch nicht einmal, was sie am Fuße des Berges erwartete, nachdem Laurel kaltblütig ermordet worden war und Willow sich jetzt in der Gewalt eines riesigen Stammesvampirs befand, der gerade zugegeben hatte, zwei Beamte der örtlichen Polizei ermordet zu haben.
Wer war er überhaupt? Offensichtlich war er ein gefährlicher Mann, aber er schien nicht völlig irre zu sein. Er wirkte fast … vernünftig. Fürsorglich. Vertrauenswürdig.
Eine lächerlich wirkende Wortwahl, um so ein mörderisches Wesen zu beschreiben.
Aber bis jetzt hatte er die ganze Zeit nur versucht, ihr zu helfen.
Vielleicht war sie diejenige, die allmählich den Bezug zur Realität verlor, denn irgendwie war sie Razor dankbar dafür, dass er jetzt bei ihr war. Sie war erleichtert, dass sie in diesem Moment, in dem sie das Geschehene verarbeiten musste, nicht allein war. Sie war dankbar, dass er sich um Laurels Leiche gekümmert hatte und sie nicht gezwungen gewesen war, das entsetzliche Leid, das Laurel widerfahren war, aus nächster Nähe zu sehen.
»Wir müssen von hier weg«, sagte Razor, und seine tiefe Stimme durchdrang den Tumult, in dem ihre Gefühle sich befanden. »Ich werde fahren.«
Das klang nicht wie eine Bitte, aber Willow wusste im Grunde auch nicht, welche andere Wahl sie haben sollte. Sie folgte ihm zu ihrem Jeep und bewegte sich schwerfällig wie in einem finsteren Traum. Er schwang sich hinter das Steuer, während sie wie betäubt auf der Beifahrerseite einstieg und ihren Beutel auf dem Boden abstellte.
Als sie nur stumm dasaß und in der zunehmenden Dunkelheit mit leerem Blick auf den Haufen aus Asche und Geröll schaute, drehte Razor sich zu ihr und griff um sie herum. Er zog am Sicherheitsgurt und legte ihn für sie an.
»Da ist Blut auf Ihrem Arm«, sagte sie leise. Seine Verletzung hatte sie aus dem durch den Schock ausgelösten Dämmerzustand gerissen. Sie setzte sich aufrechter hin. »Sind Sie verletzt? Ist das eine Schusswunde?«
»Mir geht’s gut«, brummte er.
Ohne noch etwas zu sagen, legte er den Gang ein und fuhr zurück auf die Schotterstraße, die den Berg hinunterführte. Das Licht der Scheinwerfer hüpfte wegen der vielen Schlaglöcher auf und ab und fiel immer wieder auf die am Straßenrand stehenden Bäume. Mit einem leisen Knurren schaltete er das Licht aus und fuhr jetzt noch schneller durch die Nacht.
Willow warf ihm einen verblüfften Blick zu. »Was soll das? Ich kann ja überhaupt nichts mehr sehen.«
»Ich aber.« Er sah sie mit seinen außerirdischen Augen an, und eine seltsame Hitze schoss durch ihren Körper. »Ich kenne eine Abkürzung. Halten Sie sich fest.«