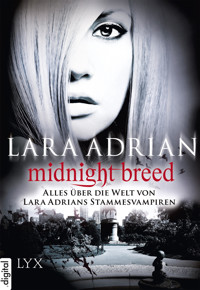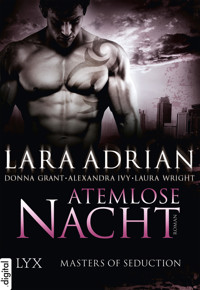9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Hunter-Legacy-Reihe
- Sprache: Deutsch
Er ist ein tödlicher Jäger - und ihre einzige Chance!
Lenora Calhoun ist eine der Wenigen, die der mächtigen Familie Parrish die Stirn bieten. Denn sie ist davon überzeugt, dass diese für das Verschwinden ihrer Schwester verantwortlich ist. Doch als sie auch noch ihren Neffen zu verlieren droht, schluckt sie ihren Stolz herunter und nimmt die Hilfe des grimmigen Hunters Knox an, den der Zufall in ihr kleines Diner geführt hat. Aber auch wenn sie weiß, dass Knox alles tun würde, um sie zu beschützen, fürchtet sie die Macht der Gefühle, die der gefährliche Jäger in ihr auslöst ...
"Ich kann das nächste Buch der Serie kaum erwarten!" FEELING FICTIONAL
Band 3 des düster-romantischen Spin-off der MIDNIGHT-BREED-Reihe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Epilog
Die Autorin
Die Romane von Lara Adrian bei LYX
Impressum
LARA ADRIAN
Hunter Legacy
VERLANGEN DER DUNKELHEIT
Roman
Ins Deutsche übertragen von Firouzeh Akhavan-Zandjani
Zu diesem Buch
Lenora Calhoun ist die Einzige in Parrish Falls, die der mächtigsten Familie der Stadt die Stirn bietet. Denn die Parrishs, davon ist sie überzeugt, sind für das Verschwinden ihrer Schwester Shannon verantwortlich. Diese hatte den ältesten Sohn der Familie vor Gericht gebracht, nachdem er sie geschwängert und halbtot geprügelt hatte. Doch kurz nachdem Lenis kleiner Neffe geboren wurde, verschwand Shannon spurlos und ließ das Baby zurück. Als der Vater des kleinen Riley aus dem Gefängnis entlassen wird, droht Leni auch noch den Jungen zu verlieren. Für ihren Ziehsohn würde sie alles tun, und so schluckt sie ihren Stolz herunter und nimmt die Hilfe des grimmigen Hunters Knox an, den der Zufall während eines Schneesturms in ihr kleines Diner verschlagen hat. Knox, der ganz offensichtlich auf der Flucht vor seinen eigenen inneren Dämonen ist, bietet ihr seinen Schutz ebenso widerwillig an, wie sie ihn annimmt. Denn obgleich die Anziehungskraft zwischen ihnen unleugbar ist, fürchtet Leni sich vor den leidenschaftlichen Gefühlen, die der gefährliche Jäger in ihr auslöst. Spürt sie doch, dass es kein Zurück mehr geben kann, wenn sie ihm einmal ihr Herz geöffnet hat …
1
Das Glöckchen über der Eingangstür klingelte hell, als ein später Gast aus dem draußen tobenden Schneesturm in den Diner trat. Ein Schwall eisiger Luft strömte mit dem Neuankömmling herein. Winzige Eiskristalle legten sich auf Leni Calhouns Nacken, als sie Richtung Küche eilte. In der Hand hielt sie das Geschirr des Gastes, der, wie sie angenommen hatte, heute Abend der letzte sein würde.
»Sie können sich selbst einen Platz suchen«, sagte sie, ohne langsamer zu werden oder sich umzuschauen.
Dass man sich in ihrem kleinen Imbiss am Rande der North Maine Woods, einer riesigen, aus Wäldern, Flüssen und Seen bestehenden Naturlandschaft, selbst seinen Platz suchte, brauchte sie ihren Stammgästen nicht zu sagen.
Das nächtliche Unwetter bedeutete, dass heute zwar weniger los war als sonst, aber doch ständig Leute hereinkamen. Es waren überwiegend Holzfäller und Jäger auf der privaten, größtenteils unbefestigten, zweispurigen Straße unterwegs, welche sich auf etwas über neunzig Meilen von Millinocket nahe der Interstate Richtung Westen bis zur kanadischen Grenze schlängelte, und diese Männer wussten, dass es im Diner mittwochs immer Schmorbraten gab. Und die meisten ließen sich nicht einmal bei dem für den Februar typischen scharfen Nordostwind einen Teller mit langsam gegartem Rindfleisch und Gemüse in sämiger Bratensauce entgehen.
Leni nahm an, dass sie jetzt wohl die letzte Portion des Gerichts nach einem von ihrer Großmutter geerbten Familienrezept an den Nachzügler ausgeben würde, der gerade hereingekommen war. Sie griff nach der Kaffeekanne, die auf der Warmhalteplatte stand, und nahm, ehe sie zurück in den Gastraum ging, einen der schweren, weißen Keramikbecher, der immer noch warm war, weil er frisch aus dem Geschirrspüler kam.
Ein paar Männer, die aus der näheren Umgebung kamen, rutschten von den Hockern am Tresen und wünschten ihr noch einen schönen Abend, während sie Richtung Tür schlurften. Es gab mehrere freie Plätze am langen Bartresen, doch der Neuankömmling war an allen Stühlen vorbeigegangen, um sich in einer Nische hinzusetzen, die am weitesten von den anderen Gästen entfernt war.
Leni kannte ihn nicht. Er saß mit dem Gesicht zum Ausgang, sein Kopf war leicht gesenkt und das Gesicht unter der großen Kapuze seines mit Schnee bedeckten schwarzen Parkas verborgen. Unter dem von Kunstpelz umrahmten Stoff waren nur ein kantiger, leicht bärtiger Kiefer und ein schmaler Mund zu sehen, den kein Lächeln verzog.
Der Mann war ein Hüne. Obwohl er saß, konnte Leni erkennen, dass er groß und kräftig war. Unter der schweren Winterjacke verbargen sich Schultern, die breiter und muskulöser waren als die eines Verteidigers im American Football. Wahrscheinlich war er neu im Geschäft und wollte sein Glück versuchen, indem er noch vor Ende der Woche eine Ladung Holz zu einem der Sägewerke schaffte. Nur erfahrene einheimische Fahrer und ahnungslose Neueinsteiger, die sich in der Gegend nicht auskannten, würden es überhaupt in Erwägung ziehen, sich bei so einem Wetter wie heute auf eine der Schotterpisten zu wagen.
»Sieht mal wieder nach einem Jahrhundertsturm da draußen aus«, meinte Leni im Plauderton, als sie den Becher auf den Tisch stellte und den starken schwarzen Kaffee einzuschenken begann. »Andererseits erleben wir das fast jedes Jahr, deshalb kann man wohl –«
»Kein Kaffee.« Die schroffen Worte kamen mit einer tiefen, tonlosen Stimme heraus, doch das dunkle Timbre ging ihr durch und durch.
»Okay, kein Problem.« Sie hörte auf einzugießen und nahm die Kanne wieder hoch. »Was kann ich Ihnen ansonsten zu trinken bringen? Normalerweise nehmen alle Kaffee, aber ich hab auch Wasser mit oder ohne Kohlensäure. Wenn Sie einen Tee möchten, dauert es ein paar Minuten, weil ich frisches Wasser aufsetzen müsste.«
Er schüttelte den Kopf, und ein paar der geschmolzenen Schneeflocken liefen wie Regentropfen von seiner Kapuze herunter. »Ich möchte nichts trinken. Danke.«
Die Stimme klang heiser, wie eingerostet, doch was er sagte, war erfrischend ehrlich. Mit seiner großen Hand, die in einem schwarzen Lederhandschuh steckte, schob er sich die Kapuze seines Parkas vom Kopf. Leni brachte eigentlich nichts so leicht aus der Fassung, aber bei dem Anblick, der sich ihr nun bot, fiel es sogar ihr schwer, den Mann nicht mit offenem Mund anzustarren. Das Gesicht, das jetzt zu ihr aufschaute, war aber auch wirklich atemberaubend.
Unter einem vollen Schopf brauner Haare, die ein paar Nuancen heller waren als ihre, sah er sie mit durchdringendem Blick aus blaugrauen Augen an. Der kantige Kiefer, auf dem ein Bartschatten lag, sah im fahlgelben Licht der Lampe über dem Tisch noch kräftiger aus. Durch die hohen, spitzen Wangenknochen hätte sein Gesicht eigentlich streng wirken müssen, doch stattdessen bildeten die schroffen Ecken und Kanten einen reizvollen Gegensatz zu einem regelrecht sündhaft wirkenden Mund, dessen Anblick ihr Herz ein bisschen schneller schlagen ließ.
Dass sein stürmischer Blick sie nicht losließ, war dabei auch nicht sonderlich hilfreich.
Obwohl Leni mit ihrem braunen Haar und den sommersprossigen Wangen nie so hübsch gewesen war wie ihre blonde, blauäugige ältere Schwester Shannon, warfen ihr sowohl die Einheimischen als auch die Männer auf der Durchreise gern einen zweiten Blick zu. Doch dieser Mann musterte sie mit einer Intensität, die weit über eine ungeschickte Anmache oder Feld-Wald-und-Wiesen-Flirterei hinausging.
Er schaute sie an, als könnte er direkt in sie hineinsehen. Sein Blick glitt langsam über jede Facette ihres Gesichts und ließ dabei weder ihre haselnussbraunen Augen noch die leicht nach oben ragende Nase oder ihren Mund aus, der plötzlich völlig ausgetrocknet war. Dann ging sein Blick weiter nach unten und richtete sich auf ihre Kehle, was ihren ohnehin schon hämmernden Puls zum Rasen brachte.
Die finstere Kraft und die unausgesprochene, doch deutlich spürbare Dominanz, die er ausstrahlte, hätten sie eigentlich verunsichern müssen. Und in der Tat war sie ein bisschen durcheinander, denn es war definitiv nicht ihre Art, so zu reagieren, wenn ein gut aussehender Mann in ihren Diner kam. Was, um ehrlich zu sein, nicht sonderlich häufig passierte. Eigentlich nie. Und dieser Mann war wirklich überirdisch gut aussehend.
Himmel, was war nur los mit ihr?
Leni nahm den zur Hälfte gefüllten Becher, den er sowieso nicht anrühren würde, und rief sich zur Räson. »Na gut. Kein Getränk also. Was kann ich ansonsten für Sie tun? Ich habe noch eine Portion Schmorbraten, nach dem Rezept meiner Großmutter, und ich garantiere Ihnen, dass Sie noch nie etwas so Gutes gegessen haben.«
Seine dunklen Augenbrauen reckten sich ein wenig nach oben, sodass Leni seinem beunruhigend durchdringenden Blick noch stärker ausgesetzt war, während ein leichtes Zucken der Erheiterung um seine Mundwinkel spielte. »Den Schmorbraten möchte ich auch nicht.«
»Sicher? Wenn Sie zu einem der Sägewerke bei Jackman oder St. Zacharie an der Grenze von Quebec wollen, brauchen Sie ein bisschen was auf den Rippen. Sie haben da eine brenzlige Fahrt von über hundert Meilen vor sich.« Leni deutete mit dem Kinn auf das Unwetter, das gegen die Scheiben schlug. »Wofür man bei gutem Wetter über vier Stunden braucht, wird in einer Nacht wie dieser doppelt oder dreifach so lange dauern. Wenn man es überhaupt schafft.«
»Ich werde das in der Abteilung für gute Ratschläge ablegen«, brummte er.
Sie legte den Kopf auf die Seite, als sie ihn jetzt genauer in Augenschein nahm. Er wollte gar nicht zu einem dieser Orte. Überhaupt hatte sie mittlerweile den Eindruck, dass er gar kein Holzfäller oder Lastwagenfahrer war.
Sie war jetzt siebenundzwanzig Jahre alt und arbeitete mittlerweile ihr halbes Leben in diesem Diner – erst an der Seite ihrer Mutter und ihrer Großmutter und später allein, nachdem beide gestorben waren. Im Laufe dieser Zeit hatte Leni einen sechsten Sinn für die Fremden entwickelt, die auf ihrem Weg egal wohin durch Parrish Falls kamen. Doch bei diesem Mann war ihr erster Eindruck völlig verkehrt gewesen.
So einem wie ihm war sie noch nie begegnet, und das hing nicht nur mit seinem durchdringenden Blick und dem unglaublich schönen Gesicht zusammen.
Er hatte etwas an sich, das eine Vielzahl von Schaltern bei ihr umgelegt hatte, und dazu gehörten auch ein paar, die sie eigentlich nicht wahrhaben wollte. Als er seine Handschuhe auszog und ihr Blick auf die ungewöhnlichen Hautmuster auf dem Rücken seiner starken Hände fiel, begriff sie, warum.
Allmächtiger. Er war ein Stammesvampir.
Die ineinander verwobenen Schnörkel und Windungen, die ein oder zwei Nuancen dunkler als seine golden schimmernde Haut waren, gab es bei Menschen nicht. Es waren außerirdische Hautmuster. Dermaglyphen, die nur bei den bluttrinkenden Mitbewohnern dieses Planeten vorkamen, welche bis vor ungefähr zwanzig Jahren unerkannt unter den Menschen gelebt hatten.
Leni war noch nie einem Abkömmling dieser Art leibhaftig begegnet, doch sie wusste von den Stammesvampiren. Und angesichts seiner hünenhaften Gestalt und der Dichte und Verschlungenheit der Glyphen, die seine großen Hände und Handgelenke bedeckten, war ihr klar, dass bestimmt auch sein restlicher Körper davon überzogen war.
Das bedeutete, dass sie es mit einem besonders reinblütigen Stammesvampir zu tun hatte – einem der mächtigsten und gefährlichsten seiner Art.
Er zog ein Bündel Banknoten aus der Innentasche seines Parkas und entnahm ihm eine Zwanzig-Dollar-Note. »Ich bleibe nicht lange«, sagte er und schob den Schein an den Rand des beschichteten und mit einem Metallband eingefassten Tisches. »Ich wollte nur einen Moment lang aus der Kälte raus.«
Leni blickte erstaunt in die stürmisch flackernden blauen Augen. Und das nicht nur, weil sie sich in ihrem Restaurant mit einem Vampir unterhielt, sondern weil er sich eigentlich von den Menschen alles nehmen konnte – ihr Leben eingeschlossen –, aber jetzt tatsächlich hier saß und für ein paar Minuten freundlicher Aufmerksamkeit bezahlen wollte.
»Behalten Sie Ihr Geld. Bleiben Sie, so lange Sie mögen.«
Während sie sprach, hörte man das laute Brummen eines Dieselmotors, der zu einem schweren Laster gehörte, welcher sich dem Restaurant näherte. Das schwarze Ungetüm war heute mit einem riesigen Schneepflug versehen, die Scheinwerfer funkelten grell. Die beiden Lichter schnitten durch die dichte Wand dicker Schneeflocken und blendeten Leni förmlich, als der Fahrer auf den Parkplatz fuhr und direkt vor einem der Fenster hielt.
Verdammt. Das konnte sie jetzt gar nicht brauchen.
Sie runzelte die Stirn und unterdrückte ein Stöhnen. Den ganzen Tag hatte sie die beiden Männer, die aus dem schweren Fahrzeug stiegen, nicht gesehen. Wenn sie den Rest ihres Lebens nichts mehr mit Dwight Parrish und dem Rest seiner Sippe zu tun hätte, wäre das für ihren Geschmack immer noch zu viel.
Die Parrish-Familie verwaltete die nicht eingemeindeten Wälder im Norden des Landes schon seit Generationen – sogar länger als der Bundesstaat zu den Vereinigten Staaten gehörte. Im Laufe der Zeit war die Familie im gleichen Maße kleiner geworden, wie das Vermögen schrumpfte, das die ersten Parrishs mit Holz und Pelzen gemacht hatten. Doch der Name besaß hier und in den umliegenden Siedlungen immer noch Gewicht, und es gab nur wenige – wenn überhaupt –, die es wagten, mit dem alten Enoch Parrish oder seinen Söhnen Dwight, Jeb und Travis aneinanderzugeraten.
Leider war Leni eine von diesen wenigen, aber dagegen ließ sich eben nichts machen.
Die Tür wurde weit aufgestoßen, als Dwight und ein anderer aus dem Ort, Frank Garland, hereinkamen und erst dann stampfend den Schnee von ihren derben Stiefeln lösten. Arschlöcher.
Die Verärgerung musste Leni wohl anzusehen gewesen sein, denn als sie sich wieder zu dem Stammesvampir umdrehte, bedachte dieser sie mit einem forschenden Blick. »Alles in Ordnung?«
»Nur das Übliche.« Sie zwang sich zu einem freundlichen Lächeln. »Wie ich schon sagte … keine Eile. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie etwas brauchen, ja?«
Er nickte leicht, doch sein durchdringender Blick heftete sich auf die beiden Männer, die an den Tresen traten, um sich mit den paar Männern zu unterhalten, die dort saßen.
Dwight Parrish schlug mit der flachen Hand auf den Tresen, ehe er mit seiner vom ständigen Rauchen rauen Stimme laut lospolterte. »Was zum Teufel muss man tun, um in diesem Laden einen Kaffee zu bekommen?«
2
Knox war eher unfreiwillig in diesem abgeschiedenen Dörfchen gelandet. So erging es wahrscheinlich den meisten. Er war nur ein paar Minuten in diesem Ort gewesen, und das hatte schon gereicht, um das Gefühl zu bekommen, dass man hier nicht häufig Fremde sah – am allerwenigsten welche mit Fängen und Glyphen wie ihn.
Wären der tobende Schneesturm und ein Fernfahrer mit einer schwachen Blase nicht gewesen, würde Knox wohl immer noch in der warmen Fahrerkabine eines Sattelschleppers sitzen, der auf der I-95 Richtung Norden fuhr. Doch dann hatte der Fahrer, der ihn in New Hampshire mitgenommen hatte, ihn nach mehreren Stunden Fahrt mitten in Maine, an einer Bushaltestelle in Medway, abgesetzt, und Knox hatte zwei Möglichkeiten gehabt: sich am Tage irgendwo zu verkriechen, bis das Unwetter vorüber war, oder in Bewegung zu bleiben. Seitdem er vor fünf Monaten den Ort in Florida verlassen hatte, der für ihn einem Zuhause am nächsten gekommen war, und er sich abgesehen von Gelegenheitsjobs hatte treiben lassen, bekam Knox der Stillstand nicht mehr.
Das ging schon eine ganze Weile so.
Seit acht Jahren, und ein Ende war nicht abzusehen.
Seit Abbie, um genau zu sein.
Damals hatte er, wenn es um sie ging, sich selbst Schwäche erlaubt, aber jetzt nicht mehr. Nie wieder. Jetzt führte er ein einfaches Leben ohne emotionale Verwicklungen jedweder Art.
Mit nichts und niemandem ging er Verpflichtungen ein.
Solange er in Bewegung blieb, solange sein Leben in den Bahnen der selbst auferlegten Disziplin und der Ausbildung verlief, die ihn zum Jäger, zum Hunter, gemacht hatte – einem der gefährlichsten Abkömmlinge seiner Art –, ergab sich keine Gelegenheit, darüber nachzudenken, was er verloren hatte. Dann gab es keinen Raum für Kummer und Schmerz … oder Schuldgefühle.
Als er also vor die Wahl gestellt worden war, sich ein paar Stunden in der Nähe der Interstate die Beine in den Bauch zu stehen oder auf eigene Faust die zweispurige Straße entlang aus der Stadt heraus Richtung Norden zu marschieren, hatte er sich für Letzteres entschieden.
Nach etwa dreißig beschwerlichen Meilen durch eine malerische Landschaft waren immer weniger menschliche Behausungen zu sehen gewesen. Nur hin und wieder begegneten ihm auf seinem Weg alte Farmhäuser oder Wohnmobile. Er schätzte, dass er ungefähr noch einmal eine ähnlich lange Strecke gegangen war, ehe er den Lichtschein eines Diners erspähte, etwa hundert Meter hinter einem verwitterten Holzschild, welches verkündete, dass dieser Ort Parrish Falls hieß.
Er würde wohl entlang derselben unbefestigten Straße weiterlaufen, wenn er das Schnellrestaurant wieder verließ, um dann wahrscheinlich die Grenze nach Kanada zu überschreiten und zu schauen, wohin ihn sein Weg führen würde.
Die hübsche braunhaarige Frau, die ihm Kaffee und eine heiße Mahlzeit angeboten hatte, ehe sie merkte, was er war, hatte erwähnt, dass die Grenze – die die Rückkehr in die Zivilisation verhieß – in ungefähr hundert Meilen Entfernung läge und er mit einem Wagen bei diesen Wetterverhältnissen mindestens acht Stunden unterwegs wäre. Als Stammesvampir würde er die Strecke dagegen zu Fuß viel schneller bewältigen; insbesondere bei einem Wetter wie heute Nacht.
Er musste allerdings zugeben, dass es eine verführerische Vorstellung war, sich ein warmes Bett und einen willigen Blutwirt zu suchen, um etwas gegen den Appetit in seinen Fängen und anderen, ähnlich fordernden Körperteilen zu tun, nachdem er sich bei dem Schneesturm alles Mögliche abgefroren hatte.
Diese beiden miteinander im Wettstreit liegenden Gelüste lenkten seinen Blick auf die langen, in Jeans gehüllten Beine, die sich gerade wieder von der Nische, in der er Platz genommen hatte, entfernten. Außer dem hübschesten und ehrlichsten Gesicht, das er in den letzten Wochen gesehen hatte, hatte die Frau auch ein direktes, selbstbewusstes Auftreten und eine weiche, leicht heisere Stimme, die seine Sinne wie Samt berührte. Doch da hörten ihre Vorzüge noch nicht auf. Sie war groß und wohlgeformt mit fraulichen Hüften und einer schmalen Taille, die noch nicht einmal das weite Flanellhemd, das sie anhatte, verbergen konnte. Das volle, dunkle Haar, das bestimmt bis zur Mitte ihres Rückens reichte, wie Knox schätzte, hatte sie zu einem lockeren Knoten hochgesteckt.
Nur mühsam war es ihm gelungen, seine Fänge im Zaum zu halten, als er ihren schlanken Hals anstarrte, während sie am Tisch mit ihm sprach. Es waren einige Tage zu viel vergangen, seit er Nahrung zu sich genommen hatte, doch nicht der Gedanke an ihr frisches rotes Blut auf seiner Zunge ließ seine Adern enger werden, als er sie jetzt weiter beobachtete.
Mit dem von ihm abgelehnten Becher in der einen und der Kaffeekanne in der anderen Hand ging sie zum Tresen zurück, wo die beiden Männer, die mit dem Schneepflug gekommen waren, auf leeren Hockern in der Nähe der altmodischen Registrierkasse Platz genommen hatten.
Sie war über ihr Erscheinen nicht froh gewesen. Man merkte ihr den Unmut immer noch deutlich an, als sie an ihnen vorbei durch die Schwingtür in die Küche verschwand. Sie kam mit zwei frischen Bechern zurück und schenkte beiden Kaffee ein.
»Sonst noch was?«
Sie richtete die Frage an den Größeren der beiden. Der massige Mann mit breiten Schultern unter einer dick gefütterten Winterjacke trug eine graue Strickmütze und hatte ein rotes Gesicht, das von einem rotbraunen Holzfällerbart bedeckt war.
Er nahm einen Schluck seines heißen Kaffees und musterte die Frau über den Rand des Bechers hinweg. »Willst du mich nicht nach Travis fragen, Lenora?«
»Nein. Warum sollte ich?«
Er zuckte höhnisch mit seinen fleischigen Schultern. »Er kommt dieses Wochenende nach Hause.«
»Dessen bin ich mir bewusst.« An ihrer tonlosen Stimme erkannte man, dass es für sie keine gute Nachricht war.
»Er wird den Jungen sehen wollen, Leni.«
Sie trat einen Schritt zurück, als brauchte sie den Abstand nicht nur zu dieser Ankündigung, sondern auch zu dem Mann, der sie überbrachte. Sie verschränkte die Arme vor der Brust und schüttelte den Kopf. »Riley kennt ihn noch nicht einmal. Er weiß überhaupt noch gar nichts. Und er ist zu jung, um zu verstehen.«
»Darüber hat mein Bruder zu entscheiden … nicht du.«
»Er? Den Teufel wird er tun«, gab sie schroff zurück. Ein ärgerlicher Ausdruck lag auf ihrem Gesicht. »Ich werde Travis noch nicht einmal in die Nähe des Kindes lassen. Das kannst du ihm gern ausrichten.«
Der grobschlächtige Mann setzte seinen Becher ab. »Du kannst uns nicht von dem Jungen fernhalten … nicht mehr. Das wird Travis nicht dulden, wenn er erst einmal zu Hause ist. Vielleicht kommt er ja vorbei, um Hallo zu sagen, wenn er wieder da ist. Oder vielleicht stattet er nächste Woche der Grundschule einen Besuch ab und überrascht seinen Sohn mit einem kleinen Familientreffen.«
Ein älteres Ehepaar, das ein paar Plätze von der Auseinandersetzung entfernt saß, hatte offensichtlich das Gefühl, dass es an der Zeit wäre zu gehen. Sie ließen ein paar Dollar Trinkgeld neben ihren halb leeren Tellern liegen und trotteten aus dem Diner. Das fröhliche Läuten des Türglöckchens begleitete ihren Abgang.
Jetzt hockten nur noch zwei Trucker und ein Mann mittleren Alters mit lichter werdendem Haar und einer tarnfarbenen Jagdjacke am Tresen. Die Trucker schaufelten stur ihr Schmorfleisch in sich hinein, ohne aufzuschauen. Der Mann mit der tarnfarbenen Jacke hatte vor ein paar Minuten den letzten Krümel von seinem Apfelkuchen verputzt und schien entschlossen, das Drama, das sich ein paar Stühle neben ihm abspielte, ignorieren zu wollen.
Und dann war da noch Knox in der hintersten Nische, der die Hände unter der Tischplatte abwechselnd öffnete und zu Fäusten ballte. Sein Kampfgeist war geweckt und drängte ihn immer stärker zum Handeln, während er den anmaßenden Mistkerl anstarrte, der anscheinend nur hereingekommen war, um Unruhe zu stiften.
Lenora – oder Leni, wie der Mann sie genannt hatte – atmete zischend aus, während sie die Hände auf den Tresen legte und vor dem arroganten Riesen nicht klein beigab.
»Verdammt noch mal, Dwight. Hat deine Familie meiner nicht schon genug Schaden zugefügt?« Sie wurde nicht laut, sondern schlug einen leisen, gefassten Ton an, doch Knox mit seinem scharfen Gehör fing jede Silbe und das Ausmaß ihrer unterdrückten Wut auf. »Lass Riley aus der Sache raus. Er ist nicht der Besitz von irgendjemandem.«
»Das stimmt, Lenora. Er ist Fleisch und Blut … unser Blut.«
Sie hob das Kinn. »Ach ja? Den Beweis bist du mir noch schuldig.«
»Nur weil du dich geweigert hast, den Test machen zu lassen«, erwiderte er höhnisch.
Sie zuckte noch nicht einmal zusammen. »Das macht zwei fünfzig für die beiden Kaffee.«
»Könnte ich meinen in einem Becher zum Mitnehmen haben, Leni?« Es war das erste Mal, dass der Begleiter des Mistkerls etwas sagte, seitdem sie hereingekommen waren. Er griff in die Jackentasche, um sein Portemonnaie herauszuholen, erstarrte jedoch mitten in der Bewegung, als sein Kumpan ihm einen scharfen Blick zuwarf.
»Wir wollen auch was essen«, sagte der große Mann – Dwight. »Ich nehme eine Portion von dem Schmorfleisch.«
Leni schnalzte bedauernd. »Ihr seid zu spät. Das Schmorfleisch ist leider schon aus.«
Dwight zog bei der Lüge die Augenbrauen zusammen. »Dann nehme ich stattdessen die Fleischklöße mit viel Sauce.«
Sie zuckte mit den Achseln und schüttelte den Kopf. »Die Küche ist schon zu. Wegen des Wetters.«
»Blödsinn.« Er gab einen drohenden Laut von sich, der fast wie ein Knurren klang, und stand auf. »Dann geh mir aus dem Weg, Lenora. Ich komme jetzt nach hinten und hol mir das verdammte Essen selbst.«
Das würde Knox nicht dulden. »He, Rübezahl. Hast du nicht gehört, was die Lady gesagt hat, die Küche ist geschlossen.«
Alle Köpfe im Raum drehten sich in seine Richtung. Auch Lenis. Ihre hübschen haselnussbraunen Augen wurden vor Überraschung – und Unsicherheit – ganz groß, als sich ihre Blicke quer durch den ganzen Diner begegneten.
Der große Mann und Unruhestifter zog die buschigen Brauen zusammen. »Wer zum Henker bist du denn?«
Knox sah ihn von seinem Platz in der Nische unverwandt an und ignorierte die Frage. »Ihr legt jetzt jeder eure zwei fünfzig auf den Tresen und geht.«
Schnaubend drehte Dwight den Kopf zu seinem nervös aussehenden Kumpel. »Was will denn der Kerl?« Er bewegte sich auf die Nische zu. »Der Einzige, der hier gleich geht, ist …«
Knox kam aus der Nische und richtete sich auf. Seine Größe war im Sitzen nicht ganz so offensichtlich gewesen. Doch jetzt waren seine zwei Meter und die hundertzwanzig Kilo Muskeln und Sehnen unverkennbar … genau wie die Bereitschaft, seinen Worten mit Gewalt Nachdruck zu verleihen.
Lenis Quälgeist blieb ein halbes Dutzend Schritte von Knox entfernt stehen. Der Mann mit der Jagdjacke, der am Tresen saß, ließ plötzlich mit einem Ruck die vorgetäuschte Attitüde, nichts von der angespannten Situation mitbekommen zu haben, fahren. Er rutschte von seinem Hocker und stellte sich zwischen Knox und den anderen, während die beiden Trucker, die am Tresen gegessen hatten, bezahlten und hastig das Restaurant verließen.
»So, jetzt aber alle mal mit der Ruhe.« Der Mann sah Knox an, als hätte der den Streit vom Zaun gebrochen. Seine tarnfarbene Jacke war nicht geschlossen, aber jetzt ließ er sie noch weiter aufklaffen, sodass die Pistole, die er am Gürtel trug, sowie die Sheriff-Marke an seiner Brust sichtbar wurden. »Ich glaube, ich habe Sie hier noch nie gesehen, Mr …«
Knox reagierte nicht auf die unausgesprochene Aufforderung, seinen Namen zu nennen. Sein Blick war immer noch auf Dwight gerichtet, der sichtlich erleichtert wirkte, dass das Gesetz zu seiner Rettung herbeigeeilt war. Rückgratlose Memme.
Dass der Sheriff, der offensichtlich nicht im Dienst war, es nicht für nötig befunden hatte einzuschreiten, als Leni verbal belästigt worden war, ärgerte Knox mehr, als es eigentlich sollte. Sie ging ihn nichts an. Genauso wenig wie die offensichtliche Voreingenommenheit, mit der der Dorfpolizist sich schützend vor den arroganten Mistkerl stellte. Dennoch war sein Misstrauen geweckt.
Der Beamte räusperte sich und versuchte es jetzt auf andere Weise. »’N höllisches Wetter da draußen. Was führt Sie nach Parrish Falls?«
»Bin nur auf der Durchreise.«
Die ausweichende Antwort trug ihm einen Blick aus schmalen Augen ein. »Wo kommen Sie her, mein Sohn?«
»Von hier und da.«
Knox amüsierte es fast ein bisschen, dass der Mann, der um die fünfzig sein musste, immer noch nicht erkannt hatte, dass ein Stammesvampir vor ihm stand. Und genauso wenig schien ihm klar zu sein, dass Knox sogar noch gefährlicher als das war.
Er hatte seine ganze Kindheit – von seiner Geburt bis in die Teenagerjahre – im Labor eines Wahnsinnigen verbracht, wo er genau wie die anderen aus dem Hunter-Programm darauf gedrillt worden war, ohne die geringste Emotion zu töten. Diese höllischen Anfänge waren die Vorbereitung auf die Jahre gewesen, die er im Würgegriff des Halsrings verbracht hatte, den ihm der besagte Verrückte angelegt hatte, damit Knox als einer der vielen im Labor aufgewachsenen Killer seine mörderischen Befehle ausführte.
Es war jetzt mehr als zwanzig Jahre her, dass Knox und einige andere glückliche Hunter aus ihrer Gefangenschaft befreit worden waren. Doch das bedeutete nicht, dass er irgendetwas von dem vergessen hatte, was er gelernt hatte.
Weit gefehlt.
Er war immer noch der geborene Killer und wohl die gefährlichste Kreatur, die sich in diesem abgelegenen Winkel der North Maine Woods herumtrieb. Irgendwie hoffte er, dass ihm der Feigling, der sich hinter dem Sheriff versteckte, den Vorwand lieferte, das zu beweisen.
»Habe Sie gar nicht mit einem Wagen kommen sehen«, meinte der Mann mit der Marke und der Pistole. »Hat jemand Sie abgesetzt?«
»Ich bin gelaufen.«
Der Mann sah ihn zweifelnd an. »Wo wollten Sie denn bei so einem Wetter hin?«
Knox zuckte mit den Achseln. »Hatte mich noch nicht entschieden.«
»Sie reden eindeutig nicht viel, hm?«
»Ist das in Parrish Falls verboten?«
Der Sheriff gab nur ein Brummen von sich. Der hinter ihm stehende Dwight nahm das bisschen Mut zusammen, das er besaß, und schnaubte höhnisch, während er an dem kleineren, älteren Mann vorbeischaute, der ihn von Knox trennte.
»Respektloses Verhalten bringt dich vielleicht nicht hinter Gitter, aber Herumlungern könnte schon dafür sorgen. Oder auch wenn man ein öffentliches Ärgernis darstellt.«
»Er lungert nicht herum«, sagte Leni. Sie begegnete Knox’ Blick und sah ihm lange in die Augen. »Ich habe ihm gesagt, er könne so lange hier in meinem Diner bleiben, wie er möchte. Ich habe noch nie jemanden abgewiesen und werde auch nicht damit anfangen. Es gibt heute Abend nur ein öffentliches Ärgernis hier drin, und das ist nicht er.«
Dwight grinste spöttisch. »Sheriff Barstow, warum verhaften Sie diesen Herumtreiber nicht wegen Landstreicherei? Vielleicht möchte er ja gern in einer Zelle abwarten, bis das Unwetter vorbei ist.«
»Du glaubst also, eine Zelle könnte mich aufhalten?« Knox richtete das Wort an dem Polizisten vorbei direkt an Dwight. Zur Sicherheit – um auch wirklich nicht missverstanden zu werden – ließ er kurz seine Fänge aufblitzen.
»Allmächtiger!«
Für einen so massigen Mann war es schon erstaunlich, wie schnell er einen Satz nach hinten machte. Auch der Sheriff wich einen Schritt zurück. Er hob eine Hand, die – das musste man ihm lassen – nur leicht zitterte.
»Okay, jetzt mal langsam. Entspannen wir uns alle wieder.« Er sprach langsam und ganz ruhig, wie er es wohl tun würde, hätte er es plötzlich mit einer Geiselnahme zu tun … oder einer Bombendrohung. »Keiner wird verhaftet. Und es will hier auch keiner Ärger heute Abend.«
»Den gibt’s auch nicht«, erwiderte Knox. »Wenn er sich entschuldigt.«
Der Sheriff warf einen auffordernden Blick über die Schulter.
»Sorry«, ertönte brummig die nicht ernst gemeinte Antwort vom anderen Ende des Diners.
»Nicht bei mir.« Knox sah den Mann unverwandt an und nickte dann in Lenis Richtung. »Entschuldige dich bei ihr.«
»Wofür denn zum Teufel?«
Der Sheriff schnaubte ungeduldig. »Um Himmels willen, Dwight, tu’s einfach.«
»Na, schön. Es tut mir leid. Okay?«
Knox durchbohrte ihn mit einem kalten Blick. »Jetzt bezahl den Kaffee, und dann mach, dass du wegkommst.«
Dwight verzog erbost das Gesicht, griff aber in die Tasche seiner Jeans und holte eine Handvoll zerknüllter Scheine und Münzen hervor. Sein Freund beeilte sich, es ihm nachzutun.
»Zwei fünfzig für jeden«, erinnerte Leni sie.
»Plus Trinkgeld«, fügte Knox hinzu.
Die Männer zahlten und gingen, wobei Dwight wie ein wütender Bär durch die Tür nach draußen stürmte. Der Sheriff folgte ihnen und unterhielt sich noch mit den Männern neben dem Laster mit dem Schneepflug.
»Danke, dass Sie das für mich getan haben.« Als Knox den Kopf zu Leni drehte, sah er, dass ein leichtes Lächeln um ihren ausdrucksvollen Mund spielte. »Ich glaube, bis heute hat ihm noch nie jemand die Stirn geboten.«
»Sie meinen, außer Ihnen?«
Sie zog eine Schulter hoch. »Dwight Parrish jagt mir keine Angst ein.«
Knox verzog das Gesicht, als er den Namen hörte. Parrish. Kein Wunder, dass der arrogante Mistkerl sich aufführte, als gehörte ihm die Stadt. »Was ist mit seinem Bruder? Travis. Jagt der Ihnen Angst ein?«
Sie sah ihn einen Moment lang an, ehe sie den Blick senkte und den Kopf schüttelte. »Nichts, womit ich nicht fertigwerden könnte.«
»Sicher?«
Sie nickte. Als sie den Kopf wieder hob, lag ein sehr entschlossener Ausdruck auf ihrem Gesicht. »Ja, ich bin mir sicher.«
Er hatte da so seine Zweifel. Er wollte ihr gern noch mehr Fragen stellen. Fragen, über die er sich eigentlich keine Gedanken machen sollte, geschweige denn sie in Worte fassen. Je länger er mit ihr allein in dem leeren Diner stand, desto schwerer fiel es ihm, den schnellen Schlag ihres Pulses am Ansatz ihrer zarten Kehle zu ignorieren … oder das Verlangen, seinen Mund auf noch ganz andere Stellen ihres Körpers zu drücken.
Verdammt. Der erste Punkt auf seiner Tagesordnung, den er erledigen musste, wenn er zurück in der Zivilisation war, wäre, Nahrung zu sich zu nehmen und sich eine Frau zu besorgen. Denn das Verlangen, das ihn nach dieser faszinierenden, viel zu verführerischen Frau durchströmte, raste wie ein Buschbrand durch seinen Körper.
»Ich sollte jetzt gehen.«
»Okay. Und danke noch mal.«
Er neigte kurz den Kopf. »Machen Sie’s gut.«
Ihr warmes Lächeln schoss direkt in seine Brust. »Sie auch … äh, ich weiß noch nicht einmal, wie Sie heißen.«
»Knox.«
»Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen, Knox. Ich bin Lenora Calhoun. Die meisten nennen mich Leni.«
Sie reichte ihm die Hand. Er griff zögernd danach und wappnete sich gegen die Verbindung.
Nicht nur wegen des Verlangens, das bereits durch seinen Körper schoss, sondern auch weil er, wenn er sie berührte, Dinge über sie erfahren würde, die er nicht wissen sollte.
Er würde von all ihren Sünden erfahren, weil seine einzigartige übersinnliche Fähigkeit sie ihm zuraunen würde.
Doch es ging kein Ruck des Widerwillens oder der Abscheu durch ihn. Da war nichts Widerwärtiges, das ihn wie schwarzes, fauliges Öl überschwemmte.
Sondern nur Lenis warmes, ehrliches Lächeln, als sie ihn anschaute.
Nur die Freundlichkeit ihrer intelligenten haselnussbraunen Augen.
»Passen Sie da draußen auf sich auf, Knox.«
Er lächelte belustigt angesichts ihrer Sorge.
Von draußen hörte man das Aufheulen des Lasters, als Dwight Parrish aufs Gaspedal trat und auf die schneebedeckte Straße einbog.
Knox ließ Lenis Hand los und zog sich die Kapuze seines Parkas über den Kopf.
Dann trat er in die eisige Dunkelheit und ging dabei am Sheriff vorbei, als dieser in den Diner zurückkam.
Hundert Meilen – mehr oder weniger – lagen zwischen Knox und der kanadischen Grenze.
Vielleicht würde er etwas langsamer gehen.
Mehrere Stunden durch den Schneesturm zu stapfen, wäre vielleicht die einzige Möglichkeit, das unerwünschte Feuer, das in seinem Blut loderte, abzukühlen.
3
Leni stand hinter dem Tresen und starrte in das Schneegestöber und die Dunkelheit, die Knox verschluckten, als Sheriff Barstow wieder hereinkam.
Sie konnte den Blick nicht abwenden, und auf ihrer Brust lag ein solcher Druck, dass sie noch nicht einmal Luft holen konnte, bis schließlich nichts mehr von ihm zu sehen war.
Und selbst nachdem er fort war, erfüllte sie der seltsame Drang, ihm hinterherzulaufen und ihn zu bitten zu bleiben.
Oder ihn anzuflehen, sie mitzunehmen, egal, wohin sein Weg ihn führte.
Es schockierte sie, dass sie so etwas auch nur dachte.
Himmel, stand es wirklich so schlimm um sie, war sie so einsam, dass ein paar Minuten mit einem gut aussehenden Herumtreiber ausreichten, um sie in ein zitterndes Etwas zu verwandeln?
Die Antwort darauf wollte sie wahrscheinlich nicht hören. Und sie brauchte auch nicht nachzurechnen, wie lange es her war, dass sie mit einem Mann im Bett gelegen hatte … oder einem, den sie mochte, so nahe gekommen war, dass es zum Kuss hätte kommen können.
Sie brauchte nur den sechs Jahre alten Riley anzuschauen, um sich an die Dauer ihrer selbst auferlegten Abstinenz zu erinnern. Das hieß allerdings nicht, dass sie viele Erfahrungen gesammelt hätte, bevor der süße, kleine Knirps in ihr Leben geschneit war und sich seitdem für sie alles um ihn drehte.
Leni hatte ihn zwar nicht selbst zur Welt gebracht, doch Riley gehörte trotzdem ganz und gar zu ihr. Er war das Einzige, was sie an Familie noch hatte, nachdem ihre ältere, immer schon schwierige Halbschwester nur wenige Monate nach der Geburt ihres Sohnes die Stadt Knall auf Fall verlassen hatte.
Leni bedauerte nicht eine Sekunde lang die Gegenwart des ihr so kostbaren Neffen oder grämte sich wegen der Verantwortung, ihm ein behütetes, glückliches und sicheres Leben bieten zu wollen. Nie würde sie ihn fortwünschen, aber manchmal sehnte sie sich doch nach mehr.
War sie schlecht, weil sie sich hin und wieder weiblich und verführerisch fühlen wollte? Lebendig … so wie unter dem beunruhigenden, durchdringenden Blick aus Knox’ strahlend blauen Augen.
Doch das würde nicht passieren. Nicht in einer Million Jahre. Das Einzige, was noch schlimmer war als zu meinen, sie könnte ihr Herz – oder ihren Körper – einem Mann in Parrish Falls oder aus einem Umkreis von hundert Meilen anvertrauen, war, sich mit einem Mann einzulassen, der nur auf der Durchreise war. Insbesondere, wenn es sich bei diesem ausgerechnet um einen Stammesvampir handelte.
Knox war die gefährlichste Sorte Mann, nach der sie sich sehnen konnte, und das nicht nur wegen der Bedrohlichkeit, die er ausstrahlte. Er brauchte sie nur einmal nackt zu sehen, um sofort zu erkennen, dass auch sie keine Normalsterbliche war.
Aber wahrscheinlich brauchte es noch nicht einmal so weit zu kommen. Denn obwohl das kleine Mal aus Träne und Halbmond, das sie auf dem Bauch trug, heute unter ihrem Flanellhemd und der Thermounterwäsche verborgen war, gab es andere Dinge, die sie bei einem wie Knox schnell verraten würden.
Da waren auch der ganz eigene Geruch ihres Blutes und ihre einzigartige Gabe als Stammesgefährtin, nach der ihr Verletzungen jeglicher Art nichts anhaben konnten.
Deshalb war es gut, dass er fort war.
Der Himmel wusste, dass sie auch so schon genug Probleme hatte.
Sheriff Barstow nahm seine Schlüssel und die Handschuhe vom Tresen, wo er sie vor dem Streit zwischen Dwight Parrish und Knox liegen gelassen hatte. Der behäbige Mann sah sie mit einem bedauernden Blick an, als er sich der Kasse näherte.
»Weißt du, das Beste für dich und den Jungen wäre, wenn du eine Möglichkeit fändest, mit den Parrishs deinen Frieden zu machen, Lenora.«
»Frieden machen?« Sie schnaubte kurz, als sie nach einem Tuch und einer Flasche mit Sprühreiniger griff und anfing, den Tresen abzuwischen. »Wie du dich bestimmt erinnerst, war ich nicht diejenige, die mit dem Krieg angefangen hat.«
»Mag sein. Aber willst du diejenige sein, die die Situation eskalieren lässt?«
Barstow strich sich mit einer Hand über die langen grauen Haare, die quer über seinem Kopf lagen, aber kaum mehr die kahle Stelle zu verdecken mochten. »Mir ist klar, dass du über Travis’ Heimkehr am Samstag nicht froh bist.«
»Das ist milde ausgedrückt«, brummte sie und schrubbte weiter verbissen die Kunststoffoberfläche. »Soll ich etwa froh sein, dass der Mann, der vor sieben Jahren wegen Körperverletzung an meiner Schwester ins Gefängnis gegangen ist, jetzt vorzeitig wegen guter Führung wieder herauskommt?«
»Er hat seine Strafe abgesessen, Lenora. Er fühlt sich schrecklich wegen der Sache mit Shannon, aber er sagte, dass ihre On-Off-Beziehung die ganze Zeit über explosiv war. Bei allem Respekt, aber deine Schwester war auch kein Engel. Sie war ein rebellisches Mädchen, das ständig in Schwierigkeiten steckte.«
»Erst nachdem sie sich mit Travis eingelassen hatte.«
»Sie hat in dem Jahr ständig Entziehungskuren gemacht, Leni.«
»Willst du tatsächlich rechtfertigen, was Travis getan hat, indem du Shannon die Schuld gibst? Auch wenn es keine Rolle mehr spielt, weiß ich, dass sie schon Monate, bevor er sie verprügelt hat, trocken war.«
Sheriff Barstow hob beide Hände. »Wie dem auch sei, aber laut Travis’ Zeugenaussage hatte Shannon ihn zuerst geschlagen. Er hatte Prellungen und Hautabschürfungen, die das bewiesen.«
»Ach ja? Prellungen und Hautabschürfungen. Dass ich nicht lache, Amos«, schnaubte Leni höhnisch. »Shannons Schädel wies an drei Stellen Frakturen auf. Er hatte sie so schlimm geschlagen, dass sie beinahe ihre Vorderzähne verloren hätte.«
Trotz alledem hatte ihre Schwester nicht Anzeige erstatten wollen. Und sie hätte es wahrscheinlich auch nicht getan, wäre bei der Untersuchung in der Notaufnahme, die wegen ihrer Schädelverletzungen veranlasst worden war, nicht herausgekommen, dass sie im zweiten Monat schwanger war. Das hatte Shannon dazu bewogen, ihre Angst vor Vergeltung durch Travis oder seine Familie zu überwinden, denn nun war es ihr nur noch um die Sicherheit ihres ungeborenen Kindes gegangen.
Jetzt lastete diese Verantwortung auf Leni.
»Ich bin Rileys gesetzlicher Vormund«, rief sie dem Sheriff in Erinnerung. »Solange meine Schwester nicht da ist, entscheide ich, was das Beste für ihren Sohn ist. Ich kann wohl nicht damit rechnen, dass du dafür sorgt, dass der Mann nicht in die Nähe von Riley kommt.«
Der verlegene Ausdruck auf dem Gesicht des Sheriffs war Antwort genug. »Travis Parrish kommt als freier Mann nach Hause, Leni. Solange er auf der richtigen Seite des Gesetzes bleibt, kann ich ihn nicht daran hindern zu gehen, wohin er will.«
»Du meinst wohl eher, du wirst ihn nicht daran hindern.«
Es war gemeinhin bekannt, dass Amos Barstows Loyalität gegenüber den Parrishs schon weit in die Vergangenheit zurückreichte. Sein Vater war bis zu seinem Tod vor zehn Jahren einer der engsten Freunde des alten Enoch Parrish gewesen. Deshalb war Amos auch heutzutage immer noch bereit, häufig ein Auge zuzudrücken, wenn es um den alten Mann und seine drei Söhne ging.
Sein Blick wurde sanfter, als er sie jetzt ansah. »Es tut mir leid, was mit deiner Schwester passiert ist, Lenora. Wirklich. Es tut mir leid, was sie dir aufgebürdet hat, als sie ihr Kind im Stich ließ und auf Nimmerwiedersehen verschwand. Es hätte nicht an dir hängen bleiben dürfen, sich um den ganzen Schlamassel zu kümmern.«
»Schlamassel?« Lenis Stimme wurde im gleichen Maß lauter, wie ihre Wut zunahm. »Riley ist kein Schlamassel, um den ich mich kümmere. Er ist keine Bürde. Und was meine Schwester angeht – sie hat ihr Kind nicht im Stich gelassen. So etwas würde sie nie tun. Ich weiß nicht, wo sie ist oder was sie dazu gebracht hat zu gehen … aber es war nicht ihre eigene Entscheidung. Eines Tages wird sie zurückkommen. Ich weiß, dass sie das tun wird.«
Der mitfühlende Blick des erfahrenen Polizisten sprach Bände. Es war nicht das erste Mal, dass Angehörige zur Ehrenrettung eines Familienmitglieds, das sich einfach so davongemacht hatte, in die Bresche sprangen. Sie konnte seinen Zweifel sehen. Er brauchte gar nicht auszusprechen, dass er überzeugt war, Shannon wäre für immer fortgegangen – oder vielleicht gar nicht mehr am Leben. Sein langes Schweigen machte das deutlich genug.
Leni hielt es nicht eine Sekunde länger aus.
»Drehst du bitte das Schild an der Tür um, wenn du gehst, Amos? Ich werde jetzt schließen.«
Davon abgesehen wartete Riley darauf, dass sie ihn bei ihrer besten Freundin abholte. Leni und er wohnten zwar in dem Haus hinter dem Diner, wo Shannon und sie aufgewachsen waren, aber unter der Woche nahm ihre Freundin Carla Hansen Riley mit zu sich nach Hause, wenn sie an der Grundschule, die Riley besuchte, mit Unterrichten fertig war.
Nach dem Streit mit Dwight Parrish und der Tatsache, dass Travis morgen nach Hause zurückkehren würde, musste sie jetzt einfach das liebe Gesicht ihres kleinen Neffen sehen und dafür sorgen, dass er gesund und munter dort untergebracht war, wo er hingehörte.
Sheriff Barstow zog den Reißverschluss seiner Jacke hoch und streifte die Handschuhe über. »Pass auf dich auf, wenn du heute Abend noch rausgehst, ja?«
Leni nickte kurz. »Gute Nacht, Sheriff.«
Sie putzte weiter und beobachtete, wie er ging. Er bog mit seinem SUV vom Parkplatz des Diners nach links ab, um in den Nachbarort zu fahren, in dem er lebte.
Ein paar Minuten später schloss Leni ab, schlüpfte in ihren schweren Caban aus Schurwolle, ohne ihn zuzuknöpfen, und stapfte dann zu ihrem alten roten Bronco. Sie befreite den Wagen von acht Stunden Schnee, der sich während ihrer Schicht darauf gesammelt hatte, dann stieg sie ein und stellte sowohl die Heizung als auch die Scheibenwischer auf die höchste Stufe. Während der Wagen warmlief, tippte sie Carlas Nummer in ihr Handy ein. »Ich habe gerade zugemacht und fahre gleich zu dir«, sagte sie, nachdem sie ihre Freundin begrüßt hatte. »Wie war er heute?«
»Ganz wunderbar … wie immer«, erwiderte Carla mit einem Lächeln in der Stimme. »Nach der Schule haben wir im Vordergarten Schneeengel gemacht und dann ein paar Stunden lang den Schneesturm online auf Wetterkarten beobachtet. Dabei haben wir eine Menge über die größten Schneestürme erfahren. Wusstest du, dass 1921 ein Rekordschneefall innerhalb von vierundzwanzig Stunden in Colorado gemessen wurde?«
Leni lachte. »Äh. Nee, kann nicht behaupten, dass ich das gewusst hätte.«
»Es waren genau einen Meter und zweiundneunzig Zentimeter, falls es dich interessieren sollte. Riley konnte nicht glauben, dass zwei Kinder seiner Größe aufeinandergestellt darunter begraben sein würden. Deshalb hab ich ein Maßband rausgeholt und es ihm gezeigt. Ich glaube, mittlerweile hat er alles in meinem Haus vermessen.«