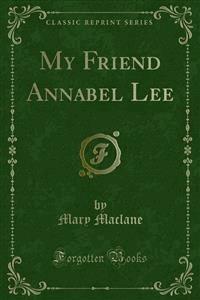9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Die 19-jährige Mary MacLane wünscht sich Napoleon oder am besten gleich den Teufel als Liebhaber. Sie träumt von einer Revolution, während sie mit ihren Mitmenschen in dem tristen Bergarbeiterstädtchen in Montana genauso wenig anfangen kann wie mit ihren häuslichen Pflichten und der kargen Landschaft. MacLane war völlig unbekannt, als sie 1902 ihr erstes, im Tagebuchstil verfasstes Buch veröffentlichte. Es wurde zum Skandal und seine Autorin zum Star. – Mit einer kompakten Biographie der Autorin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 261
Ähnliche
Mary MacLane
Ich erwarte die Ankunft des Teufels
Reclam
Das Werk erschien erstmals 1902 unter dem vom Verleger gewählten Titel The Story of Mary MacLane bei Herbert S. Stone & Co. in Chicago. Die Autorin hatte ihm den Titel I Await the Devil’s Coming gegeben.
2023 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH
Coverabbildung: The Newberry Library
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2023
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-961669-8
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-020647-8
www.reclam.de
Inhalt
Ich erwarte die Ankunft des Teufels
Anhang
Nachwort der Übersetzerin (von Ann Cotten)
There’s something about Mary (von Juliane Liebert)
Zeittafel
Ich erwarte die Ankunft des Teufels
Dem Teufel
mit den stahlgrauen Augen, der eines Tages
kommen mag – wer weiß? –
widme ich, mit der wahnwitzigen Liebe
eines jungen, müden, hölzernen Herzens,
dieses mein Buch.
Butte, Montana
November 1901
Butte, Montana13. Januar 1901
Ich, neunzehn Jahre alt und im weiblichen Geschlecht geboren, werde jetzt, so vollständig und ehrlich wie ich kann, eine Darstellung von mir selbst verfassen, Mary MacLane, die in der Welt nicht ihresgleichen kennt.
Davon bin ich überzeugt, denn ich bin ungewöhnlich.
Ich bin ausgesprochen originell, von Geburt an und in meiner Entwicklung.
Ich habe eine ganz ungewöhnliche Lebensintensität in mir.
Ich kann fühlen.
Ich habe eine wunderbare Fähigkeit zu Elend und zu Glück.
Ich bin gedanklich offen.
Ich bin ein Genie.
Ich bin eine Philosophin meiner eigenen guten peripatetischen Schule.
Mich kümmert weder Gut noch Böse – mein Gewissen ist gleich null.
Mein Gehirn ist ein Sammelgefäß energischer Vielfalt.
Ich habe einen wahrlich erstaunlichen Zustand elenden, krankhaften Unglücks erlangt.
Ich kenne mich, ach, sehr gut.
Ich habe einen wirklich seltenen Egoismus entwickelt.
Ich bin in die tiefen Schatten hineingegangen.
All das zusammen ergibt Seltsamkeit. Ich denke also, dass ich ziemlich, ziemlich seltsam bin.
Ich habe mich umgesehen, ob es auch nur die Andeutung einer Parallele zu den paar hundert Menschen gibt, die ich meine Bekannten nenne. Vergeblich. Es gibt Leute von unterschiedlicher Tiefe und charakterlicher Vertracktheit, aber niemanden, der sich mit mir vergleichen ließe. Die jungen Leute in meinem Alter – sofern ich ihnen auch nur einen kurzen Blick in die wahren Vorgänge meines Gehirns gewähre – starren mich in ihrer stumpfen Blödheit nur verständnislos an; und die Alten, die vierzig und fünfzig sind – vierzig und fünfzig sind alt, wenn man neunzehn ist –, können auch nur blöd starren, oder sie setzen mit der ihnen eigenen Engstirnigkeit ihr kleines, teuflisches, überlegenes Lächeln auf, das sie für ahnungslose junge Menschen bereithalten. – Diese völlige Idiotie von Vierzig- und Fünfzigjährigen manchmal! –
Das sind sicherlich Extremfälle. Es gibt unter meinen jungen Bekannten auch welche, die nicht blöd starren, und ja, sogar mit vierzig und fünfzig gibt es ein paar, die die eine oder andere Phase meines komplizierten Charakters verstehen, auch wenn niemand ihn in seiner Ganzheit begreift.
Allerdings finde ich, wie gesagt, nicht einmal annähernd eine Entsprechung unter ihnen.
In diesem Moment denke ich an zwei berühmte Köpfe aus der literarischen Welt, die mit dem meinen gewisse feine Gemeinsamkeiten haben. Es sind die von Lord Byron und Marie Bashkirtseff. Im Byron des Don Juan finde ich mich selbst angedeutet. In diesem erhabenen Erguss werden nur wenige die Figur Don Juan bewundern, alle aber müssen Byron verehren. Man muss ihn wirklich bewundern. Er enthüllte und entblößte seine Seele, diese Mischung aus Gut und Böse – wie man so sagt –, damit die Welt sie betrachten konnte. Er kannte die menschliche Rasse. Und er kannte sich selbst.
Was diese seltsame Berühmtheit anbelangt, Marie Bashkirtseff: Ja, ich ähnele ihr in manchen Punkten, hat man mir gesagt. Aber in den meisten gehe ich über sie hinaus.
Wo sie tiefgründig ist, bin ich tiefgründiger.
Wo sie wunderbar leidenschaftlich ist, bin ich noch viel leidenschaftlicher.
Wo sie philosophisch ist, bin ich eine Philosophin.
Wo sie erstaunliche Eitelkeit und Einbildung besaß, bin ich noch eitler und eingebildeter.
Aber, ganz ehrlich, sie konnte gut malen – und ich – was kann ich?
Sie hatte ein wunderschönes Gesicht, und ich bin ein bedeutungsloses kleines Tier mit unauffälligen Zügen.
Sie war umringt von bewundernden, mitfühlenden Freunden, und ich bin allein – allein, obwohl es vor Leuten wimmelt.
Sie war ein Genie, doch ich bin noch viel mehr ein Genie.
Sie litt mit dem Schmerz einer Frau, die jung ist, und ich leide mit dem Schmerz einer Frau, die jung und ganz allein ist.
Und so ist es.
In mancherlei Hinsicht habe ich den Rand der Welt erreicht. Noch ein Schritt und ich falle hinunter. Ich mache den Schritt nicht. Ich stehe am Rand, und ich leide.
Nichts, ach, nichts auf der Welt kann so leiden wie eine Frau, die jung ist und völlig allein!
– Bevor ich mit der Darstellung von Mary MacLanes Persönlichkeit fortfahre, will ich etwas von ihrem uninteressanten Werdegang herunterschreiben.
Ich wurde 1881 in Winnipeg in Kanada geboren. – Ob Winnipeg noch einmal auf diese Tatsache stolz sein wird, ist eine Frage, die mir Anlass zu einiger Spekulation und Nervosität gibt. – Als ich vier Jahre alt war, wurde ich mit meiner Familie in eine kleine Stadt im Westen Minnesotas gebracht, wo ich, bis ich zehn wurde, ein mehr oder weniger nichtssagendes und einsames Leben führte. Dann kamen wir nach Montana.
Dort ging das Leben genauso weiter.
Mein Vater starb, als ich acht war.
Er ernährte mich und kleidete mich und schickte mich in die Schule – nicht mehr, als mir zusteht – und übertrug auf mich den Erbcharakter und das Blut der MacLanes, aber ich wüsste nicht, dass er mir je einen einzigen Gedanken schenkte.
Auf jeden Fall liebte er mich nicht, denn er war unfähig, irgendwen außer sich selbst zu lieben. Und da nichts in dieser Welt von Bedeutung ist, wenn die Menschen einander nicht lieben, ist es mir im höchsten Grade gleichgültig, ob mein Vater, Jim MacLane, selbstsüchtigen Eingedenkens, lebte oder starb.
Er ist mir nichts.
Auf dieser Welt sind mir noch gegeben: eine Mutter, eine Schwester und zwei Brüder.
Sie bedeuten mir auch nichts.
Sie verstehen mich nicht, sie scheinen mich als eine Art lebende Kuriosität zu betrachten.
Mich durchströmt in besonderer Weise das Blut der MacLanes, das aus dem schottischen Hochland stammt. Meine Schwester und meine Brüder haben die Züge der Familie ihrer Mutter aus dem schottischen Tiefland geerbt. Schon dieser Unterschied kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Davon abgesehen unterscheiden sich die MacLanes – diese speziellen MacLanes – ein klein wenig von jeder Familie in Kanada, wie auch von jeder anderen, die ich kennengelernt habe. Sie hat Fanatiker aller Art hervorgebracht – religiöse, soziale, was weiß ich. Und ich bin eine echte MacLane.
Zwischen meiner unmittelbaren Familie und mir herrscht nicht das kleinste bisschen Sympathie. Es wird auch niemals dazu kommen.
Meine Mutter, die die gesamten neunzehn Jahre mit mir verbracht hat, hat ein vollkommen verzerrtes Bild von meiner Natur und meinen Wünschen, falls sie sich überhaupt eine Vorstellung davon macht.
Wenn ich an die köstliche Liebe und zärtliche Sympathie denke, die zwischen einer Mutter und einer Tochter möglich wären, fühle ich mich um eine wunderschöne Sache betrogen, auf die ich ein Anrecht gehabt hätte, in einer Welt, wo es für mich wenige solcher Dinge gibt.
Es wird immer so sein.
Meine Schwester und meine Brüder interessieren sich nicht für mich, meine Analysen und meine Philosophie, auch nicht für meine Wünsche. Ihre eigenen sind entschieden praktisch und materiell. Liebe und Sympathie zwischen Menschen sind in ihren Augen etwas für Romanfiguren.
Kurzum, sie sind Tieflandschotten, und ich bin eine MacLane.
Wie ich schon erwähnte, schleppte ich also mein uninteressantes Dasein nach Montana. Das Dasein wurde jedoch weniger uninteressant, als mein vielseitiger Geist sich zu entwickeln und zu wachsen begann und die glitzernden Dinge kennenlernte, die da in der Welt sind. Allerdings wurde mir im Lauf der Jahre bewusst, dass mein eigenes Leben bestenfalls eine flüchtige, negative Angelegenheit ist. All die Schätze, die ich begehrte, fehlten.
Ich schloss die höhere Schule ab mit sehr gutem Latein, gutem Französisch und Griechisch und einem Desinteresse an Geometrie und sonstiger Mathematik. Von Geschichte und Literatur habe ich eine grobe Ahnung. Ohne schulische Unterstützung habe ich mir eine peripatetische Philosophie angeeignet. Bei Schulabschluss besaß ich ferner: das Genie, das mir immer schon eignete; ein leeres Herz, das eine gewisse hölzerne Beschaffenheit angenommen hatte; einen ausgezeichneten, starken jungen Frauenkörper und eine erbärmlich ausgehungerte Seele.
Mit dieser Ausstattung bin ich durch die letzten zwei Jahre gegangen. Mein Leben, sei es auch unbefriedigend und verzerrt, ist jetzt nicht mehr langweilig. Ein bitteres Elend lastet darauf – das Elend des Nichts.
Nichts beschäftigt mich sonderlich. Ich schreibe jeden Tag. Schreiben ist eine Notwendigkeit – wie Essen. Ich mache ein wenig Hausarbeit, was ich im Großen und Ganzen sogar mag – zumindest manche Aufgaben. Ich staube ungern Stühle ab, aber ich habe nichts dagegen, Böden zu scheuern. Ja, viel von meiner Kraft und körperlichen Anmut kommt vom Scheuern von Küchenböden – ganz zu schweigen von einigen feinen philosophischen Gedankengängen. Es flößt dem Körper und dem Gehirn Energie ein.
Hauptsächlich aber wandere ich sehr weit übers offene Land. Butte und seine unmittelbare Umgebung bieten einen so scheußlichen Anblick, wie man es sich nur wünschen kann. Es ist tatsächlich so scheußlich, dass es als Annäherung an die vollkommene Scheußlichkeit gelten kann. Und alles, was vollkommen ist oder beinahe, sollte man nicht verachten. Ich bin auf einige verblüffend subtile Ideen gekommen, während ich viele Meilen über den Sand und das karge Land zwischen den kleinen Hügeln und Schluchten gegangen bin. Die vollkommene Ödnis inspiriert lange, lange Gedankengänge und das namenlose Verlangen. Jeden Tag gehe ich über den Sand und die Ödnis.
Also scheint mein tägliches Leben gewöhnlich genug zu sein, und möglicherweise kommt es einem gewöhnlichen Menschen sogar einigermaßen bequem vor.
Das mag sein.
Für mich ist es nur eine leere, verdammte Müdigkeit.
Ich stehe früh auf, esse drei Mahlzeiten und gehe spazieren; arbeite ein wenig, lese ein wenig, schreibe; treffe ein paar uninteressante Leute, gehe schlafen.
Am nächsten Tag stehe ich früh auf, esse drei Mahlzeiten und gehe spazieren; arbeite ein wenig, lese ein wenig, schreibe; treffe ein paar uninteressante Leute; gehe schlafen.
Wieder stehe ich früh auf, esse drei Mahlzeiten und gehe spazieren; arbeite ein wenig, lese ein wenig, schreibe; treffe ein paar uninteressante Leute; gehe schlafen.
Wahrlich ein erhabenes, seelenvolles Leben!
Was es mir gibt und wie es mich prägt, versuche ich jetzt zu schildern.
14. Januar
In mir trage ich den Keim eines intensiven Lebens. Wenn ich leben könnte, und wenn es mir gelingen könnte, mein Leben aufzuschreiben, würde die Welt seine schwere Intensität spüren.
Ich habe die Persönlichkeit, die Anlagen eines Napoleon, wenngleich in einer weiblichen Version. Daher erobere ich nicht; ich kämpfe nicht einmal. Ich schaffe es gerade einmal, zu existieren.
– Arme kleine Mary MacLane, – was könntest du nicht alles sein? Welch herrliche Taten könntest du vollbringen? Aber kleingehalten, halb begraben, ein Samenkorn, das auf unfruchtbaren Boden fiel, allein, unverstanden, unbekannt – arme kleine Mary MacLane! – Weine, Welt, – warum weinst du nicht? – für die arme kleine Mary MacLane.
Wäre ich als Mann geboren worden, hätte ich bereits einen tiefen Eindruck in der Welt hinterlassen – in irgendeinem Teil davon. Aber ich bin eine Frau, und Gott, oder der Teufel, oder das Schicksal, oder was es auch immer war, hat mir die dicke äußere Haut abgezogen und mich mitten ins Leben hineingeworfen – hat mich dort zurückgelassen als einsames, verdammtes Ding, gefüllt mit dem roten, roten Blut des Ehrgeizes und der Lust, das aber vor Berührungen Angst hat, denn zwischen meinem empfindlichen Fleisch und den Fingern der Welt ist keine dicke Haut.
Aber ich möchte berührt werden.
Napoleon war ein Mann, und wenn auch sein Fleisch fein empfand, war es sicher eingehüllt.
Aber ich bin eine Frau. Ich wache auf, und nachdem ich aufgewacht bin und mich umgesehen habe, möchte ich mich umdrehen und wieder einschlafen. Schmerz ist mit diesen Dingen verbunden, wenn man eine Frau ist, jung und völlig alleine.
– Mich erfüllt ein Ehrgeiz. Ich möchte der Welt eine nackte Darstellung von Mary MacLane geben: Ich zeige ihr hölzernes Herz, ihren guten jungen Frauenkörper, ihren Geist, ihre Seele.
Ich möchte schreiben, schreiben, schreiben!
Ich möchte diese schöne, gütige, zärtliche, erquickende Sache erlangen: Ruhm. Ich will ihn – oh, ich will ihn! Ich will all meine Unbekanntheit, mein Elend, – mein müdes Unglück für immer hinter mir lassen.
Ich bin meines Unglücks so zum Sterben müde.
Ich möchte, dass diese Schilderung veröffentlicht wird und in jenes tiefe, salzige Meer sticht, das die Welt ist. Es gibt dort sicher einige, die sie und mich verstehen werden.
Kann ich sein, was ich bin – kann ich ein seltsames, seltenes Genie besitzen und doch mein Leben verborgen in diesem ungehobelten, verzerrten Städtchen in Montana fristen?
Es ist doch unmöglich! Wenn ich glaubte, dass die Welt nichts anderes für mich bereithielte – ach, was täte ich! Würde ich mein trostloses kleines Leben jetzt beenden? Ich fürchte, ja. Ich bin Philosophin – und ein Feigling. Und es wäre unendlich viel besser, jetzt im schnellen Puls der Jugend zu sterben, als Jahr für Jahr, Jahr für Jahr sich weiterzuschleppen und sich schließlich als starre alte Frau wiederzufinden, lustlos, hoffnungslos, mit einem alternden Körper, einem nachlassenden Gehirn – und auf nichts zurückblicken zu können außer Visionen dessen, was möglich hätte sein können – und die Müdigkeit.
Ich sehe das Bild. Ich sehe es deutlich. Oh, gütiger Teufel, erlöse mich davon!
In einer Welt von so vielfältiger Schönheit muss es doch auch etwas für mich geben.
Und noch immer, solange ich jung bin, leuchtet mir diese trübe Funzel, die Zukunft. Aber ihr Licht ist in der Tat ein sehr, sehr trübes, und oft trügt es.
15. Januar
Nun denn. Ich befinde mich an diesem Punkt, als Frau von neunzehn Jahren. Ich bin ein Genie, eine Diebin, eine Lügnerin – eine moralische Vagabundin von Grund auf, mehr oder weniger eine Närrin und eine Philosophin der peripatetischen Schule. Ich finde auch, dass selbst diese Kombination niemanden glücklich machen kann. Sie reicht aber aus, um mein vielseitiges Denken zu beschäftigen, und dass ich mich weiterhin frage, was ein gütiger Teufel für mich auf Lager haben mag.
Eine Philosophin meiner eigenen peripatetischen Schule – Stunde um Stunde durchwandere ich die öde Wüste, die Trostlosigkeit zwischen den winzigen Hügeln und Schluchten am Rand dieser Bergbaustadt; am Morgen, am langen Nachmittag, in der Kühle der Nacht. Und Stunde um Stunde, während ich gehe, marschieren durch mein Gehirn lange, lange Prozessionen: die Prozession meiner Fantasien, die Prozession meines unnachahmlichen Egoismus, die Prozession meines Unglücks, die Prozession meines detaillierten Analysierens, die Prozession meiner eigentümlichen Philosophie, die Prozession meines öden, öden Lebens, – und die Prozession der Möglichkeiten.
Wir drei gehen hinaus auf den Sand, über die Ödnis: mein hölzernes Herz, mein guter junger Frauenkörper, meine Seele. Wir gehen dorthin und betrachten reflektierend die lange, sandige Einöde, die rote, rote Linie am Himmel, wenn die Sonne untergeht, die kalten, düsteren Berge darunter, den Boden ohne Unkraut, ohne einen Grashalm, obwohl es ihre Jahreszeit wäre – der Schwefelrauch der Gießereien hat sie schon vor vielen Jahren vernichtet.
Dieser Sand und diese Ödnis sind also die Kulisse für meine Persönlichkeit.
16. Januar
Ich fühle mich etwa vierzig Jahre alt.
Aber ich weiß, dass mein Gefühl nicht das Gefühl ist, das man mit vierzig Jahren hat. Das hier sind die Gefühle elender, unglücklicher Jugend.
Jeden Tag wird mir die Atmosphäre eines Hauses unerträglich, also gehe ich jeden Tag hinaus zum Sand und zur Ödnis. Es ist weder kalt noch mild. Es ist düster.
Ich sitze zwei Stunden lang neben einem erbärmlich kleinen, schmalen Wasserlauf auf dem Boden. Er ist nicht einmal ein natürlicher Bach. Ich vermute, dass er aus irgendeinem Bergwerk in den Hügeln kommt. Aber es ist schon gut, dass der Bach kein natürlicher ist – wenn man den Sand und die Ödnis betrachtet. Es ist eigentümlich passend.
Und ich passe auch eigentümlich dazu. Es ist gut, zu passen, mit etwas in Einklang zu sein, und wenn es bloß Sand und Ödnis sind.
Der Sand und die Ödnis sind alt – ach, sehr alt. Das fällt einem ein, wenn man sie anschaut.
Was täte ich, wenn die Erde aus Holz wäre, mit einem Himmel aus Papier!
Ich fühle mich etwa vierzig Jahre alt.
Und wieder sage ich, ich weiß, dass mein Gefühl nicht das ist, das man mit vierzig Jahren hat. Das hier sind die Gefühle elender, unglücklicher Jugend.
Noch erbärmlicher als der Sand und die Ödnis und der armselige künstliche Bach ist der trockene, verzerrte Friedhof, auf dem die trockenen, verzerrten Leute von Butte ihre toten Freunde begraben. Es ist mir ein Quell der Befriedigung, zu diesem Friedhof hinunterzusteigen und ihn zu betrachten und in seiner kompletten Erbärmlichkeit zu schwelgen.
»Er ist noch erbärmlicher als ich selbst und mein Sand und meine Ödnis und mein armer künstlicher Bach«, sage ich wieder und wieder, und das tröstet mich.
Sein Zustand ist noch desolater als der einer jungen Frau, die ganz alleine ist. Er ist ungepflegt. Er erstickt an Staub und Steinen. Die vereinzelten Grashalme sehen aus, als würden sie sich schämen, dort zu wachsen. Viele Grabmale sind aus Holz und beschämend verwittert. Die aus Stein sind noch schändlicher in ihrer gleißenden Härte.
Die trockenen, verzerrten Freunde der trockenen, verzerrten Leute von Butte sind in diesem staubigen, trostlosen, vom Wind verwüsteten Schutt begraben. Sie werden hier abgeladen und vergessen.
Der Teufel muss seine Freude an diesem Friedhof haben.
Und ich freue mich mit dem Teufel.
Es ist etwas, das ich betrachten kann, das noch erbärmlicher ist als ich selbst und mein Sand und meine Ödnis und mein künstlicher Bach.
Ich freue mich mit dem Teufel.
Die Bewohner dieses Friedhofs sind vergessen. Ich habe einmal zugesehen, als ein kleines Kind begraben wurde. Die nächsten zwei Wochen lang kam ich jeden Tag wieder und sah dort die Mutter des Kinds. Sie kam und stand neben dem neuen kleinen Grab. Ein paar Tage später kam sie nicht mehr.
Ich kannte die Frau und ging sie besuchen. Sie begann, das Kind zu vergessen. Sie begann, die Fäden ihres Lebens dort, wo sie sie fallengelassen hatte, wieder aufzunehmen. Die Fäden ihres Lebens sind verstrickt mit den Trennungen und Streitangelegenheiten ihrer Nachbarn.
Draußen auf dem verzerrten Friedhof ist ihr Kind vergessen. Und bald wird der Grabstein aus Holz beginnen zu verfaulen. Aber die Würmer werden ihren Teil nicht vergessen. Sie haben den kleinen Körper mittlerweile aufgefressen und es genossen. Sie genießen es immer, einen Körper zu fressen.
Und der Teufel freute sich auch.
Und ich freute mich mit dem Teufel.
Sie sind, ich bestehe darauf, noch erbärmlicher als ich selbst und mein Sand und meine Ödnis – die Mutter, deren Leben mit den Streitigkeiten und Trennungen verstrickt ist, und die Würmer, die am Kinderkörper fressen, und der hölzerne Grabstein, der bald verrotten wird.
Und so freuen sich der Teufel und ich.
Aber ganz gleich, wie furchterregend erbärmlich der vertrocknete Friedhof sein mag, der Sand und die Ödnis und der träge kleine Bach haben ihre eigene, zähe, individuelle Verdammnis. Wenigstens ist die Welt so geschaffen, dass ihre Schätze jeder auf eine andere Art verdammt sein können.
Ich fühle mich etwa vierzig Jahre alt.
Und ich weiß, dass mein Gefühl nicht das Gefühl ist, das man mit vierzig Jahren hat. Die Vierzigjährigen fühlen nichts von diesen Dingen. Mit vierzig ist das Feuer längst ausgebrannt. Wenn ich vierzig bin, werde ich auf mich selbst zurückblicken und auf meine Gefühle mit neunzehn – und ich werde lächeln.
Werde ich wirklich lächeln?
17. Januar
Wie gesagt, ich will Ruhm. Ich will schreiben – Dinge schreiben, die den bewundernden Zuspruch der ganzen Welt auf sich ziehen; Dinge, wie sie nur einmal in vielen Jahren geschrieben werden, die sich subtil, aber eindeutig von den Büchern unterscheiden, die jeden Tag geschrieben werden.
Ich kann das.
Lassen Sie mich nur anfangen, lassen Sie mich nur die Welt an einer empfindlichen Stelle treffen, und ich erobere sie im Sturm. Lassen Sie mich nur meine Sporen verdienen, und dann werden Sie mich sehen – weiblich, jung –, kühn auf einem Schlachtross, die Welt niederstürmend, der Ruhm auf den Fersen des Schlachtrosses, und die Menge wird staunen mit offenem Mund.
Aber ach, noch mehr als all das will ich glücklich sein!
Ruhm ist in der Tat gütig und zärtlich und befriedigend. Aber Glück ist eine zugleich zärtliche und alles auf der Welt überglänzende Sache.
Ich will Ruhm mehr, als ich aussprechen kann.
Aber noch mehr als Ruhm will ich Glück. In meinem müden jungen Leben bin ich noch nie glücklich gewesen. Man stelle sich vor, oh, man stelle sich nur vor, ein Jahr lang glücklich zu sein – einen Tag lang! Wie strahlend blau wäre der Himmel; wie schnell und fröhlich flössen die grünen Flüsse; in welch verrücktem, fröhlichem Triumph würden die vier Himmelswinde um die Ecken der schönen Erde fegen!
Was gäbe ich nicht für einen Tag, eine Stunde dieser verzauberten Sache, Glück! Was gäbe ich nicht dafür?
Wie wir eifrigen Idioten einander auf die Füße treten und an den Haaren reißen und einander die Gesichter zerkratzen, in unserem blindwütigen Galopp dem Glück hinterher. Manche finden es im Ruhm, manche im Geld, manche in der Macht, manche in der Tugend – und ich finde es in etwas, das der Liebe sehr ähnlich sieht.
Kein anderer Narr begehrt das Glück, wie ich es begehre. Für eine einzige Stunde Glück würde ich auf einen Schlag alles aufgeben: Ruhm und Geld und Macht und Tugend und Ehre und Rechtschaffenheit und Wahrheit und Logik und Philosophie und Genie. Und ich würde sagen: Was für ein kleiner, kleiner Preis für das teure Glück.
Ich bin bereit und warte darauf, alles, was ich habe, dem Teufel zu übergeben im Austausch gegen Glück. Ich bin so lang mit dem öden, öden Elend des Nichts gequält worden – meine gesamten neunzehn Jahre lang. Ich will glücklich sein – oh, ich möchte glücklich sein –
Der Teufel ist noch nicht gekommen. Aber ich weiß, dass er meistens kommt, und ich erwarte ihn voller Vorfreude.
Zum Glück bin ich nicht eine von jenen, die mit einem inwendigen Sinn für Tugend und Ehre belastet sind, denen sie immer vor dem Glück den Vorrang geben. Nur wenige finden ihr Glück in ihrer Tugend. Die meisten müssen sich damit abfinden, es davonspazieren zu sehen. Aber mir bedeuten Tugend und Ehre nichts.
Ich sehne mich unaussprechlich nach Glück.
Und so warte ich auf den Teufel.
18. Januar
Und in der Zwischenzeit – während ich warte – beschäftigt sich mein Denken mit seiner eigenen guten, seltsamen Philosophie, sodass sogar das Nichts beinahe erträglich wird.
Der Teufel hat mir das eine oder andere Gute mitgegeben – denn ich meine, dass der Teufel die Erde und alles, was darin ist, besitzt und beherrscht. Er hat mir unter anderem meinen bewunderungswürdigen jungen Frauenkörper gegeben, den ich durch und durch genieße und den ich leidenschaftlich gerne mag.
Zuckungen der Freude erfassen mich, wenn ich in irgendeinem bestimmten Moment an die robuste Gesundheit und Lebenskraft dieses herrlichen jungen Körpers denke, der in jeder Faser feminin ist.
Sie dürfen das Bild vorne in diesem Buch betrachten und bewundern. Es ist das Bild eines Genies – eines Genies mit einem guten, starken, jungen Frauenkörper, – und im Inneren des abgebildeten Körpers befindet sich eine Leber, eine MacLane-Leber, von bewundernswürdiger Perfektion.
Andere junge Frauen und ältere Frauen und Männer jeglichen Alters haben auch gute Körper, zweifellos – obwohl der männliche Körper mir nur Fleisch zu sein scheint, Fleisch und Knochen und sonst nichts. Aber wenigen ist der Wert ihrer Körper bewusst; wenige haben dessen Möglichkeiten erfasst, die künstlerische, graziöse Perfektion, die Poesie gesunden menschlichen Fleisches. Wenige sind auch nur vernünftig genug, ihr Fleisch gesund zu halten oder zu wissen, was Gesundheit überhaupt ist, bis sie irgendein lebenswichtiges Organ ruiniert und sie so auf immer verbannt haben.
Ich habe keines meiner Organe ruiniert, und ich habe einen Sinn dafür, was Gesundheit ist. Ich habe die Kunst, die Poesie meines feinen, femininen Körpers erfasst.
– Das mit neunzehn Jahren geschafft zu haben, empfinde ich als Triumph. –
Manchmal, mitten in einem hellen Oktober, bin ich meilenweit in der stillen Luft unter dem Blau des Himmels gegangen. Die Helligkeit des Tages und das Blau des Himmels und der unvergleichliche hohe Luftraum sind in meine Adern eingetreten und flossen durch mich in meinem roten Blut. Sie drangen in jedes entlegene Nervenzentrum und in mein Knochenmark.
In so einem Moment glüht dieser junge Körper vor Leben.
Mein rotes Blut fließt schnell und fröhlich – mitten in dem hellen Oktober.
Meine robuste, empfindliche Leber ruht sanft mit ihrer dünnen gelben Galle in süßer Zufriedenheit.
Mein ruhiger, schöner Magen singt lautlos, während ich gehe, ein Lied des Friedens, umgeben vom Glockengeläut, das mein Mittagessen war.
Meine Lungen, getränkt mit Bergluft und dem Parfum der Kiefern, weiten sich in unaufhörlicher Verzückung.
Mein Herz pocht wie die Musik von Schumann, in einem leichten, anmutigen Rhythmus mit einem mächtigen Grundton.
Selbst mein Darm räkelt sich zufrieden an seinem Platz wie eine Schlange im heißen Staub, mit den Vibrationen bewussten Lebens.
Meine starken und empfindlichen Nerven schnaufen und schwimmen in Sinnlichkeit wie trunkene kleine Bacchantinnen, übermütig und bekränzt in besinnungsloser Feier.
Der gesamte, wunderbare, elegante Mechanismus meines Frauenkörpers ist zur Zeit – wie auch der wunderbare, elegante Mechanismus meines weiblichen Gehirns – im Zauberbann eines Tages im Oktober.
»Es ist gut«, denke ich bei mir, »oh, wie gut es ist, am Leben zu sein! Es ist wunderbar gut, eine Frau zu sein, jung, in der Fülle von neunzehn Lenzen. Es ist unaussprechlich herrlich, ein gesundes junges Tier zu sein und auf dieser verzauberten Erde am Leben zu sein.«
Nachdem ich einige Stunden lang gegangen bin, komme ich in eine Gegend, in die der Schwefelrauch noch nicht vorgedrungen ist, und ich sitze am Boden mit hochgezogenen Knien und ruhe mich aus, während die Schatten länger werden. Die Schatten werden früh länger im Oktober.
Nach einer Zeit liege ich flach auf dem Rücken und strecke meine geschmeidige Schlankheit bis zum Äußersten, wie eine Berglöwin, die es sich gemütlich macht. Ich danke dem Teufel innig für meine zwei guten Beine, die mir unter einem kurzen Rock gute Dienste leisten, wenn sie mich, wie jetzt, weit über den Rand der Zivilisation hinaustragen, fort von den ermüdend dumpfen Leuten. Es gibt auf der Welt nichts, was einen so ermüden kann wie Menschen, Menschen, Menschen!
– Daher, Teufel, nehmen Sie bitte für meine zwei guten Beine meine aufrichtigste Dankbarkeit entgegen. –
Ich liege einige Minuten am Boden und hänge müßig meinen Gedanken nach. Eine ganze Welt leichter, träger, schöner Sinnlichkeit wohnt in der Gestalt einer jungen Frau, die unter einer warmen, untergehenden Sonne auf dem Boden liegt. Ein Mann mag am Boden liegen – aber das ist es auch schon. Ein Mann würde einschlafen, wahrscheinlich, wie ein Hund oder ein Schwein. Er würde vielleicht sogar schnarchen unter der sterbenden Sonne. Aber der Mann hat zum Fühlen ja auch keinen guten jungen weiblichen Körper, um die Kraft einer wärmenden sinkenden Sonne in sich aufzunehmen an solch einem Oktobertag. – Verzeihen wir ihm also das Schlafen, und das Schnarchen.
Als ich mich wieder aufsetze, hat sich die ganze Helligkeit im Westen konzentriert. Sie wirft einen gelben Schein über die Erde, einen Schein nicht von Glück oder Vergnügen oder Genuss, – sondern von Frieden.
Die jungen Pappeln lächeln sanft in der totenstillen Luft. Das Artemisiakraut und das hohe Gras umgibt eine strahlende Stille. Die hohen Hügel Montanas, nah und fern, wirken zugewandt und wohlwollend. Alles ist Friede – Friede. Ich denke an jenes schöne alte Lied –
Süßes Tal von Avoca! Wie ruhig wär’ ich
an deinem schattigen Busen –1
Aber ich bin noch zu jung, um an Frieden zu denken. Friede ist nicht, was ich will. Friede ist was für Vierzig- und Fünfzigjährige. Ich warte auf meine Erfahrung.
Ich erwarte die Ankunft des Teufels.
Und jetzt, kurz vor der Dämmerung, nachdem die Sonne über dem Kamm verschwunden ist, steht der rote, rote Streifen am Horizont.
Es wird wilde und stürmische Tage geben, voller Regen, Wind und Hagel; und doch fast immer bei Sonnenuntergang wird es ruhig und es erscheint die rote Linie des Himmels.
Es gibt auf der Welt nichts, das diesem roten Himmel bei Sonnenuntergang gleicht. Er ist Glorie, Triumph, Liebe, Ruhm!
Man stelle sich ein Leben vor, aller Dinge beraubt, ein Leben, auf das Finger zeigen und gehobene Augenbrauen deuten; gebeutelt, hin- und hergeworfen; zermalmt, geschlagen, ausgeblutet, auseinandergerissen, entrüstet, verkrampft vor Schmerz. Und dann, in diesem Leben, das noch jung ist, die rote, rote Linie des Himmels!
– Warum schrie ich auf gegen das Schicksal, sagt die Linie; warum lehnte ich mich gegen meine Leidenszeit auf? Nun freue ich mich vielmehr daran; jetzt in meinem Glück erinnere ich mich daran nur mit tiefem Vergnügen. –
Man denke an diesen wunderbaren, bewunderungswürdigsten, unvergleichlichen Mann aus Stahl, Napoleon Bonaparte. Er warf sich mit ganzem Gewicht auf die Welt, und die Welt war nie mehr dieselbe. Er hasste sich und die Welt, Gott und das Schicksal und den Teufel. Sein Hass war seine Leidenszeit.
Dann warf die Sonne für ihn eine rote, rote Linie an den Himmel – die rote Linie des Triumphs, der Ehre, des Ruhms!
Und danach kam die Schwärze der Nacht, die Schwärze, die nicht zärtlich ist, nicht freundlich.
Aber so schwarz unsere Nacht auch sein mag, nichts kann uns die Erinnerung an den roten, roten Himmel nehmen. »Erinnerung ist Besitz«, und so haben wir den roten Himmel immer bei uns.
O Teufel, Schicksal, Welt – wer auch immer, bringe mir meinen roten Himmel! Nur eine ganz kurze Zeit, und ich bin zufrieden. Bringe ihn mir, intensiv rot, voll, lebendig! So kurz wie du willst, aber rot, rot, rot!
Ich bin müde – müde, und oh, ich will meinen roten Himmel!
So kurz es auch wäre, die Erinnerung, der Duft würde für immer bei mir bleiben – für immer. Bring mir, Teufel, meine rote Himmelslinie für eine Stunde und nimm alles, alles, was ich besitze. Lass mich mein Glück eine Stunde lang behalten und nimm mir dann alles, für immer. Ich werde es zufrieden sein, wenn die Nacht gekommen ist und alles weg ist.
Oh, ich erwarte dich, Teufel, in wilder taumelnder Ungeduld!
Während ich durch die kühle Dunkelheit des Oktobers zurückeile, fühle ich diese Raserei in jeder Faser meines glühenden Frauenkörpers.
19. Januar
Ich stamme von einer langen Linie von MacLanes aus Schottland und Kanada ab. Es gibt einen Haufen MacLanes, aber meist wird in jeder Generation nur ein einziger echter MacLane geboren. Nur einer fühlt wieder den leidenschaftlichen Geist der Clans, jener barbarischen Bewohner des öden, aber geliebten schottischen Hochlands.
Ich bin die echte MacLane meiner Generation. Die echte MacLane ist in den letzten Jahrhunderten immer eine Frau gewesen. Die Männer in meiner Familie erreichen keine großen Höhen, nichts, was der Rede wert ist – bis auf den Zenit der Selbstsucht, den Höhepunkt des reinen Egoismus.
Das Leben ist vermutlich leichter für die unzähligen kanadischen MacLanes, die keine echten sind. Für die eine echte ist es aber mehr oder weniger ein Leidensberg. Sie ist ganz auf sich gestellt; sie findet sich ein wenig allein. Ich habe Brüder, eine Schwester und eine Mutter im selben Haus – und finde mich ein wenig allein. Zwischen ihnen und mir herrscht keine Zärtlichkeit, kein Mitgefühl, keine Verbindung. Angenommen, sie würden alle morgen sterben, würde es mich wohl im Geringsten angehen? Wäre ich keine echte MacLane, wäre es vielleicht anders, oder ich hätte diese Dinge gar nicht vermisst.
Wie viel, Teufel, habe ich verloren gegen den Vorzug, eine echte MacLane zu sein.
Aber – ja. Ich habe auch viel gewonnen.
20. Januar