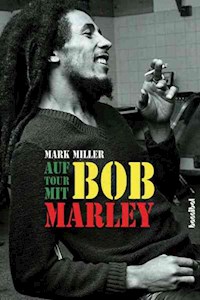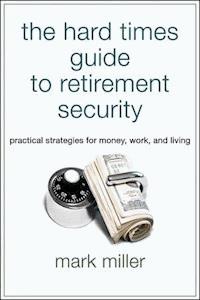14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein schrecklicher Unfall. Eine anonyme Botschaft. Eine neue Hoffnung – oder tödliche Gefahr? Seit sein kleiner Sohn kurz vor Weihnachten bei einem schweren Autounfall verstarb, lebt Tom alleine auf den Florida Keys. Mit Blick auf das weite Meer verbringt er seine Tage mit Schreiben. Als nebenan die attraktive ehemalige Polizistin Kate einzieht, knistert es augenblicklich zwischen den beiden. Gibt es Hoffnung auf ein zweites Glück für Tom? Da wird plötzlich sein Laptop gestohlen, auf dem sich sein Manuskript über den Unfall befindet. Und er erhält eine E-Mail: »Dein Sohn lebt!« Mithilfe von Kate macht sich Tom auf die Suche nach der Wahrheit und gerät in große Gefahr ... »Absolut fesselnd.« Paris Normandie – der neue Pageturner von Mark Miller für Fans von Charlotte Link und Guillaume Musso. »Atemberaubend und geheimnisvoll.« Le Dauphiné Libéré
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Text bei Büchern mit inhaltsrelevanten Abbildungen und Alternativtexten:
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman, gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Ich finde dich wieder« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Übersetzung aus dem Französischen von Anja Mehrmann
© XO Editions 2022
Titel der französischen Originalausgabe:
»Sur la route de Key West«, XO Editions, Paris 2022
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Dieses Werk wurde vermittelt durch die EDITIO DIALOG, Lille (www.editio-dialog.com).
Redaktion: Nadine Lipp
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: FinePic®, München; Carolyn Lagattuta/Stocksy
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Karte
Widmung
Zitate
Prolog
Staat New York, 23. Dezember 2017
Erster Teil
Die Florida Keys
1
Islamorada
2
Chris
3
Tom ruft den Arzt an
4
Kay und Randy
5
Raynard Wailand
6
Erstes Gewitter
7
Kay
8
Kilgore
9
Tom wird bestohlen
10
Befragungen
11
Ausflug aufs Meer
12
Tom wird in die Schranken gewiesen
13
Duval Street
14
Kay und Tom kommen einander näher
15
Trau niemandem
16
Raynard Wailand erhält einen Anruf
Zweiter Teil
Wahrheit oder Pflicht
17
Myers & Son
18
Tom dreht die Zeit zurück
19
Eine schwachsinnige Idee
20
Tom spielt den Unerschrockenen
21
Byron Woodruff
22
Randy hat was angepflanzt
23
Neuigkeiten von Byron
24
Hialeah
25
Santiago hat Angst
26
Wie der Neffe, so der Onkel
27
Kay bekommt Besuch
28
Auf einer Wolke
29
Der Augenblick der Wahrheit
30
Der Doktor lässt die Katze aus dem Sack
31
Willst du mir nun helfen oder nicht?
32
Die Mangrove
33
Raynard Wailand
Dritter Teil
Apocalypto
34
Everglades
35
Auftritt Eufemio Rojas
36
Auch wenn es nur ein Film ist
37
Frida Kahlo
38
Tom trifft eine Wahl
39
Glückstag
40
Robbie’s
41
Drogenschmuggler
42
Kilgore spielt Sandmännchen
43
Auftritt Randy
44
Das Boot
45
Rette sich, wer kann
46
Ich gehe
Epilog
Ein Ende, das keines ist
Playlist
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für Lisa
Leben heißt, den Tod eines Kindes zu überleben.
Jean Genet
Liebe ist immer noch das Beste, was jemals gegen Migräne erfunden wurde.
Aus: Zoë Gwendoline Mackenzie, Zoë muckt auf
Prolog
Staat New York, 23. Dezember 2017
Mein Name ist Tom Baldwin, ich bin Schriftsteller. Und Schriftsteller haben zu viel Fantasie. Dieser Meinung war jedenfalls Annabelle, meine Ex-Frau. Josh, mein wunderbarer kleiner Josh, pflegte hingegen zu sagen: »Dad erfindet Geschichten.«
Und mein geliebtes Kind hatte recht. Denn das tue ich im Grunde: Ich erfinde Geschichten. Die Geschichte, die ich euch jetzt erzählen werde, habe ich mir aber nicht ausgedacht. Obwohl es wünschenswert wäre … Sie beginnt am 23. Dezember in der Nähe von Philipstown im Staat New York. Am Abend dieses Tages ging die Welt unter … meine Welt jedenfalls.
Es war etwa 18:30 Uhr, wir kamen aus Fishkill und fuhren auf dem U. S. Highway 9 Richtung Süden. Josh saß auf der Rückbank und plapperte unaufhörlich vor sich hin, als ein orangefarbener Lkw vom Scheitelpunkt der Küstenstraße auf uns zukam.
Es war ein riesiger Oshkosh-Betonmischer mit vierzehn Rädern und Frontentladung – das erfuhr ich jedoch erst hinterher, da ich ihn nur von vorn gesehen hatte, und auch den Namen des Modells nahm ich erst beim Unterzeichnen der Unfallpapiere zur Kenntnis. Während er uns entgegenkam, hatte ich für einen Augenblick das Gefühl, dass der riesige Truck angesichts des dichten Schneefalls ein bisschen zu schnell unterwegs war.
Ich weiß noch, dass ich kurz beunruhigt war – womöglich eine Art Vorahnung –, aber nur für den Bruchteil einer Sekunde. Denn obwohl wir gerade erst losgefahren waren, hörte Josh nicht auf zu plappern und herumzuzappeln und nahm so einen Teil meiner Aufmerksamkeit in Anspruch. Joshs Mutter erwartete uns in North Haven, und es war schon klar, dass wir uns verspäteten, was sie mir garantiert vorwerfen würde. Auch wenn sie Weihnachten und den Jahreswechsel mit unserem Sohn verbringen durfte und nicht ich. So hatte es die Richterin entschieden.
»Das war echt super, Dad«, sagte Josh.
»Ja«, antwortete ich lächelnd. »Das war klasse.«
Josh erwiderte mein Lächeln, und mir wurde ganz warm ums Herz. Ihm zuliebe hatte ich den Garten in einen beleuchteten Mini-Vergnügungspark verwandelt (keine Sorge, nur LEDs), der von Rentieren bevölkert und mit einem blinkenden Schlitten und bunten Girlanden geschmückt war. Wir hatten Weihnachtslieder aufgelegt: Santa Claus is Coming to Town von The Crystals, White Christmas von Darlene Love, Frosty the Snowman von The Ronettes und so weiter.
»Glaubst du, Mom wird sauer sein, weil wir zu spät sind?«, fragte mich mein sechsjähriger gewitzter Sohn, der zu früh auf die Welt gekommen und dem Leben stets einen Schritt voraus war. Dabei betrachtete er mich mit seinen großen blauen Augen aufmerksam im Rückspiegel.
»Ach, es ist doch Weihnachten«, tat ich seine Bedenken etwas zu schnell ab. »An Weihnachten ist niemand sauer.«
»Niemand außer Mom«, antwortete er.
Niemand außer Mom … Wie recht er damit hatte … Wäre ich in Gedanken weniger mit den Bemerkungen meines Sohnes beschäftigt gewesen, hätte ich vielleicht anders gehandelt, aber es wäre grausam und ungerecht, ihm die Verantwortung für die folgenden Ereignisse zuzuschieben.
»Dad, das ist aber ein großer Laster!«, sagte er plötzlich.
Der gigantische Oshkosh war nur noch ungefähr dreihundert Meter von uns entfernt und hatte seine Geschwindigkeit keineswegs gedrosselt. Ich hingegen hatte verlangsamt, denn es schneite immer stärker, und der Asphalt war inzwischen von einer Schneeschicht bedeckt, in der allein die Reifenspuren noch sichtbar waren.
»Dad, der Film war echt lustig«, sagte Josh. »Hat er dir gefallen?«
»Ja, Buzz. Sehr. Und dir?«
Ich nannte ihn Buzz wegen Buzz Lightyear, der sprechenden Actionfigur aus den Toy-Story-Filmen, die wir uns schon unzählige Male angesehen hatten. Buzz ist der lustige Weltraumranger mit der Devise: »Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter!« Buzz war Joshs Lieblingsfigur.
Als der Lkw nur noch zweihundert Meter entfernt war, verlor der Toyota-Pick-up-Fahrer hinter uns die Geduld und beschloss, uns im Anstieg zu überholen. Angesichts des Schneegestöbers und des geringen Abstands zu dem entgegenkommenden Truck war das ziemlich riskant. Er zog kurz auf die Gegenfahrbahn, um die Entfernung abzuschätzen, dann trat er das Gaspedal durch. Als er ausscherte, betätigte der Lkw Lichthupe und Hupe. Der kraftvolle Klang durchriss die kalte Luft und klang wie ein wütendes: »Hey, Arschloch, was machst du da? Siehst du nicht, dass es schneit?« Ich bin mir sicher, dass der Fernfahrer in seiner mit Lichterketten weihnachtlich geschmückten Kabine herzhaft geflucht hat. Und dann erschauderte ich. Er wird es nicht schaffen.
»Dad, wenn ich groß bin, darf ich dann neben dir sitzen?«
Ich antwortete nicht, war viel zu sehr mit dem beschäftigt, was auf der Straße vor sich ging. Ich trat kräftig auf die Bremse und blickte wütend zu dem Fahrer auf der linken Seite hinüber. Jetzt befand er sich auf meiner Höhe, aber ich sah nur die Beifahrerin, eine Blondine, noch keine zwanzig, die meinen Blick Kaugummi kauend erwiderte und sich der Gefahr offenbar genauso wenig bewusst war wie ihr dämlicher Begleiter. Ich geriet in Panik.
»Dad, der Lastwagen, er fährt gleich in das Auto!«, rief Josh plötzlich, mein wunderbarer cleverer Josh, mit einem Anflug von Panik in der Stimme. Er hatte sich vorgebeugt und zerrte an seinem Sicherheitsgurt, um besser durch die Frontscheibe sehen zu können.
Aber es muss alles viel chaotischer abgelaufen sein, als mein Gedächtnis es wiedergibt. Mein analytischer Verstand zieht im Nachhinein die einzelnen Details heraus, eins nach dem anderen, wie ein Mikadospieler die Stäbe.
Er wird es nicht schaffen …
Allmählich verdichtete sich dieser Gedanke zur Gewissheit. Der Fernfahrer ließ mehrmals die Lichthupe durch die silbrig wirbelnden Schneeflocken aufblitzen, er betätigte auch erneut die Hupe, die ein zweites Mal heulte, ein ohrenbetäubender Lärm, der an meinen Nerven zerrte. Ich spannte jeden Muskel an, schloss die feuchten Handflächen fest um das Lenkrad, streckte die Arme aus und bemerkte nebenbei, dass Josh verstummt war. Mir schlug das Herz bis zum Hals, ich glaube, ich war schweißgebadet.
Na los, mach schon, jetzt überhol doch, du Arschloch! Der Vollidiot hätte den Fuß vom Gaspedal nehmen und zurückscheren können, aber nein, er musste es unbedingt durchziehen!
»Dad …«, stieß Josh entsetzt hervor.
Der Pick-up beschleunigte und überholte. In letzter Sekunde scherte er ein, gerade noch rechtzeitig, um nicht gegen die riesige Stoßstange des auf ihn zurasenden Lkws zu prallen, aber viel zu früh, um nicht mit uns zu kollidieren. Die rechte Seite seines Hecks streifte meinen Chevy vorne links, zwar nur leicht, aber es reichte, um uns von der Fahrbahn zu drängen und auf die Böschung zurasen zu lassen. Ich fluchte leise, spürte, wie wir die Bodenhaftung verloren, und klammerte mich mit aller Kraft ans Lenkrad. Josh schrie auf, als unser Wagen heftig schleudernd direkt auf die große Schneewehe am Straßenrand zuraste. Wir flogen darüber hinweg, überschlugen uns und landeten auf der anderen Seite des Hangs auf dem Wagendach.
Eine halbe Sekunde lang war es seltsam still. Die Zeit wirkte wie angehalten, schien zu schweben, während sich der Wagen wie in Zeitlupe drehte.
Darauf folgten ganz viele Geräusche – ein anhaltendes Quietschen, Knacken, Knirschen und das Zersplittern von Glas, als der tonnenschwere Chevy kopfüber landete, die Karosserie von allen Seiten eingedrückt wurde, die Fenster und die Windschutzscheibe zersprangen und der Airbag mich wie ein Fausthieb traf. Ich hörte Josh schreien, aber es klang, als wäre ich unter Wasser oder hätte Wachsstöpsel in den Ohren.
Dann das schreckliche hohle Kreischen von Blech, als die Vorderseite des Wagens gegen einen Baumstamm krachte und so stark eingedrückt wurde, dass sie sich förmlich darum wickelte. Auf einmal waren Joshs Schreie verstummt.
Stille …
Ein schrilles Pfeifen in meinen Ohren und das klickende Geräusch eines sich drehenden Rades, begleitet vom gleichmäßigen Plopp-plopp einer Flüssigkeit, die irgendwo heruntertropft. Ich atme die kalte Luft ein, die mir in der Lunge brennt; der Wind weht zu den zerborstenen Fenstern und zur Windschutzscheibe herein, nasse Schneeflocken fliegen herein. Ich habe Schmerzen in der Brust, in den Rippen und vor allem im Gesicht; der leere Airbag hängt schlaff zwischen mir und dem Armaturenbrett. Die Scheinwerfer und die Lichter im Inneren des Wagens sind erloschen, während das Radio seltsamerweise noch funktioniert, sodass Darlene in der nach allen Seiten offenen Fahrgastzelle noch immer Christmas (Baby Please Come Home) singt.
Und dann fällt es mir auf, erwischt mich eiskalt und erschreckt mich mehr als alles andere: die Stille hinter mir.
In der nächsten Sekunde verliere ich das Bewusstsein.
Ich werde weggebracht. Im Krankenwagen. Hin und wieder komme ich kurz zu mir. Wenn ich mich doch nur durch die Sauerstoffmaske hindurch verständlich machen und nach meinem Sohn fragen könnte! Offenbar versuche ich es, aber heute bin ich mir da nicht mehr so sicher, heute weiß ich gar nichts mehr mit Sicherheit. Außer dass Darlene Love in meinem Kopf seltsamerweise weiterhin Christmas sang. Dann das Koma. Volle sechs Tage außerhalb der Zeit, außerhalb der Welt.
Bis ich die schreckliche Wahrheit erfuhr.
Mein Ex-Schwiegervater überbrachte mir die Nachricht. Ihn als Überbringer schlechter Nachrichten zu bezeichnen, wäre in diesem Fall deutlich untertrieben. Der Vater meiner Ex-Frau heißt Raynard Lanier Wailand III., ist dreiundsiebzig Jahre alt und verwitwet. Er ist die personifizierte New Yorker Upper Class. Sehr intelligent, sehr gierig und über die Maßen Furcht einflößend. Hart in geschäftlichen Dingen, aggressiv im Umgang mit Menschen. Fordernd, einschüchternd, arrogant … und noch vieles mehr. Es gab Zeiten, als mir beim bloßen Anblick seiner weißen Mähne, seines Pferdegesichts und seiner blassblauen Augen das Blut in den Adern gefror. Es gab Zeiten, da hatte ich vor Annabelles Vater regelrecht Angst.
Aber das ist vorbei …
Raynard Wailand ist Geschäftsmann, Philanthrop, Mäzen und ein echter Scheißkerl. In New York gibt es keine Abendgesellschaft, keine Vernissage, keine Premiere, zu der er nicht eingeladen ist. Er ist von der Statur ein bisschen größer als ich, und aufgrund der Natur unserer Beziehung hat er sich dieses Vorteils während all der Zeit, in der wir miteinander zu tun hatten, bedient, um mich von oben herab zu behandeln und einzuschüchtern. An diesem Tag jedoch steht ihm der Sinn offensichtlich weder nach dem einen noch dem anderen.
Mein Ex-Schwiegervater hat Josh abgöttisch geliebt. Und diese Liebe zu seinem Enkel hat ihn dazu getrieben, sich weitaus mehr in unser Leben und vor allem in Joshs Erziehung einzumischen, als ich hinzunehmen bereit war. Wir hatten heftige Auseinandersetzungen deswegen, denn Raynard Wailand sprach mir immer wieder das Recht ab, in meiner Eigenschaft als Vater zu entscheiden, was für meinen Sohn das Beste war.
Soweit ich mich erinnere, hat sich Annabelle stets auf die Seite ihres Vaters geschlagen.
Doch als er an diesem Tag die Tür zu meinem Krankenzimmer öffnet, ist von dem arroganten, autoritären Mann, als den ich ihn kennengelernt habe, nichts zu sehen. Es ist ein in Halbdunkel getauchter kleiner Raum im Health Alliance Hospital in Kingston. Ausgestattet mit einem Krankenbett, einem Nachttisch, einem schmalen Fenster mit heruntergelassener Jalousie, das auf einen verschneiten Parkplatz hinausgeht, mit Monitoren und Apparaten, die dumpfe, regelmäßige Geräusche von sich geben. Friedlich. Beruhigend.
Raynard Wailands Gesichtsausdruck hingegen ist alles andere als friedlich. Er wirkt aufgelöst, verstört. Seine Augen sind rot geädert, so als hätte er gerade geweint. Was vermutlich auch stimmt. Mit zusammengebissenen Zähnen nähert er sich meinem Bett und blickt auf mich herab. In seinen Augen liegt eine derartige Verzweiflung, dass ich beschämt und verwirrt den Blick abwende.
Jetzt schluchzt er. Von Trauer geschüttelt, steht er mit baumelnden Armen da wie ein angeschlagener Boxer, und ich betrachte ihn mit grenzenloser Verwunderung. Nie zuvor habe ich Raynard Wailand weinen sehen. Noch erstaunlicher ist, dass er es in meiner Gegenwart tut, hemmungslos, ohne jeden Versuch, seine Tränen vor mir zu verstecken. Doch plötzlich starrt er mich mit einer Art irrer Wildheit an. Ich versuche, dem furchterregenden Blick seiner blauen Augen standzuhalten, muss aber schließlich doch wegsehen.
»Was ich dir jetzt sagen muss, fällt mir nicht leicht«, sagt er gedehnt, mit schmerzerfüllter Stimme und noch immer mit dieser hassverzerrten Miene, in die sich aber auch unendliche Trauer mischt. »Ich wünschte sehr, ich müsste es nicht tun. Eigentlich sollte Annabelle hier sein, aber sie hatte weder die Kraft noch Lust, dich zu … na ja, mit dir zu reden. Deshalb bin ich hier … du bist gerade aufgewacht, und ich bin es, der …«
Er verstummt, aber ich habe bereits verstanden. Am liebsten würde ich ihn anflehen, einfach zu schweigen, denn ich will den Rest nicht hören.
»Josh ist tot«, fährt er fort, so leise, dass ich ihn bitten muss, die Worte zu wiederholen.
Mit offenem Mund starre ich ihn an. Er hat noch immer feuchte Augen und einen wütenden Blick. Mir dagegen läuft nun eine Träne über die Wange, gefolgt von einer zweiten, dann einer dritten. Ich sage kein Wort. Und obwohl Raynard Wailand zweifellos gern verschwinden würde, bleibt er stehen und starrt mich wortlos an, ohne jede Spur von Mitgefühl, so als blickte er einem Mörder ins Gesicht. Schweigend weinen wir beide, vereint im Kummer, getrennt durch Hass.
»Du bist schuld an Joshs Tod«, fügt er schließlich hinzu.
Erster Teil
Die Florida Keys
1
Islamorada
When you’re on a golden sea,
you don’t need no memory.
Weezer, Island in the Sun
Die Florida Keys. Vielen gelten sie als das Paradies auf Erden. Für mich sind sie einfach ein Ort, an dem ich alles vergessen kann, auch wenn ich nicht wirklich vergesse.
Tatsächlich entspricht die Gegend genau dem, was man sich unter einem Garten Eden vorstellt. Eine Kette von über zweihundert kleinen und größeren Inseln, miteinander verbunden durch eine einzige Straße, den U. S. Highway 1, der sich wie ein zweihundert Kilometer langes Komma zwischen dem Golf von Mexiko und dem Atlantik tief im Süden von Florida erstreckt. Wenn ich morgens aufstehe, sehe ich hinter Palmen, die in der Meeresbrise rauschen, den Ozean. Außerhalb der Regenzeit scheint mit hoher Wahrscheinlichkeit die Sonne, und der Himmel ist wolkenlos blau. Fast das ganze Jahr über herrschen milde Temperaturen zwischen fünfundzwanzig und dreiunddreißig Grad, ausgenommen im schwülen, feuchten Sommer, der von Juni bis September dauert und von Tropenstürmen und Orkanen durchzogen ist.
Ausgerechnet auf einen dieser feuchten Tage fiel Joshs Geburtstag, er ist an einem 29. Juli geboren. Und natürlich ist dieser Tag neben seinem Todestag der schlimmste im ganzen Jahr für mich.
Aber zurück zu den Florida Keys. Vor einem Jahr hatte ich einem alternden, aus der Mode gekommenen Schauspieler sein Haus am Meer in Islamorada abgekauft. Er musste sich finanziell wieder ein bisschen auf Vordermann bringen, um seinen Lebensstil beibehalten zu können (immerhin blieben ihm noch ein Penthouse in New York und ein Haus in Pacific Palisades). Es war eine sehr schöne karibische Villa aus weiß gestrichenem Holz. Der umlaufende Balkon verfügte über eine ausgesprochen hübsche Brüstung und bildete die Überdachung der Säulenveranda zu ebener Erde. Umgeben von üppig blühender Vegetation, war das Haus durch einen riesigen, makellosen und mit Palmen bepflanzten Rasen vom Strand getrennt. Ein in jeder Hinsicht prachtvoller Ort. Und sündhaft teuer. Das Anwesen lag versteckt inmitten von Bäumen und in Achtung gebietendem Abstand zu den anderen Anwesen, deren Eigentümer stark auf Diskretion bedacht waren, da die Reichen und Berühmten hier (Gene Hackman wohnt ganz in der Nähe) gern selbst entscheiden, wann sie sich zeigen.
Das Ganze hat mich eine Menge Geld gekostet, aber es lief ziemlich gut für mich, jedenfalls auf der materiellen Seite.
Eines muss ich klarstellen: Als mein kleiner Josh noch lebte, träumte ich davon, ein neuer J. D. Salinger, Hemingway oder Jonathan Franzen zu werden. Ich wollte den großen Roman schreiben, der mich direkt in den Pantheon der amerikanischen Literatur befördern und mir den National Book Award, den Pulitzerpreis und den PEN/Faulkner Award bescheren würde – und den Nobelpreis mit fünfzig. Nicht mehr und nicht weniger. Meine Freizeit verbrachte ich ausschließlich damit, an der Verwirklichung dieses Traums zu werkeln, meiner Kathedrale aus Papier.
Nach dem Unfall verzichtete ich auf diese absurden – und für mich wohl unerreichbaren – Träume und schrieb innerhalb von neun Monaten kurz nacheinander drei Liebesromane. Sie waren das literarische Äquivalent zu den romantischen Komödien, die ich mir damals im Fernsehen anschaute, weil ich sonst nichts vertrug … vor allem keine Dramen, in denen Verkehrsunfälle und Kinder vorkamen.
Bei einer Abendgesellschaft der Wailands hatte ich einen Agenten kennengelernt, ein Typ aus Miami, dem ich meine Texte schickte. Mitten in einer windigen Novembernacht, in der der Ozean toste, rief er mich an, um mir mitzuteilen, dass er bis drei Uhr nachts wach geblieben sei, um mein Manuskript zu lesen. Die Missgeschicke von Zoë Gwendoline Mackenzie hätten ihn sowohl zum Lachen als auch zum Weinen gebracht, und er sei sich sicher, dass wir »mit diesem Stoff für gebrochene Herzen den Markt richtig aufmischen« würden.
»Wie meinst du das?«, fragte ich.
»Ich meine, dass hier ein Stoff vorliegt wie Brown Sugar, Ecstasy, Speedball oder Crack, mein Lieber … Glaub mir, nach der ersten Dosis Tom Baldwin werden sie alle mehr haben wollen.«
Am nächsten Morgen schickten wir die drei Manuskripte an Penguin Random House, Harper Collins, Simon & Schuster und Myers & Son.
Drei Wochen später erhielten wir die erste Antwort. Sie war positiv.
Einen Monat später antworteten auch die anderen drei Verlagshäuser. Alle ebenfalls positiv.
Nach weiteren zwei Wochen stellte uns Rosie Myers, Gründerin des Verlags Myers & Son, in ihren Büroräumen im One World Trade Center in Manhattan einen als Vorschuss getarnten Scheck über dreihunderttausend Dollar aus. Ich hatte nicht gewusst, dass so etwas in der Hyperkonkurrenz der Verlagswelt, in der es bald mehr Autoren und Verleger als Leser geben wird, überhaupt möglich war.
An meinem Kummer änderte das aber, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, nicht das Geringste. An diesem unendlichen Schmerz, der in jeden Winkel meiner Existenz vorgedrungen war. Der es mir zeitweise unmöglich machte, die kleinsten Aufgaben zu erledigen, der mich nichts anderes tun ließ als schreiben. Letzteres bescherte mir allerdings eine beachtliche Einkommensquelle, denn der erste und auch der zweite Roman waren durchschlagende Erfolge. Gleichzeitig war das Schreiben ein Mittel, meinen Geist beschäftigt und die Gespenster auf Abstand zu halten. Jedenfalls tagsüber. Nachts kamen immer die Albträume, die Weinkrämpfe und manchmal auch Selbstmordgedanken.
Aber ich habe die Prüfung bestanden, wie man so schön sagt. Und obwohl der Schmerz auch nach drei Jahren noch da war, konnte ich ihn zumeist doch besänftigen, ihn sozusagen auf Zimmerlautstärke stellen, wenn ich schon nicht in der Lage war, ihn zum Schweigen zu bringen.
Nur an Joshs Todestag und an seinem Geburtstag gelang es mir nicht. Diese Tage waren jedes Mal die Hölle.
Wie in den Jahren zuvor fing es am 29. Juli bereits in den frühen Morgenstunden an. Ich wachte weinend auf, war unfähig, mich zu beherrschen. Eine ganze Weile blieb ich niedergeschlagen im Bett liegen, wartete auf den Sonnenaufgang und dachte, wie gern ich in der Zeit zurückgehen, den Film zurückspulen, mich an jenem Abend nicht zu spät auf den Weg machen würde. Aber das Leben ist kein Film. Es gibt keinen zweiten Anlauf. Man muss stark sein, heißt es, muss dem Unglück stoisch begegnen. Das ist alles Unsinn. Erzählt mir nichts von Trauer, und erspart mir vor allem das Modewort »Resilienz«. Erzählt mir nichts von Vergessen und vom Vergehen der Zeit. Ich will nicht vergessen. Weint lieber. Weint aus tiefster Seele, weint, so viel ihr wollt. Es ist euer gutes Recht, zu weinen und zu leiden, denn das Leben tut weh, es hat scharfe Zähne, und früher oder später, das könnt ihr mir glauben, wird es euch auf die eine oder andere Weise für all die kleinen Glücksmomente bezahlen lassen, die es euch gewährt hat.
Und so schleppte ich mich an jenem Morgen in beigefarbenen kurzen Chinos und weißem T-Shirt in die Küche wie ein bedrücktes Kind.
Ich betätigte die Kaffeemühle und bereitete mir mit der Elektra-Kaffeemaschine einen Espresso zu – Kona-Kaffee aus Hawaii, ganze Bohnen. Durch die Fensterscheibe nahm ich den dunklen Himmel wahr, hinter den von Windböen geschüttelten Palmen lugte der graue Ozean hervor. Das Wetter passte zu meiner Stimmung. Nur die Seevögel schienen es zu genießen und ließen sich wie himmlische Surfer im Wind treiben. Insgeheim war ich froh darüber, dass das Wetter mir erlaubte, mich zu Hause einzuigeln und zu arbeiten.
Ich saß bereits an meinem Rechner – eine dicke Holzplatte aus Rohholz dient mir als Schreibtisch und steht am Fenster mit Blick auf den Ozean –, ich saß also am Schreibtisch und tippte den ersten Satz des fünften Bandes über Zoë Gwendoline Mackenzies sentimentale Missgeschicke (und selbstverständlich über ihre sexuellen Missgeschicke, seit Fifty Shades of Grey und After geht es immer auch um Sex): »Es geschah am Weihnachtsmorgen, als Zoë vor dem Tannenbaum kniete und Perrys Geschenk auspackte.« Genau in diesem Augenblick ertönte das Glockenspiel der Türklingel, ein paar ätherische Noten des Jazzpianisten Bill Evans.
Verflixt, Tucker!
Ich hatte vergessen, dass mein Kumpel Tucker Devine kommen würde, um mir zu helfen, den Zimmern in dem kleinen Gästehaus den letzten Anstrich zu verpassen, nachdem ich endlich beschlossen hatte, es zu vermieten. Allerdings war es seine Idee gewesen, nicht meine.
»Dann hast du ein bisschen Gesellschaft, es ist einfach jemand in der Nähe«, hatte er gesagt. »Die Leute wären weit genug weg, um dir nicht auf den Wecker zu gehen, aber nahe genug, damit du dich weniger allein fühlst.«
»Ich fühle mich nicht allein.«
»Lügner. Und außerdem, wer weiß? Vielleicht vermietest du es an eine hübsche junge Frau, die dich fragt, ob ihr euch nicht den Sonnenuntergang anschaut, bei einem Bierchen am Strand. Schon mal an so was gedacht?«
»Und wenn es ein Arschloch aus Miami ist, das sich an Bitcoin-Spekulationen bereichert hat und hier an jedem Wochenende die Puppen tanzen lassen will?«
Tucker hatte mit den Schultern gezuckt.
»Ich kenne dich, Tom Baldwin, du besitzt genug Menschenkenntnis, um ein mieses Arschloch zu erkennen, wenn du eins siehst. Außerdem bist du derjenige, der die Mieter aussucht, Mann, vergiss das nicht. Es ist eine Art Casting. Und du bist der Boss.«
Es war Tucker. Er lehnte an seinem Pick-up, einem Ford F-150, den er auf dem Sandweg geparkt hatte, und hielt trotz der morgendlichen Stunde eine Flasche Heineken in der Hand. Seine Cargoshorts hatten unzählige Taschen, und auf seinem T-Shirt stand: WER MICH ANFASST, IST TOT. Tucker Devine ist dreiundvierzig und ein leicht aufbrausender Typ. Er ist gedrungen, hat kurze Beine und den Kopf einer Bulldogge. Er trägt einen sehr schmalen Schnurrbart, und sein Blick wirkt leicht aggressiv. Wenn man ihn nicht kennt, wirkt er auf den ersten Blick vielleicht mürrisch oder sogar unangenehm, aber der Schein trügt. Tucker ist ein gutmütiger Typ und einer der Menschen, derentwegen ich mich hier sofort wohlgefühlt habe. Auf der Insel ist er der Einzige, der meine Geschichte kennt. Er betreibt das Blue Motel am Overseas Highway und organisiert gelegentlich Angelausflüge für Touristen, die Speerfische, Goldmakrelen und Tarpune fangen wollen. Islamorada ist die Welthauptstadt der Hochseefischerei. Nirgendwo gibt es mehr Fangschiffe pro Quadratkilometer.
»Legen wir gleich los?«, fragte er mich an jenem Morgen. »Oder muss ich wieder alles alleine machen?«
Die Sonne ging gerade unter, als ich das Schild mit der Aufschrift ZU VERMIETEN an die Fassade hängte. Zusätzlich hatte ich online je eine kleine Anzeige auf Realtor, Trulia und Zillow geschaltet. Die Palmen wogen sanft im Wind; zum Abend hin kam der Ozean ein wenig stärker in Bewegung.
Tucker reichte mir eine kalte Dose Dr. Pepper aus der Kühlbox. An seinem T-Shirt, den Armen, sogar an seinen Augenbrauen und am Schnurrbart klebte gelbe Farbe wie bei einem Hund, der die Schnauze gerade in ein Glas Mayonnaise gesteckt hat.
»Na also«, sagte er, »bald brennt hinter diesen Fenstern abends Licht, und du hast bezaubernde Nachbarn.«
»Oder schreckliche«, entgegnete ich.
»Tom Baldwin, der Optimist«, sagte er nur.
Ich dankte ihm für seine Hilfe, woraufhin er mir einen Schlag verpasste, der mir fast die Schulter ausrenkte. Dann stieg er in seinen Pick-up. Während er davonfuhr, drehte ich mich zum Gästehaus um. Wir hatten das Licht angelassen. Zum ersten Mal seit langer Zeit leuchteten die Fenster in dem sich niederlassenden abendlichen Grau. In der Ferne wirkte der hinter Wolken violett und orange schimmernde Himmel wie eine Film- oder Werbekulisse über dem Ozean … eine dieser tragbaren Wände, die entfernt werden, sobald die entsprechende Szene abgedreht ist.
Ich löschte sämtliche Lichter im Gästehaus, schloss die Tür ab und ging zu mir. Der Wind frischte weiter auf.
Zurück an meinem Schreibtisch, holte ich den Rechner aus dem Ruhezustand, und mein Textverarbeitungsprogramm zeigte mir sogleich die Seite an, an der ich zuletzt geschrieben hatte. Mechanisch beschloss ich, meine Mails zu checken, bevor ich mit der Arbeit fortfahren würde. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis sich die Mailbox öffnete und mein Blick auf die letzten E-Mails in meinem Posteingang fiel. Fast sofort blieb er an einer Nachricht hängen, deren Absendername aus einer Reihe von Buchstaben und Ziffern bestand. Der Betreff lautete:
JAHRESTAG
Kalter Schweiß trat mir auf die Stirn, ähnlich dem Kondenswasser auf meiner sehr kalten Limonadendose. Ich las den aus einem einzigen Satz bestehenden Text, der einschlug wie ein Blitz:
DEIN SOHN LEBT.
2
Chris
It’s one of those moments,
that’s got your name written all over it.
Cole Swindell, You Should Be Here
Wie betäubt starrte ich auf den Bildschirm. Meine Nackenhaare hatten sich aufgestellt, mein Herz schlug mir bis zum Hals. Ich zweifelte keinen Moment daran, dass es sich um einen üblen Scherz handelte. Aber wer erlaubte sich etwas derart Grausames? Warum tat mir jemand drei Jahre nach dem Unfall so etwas an?
Ich war verblüfft und wütend zugleich. Diese Nachricht beleidigte Joshs Andenken. Wer war so unverfroren, den Tod meines Kindes zu benutzen, um sich an mich heranzuschleichen? Ich hatte keine Ahnung. Ein Teil von mir wollte die Mail sofort in den Papierkorb verschieben, ihn leeren und sich dann um andere Dinge kümmern. Der andere, hartnäckigere Teil wollte wissen. Rasch tippte ich:
WER BIST DU?
Und schickte die Nachricht ab. Die Antwort kam postwendend. Oder vielmehr die Nichtantwort:
Mail Delivery Subsystem, [email protected]
Unknown user.
Natürlich, der Absender hatte eine Adresse angelegt, um diese Mail zu schreiben, und sie dann sofort wieder gelöscht. Aber die Frage lautete nach wie vor: Warum? Wer verspürte ausgerechnet an diesem schmerzlichen Tag das Bedürfnis, mich auf diese Art zu quälen? Für eine Sekunde dachte ich an meine Ex-Frau Annabelle, aber nein, das war absurd. Annabelle war nach Joshs Tod genauso am Boden zerstört gewesen wie ich. Wir hatten unsere Differenzen gehabt, und sie würde mich ewig hassen, weil ich ihrer Meinung nach die Schuld an seinem Tod trug, aber nur ein Psychopath konnte danach gieren, mich auf diese Weise zu bestrafen. Außerdem hatte ich seit drei Jahren nichts mehr von ihr gehört.
Raynard Wailand?
Nein. Nicht einmal er …
Es stimmt: Als seine einzige Tochter sich in einen mittellosen Literaturstudenten verliebt hatte, der von einer Karriere als Schriftsteller träumte, und erst recht, als sie ihm erlaubte, bei ihr einzuziehen und seine Tage mit Schreiben zu verbringen, während sie, schwanger von ihm, die Brötchen verdiente, hatte Raynard Wailand begonnen, diesen Eindringling zu hassen, der ihm seine Tochter gestohlen hatte. Und er hatte es mir bei jeder sich bietenden Gelegenheit gezeigt.
Ich erinnerte mich an zahllose Demütigungen, sarkastische Bemerkungen und erniedrigende Sticheleien, eine grausamer als die andere. War es Mobbing gewesen? Zweifellos. Es gab Zeiten, da gelang es ihm, mir jedes Selbstvertrauen zu nehmen, Zeiten, in denen ich nach und nach zu der Überzeugung kam, dass er recht hatte, dass ich ein Versager, ein Schmarotzer, ein Nichtsnutz war. Hatte ich seinetwegen mit dem Trinken angefangen? Möglich. Aber das war nicht der einzige Grund. Was ich schrieb, war nicht gut, meine Beziehung mit seiner Tochter verschlechterte sich zusehends, der Tod meiner Mutter hatte mir stärker zugesetzt, als ich gedacht hätte. Okay, es macht keinen Sinn, nach Ausreden zu suchen. Ich war damals ein Trinker. Ein Säufer. Basta.
Doch obwohl mein Ex-Schwiegervater ein Scheißkerl ist und – wie mir von Anfang an klar war – eine sehr individuelle Form von Wahnsinn in sich trägt, liebte er Josh über alles. Niemals hätte er den Namen seines Enkels in den Schmutz gezogen, niemals hätte er an dessen Gedächtnis gerührt, nicht einmal, um mich zu verletzen. Sein Tod hatte ihn fast genauso zerrissen wie Annabelle und mich. Und er hat sich nie wirklich davon erholt. Ich bin mir sicher, dass der Krebs, der im Jahr darauf bei ihm diagnostiziert wurde, eine Folge dieser Tragödie war.
Also wer? Und plötzlich kam mir ein Gedanke. Oder vielmehr eine Hoffnung. Unsinnig. Wahnwitzig. Es war unmöglich, das wusste ich.
Ich musste mit jemandem darüber reden, hier und jetzt. Tucker konnte mir in diesem Fall nicht helfen. Tucker Devine ist ein aufrichtiger, direkter Typ, der keiner Fliege etwas zuleide tun würde. Ich dachte an jemand anderes, einen durchtriebeneren Typen, der mein Literaturagent und gleichzeitig mein Freund geworden war: Christophorous Georgiadis.
Die Fahrt von Miami nach Islamorada dauert normalerweise anderthalb Stunden … Allerdings kann die tatsächliche Dauer stark davon abweichen, und in der Rushhour werden leicht drei Stunden daraus. Genau einhundertdreiundzwanzig Kilometer liegen zwischen Chris’ Maisonettewohnung in Coral Gables und meinem Haus am Strand. Er hat die Entfernung selbst auf dem Tacho seines Porsche Cayenne abgelesen. So ist Chris, er zählt alles: Kilometer, Stunden, Minuten und vor allem Dollar.
Der Sohn von Onesimos und Kalliopi Georgiadis, die 1993 aus Thessaloniki gekommen waren, wuchs im Kreis der griechischen Community im County Broward nördlich von Miami auf. Aber Chris hat sich eigentlich nie als Grieche gefühlt. Er ist ein typischer heutiger Vierzigjähriger: Geschichte interessiert ihn nicht und Geografie noch weniger. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er Bücher mag, aber im Lesen von Verträgen ist er unübertroffen. Bevor er Literaturagent wurde, war er Anwalt für Unternehmensrecht.
Sobald ich den Motor seines Porsches hörte, stürmte ich nach draußen. Chris schlug bereits die Wagentür zu. Er trug eine Bundfaltenhose und eine sehr elegante Jacke aus weichem, beige meliertem Leinen zu einem weißen Baumwollhemd und einer getüpfelten Krawatte, alles schmeichelhaft in Szene gesetzt vom rötlichen Licht der Dämmerung. Chris liebt es, sich nach der Mode der Neunzigerjahre zu kleiden; er sieht aus wie eine Figur aus American Psycho. Wie üblich glänzten seine mit stark fixierendem Gel gestylten schwarzen Haare; er hat mandelförmige, sehr dunkle und funkelnde Augen und ein Schauspielergesicht, das eine Mischung aus Männlichkeit und nahezu weiblicher Verführungskraft ausstrahlt.
»Was ziehst du für ein Gesicht?«, fragte er, als er mich sah. »Du siehst aus, als wärst du einem Gespenst begegnet. Warum wolltest du nicht am Telefon darüber reden?«
»Weil ich einem Gespenst begegnet bin. Komm rein.«
Das tat er, und ich merkte, dass er sich bereits fragte, wie lange die Sache wohl dauern würde. Der Satz »Zeit ist Geld« wurde eigens für Chris erfunden.
»Verdammte Scheiße.« Das war sein einziger Kommentar, jedenfalls anfangs. Er starrte genauso entgeistert auf den Bildschirm wie ich ein paar Stunden zuvor. »Was ist das für ein Schwachsinn?«, fragte er.
»Eine anonyme Nachricht.«
Er schwieg einen Augenblick, dann platzte er heraus: »Von wegen anonym! Welcher Geisteskranke hat dir dieses Ding geschickt? Jetzt sag bloß nicht, du glaubst ihm.«
»Nein, natürlich nicht.«
Aber er hörte den leisen Zweifel in meiner Stimme.
»Tom, um Himmels willen! Hast du darauf geantwortet?«
»Die Adresse ist ungültig, sie wurde gelöscht.«
»Ach, das ist doch Bullshit! Glaub mir, da draußen gibt es jede Menge Bekloppte.«
Kopfschüttelnd lief er wie ein Löwe im Käfig in meinem mit Bücherwänden geschmückten Büro auf und ab. Über der Tür hing ein Schild, das verkündete: »Pause kannst du später machen, geh wieder an die Arbeit«. Ermahnungen dieser Art waren überall im Haus verteilt. In der Küche stand: »Such nach einer Idee«, im Wohnzimmer: »Mach den Fernseher aus und dich selbst an die Arbeit«, sogar über meinem Bett war zu lesen: »Schau lieber in deinen Rechner als an die Zimmerdecke«.
Chris rückte mechanisch seinen Krawattenknoten zurecht.
»Hast du eine Ahnung, wer dir das geschickt haben könnte?«
»Nicht die geringste.«
Draußen vor den Fenstern verfinsterte sich der Himmel, der Ozean nahm eine bedrohliche Färbung an, Hitzeblitze färbten den Horizont weiß. Gewitter kommen am Golf von Mexiko häufig vor, gerade im Sommer.
»Nicht mal dein beschissener Schwiegervater würde so etwas tun«, sagte Chris mit finsterer Miene.
»Ex-Schwiegervater«, stellte ich richtig. »Nein. Natürlich nicht. Raynard war ganz vernarrt in Josh.«
Chris wirkte ebenso ratlos wie ich.
»Drei Jahre später, das ergibt doch keinen Sinn«, sagte er. »Du solltest es der Polizei melden.«
»Eine anonyme Mail, in der jemand behauptet, dass Josh noch am Leben ist? Die Cops haben Wichtigeres zu tun.«
»Und warum rufst du ausgerechnet mich an?«
»Meine Güte, Chris, ich musste mit jemandem darüber reden, dem ich vertraue. Und dann wollte ich wissen, ob du glaubst, dass es auch nur den Hauch einer Chance gibt, dass … na ja, du weißt schon, was ich meine.«
Er starrte mich an. Und in seinen schwarzen Augen sah ich, dass er Mitleid mit mir hatte. Chris mag gierig sein, geizig und manipulativ, aber er ist auch mein Freund.
»Tom, ist das dein Ernst?«
Ich sah, dass er zögerte. Er atmete aus. Lange.