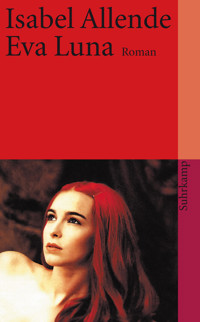Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Isabel Allende gilt als erfolgreichste Schriftstellerin Lateinamerikas. Inspiration für ihre Romane ist häufig ihr eigenes, turbulentes Leben. In Peru geboren, wuchs sie in Chile auf und erlebte 1973 den Militärputsch hautnah mit, bei dem sich ihr Onkel, der damalige Präsident Salvador Allende, das Leben nahm. Als linksgerichtete Journalistin und Frauenrechtlerin, die beispielsweise die feministische Zeitschrift Paula gegründet hatte, musste sie 1975 vor dem Pinochet-Regime nach Venezuela fliehen. Im Exil schrieb Allende ihren ersten Roman Das Geisterhaus, der sie über Nacht weltberühmt machte. Nach der Scheidung von ihrem ersten Mann emigrierte Allende in die USA, wo sie bis heute lebt. Vor einigen Jahren kündigte sie an, in Rente zu gehen – um dann zu bemerken, dass sie auf das Glück, das sie im Schreiben findet, nicht verzichten kann. Martin Scholz traf die Schriftstellerin mehrmals über zwei Jahrzehnte hinweg, meist in ihrem mit Bücherregalen vollgestopften Haus in Sausalito, Kalifornien. Neben ernsten Themen wie Allendes Flucht aus der Heimat geht es in den Gesprächen auch um die Ursprünge und den Wandel des Feminismus, die Besonderheiten der Liebe im Alter oder die Inspiration für ihr erotisches Kochbuch: Antonio Banderas, der ihr im Traum erschienen ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Isabel Allende
Ich habe tausend Geschichten in mir
Gespräche mit Martin Scholz
Kampa
VorwortAuf der Couch mit Isabel Allende
Fünfundzwanzig Jahre Interviews mit Isabel Allende oder: Wie es dazu kam, über ein Vierteljahrhundert hinweg mit der »Königin der lateinamerikanischen Literatur« im Austausch zu bleiben. Gesprächsmarathon über ein Leben, das mehr als einmal »stranger than fiction« war und es immer noch ist.
Isabel Allende sitzt neben uns auf einem Sofa mit weißen Polstern. Wobei: Sitzen trifft es nicht ganz. Man versinkt eher in oder zwischen den Polstern. Wir treffen uns in ihrem Arbeitshaus, wie sie es nennt, im kalifornischen Sausalito, direkt gegenüber von San Francisco auf der nördlichen Seite der Bay gelegen. Das holzverkleidete viktorianische Haus ist auch Sitz der nach ihr benannten Stiftung. Ihr Wohnhaus steht im etwa fünfzehn Kilometer nördlich gelegenen San Rafael. Allende trägt bei unserem Gespräch eine weinrote Bluse, dazu einen dunkelroten Rock. Ihre Beine hat sie seitlich angewinkelt und neben sich auf die Polster gezogen. Ihren Kopf stützt sie mit der rechten Hand, der Arm ist lässig auf das Rückenpolster gelehnt. Für ein Interview ist es eine ungewöhnliche, aber sehr entspannte Sitzhaltung. Es wirkt ein bisschen so, als habe sie uns eingeladen, mit ihr ihren Lieblingsfilm zu gucken oder einfach zwanglos bei einer Tasse Tee zu plaudern. In diesem Fall nimmt das Interview oft Züge eines, nennen wir es, locker-therapeutischen Sofa-Gesprächs an. Bei dem sie selbst jedoch immer wieder darauf achtet, dass es zu Perspektivwechseln kommt. Es ist keineswegs so, dass ausschließlich Isabel Allende diejenige ist, die über all jene Traumata, Brüche und Zeitenwenden in ihrem Leben spricht, die ihr immer wieder den Stoff für ihre Romane lieferten. Nein, sie dreht den Spieß gerne um, konfrontiert die Fragesteller mit Sätzen wie diesen: »Es kommt natürlich immer darauf an, auf was für einen Partner man steht, also: welchen Typ man gerne datet. Ich weiß ja nicht, wie ist das bei Ihnen?« Solche Volten kommen meist unverhofft, mal sind sie kokett, mal witzig, aber immer verblüffend.
In einem unserer Gespräche stellt sie eine besondere Gegenfrage: Nachdem sie zuvor weit ausgeholt, über die Bedeutung ihrer Träume gesprochen hat, hält sie plötzlich inne. »Langweile ich Sie? Dann müssen Sie mir das sagen und mich stoppen«, sagt sie und lacht, »denn ich möchte Sie auf gar keinen Fall langweilen.« Das ist in diesem Augenblick keine Koketterie, auch keine gespielte Unsicherheit. Es ist ein Satz, der uns in Erinnerung geblieben ist. Weil er zeigt, dass Isabel Allende so gar nichts Divenhaftes an sich hat. Was man vielleicht erwarten würde von der erfolgreichsten Schriftstellerin Lateinamerikas, von einer Starautorin, die mehr als 72 Millionen Bücher weltweit verkauft hat, die zudem als feministische Ikone gefeiert wird.
Trotzdem sind wir, als uns diese bereits zu Lebzeiten zur literarischen Legende stilisierte kleine Frau auf dem Sofa fragt, ob sie uns langweilen würde, erst mal perplex. Denn ihre Antworten und Schilderungen sind sehr vieles: temperamentvoll, überbordend, scharfsinnig, meinungsstark, bewegend, verstörend, leidenschaftlich, und sehr oft auf nahezu unanständige Weise brüllend komisch. Nur langweilig, das sind sie ganz und gar nicht.
Diese Gesprächsepisode zeigt auch, dass Journalisten stets darauf achten müssen, die nötige Distanz zu wahren, wenn sie Isabel Allende interviewen. Weil sie ein sehr für sich einnehmendes Wesen hat, und weil sie, wenn sie merkt, dass ihr Gegenüber vorbereitet ist, sehr gut darin ist, eine »Wir sind ja hier unter uns und können offen reden«-Atmosphäre entstehen zu lassen. So kann es passieren, dass sie einem bei den obligatorischen Interview-Beweisfotos schon mal beide Hände mütterlich auf die Schultern legt. Einfach so. Nicht ohne die Journalisten vorher gebeten zu haben, doch am besten auf einem Stuhl vor ihr Platz zu nehmen. Mit ihrer Körpergröße von 1,55 Metern muss sie kreativ sein, um auf Fotos so dastehen zu können, dass sie anderen die Hände auf die Schultern legen kann. Es wirkt dann wie ein Familien-Foto mit Matriarchin, wie ein Schnappschuss aus einer Saga. Und mit diesem Genre kennt sie sich aus.
Die elf Interviews in diesem Buch umfassen einen Zeitraum von fünfundzwanzig Jahren. Bei unserer ersten Begegnung 1999 in Sausalito war sie sechsundfünfzig, bei unserem vorerst letzten Interview im Frühjahr 2024 war sie einundachtzig Jahre alt. In diesem Vierteljahrhundert hat sie neunzehn Bücher veröffentlicht, fünf Präsidenten in ihrer Wahlheimat USA sowie eine Präsidentin und vier Präsidenten in ihrer alten Heimat Chile erlebt. Aus Chile musste sie 1975, zwei Jahre nach dem Pinochet-Putsch, nach Venezuela fliehen, Ende der achtziger Jahre zog sie nach Kalifornien, wo sie bis heute lebt und arbeitet und inzwischen auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt. Die Interviews aus fünfundzwanzig Jahren wirken wie Jahresringe, die um all die Leitmotive ihrer Literatur und ihres Lebens gewachsen sind. Jahresringe, die um Fragen nach Heimatverlust und Identität kreisen, nach starken Frauen, die sich gegen Machtmissbrauch und das Patriarchat stemmen, ganz gleich, ob ihre Kämpfe in der großen Welt der Politik oder im Mikrokosmos der Familie ausgetragen werden.
»Langweile ich Sie? Ich möchte Sie auf gar keinen Fall langweilen.« Aus all den Interviews mit ihr haben diese Sätze einen besonderen Nachhall. Nicht nur, weil sie eine gewisse Demut offenbaren und zeigen, dass Allende sich selbst, ihre Erfolge, das Erlebte und Erlittene nicht zu wichtig nimmt. Ihre Aussage ist auch in dem Sinne authentisch, weil sie darin, wie en passant, ihre vielleicht größte Sorge äußert – dass sie ihre Zuhörer und auch Leser langweilen könnte.
Dabei hat es Langeweile in ihrem Leben nur selten gegeben. Allende, als Tochter eines chilenischen Diplomaten in Peru geboren, hat inzwischen mehr Zeit ihres Lebens in ihrer Wahlheimat Kalifornien verbracht als in ihrer alten Heimat Chile. Bereits in jungen Jahren führte sie ein Leben zwischen den Welten, wuchs in Bolivien und im Libanon auf, wohin ihr Stiefvater, der ebenfalls Diplomat war, entsandt worden war. Nach ihrer Rückkehr nach Chile, wo sie ihren Schulabschluss machte, reiste sie später durch Europa, die Schweiz und Belgien, bevor sie, abermals zurück in Chile, als Journalistin Karriere machte. Sie war bereits verheiratet und Mutter zweier noch kleiner Kinder, als sie 1967 mit anderen Frauen die feministische Zeitschrift Paula gründete. Sie schrieb über Tabu-Themen wie Abtreibungen oder häusliche Gewalt. Erst viele Jahre später, in ihrem 2020 veröffentlichten Essayband Was wir Frauen wollen, schilderte sie, dass sie in jener Zeit einer Freundin in Chile bei einer verbotenen Abtreibung zur Seite stand. Allende half als Anästhesistin aus, unter schlimmen hygienischen Bedingungen, wie sie schrieb, im Anschluss habe sie sich übergeben müssen.
Später machte Allende im chilenischen Fernsehen Karriere, erlangte durch eigene humoristische Sendungen und Talkshows nationale Bekanntheit. Darüber hinaus schrieb sie satirische Kolumnen. Schon damals zeigte sich ihre Fähigkeit, sowohl über leichte wie auch schwere Themen schreiben und berichten zu können. Wobei sie es zu der Zeit noch nicht zu jener Meisterschaft brachte, die sie erst in späteren Jahren als Erzählerin auszeichnen sollte, als sie das eine mit dem anderen verband, mehr noch, als sie es schaffte, das Leichte schwer und das Schwere leicht zu machen.
Dass sie literarisches Potenzial hatte, machte ihr seinerzeit kein Geringerer als der chilenische Literaturnobelpreisträger Pablo Neruda klar – allerdings auf ziemlich ruppige und für Allende demütigende Art und Weise. Neruda kannte und schätzte Allende vor allem als Autorin ihrer manchmal aberwitzigen Kolumnen. Er wollte sie kennenlernen, lud sie ein. Allende fuhr in ihrem Citroën zu seinem Haus, in dem Glauben, der große Neruda würde ihr ein Interview geben. Das lehnte er jedoch brüsk ab – mit der Begründung, er schätze sie zwar als Kolumnistin, weil sie offenbar eine blühende Phantasie habe, als Journalistin aber finde er Allende lausig, und er verweigerte ihr das Interview. Neruda schickte sie mit leeren Händen, aber auch mit einem gut gemeinten Rat zurück in die Redaktion: Sie möge es doch mal mit Literatur probieren, das würde ihr mit ihrer Erfindungsgabe womöglich besser liegen.
Doch letztlich war es nicht Neruda, der sie zur Schriftstellerin machte – sondern der chilenische Diktator Augusto Pinochet. Am 11. September 1973 putschte er sich an die Macht und stürzte den sozialistischen Präsidenten Salvador Allende, der sich daraufhin das Leben nahm. Salvador Allende war der Cousin von Isabels Vater. (Er war nicht ihr Onkel, wie jahrelang fälschlicherweise geschrieben wurde. Die nicht korrekte familiäre Zuordnung mag auch damit zu erklären sein, dass Isabel Allende selbst mehrmals erzählt hatte, für ihre Familie und sie sei Salvador Allende wie ein Onkel gewesen. Dass die Tochter des Ex-Präsidenten genauso heißt wie die Schriftstellerin – Isabel Allende – sorgte zusätzlich für Verwirrung). 1970 gewählt, hatte Salvador Allende zunächst die Rechte der Arbeiter gestärkt, Chiles Kupferbergbau verstaatlicht sowie Großgrundbesitzer enteignet und mehr als sechs Millionen Hektar Land umverteilt. Darüber hinaus förderte er die Integration des indigenen Volks der Mapuche, sorgte dafür, dass Arztbesuche, Medikamente und Schulbücher künftig kostenlos waren. Seine politische Utopie von einem Leben in Würde und Gerechtigkeit für alle rief den Unmut von Industriellen, Großgrundbesitzern und Konservativen hervor, der sich schließlich in dem von den USA unterstützten Sturz Allendes entlud. Für Isabel Allende waren der Putsch und ihre Flucht vor der für sie persönlich bedrohlichen Situation aus Chile 1975 Kipppunkte, die sie als Schriftstellerin prägten wie kaum ein anderes Ereignis. In Caracas, wo sie dreizehn Jahre im Exil lebte, arbeitete sie als Journalistin, war aber gleichzeitig alleinerziehende Mutter ihrer beiden Kinder, weil ihr damaliger Ehemann als Ingenieur im Urwald arbeitete.
Als sie Anfang der achtziger Jahre erfuhr, dass ihr geliebter Großvater in Chile im Sterben lag, fing sie an, einen Brief an ihn zu schreiben. Er starb, bevor sie den Brief abschicken konnte. Der Brief wurde das Fundament ihres ersten Romans: Das Geisterhaus, eine Hommage an jenes düstere, alte Haus ihres Großvaters, in dem sie als Kind aufgewachsen war. Allende schuf kuriose Figuren, die mit Hilfe ihrer Gedanken die Tasten eines Klaviers anschlagen und mit den Geistern sprechen können. Sie erzählt zugleich die Geschichte vom Aufstieg und Fall einer patriarchalisch geprägten chilenischen Familie vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Sturz Salvador Allendes. Das Ziel der Erzählerin Alba ist zugleich ihr eigenes: »Das Gedächtnis wiederzufinden und mein eigenes Entsetzen zu überleben.« Mit ihrem Roman führte Allende den Feminismus in den magischen Realismus ein: In ihrer generationsübergreifenden Familiensaga sind es starke Frauen, die sich Unterdrückung und Machtmissbrauch widersetzen, es sind Frauen, die den Laden letztlich zusammenhalten.
Eine der einprägsamsten Rezensionen von Allendes Debüt schrieb Wolfram Schütte 1984, im Jahr des Erscheinens der deutschen Ausgabe, in der Frankfurter Rundschau. Er lobte den »ansteckenden Erotismus ihrer Prosa«, die unverkennbare erzählerische, darstellerische und kompositorische Verve der Autorin, die damals noch kaum bekannt war. Ebenfalls mit Verve verteidigte Schütte die Chilenin ausdrücklich gegen all jene Stimmen, die ihr vorwarfen, mit dem Geisterhaus lediglich ein Plagiat von García Márquez’ Erfolgsroman Hundert Jahre Einsamkeit verfasst zu haben. Das Geisterhaus, so Schütte, sei der »Roman einer Frau, aber kein Frauenroman«, sondern der Roman einer eloquenten und sinnlichen Erzählerin. Le Monde ernannte Allende nach dem Erfolg ihres Debüts gar zum »Echo einer Nation«, weil sie die Brutalität des Regimes schonungslos darstelle, zu einem Zeitpunkt, als ihr Buch in Chile noch verboten war. Mit fast vierzig war sie plötzlich ein Literaturstar – die populärste Chilenin der Welt und eine Art weibliche Antipode zu Pinochet.
Doch während ihre Bücher in den darauffolgenden vierzig Jahren regelmäßig die vorderen Plätze der internationalen Bestsellerlisten belegten, wurden sie von der Kritik zunehmend verrissen, mal mit sanftem Spott, mal mit Furor und Häme. Das Allende-Bashing wurde auch von ihren Kollegen wie dem 2003 verstorbenen chilenischen Schriftsteller Roberto Bolaño betrieben, der seinerzeit lästerte, Allendes Literatur gehöre zur Kategorie des schwachen Denkens. Andere Kritiker degradierten sie zur »Schreib-Arbeiterin« (Focus), die am Fließband Bücher von »triefender Seichtheit« schreibe, die keine Literatur, sondern nur Kommerz produziere. Ralph Hammerthaler krönte sie in der Süddeutschen Zeitung zur »Königin des Kitsches«, stempelte den Japanischen Liebhaber als Trivialliteratur ab und urteilte, das Beste, was man über diesen Roman sagen könne, sei, dass sie ihn »gnadenlos heruntererzählt«. Je länger Allendes Erfolg andauerte, umso ungestümer, maßloser wurden die Verrisse und Schmähungen. Nach der Lektüre des Romans Von Liebe und Schatten wollte die Rezensentin des Spiegel das Buch aus Wut an die Wand werfen, der ganze Text sei ein literarisches Schlachtfeld mit Heerscharen von Klischees, die Seite für Seite mobil gemacht würden. Regelrecht Schaum vor den Mund trieb es Kristina Maidt-Zinke in der Süddeutschen Zeitung, die vor allem jene scheinbar »untilgbare Aura des politisch Korrekten und künstlerisch irgendwie Relevanten« beklagte, die Allende ungeachtet der zunehmend verwechselbaren Geschichten nach wie vor umwehe. Ihre Frauenbewegtheit und ihre linksdemokratische Gesinnung würden als Qualitätsindikatoren gelten.
Es gibt wenige Autorinnen und Autoren von Weltrang, deren Werke seit vier Jahrzehnten Kritiker verlässlich derart auf die Zinne bringen, wie das bei den Büchern von Isabel Allende der Fall ist. Für einen Moment ist es amüsant, sich vorzustellen, was passieren würde, wenn sie die Frage »Langweile ich Sie? Ich möchte Sie auf keinen Fall langweilen« ihren erbittertsten Kritikern stellen würde. Auf die teils heftige Kritik haben wir sie in unseren Interviews mehrfach angesprochen. Und jedes Mal gab sie sich betont tiefenentspannt, blickte uns mit ihren großen dunklen Augen an und sagte, die Kritiker seien ihr egal, sie schreibe nicht für die Kritiker, sondern für ihre Leser. Davon abgesehen haben wir sie im Übrigen als durchaus selbstkritisch erlebt: Ihren frühen Roman Von Liebe und Schatten, eine Liebesgeschichte vor dem Hintergrund der Militärdiktatur in Chile, bezeichnet sie selbst als misslungen.
Bei all unseren Begegnungen redete sie meist wie ein Wasserfall, mit viel Temperament, in perfektem Englisch mit ihrem charmanten spanischen Akzent, den sie bis heute nicht abgelegt hat. Ausgehend von ihren jeweiligen aktuellen Romanen reflektierte und kommentierte sie stets die Zeiten, in denen sie entstanden waren: Von der Aufregung um Bill Clintons Sex-Skandal über Pinochets Verhaftung bis hin zu der bizarren Koinzidenz des Terroranschlags auf die USA am 9. September 2001 und dem Anschlag auf die chilenische Demokratie durch das putschende Militär an jenem anderen 11. September im Jahr 1973. In unseren Interviews kommentierte sie George W. Bushs »Krieg gegen den Terror« und Michelle Bachelets Wahl zur ersten Präsidentin Chiles. Und immer wieder sprach sie über ihre Erlebnisse als politischer Flüchtling in Venezuela und später als Einwanderin in den USA. Erfahrungen, die sie stets in den Kontext aktueller gesellschaftspolitischer Debatten stellte – wie jener über wachsende Zahlen politischer Flüchtlinge und illegaler Einwanderer an den Grenzen zur USA, in Europa und anderen Teilen der Welt.
Für sie selbst wurde der Heimatverlust ihr Lebensthema. Das Private war und ist bei Isabel Allende immer auch politisch. Und sie macht keinen Hehl daraus, dass ihr die persönlichen Traumata ihres Lebens das Rohmaterial für ihre Bücher liefern. Der Tod ihrer Tochter Paula, die mit neunundzwanzig an den Folgen einer seltenen Stoffwechselkrankheit starb, oder die an einer Drogenüberdosis verstorbenen Kinder ihres zweiten Ehemannes. Und, ja, auch die Geschichte von der ersten Ehefrau ihres Sohnes Nicolás, der Mutter ihrer drei Enkel, wird den Lesern nicht vorenthalten und in dem autobiografischen Buch Das Siegel der Tage beschrieben: Als die Schwiegertochter entdeckt, dass sie lesbisch ist, trennt diese sich von ihrem Mann, der sich in der Folge in Lori, die Freundin von Allendes Stiefsohn, verliebt. Lori wird später nicht nur Allendes Sohn Nicolás heiraten, sondern auch die Stiftung der Schriftstellerin leiten. Allende hat das Leben in ihrer sich ständig verändernden Patchwork-Familie mal mit einer Seifenoper verglichen. Deren Plots und Twists sind, zugegeben, nicht unbedingt Weltliteratur, aber spiegeln ein Leben, das manchmal »stranger than fiction« ist – das man sich so eigentlich nicht ausdenken kann. Und: Es ist definitiv nicht langweilig.
Aber in ihren großen literarischen Momenten, von denen es in ihrem Werk nicht wenige gibt, löst sie die Prophezeiung Pablo Nerudas immer wieder ein, der ihr einst empfahl, vom Journalismus zur Literatur zu wechseln, weil sie dort mit ihrer Fabulierkunst und überbordenden Vorstellungskraft besser aufgehoben sei. In solchen Momenten, in Büchern wie Fortunas Tochter, Mein erfundenes Land oder Dieser weite Weg ist Isabel Allende, diese wilde Empfindsame, mehr als nur eine Autorin, die ihrem Schicksal regelmäßig Bücher abtrotzt. Weil ihr darin der Balanceakt gelingt, feministische Pamphlete mit intelligenter Unterhaltung zu verbinden, und sie immer wieder auch große Literatur daraus formt. Diese besondere Kunst hat Wolfram Schütte bereits in seiner Kritik des Geisterhauses erkannt: »Es gibt im Geisterhaus Isabel Allendes am Ende langer Augenblicke des genusssüchtigsten Schmökerns bestürzende Momente der Scham – wenn nämlich der beängstigend vergegenwärtigte Terror der Militärjunta den Genuss zur Empörung verändert.«
Genusssucht, Schmökern, Scham und Empörung – das ist nicht die schlechteste Assoziationskette. Und keine, die Langeweile auslösen würde.
In unseren Interviews ist Isabel Allende immer in Bewegung geblieben. Doch von den vielen Themen, die sie beschäftigen, hat sich eines in den vergangenen Jahren zunehmend in den Vordergrund ihrer Geschichten geschoben: das Älterwerden. Bei unserem letzten Interview im Frühjahr 2024 trägt die einundachtzigjährige ihre Haare silbergrau. Sie erinnert damit ein bisschen an Meryl Streep in ihrer Paraderolle als dominante Chefredakteurin einer Modezeitschrift in dem Film Der Teufel trägt Prada. Ihre Gesichtshaut ist auffallend glatt, ihr Hals und ihre Hände sind faltiger. No big deal, nichts wofür sie sich entschuldigen oder rechtfertigen würde. Sie hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie sich liften ließ, und – natürlich – auch darüber geschrieben. Und sie hat ebenso klar zum Ausdruck gebracht, dass sie dem Älterwerden nichts Positives abgewinnen könne. Nur wäre sie nicht Isabel Allende, wenn sie nicht selbst jene Lebensphase des zunehmenden körperlichen Verfalls mit dem ihr eigenen Humor beschreiben würde. In ihrem Roman Ein unvergänglicher Sommer lässt sie ein Best-Ager-Paar Sex in einem Schlafsack haben. Im Interview spricht sie von der Lust im hohen Alter. Ob die Kunst das Leben imitiert, ob es sich umgekehrt verhält oder ob für sie beides irgendwie zutrifft – so genau vermag man das bei ihr nicht mehr zu sagen.
»Langweile ich Sie?«, hat sie uns gefragt. Was das große Ganze ihres Werkes betrifft, sind wir ihr die Antwort bislang schuldig geblieben. Nein, langweilig war sie nie. Und es ist alles andere als langweilig, jemanden über fünfundzwanzig Jahre hinweg in Gesprächen beim Älterwerden zu begleiten, mit ihm so offen darüber sprechen zu können, wie das bei Isabel Allende der Fall war.
Dass das Schreiben für sie wie ein Lebenselixier sei, hat sie nicht nur uns mehr als einmal versichert. Aber in ihrem Fall ist das keine Phrase. Ebenso wenig wie jener Satz, dass sie nur so lange weitermachen möchte, solange sie klar denken könne. Angst vor dem Tod habe sie keine. Aber sie wünsche sich, dass ihr der Zustand der Demenz erspart bleibe. Mit einem befreundeten Piloten, habe sie mal darüber gesprochen, dass sich beide bei drohender Demenz in ein Flugzeug setzen und einfach losfliegen würden. Weit raus über den Pazifik – so lange, bis ihnen der Treibstoff ausgeht und sie nicht mehr zurückkehren können. Absturz. Ende. Aus. Aber wie so oft bei ihren Geschichten gibt es auch bei dieser eine Pointe: Dummerweise hat man besagtem Freund, als er achtzig wurde, die Pilotenlizenz abgenommen. Es wird also nichts mit dem spektakulären letzten Flug. Aber vielleicht werden wir davon eines Tages lesen – in einem ihrer Romane.
»Ich habe das Recht zu versagen«
Sommer 1999, Sausalito, Kalifornien
An die Termiten in ihren Wänden hat sie sich fast schon gewöhnt, nicht aber an die anderen ungebetenen Gäste, die oft durch ihren Garten flanieren. Nun ist die Grünfläche vor ihrem Bürohaus im kalifornischen Sausalito auch so offen gestaltet, dass man sie mit einem kleinen Park verwechseln könnte. »Schon wieder eine«, seufzt Isabel Allende und wendet sich mit übertriebener Freundlichkeit an die ältere Dame, die gerade ihr Blumenbeet inspiziert: »Kann ich irgendwie helfen?«, fragt die Schriftstellerin schnippisch. Zu viel Offenheit hat auch Nachteile. Die US-chilenische Bestsellerautorin weiß das – nicht zuletzt deshalb, weil sie in früheren Interviews auch schon mal zu viel geredet habe. »Die Ironie geht in der gedruckten Version verloren, vor allem, wenn das, was ich auf Spanisch oder, wie jetzt mit Ihnen, auf Englisch rede, in andere Sprachen übersetzt wird. Da wird etwas, das ich ironisch gemeint habe, dann wörtlich und sehr ernst genommen«, sagt sie. »Das ist manchmal der Horror, wenn mir das dann zugetragen wird und ich mir sage: »Nicht zu fassen, ich klinge ja wie eine konservative Hexe.« Die »feministische Paperback-Ausgabe des lateinamerikanischen Chef-Erzählers Márquez« (Der Spiegel) kokettiert ein bisschen mit ihrer Strahlkraft im internationalen Literaturbetrieb. Siebzehn Jahre nach der Veröffentlichung ihres hochgelobten Debüts Das Geisterhaus ist die in den USA lebende Chilenin eine der meistgelesenen Autorinnen der Gegenwart. Dass viele ihrer späteren Romane von der Kritik als Trivialschinken tituliert wurden, konnte den Erfolg nicht schmälern.
In ihrem neuen Buch Fortunas Tochter ist die Schriftstellerin zu einem ihrer Lieblingssujets zurückgekehrt – der Emanzipation der Frauen. Sie beschreibt die Odyssee der jungen Chilenin Eliza Sommers, die im 19. Jahrhundert als blinder Passagier auf einem Schiff nach Kalifornien reist, auf der Suche nach ihrem treulosen Liebhaber. Sie erreicht San Francisco 1849, dem Jahr des Goldrausches. In Männerkleidung muss sie sich im Wilden Westen unter Goldsuchern, Banditen und Prostituierten behaupten. »Das Gold«, heißt es an einer Stelle, »hat das Schlimmste des amerikanischen Charakters ans Licht gebracht: die Gier und die Gewalt.« Der Roman hat Elemente einer Abenteuer- und Liebesgeschichte, erzählt aber in seinem Kern von einer Emanzipation, davon, wie sich die starke und unabhängige Eliza aus patriarchalischen und autoritären Strukturen befreit. Mehr als sieben Jahre hat Allende, mit Unterbrechungen, an diesem Roman gearbeitet. 1991 hatte sie erstmals die Idee, über den Goldrausch in ihrer Wahlheimat San Francisco zu schreiben. Kurz darauf erkrankte ihre Tochter Paula schwer an einer seltenen Stoffwechselstörung, lag ein Jahr im Koma. 1992 starb sie. Allende verarbeitete das Trauma in dem 1994 erschienenen autobiografischen Roman Paula, in dem sie sich mit dem Verlust auseinandersetzt. Erst nach der Veröffentlichung, erzählt sie, sei sie in eine tiefe Depression verfallen. Sie habe lange nicht schreiben können. Ihr 1997 erschienenes Buch Aphrodite, ein lebenslustiger Essay über Essen und Sex, sei eine Art Lockerungsübung gewesen, bevor sie die Idee zu ihrem Roman über den Goldrausch wieder aufnahm.
Als eine Inspiration für die fiktive Eliza im Roman diente ihr übrigens die Besitzerin des Cafés Valeska im Nachbarort San Rafael, das Allende oft besucht. Petrina Wielgos heißt sie und sieht so stark, attraktiv und unabhängig aus, wie Allende sich ihre Romanheldin vorstellte. Sie ließ Wielgos, wie Conny Teufl 1999 in der Welt beschrieb, eigens in einem Kostüm aus dem 19. Jahrhundert fotografieren und stellte das Bild noch während des Schreibens neben ihren Computer. Es sollte später das Cover des Romans zieren.
Zum Zeitpunkt unseres Interviews mit Isabel Allende im Sommer 1999 stand der chilenische Diktator Augusto Pinochet in London unter Hausarrest. Pinochet war im September 1998 nach England gereist, um sich dort am Rücken behandeln zu lassen. Der spanische Untersuchungsrichter Baltasar Garzón wollte den Ex-Diktator wegen Völkermord, Folter, Geiselnahme und Mordkomplott anklagen, weil auch spanische Staatsbürger zu den Opfern der chilenischen Militärdiktatur zählten. Während Pinochets London-Aufenthalt stellte Spanien einen Auslieferungsantrag, woraufhin die britische Polizei Pinochet am 16. Oktober 1998 festnahm und unter Hausarrest stellte. Neben Spanien hatten auch die Schweiz, Belgien und Frankreich Auslieferungsanträge gestellt. Obwohl der britische Außenminister im April 1999 entschieden hatte, dass Pinochet an Spanien ausgeliefert werden könne, kam es nicht dazu. Wegen seines schlechten Gesundheitszustands und seines hohen Alters wurde der Ex-Diktator schließlich im März 2000 freigelassen und durfte nach Chile zurückkehren.
Frau Allende, waren Sie schon einmal auf einem Männerklo?
Sogar schon zweimal. Beim ersten Mal war ich schwanger und musste dringend auf Toilette. Nur war ich im Auto in der Schweiz unterwegs. Ich zwang meinen Stiefvater anzuhalten und lief schnell zur Tankstellen-Toilette, ohne darauf zu achten, ob »Herren« oder »Damen« auf der Tür stand. Da war ich also und musste mich vor all den verklemmten Schweizer Herrn erleichtern, die natürlich schockiert waren.
Was Sie nicht abhalten konnte, es ein zweites Mal zu probieren.
Das zweite Mal war es aus Neugier in einem Motel mit dem Namen »Madonna Inn«, das wie ein Bordell dekoriert war. Im kalifornischen San Luis Obispo. Viele hatten von diesem Männer-Klo gesprochen – also bin ich rein und habe es mir angesehen. Und ich wurde nicht enttäuscht – da gab es doch tatsächlich einen Wasserfall, gegen den man urinieren musste. Das fand ich ziemlich cool.
Für Eliza, die Heldin Ihres Romans Fortunas Tochter, wird das Leben in Männerkleidung auch nur dann heikel, wenn sie in Gesellschaft von wilden Kerlen pinkeln muss. Ansonsten genießt sie ihren Geschlechtertausch. Wären Sie lieber als Mann auf die Welt gekommen?
Dann hätte ich es im Leben sehr viel leichter gehabt, soviel ist sicher. Dann wäre ich dazu erzogen worden, pragmatischer, selbstbewusster und weniger gefühlsbetont zu sein. Dann wäre ich aufgewachsen mit dem Gefühl: Mir gehört die Welt. Zu Elizas Zeiten, Mitte des 19. Jahrhunderts war die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen noch besonders gravierend. Das war die Zeit einer patriarchalisch-autoritären Gesellschaft in Chile, in der Frauen keine Möglichkeiten hatten, sich zu entfalten, aufzusteigen, sich zu verändern. Es fing schon mal damit an, dass sie keine Ausbildung hatten. Sie waren für die Kinder und den Haushalt zuständig, hatten nicht die Freiheit, dieses Korsett zu verlassen. In der Mittelklasse arbeiteten Frauen ohnehin nicht, Frauen, die trotzdem arbeiten gingen, hatten keine andere Wahl, sie mussten es tun, weil sie arm waren. Und sie arbeiteten meist unter schlimmen Bedingungen, verdienten nur die Hälfte dessen, was Männer bekamen. Und dann durften sie das Geld noch nicht mal eigenhändig entgegennehmen. Es musste vom Ehemann, ihrem Vater, Bruder oder sonst einem Mann aus ihrer Familie geholt werden. Ich gehörte in Chile zur ersten Generation von Frauen, die einer organisierten Bewegung angehörten, um Frauen von diesen Einschränkungen zu befreien. Das hat mein Leben bestimmt. Und heute leben wir immer noch in einer Welt, die von Männern bestimmt wird. Sie haben die meisten Privilegien, während für Frauen meist nur die häuslichen Pflichten bleiben.
Klingt düster. Stimmt das denn noch immer?
Ja, es hat sich zwar sehr viel verändert – aber leider nur für gebildete Frauen in den Industrienationen. Für Frauen in den Städten, die Zugang zur Gesundheitsversorgung haben. Meine verstorbene Tochter Paula hätte zu dieser Gruppe gehört. Aber wenn Sie die Lebenssituationen von Frauen in unterentwickelten Ländern betrachten, dann sehen Sie, dass sich für sie fast gar nichts verändert hat. Und es ärgert mich, wenn jüngere Frauen von heute, die von den Kämpfen für Gleichberechtigung profitieren, die ihre Mütter und Großmütter austrugen, all diese Freiheiten und Errungenschaften für selbstverständlich nehmen. Vor allem stört mich, wenn sie Feminismus als altmodisch bezeichnen oder sich heute nicht mehr Feministinnen nennen, weil das für sie ein Schimpfwort ist. Manche jungen Frauen haben regelrecht Angst vor dem Wort. Die Männer waren zuletzt sehr erfolgreich in ihrem Bemühen, das Wort »Feministin« in etwas Hässliches zu verwandeln. Mir egal – ich bin immer noch stolz, Feministin zu sein.
Sie sagten, für junge Frauen in Industrienationen habe sich vieles verändert und verbessert. Aber ist es nicht auch so, dass sie heute mit subtileren Formen des Machismo zu tun haben – männlichen Machtstrukturen, die sich hinter der oft beschriebenen »gläsernen Decke« verbergen, eine unsichtbare Barriere, die Frauen daran hindert, wie Männer Karriere zu machen?
Ja, das hat mit Machtstrukturen zu tun und damit, wie sie unter den Geschlechtern verteilt sind. Wir haben noch keine kritische Menge von Frauen an der Macht erreicht. Die Welt wird immer noch von Männern regiert. Und das wird weitergehen, wenn diese inzwischen große Gruppe gebildeter Frauen sich nicht Gehör verschafft und klar macht, dass sowas immer noch nicht in Ordnung ist. Solange die Taliban Frauen unter einen Schleier zwingen, solange Frauen in die Prostitution verkauft und auf so viele andere Arten ausgebeutet werden, solange es häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen in den Medien wie auch in der Gesellschaft gibt, in der wir leben, werden Frauen nicht die gleiche Macht wie Männer haben. Die subtilen Mechanismen der Unterdrückung werden immer da sein. Also müssen wir daran etwas ändern. Wenn ich heute junge Frauen sehe, die mir sagen: »Das ist doch alles veraltet, nicht der Rede wert. Und überhaupt: Man sieht dir dein Alter an« – dann sage ich ihnen: Ihr irrt euch. Der Feminismus fängt gerade erst an.
Welche Art von Strategie sollten Frauen denn gegen diese subtilen Mechanismen der Unterdrückung ergreifen?
Zunächst einmal sollten sie sich der Rechte, die sie sich erworben haben, sehr bewusst sein – und sie verteidigen. Und sie sollten das öffentlich machen. Vor allem aber sollten sie sich für jene Frauen einsetzen, die keine Rechte haben. Ich selbst engagiere mich für Frauen, die ich nie persönlich kennenlernen werde, Frauen in Afghanistan, in Afrika oder in Guatemala. Ich weiß nicht viel über ihr Leben, aber ich weiß, dass ich mich in einer privilegierten Position befinde, die es mir erlaubt, mich für ihre Rechte einzusetzen.
Was würden Sie jüngeren Frauen raten, wenn die heute von Männern zu hören bekommen, jetzt sei es aber auch langsam mal gut mit den feministischen Parolen?
Ich würde Ihnen raten: Sprecht gar nicht mit denen. Das ist nur Zeitverschwendung. Männer, die heute noch solche Sprüche klopfen, sind wahrscheinlich über fünfzig oder noch älter. Für sie ist es sowieso zu spät. Junge Männer, wie Sie, würden so etwas nie sagen. Oder zumindest sehr selten.
Was wir meinten, war: Männer in ihren Dreißigern sind heute auf den ersten Blick zwar aufgeschlossen, wenn es um die Gleichberechtigung von Frau und Mann geht, aber wenn man tiefer geht, entdeckt man oft alte Denkmuster.
Nun, das liegt daran, dass diese Strukturen immer noch da sind und in ihnen drinstecken. Diese Männer wurden von Frauen – und Männern – erzogen, die sie geprägt haben. Und auch die Gesellschaft ist heute immer noch so. Doch genau das ändert sich gerade. Aber es ändert sich nicht durch das, was Frauen diesen Männern sagen, sondern durch die Art und Weise, was sie ihnen zeigen.
Wie meinen Sie das?
Wie zeigt man einem Mann, dass er in seinem Denken falsch liegt? Indem man sich selbst als vollwertige Frau sieht, als ein vollwertiger Mensch – und indem man dieses Selbstverständnis auch ausstrahlt. Und wenn ein Mann erkennt, dass er eben nicht intelligenter ist als man selbst, nicht fähiger oder stärker als man selbst, dann verändert sich etwas in seinem Verstand und in seiner Einstellung. Das ist unvermeidlich. Und deshalb bin ich hoffnungsvoll, dass diese jüngere Generation, in der Männer und Frauen gemeinsam die gleichen Dinge tun, den Feminismus auf eine breitere Basis stellen wird. Meine Generation hat die intellektuelle Vorarbeit geleistet, wir haben diese neue Denkweise artikuliert. Aber jetzt sind Ihre und die nachfolgenden Generationen an der Reihe, das auszuleben.
Playboy-Chefin Christie Hefner und Emma-Herausgeberin Alice Schwarzer bezeichnen sich beide als Feministinnen, verstehen aber beide etwas anderes darunter.
Feminismus bedeutet nicht überall dasselbe. In Lateinamerika hat meine Generation erst in dem Augenblick vom Feminismus gelernt, als er in den USA und Europa bereits etabliert war. Wir haben einige Ideen übernommen, aber nicht die Vorstellung, dass man Männer hassen muss. Das war mir zu radikal. In Lateinamerika hatten wir andere radikale Ideen, aber nicht solche. Ich war schon in jungen Jahren eine engagierte Feministin, aber ich war gleichzeitig immer auch Hausfrau, Mutter und Ehefrau. Und das bedeutete nicht automatisch das Gegenteil von Feministin. Ich war wohl eher Sozialistin, ich sah das als politische Bewegung, die nichts mit meinen Hormonen oder meiner Sexualität zu tun hat. Ich wollte für Frauen die gleichen Rechte und Möglichkeiten und habe gleichzeitig meine feminine Seite immer verteidigt und gefeiert. Am Anfang meiner Karriere als Journalistin habe ich mich über die Männer lustig gemacht. Humor ist eine kraftvolle Waffe.
Was haben Sie denn angestellt?
Ich hatte eine TV-Sendung mit versteckter Kamera und wollte zeigen, dass Männer vor allem auf äußerliche Sexualmerkmale reagieren. Ich ließ eine Schauspielerin in der Innenstadt von Santiago über die Straße gehen – zunächst in unauffälliger Kleidung, in Jeans und T-Shirt. Niemand hat sie angesehen. Dann habe ich dieselbe Frau mit hochhackigen Schuhen, freiem Bauchnabel und engen Jeans über die Straße gehen lassen – die Männer haben fast den Verstand verloren und sich auf den Entwicklungsstand von Primaten zurückentwickelt. So sind sie eben.
Na ja.
Die männlichen Zuschauer haben die Sendung damals übrigens sehr gemocht – sie konnten über sich selbst lachen. Ich versichere Ihnen, wenn ich dieses Experiment heute in Deutschland machte, würden Sie bei den Männern die gleichen Reaktionen beobachten können. Gar nicht zu reden von Italien (lacht). Wie auch immer – als wir diese humorvollen TV-Filme drehten und zeigten, war den meisten Menschen in Chile klar, dass sie Teil eines größeren Kampfes für Rechte für Frauen waren. Dafür, dass Frauen das gleiche Gehalt wie Männer bekommen sollten, wenn sie den gleichen Job machten. Ein Kampf gegen sexuelle Doppelmoral: Was Männern erlaubt war, sollte auch Frauen erlaubt sein. Und gleichzeitig sollten die Anforderungen, die an Frauen gestellt wurden, auch an Männer gestellt werden.
Welche meinen Sie?
Beispielsweise wenn es um so wichtige Fragen wie die Erziehung der Kinder geht. In dem Bereich war es uns wichtig zu zeigen, dass Sprache nicht sexistisch sein und es keine geschlechtsspezifischen Vorurteile geben sollte. Beispielsweise in Filmen oder Jugendbüchern. Mädchen sollten darin Vorbilder finden, weibliche Charaktere, die stark, durchsetzungsfähig und intelligent sind. Aber in den meisten Jugendbüchern ist es die Aufgabe des kleinen Jungen, Probleme zu lösen, während das kleine Mädchen in Schwierigkeiten gerät. Nehmen Sie nur Aschenputtel oder Schneewittchen – dumme junge Frauen, die in Schwierigkeiten geraten, weil sie nicht wissen, wie sie ihr Leben bewältigen sollen. Und dann kommt der schöne Prinz und rettet sie wie durch ein Wunder. In den meisten Büchern für junge Leser gibt es keine geeigneten Vorbilder für junge Mädchen. Das muss geändert werden. Aber viele der gebildeten Frauen von heute erzählen diese alten Märchen ihren Töchtern heute anders, modifizieren sie. In dieser Hinsicht hat sich die Welt doch verändert. Jedenfalls war es die Summe solcher Missstände, gegen die wir damals gekämpft haben, als wir diese TV