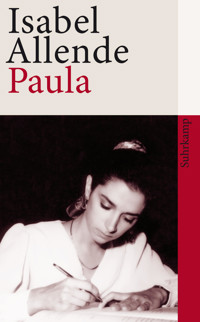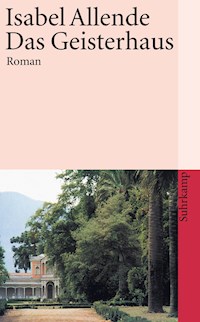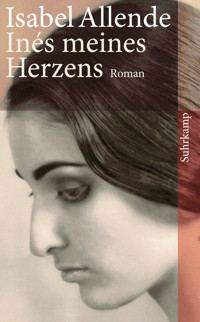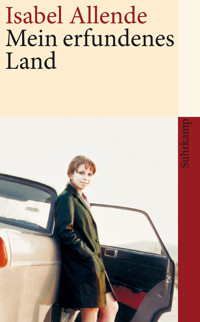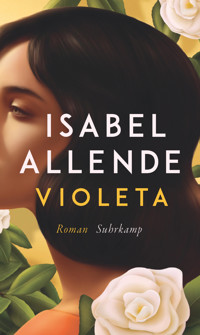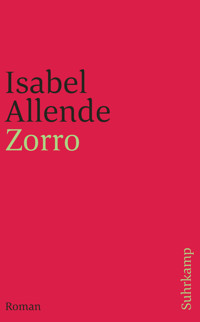
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Geboren im Kalifornien des späten achtzehnten Jahrhunderts, ist Diego de la Vega ein Kind zweier Welten: Sohn eines spanischen Edelmanns und einer indigenen Kriegerin.
Der Vater, Herr über eine große Hacienda, lehrt ihn schon früh das Fechten und will in ihm den Erben sehen, die Mutter vermittelt ihm die Traditionen ihres Volkes und den Drang nach Freiheit. Stolz und Wagemut lernt Diego von beiden, und so empört er sich früh über die Greueltaten der spanischen Kolonialherren gegen die indigene Bevölkerung und spürt den inneren Konflikt seiner Abstammung.
Mit sechzehn verläßt Diego die Heimat, um in Barcelona »europäischen Schliff« zu erhalten. Spanien krümmt sich unter der Herrschaft Napoleons, und schon bald tritt Diego als »Zorro« einem Geheimbund bei, der sich verschworen hat, Gerechtigkeit zu suchen. Doch ist es nicht allein die Gerechtigkeit, die Diego zu tollkühnen Taten treibt, sondern auch seine unbändige Liebe zu Juliana ...Bald aber sieht er sich gezwungen, vor politischer Verfolgung und tödlichen Intrigen zu fliehen. Zu Fuß geht es durch Spanien, mit Juliana, deren Schwester und ihrer Gouvernante.
Mehr und mehr schlüpft Diego in die Rolle des »Zorro«. Und als solcher kehrt er nach Kalifornien zurück, um mit seinem Degen Gerechtigkeit für all jene einzufordern, deren Kampfesmut schon gebrochen scheint. Ein großer Held ist geboren, die Legende beginnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 701
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
suhrkamp taschenbuch 3861
Isabel Allende
Zorro
Roman
Aus dem Spanischen vonSvenja Becker
Suhrkamp
Zorro
Inhalt
Erster Teil Kalifornien, 1790-1810
Zweiter Teil Barcelona, 1810-1812
Dritter Teil Barcelona, 1812-1814
Vierter Teil Spanien, Ende 1814 bis Anfang 1815
Fünfter Teil Kalifornien, 1815
Kurzer Epilog und Schlußpunkt Kalifornien, 1840
Dies ist die Geschichte von Diego de la Vega und davon, wie aus ihm der legendäre Zorro wurde. Endlich kann ich seine Identität enthüllen, die wir über so viele Jahre geheimgehalten haben, und ich tue es mit einem gewissen Zaudern, denn ein weißes Blatt Papier schreckt mich ähnlich wie die blankgezogenen Säbel von Moncadas Männern. Mit diesen Seiten will ich jenen zuvorkommen, die Zorros Wirken in den Schmutz zu ziehen trachten. Die Zahl unserer Widersacher ist beachtlich, kein Wunder, wenn man auf der Seite der Schwachen kämpft, Jungfrauen rettet und der Mächtigen spottet. Daß einer, der die Welt zu verbessern sucht, sich Feinde macht, ist nur natürlich, aber wir ziehen es vor, unsere Freunde zu zählen, und das sind weit mehr. Ich muß diese Abenteuer erzählen, denn was nützte es, daß Diego sein Leben für die Gerechtigkeit aufs Spiel setzt, wenn niemand etwas davon erführe. Heldentum ist ein Zeitvertreib, der schlecht vergolten wird, und führt häufig zu einem verfrühten Ableben, weshalb Fanatiker damit liebäugeln oder auch jene mit einer ungesunden Sehnsucht nach dem Tod. Nur selten findet man einen Helden mit romantischem Herzen und unbekümmertem Gemüt. Seien wir ehrlich: Nur einmal findet man einen Zorro.
Erster TeilKalifornien, 1790-1810
Fangen wir vorne an, mit einem Ereignis, ohne das Diego de la Vega nicht auf die Welt gekommen wäre. Es führt uns nach Kalifornien, in die Missionsstation San Gabriel, Anno Domini 1790. Zu jener Zeit wurde die Mission von Pater Mendoza geleitet, einem tatkräftigen und herrischen Franziskaner mit dem breiten Kreuz eines Holzfällers, dem man seine vierzig turbulent gelebten Jahre nicht ansah und dem nichts an seinem Amt schwerer fiel, als der Demut und Sanftheit eines Franz von Assisi nachzueifern. In Kalifornien widmeten sich damals außer ihm noch zahlreiche andere Männer der Kirche in dreiundzwanzig Missionen der Aufgabe, das Wort Christi unter Tausenden von Heiden zu verbreiten, Angehörigen der Chumash, Schoschonen und anderer Indianerstämme, die besagtes Wort nicht immer freudig anhörten. Die Ureinwohner der kalifornischen Küste waren seit Tausenden von Jahren durch Handel und Tausch miteinander verwoben. Ihr Land war reich an allem, was man zum Leben brauchte, und die einzelnen Stämme spezialisierten sich auf unterschiedliche Tätigkeiten. Die Spanier waren beeindruckt, als sie bei den Chumash ein Wirtschaftsleben vorfanden, das sich in seiner Vielfalt mit dem der Chinesen messen konnte. Die Indianer benutzten Muscheln als Zahlungsmittel und hielten regelmäßig Märkte ab, auf denen nicht nur Güter getauscht, sondern auch Ehen vereinbart wurden.
Die Indianer rätselten über das Mysterium dieses Mannes, der am Kreuz gemartert worden war und von den Weißen verehrt wurde, und sie verstanden nicht, welchen Vorteil es haben sollte, in dieser Welt zu darben, um in einer anderen womöglich ein angenehmes Leben zu führen. Im Paradies der Christen konnten sie auf einer Wolke sitzend mit den Engeln Harfe spielen, aber im Grunde wollten die meisten nach dem Tod lieber mit ihren Ahnen in den weiten Jagdgründen des Großen Geistes Bären erlegen. Auch begriffen sie nicht, warum die Fremden eine Fahne in den Boden rammten, eingebildete Grenzen um ein Gebiet zogen, das sie zu ihrem Eigentum erklärten, und sich ereiferten, wenn jemand bei der Verfolgung eines Wildes dort eindrang. Daß die Erde jemandem gehören sollte, erschien ihnen ebenso unglaublich wie die Vorstellung, das Meer könne sich teilen.
Als Pater Mendoza nun davon erfuhr, daß sich mehrere Stämme unter der Führung eines Kriegers mit einem Wolfskopf erhoben hatten, betete er für die Opfer, sorgte sich jedoch nicht weiter, da San Gabriel gewiß verschont bleiben würde. Angehöriger seiner Mission zu sein war ein Privileg, davon zeugten all die Familien von Eingeborenen, die zur Taufe kamen, weil sie unter seinen Fittichen Schutz suchten und gerne unter seinem Dach leben wollten. Er hatte noch nie Soldaten gebraucht, die ihm zukünftige Täuflinge beschafften. Der jüngste Aufstand, der erste in dieser Gegend, war sicher eine Reaktion auf die Untaten der spanischen Truppen und die Strenge seiner Brüder in den anderen Missionen. Die einzelnen Indianerstamme lebten verstreut in kleinen Gruppen, pflegten ihre eigenen Traditionen und verständigten sich nur selten miteinander über ein einfaches System von Zeichen; sie hatten sich noch nie untereinander abgesprochen, schon gar nicht für einen Krieg. Für Pater Mendoza waren diese armen Menschen unschuldige Lämmer Gottes, die aus Unkenntnis und nicht aus Lasterhaftigkeit sündigten, also mußte es schwerwiegende Gründe geben, wenn sie sich nun gegen die Siedler erhoben.
Der Missionar arbeitete von früh bis spät Seite an Seite mit den Indianern auf den Feldern, beim Gerben der Häute, beim Mahlen von Mais. Abends, wenn die anderen sich ausruhten, sah er nach denen, die sich bei der Arbeit verletzt hatten, oder zog hie und da einen faulen Zahn. Außerdem unterrichtete er den Katechismus und brachte seinen Neophyten ‒ wie die getauften Indianer genannt wurden ‒ das Rechnen bei, damit sie die Häute, Kerzen und Rinder zählen konnten, verzichtete indes darauf, sie Lesen und Schreiben zu lehren, denn diese Kenntnisse ließen sich hier doch nicht sinnvoll anwenden. Bis spät in die Nacht inspizierte er die Fässer in seinem Weinkeller, führte Buch über seine Ausgaben und Einnahmen, schrieb in seine Hefte und betete. Bei Sonnenaufgang rief er seine Gemeinde mit der Kirchenglocke zur Messe und wachte nach dem Gottesdienst mit scharfem Auge über das Frühstück, damit auch alle satt wurden. Deshalb, und nicht etwa, weil er selbstgefällig oder eitel gewesen wäre, war er überzeugt, daß die aufständischen Stämme seine Mission nicht angreifen würden. Als die schlechten Nachrichten jedoch über Wochen nicht verstummten, horchte er endlich doch auf. Um sich ein Bild von der Lage in der Region zu machen, schickte er zwei Späher aus, denen er vertrauen konnte, und rasch hatten die beiden die Aufständischen gefunden und Einzelheiten erfahren, da sie von diesen wie Gleichgesinnte aufgenommen wurden. Bei ihrer Rückkehr berichteten sie dem Missionar, aus den Tiefen der Wälder sei ein Krieger aufgetaucht, der vom Geist eines Wolfes besessen sei und es geschafft habe, mehrere Stämme zu einen, die nun die Spanier vom Land ihrer Vorfahren vertreiben wollten, in dem die Indianer von alters her gejagt hatten, ohne jemanden um Erlaubnis zu bitten. Offenbar entbehrte dieser Feldzug einer klaren Strategie; die Indianer griffen wahllos Missionen und Dörfer an, brannten auf ihrem Weg alles nieder und verschwanden so schnell, wie sie aufgetaucht waren. Sie schufen sich Freunde unter den Neophyten, deren Kampfesmut noch nicht durch die fortgesetzten Demütigungen der Weißen gebrochen war, und verstärkten so ihre Reihen. Die Späher versicherten, Häuptling Grauer Wolf habe ein Auge auf San Gabriel geworfen, nicht weil er einen besonderen Groll gegen Pater Mendoza hege, dem ja nichts vorzuwerfen sei, sondern weil die Mission auf seinem Weg liege. So mußte der Pater also doch Vorkehrungen treffen. Er würde die Früchte seiner jahrelangen Mühen nicht kampflos preisgeben und erst recht nicht zulassen, daß man ihm seine Indianer entriß, die ohne seine schützende Hand erneut der Sünde anheimfallen und wie Wilde leben würden. Er schrieb eine Nachricht für Capitán Alejandro de la Vega und bat um rasche Unterstützung. Er fürchte das Schlimmste, die Aufständischen seien bereits sehr nah und könnten jeden Moment angreifen, und ohne angemessene militärische Hilfe wisse er sich nicht zu verteidigen. Er schickte zwei schnelle Reiter auf unterschiedlichen Routen zum Fort von San Diego, denn er wollte sichergehen, daß sein Hilferuf ankäme, auch wenn einer der Reiter abgefangen würde.
Wenige Tage später preschte Alejandro de la Vega im Galopp in den Hof der Missionsstation. Mit einem Satz sprang er vom Pferd, riß sich den schweren Uniformrock und das Halstuch vom Leib, nahm den Hut ab und versenkte seinen Kopf in dem Trog, in dem die Frauen für gewöhnlich die Wäsche einweichten. Schaumiger Schweiß bedeckte die Flanken seines Pferdes, das viele Meilen galoppiert war und außer Reiter und Sattel auch die Ausrüstung eines spanischen Dragoners hatte tragen müssen: Lanze, Degen, Schild aus doppelt verstärktem Leder und einen Karabiner. Mit De la Vega erreichten zwei Soldaten und mehrere Proviantpferde die Mission. Pater Mendoza trat auf den Hof, um den Hauptmann mit offenen Armen zu empfangen, konnte indes seine Enttäuschung nicht verhehlen, als er die zwei abgekämpften Soldaten sah, die der Offizier mitgebracht hatte und die genauso am Ende ihrer Kräfte schienen wie die Pferde.
»Tut mir leid, Pater«, keuchte De la Vega und wischte sich das Gesicht mit den Hemdsärmeln trocken. »Diese beiden wackeren Männer sind alles, was ich anbieten kann. Den Rest meiner Truppe mußte ich in La Reina de Los Ángeles lassen, das Dorf ist ebenfalls von den Aufständischen bedroht.«
»Gott steh uns bei, wenn es schon Spanien nicht tut«, knurrte der Priester zwischen den Zähnen.
»Wißt Ihr, wie viele Indianer angreifen werden?«
»Zu viele, als daß man sich auf die Angaben verlassen könnte, Capitan, aber meine Späher sagen, es sind um die fünfhundert.«
»Dann sind es wohl nicht mehr als hundertfünfzig. Wir können uns wehren. Was haben wir zur Verfügung?«
»Mich, ich war Soldat, ehe ich Priester wurde, und zwei weitere Missionare, die jung sind und mutig. Außerdem hat man der Station drei Soldaten zugewiesen, die hier leben. Wir haben Musketen, Karabiner und Munition, zwei Säbel und das Dynamit, das wir im Steinbruch verwenden.«
»Wie viele Missionsbewohner?«
»Seien wir ehrlich, mein Sohn: die meisten würden nicht gegen ihre eigenen Leute kämpfen. Ich kann bestenfalls auf ein halbes Dutzend Halbwüchsige zählen, die hier aufgewachsen sind, und auf einige Frauen, die uns beim Nachladen der Gewehre helfen können. Ich darf das Leben meiner Schützlinge nicht aufs Spiel setzen, Capitan, sie sind wie Kinder. Wie meine eigenen Kinder.«
»Schön, Pater, machen wir uns also in Gottes Namen an die Arbeit. Die Kirche ist das solideste Gebäude der Mission, richtig? Wir verschanzen uns dort«, entschied der Hauptmann nach einem raschen Blick über den Platz.
In den folgenden Tagen kam niemand in San Gabriel zur Ruhe, selbst die kleinen Kinder wurden zum Arbeiten angestellt. Als Kenner der menschlichen Seele wußte Pater Mendoza, daß er nicht auf die Loyalität seiner Gläubigen hoffen durfte, wenn sie sich erst einmal von Angehörigen freier Stämme umringt sähen. Gekränkt nahm er das wilde Funkeln in manchen Augen wahr und die Unlust, mit der seine Anweisungen befolgt wurden: Steine fielen hin, Sandsäcke zerrissen, seine Indianer verhedderten sich in den Tauen, die Eimer mit dem Pech glitten ihnen aus den Fingern. Durch die Umstände dazu getrieben, verletzte er sein eigenes Gebot der Barmherzigkeit, verurteilte zur Abschreckung und ohne zu zögern zwei von ihnen zum Stehen am Halsstock und züchtigte einen dritten mit zehn Peitschenhieben. Dann ließ er die Tür am Schlafhaus der unverheirateten Frauen mit Balken verstärken. Der runde Lehmbau glich von je einem Gefängnis, weil auch die dreistesten der Mädchen daran gehindert werden sollten, nachts mit ihren Verehrern im Mondschein spazierenzugehen, weshalb das Gebäude keine Fenster hatte und sich die Tür von außen mit einem Eisenbalken verriegeln und mit Vorhängeschlössern sichern ließ. Dort würden sie die Mehrzahl der Männer einschließen und zusätzlich an Fußeisen ketten, um zu verhindern, daß sie die Fronten wechselten, wenn es zum Kampf kam.
»Die Indianer fürchten uns, Pater. Sie glauben, wir seien im Besitz eines sehr mächtigen Zaubers«, sagte Hauptmann De la Vega und tätschelte den Kolben seines Karabiners.
»Mit Schußwaffen haben diese Menschen zur Genüge Bekanntschaft gemacht, auch wenn sie mit ihrer Handhabung noch nicht vertraut sind. Was sie tatsächlich fürchten, ist das Kreuz Christi«, entgegnete der Missionar mit einem Wink auf den Altar.
»Zeigen wir ihnen also die Macht von Kreuz und Schießpulver«, sagte der Hauptmann mit einem Grinsen und legte dem Missionar seinen Plan dar.
Die beiden standen in der Kirche, wo mit Sandsäcken direkt hinter dem Portal eine Barrikade und an einigen strategischen Punkten brusthohe Wälle errichtet worden waren, hinter denen die Gewehre bereitstanden. De la Vega war der Meinung, solange sie ihre Gegner auf Abstand halten könnten und Zeit zum Nachladen hätten, stünden ihre Chancen nicht schlecht, aber auf einen Kampf Mann gegen Mann dürften sie es keinesfalls anlegen, denn die Angreifer seien ihnen an Zahl und Wildheit weit überlegen.
Pater Mendoza war froh, daß der Hauptmann so viel Entschlossenheit an den Tag legte. Der Mann war wohl nicht viel älter als dreißig, aber bereits ein erfahrener Soldat, gestählt in den Kriegen in Italien, aus denen er mit einigen stolzen Narben heimgekehrt war. Er war der dritte Sohn einer Adelsfamilie, deren Geschlecht sich bis auf den vielbesungenen Cid zurückverfolgen ließ. Seine Vorväter hatten unter der Standarte der katholischen Könige Isabella und Ferdinand gegen die Mauren gekämpft, aber all die Todesverachtung und das für Spanien vergossene Blut hatten ihnen keine Reichtümer beschert, nur Ehre. Als De la Vegas Vater starb, erbte der älteste Sohn das Haus der Familie, ein uraltes Gemäuer auf einem Stückchen kargen Landes in Kastilien. Den zweiten Sohn rief die Kirche zu sich, und ihn selbst traf das Los, Soldat zu werden; etwas anderes war für einen jungen Mann von seinem Geblüt nicht vorgesehen. Als Lohn für seinen in Italien bewiesenen Schneid erhielt er einen kleinen Beutel Dublonen und die Erlaubnis, in die Neue Welt aufzubrechen, um dort sein Glück zu machen. So hatte es ihn schließlich nach Kalifornien verschlagen, als Begleitung von Doña Eulalia de Callís, der Gattin des Gouverneurs Pedro Fages, der wegen seiner Reizbarkeit und der stattlichen Zahl eigenhändig erlegter Bären »der Grizzly« genannt wurde.
Pater Mendoza war so manches zu Ohren gekommen über diese ins Epische verlängerte Reise von Doña Eulalia, der ein ähnlich hitziges Temperament nachgesagt wurde wie ihrem Gatten. Ein Dreivierteljahr hatte sie gebraucht für die Strecke von Mexiko, der Hauptstadt des Vizekönigreichs, wo sie in großem Prunk gelebt hatte, bis nach Monterey, einem unwirtlichen Fort an der Pazifikküste, in dem sie ihr Mann erwartete. Im Schneckentempo bewegte sie sich mit ihren Ochsenkarren und der endlosen Koppel Maulesel, die das Gepäck schleppten, aus dem Hochland in Richtung Norden, und wo immer man Rast machte, wurde ein höfisches Fest organisiert, das sich über mehrere Tage hinzuziehen pflegte. Es hieß, Doña Eulalia sei exzentrisch, bade in Eselmilch und färbe sich das Haar, das ihr bis zu den Knöcheln reiche, mit einer rötlichen Paste, wie sie auch die Damen am venezianischen Hof benutzten; außerdem habe sie aus reiner Lust an der Verschwendung und nicht etwa aus christlicher Tugendhaftigkeit ihre Gewänder aus Seide und Brokat an die nackten Indianer verschenkt, denen sie unterwegs begegneten, und sich ‒ was ja nun wirklich die Höhe sei ‒ in den adretten jungen Hauptmann Alejandro de la Vega verliebt. Nun, ich bin nur ein armer Franziskaner, was maße ich mir an, über diese Dame zu urteilen? dachte Pater Mendoza bei sich, wobei er De la Vega aus den Augenwinkeln betrachtete und sich sehr zu seinem Leidwesen neugierig fragte, was wohl Wahres dran sei an diesen Gerüchten.
In ihren Briefen an den obersten Seelenhirten der mexikanischen Missionen klagten die Missionare darüber, daß die Indianer auch weiterhin lieber nackt, in Strohhütten und mit Pfeil und Bogen lebten, ohne Bildung, Regierung, Religion oder Achtung vor der Obrigkeit und einzig auf die Befriedigung ihrer schamlosen Gelüste bedacht, so als hätte das wundertätige Wasser der Taufe sie niemals von ihren Sünden reingewaschen. Daß die Eingeborenen derart hartnäckig an ihren überkommenen Gepflogenheiten festhielten, mußte das Werk des Teufels sein, eine andere Erklärung war undenkbar, und so fing man die Entlaufenen mit dem Lasso wieder ein und peitschte sie aus, um sie die Heilsbotschaft zu lehren. Pater Mendoza hatte allerdings selbst eine recht ausschweifende Jugend genossen, ehe er Priester geworden war, und die Vorstellung, schamlose Gelüste zu befriedigen, war ihm nicht fremd, weshalb er eine gewisse Sympathie für die Ureinwohner hegte. Auch bewunderte er im stillen die fortschrittlichen Ideen seiner Konkurrenz, der Jesuiten. Er unterschied sich erheblich von anderen Männern der Kirche, auch von der Mehrheit seiner franziskanischen Ordensbrüder, die die Unwissenheit zur Tugend erhoben. Einige Jahre zuvor, als er sich darauf vorbereitete, die Mission San Gabriel zu übernehmen, hatte er mit großem Interesse den Bericht eines gewissen Jean François de la Pérouse gelesen, eines Weltreisenden, der die getauften Indianer Kaliforniens als traurige, allen Esprits beraubte Geschöpfe ohne Persönlichkeit beschrieb, die ihn an die bis zum Stumpfsinn gequälten afrikanischen Sklaven auf den Plantagen der Karibik erinnerten. Die spanische Obrigkeit schrieb die Meinungsäußerungen von La Pérouse dem bedauerlichen Umstand zu, daß er Franzose war, aber bei Pater Mendoza hatten sie einen tiefen Eindruck hinterlassen. Im Grunde seines Herzens vertraute er auf die Einsichtsfähigkeit fast ebenso sehr wie auf Gott, und daher nahm er sich vor, aus seiner Mission ein Vorbild an Wohlstand und Gerechtigkeit zu machen. Er wollte seine Anhänger durch Überzeugung und nicht durch das Lasso gewinnen und sie durch gute Taten anstatt durch Peitschen hiebe zum Bleiben bewegen. Seine Erfolge konnten sich sehen lassen. De la Pérouse jedenfalls hätte Augen gemacht, wie sehr sich die Lebensbedingungen der Indianer unter der Führung des Missionars verbessert hatten. Pater Mendoza durfte sich damit brüsten ‒ was er nie tat ‒, daß sich die Zahl der Getauften in San Gabriel verdreifacht hatte und niemand für längere Zeit davonlief, denn die wenigen, die es versuchten, kehrten bald trotz der schweren Arbeit und der strengen Trennung der Geschlechter reumütig nach San Gabriel zurück, weil der Pater sie barmherzig wieder aufnahm und sie die drei Mahlzeiten am Tag und das feste Dach, unter das man sich vor den Unwettern flüchten konnte, nicht missen mochten.
Die Mission lockte Reisende aus dem übrigen Amerika und aus Spanien in diesen abgelegenen Landstrich, die das Erfolgsgeheimnis des Paters ergründen wollten. Die Augen gingen ihnen über angesichts der Getreidefelder und Gemüseäcker, der Weinberge, die einen guten Tropfen lieferten, der Bewässerung, die den Aquädukten der Römer nachempfunden war, der Pferdeställe und Schweinekoben, der Viehherden, die auf den Hügeln grasten, so weit das Auge reichte, der Lagerräume, die von gegerbten Häuten und Schläuchen voller Fett überquollen. Sie staunten, wie friedvoll die Tage hier vergingen und wie sanftmütig die Indianer waren, deren feine Flechtarbeiten und Lederwaren schon über die Provinzgrenzen hinaus Bekanntheit erlangt hatten. »Ein voller Bauch beugt Kummer vor«, war das Motto des Paters, dem die Fragen der Ernährung zum Steckenpferd geworden waren, seit er wußte, daß noch immer Seeleute an Skorbut starben, obwohl man dieser Krankheit leicht mit Zitronensaft vorbeugen konnte. Er war überzeugt, daß sich eine Seele einfacher errettet, wenn sie in einem gesunden Körper wohnt, deshalb war seine erste Maßnahme in der Mission die Abschaffung des täglich gleichen Maisbreis gewesen, den er durch Braten, Gemüse und Schmalz für die Tortillas ersetzte. Auch scheute er keine Mühe, damit die Kinder Milch bekamen, obwohl man für jeden Eimer der schaumigen Flüssigkeit einen Kampf gegen die wilden Kühe austragen mußte. Es brauchte drei kräftige Männer, um eine einzige davon zu melken, und nicht selten gewann die Kuh. Den Widerwillen der Kinder gegen die Milch rang Pater Mendoza mit derselben Methode nieder, die er auch anwandte, um ihnen einmal im Monat eine Kur gegen Würmer zu verabreichen: Er schnappte sie sich, hielt ihnen die Nase zu und steckte ihnen einen Trichter in den Mund. So viel Entschlußkraft mußte einfach Erfolge zeitigen. Dank des Trichters wuchsen die Kinder kräftig und charakterlich gefestigt heran. Die Bewohner von San Gabriel wurden nicht von Würmern geplagt und waren die einzigen, die von keiner der tödlichen Epidemien heimgesucht wurden, die in anderen Siedlungen wüteten, auch wenn zuweilen eine Erkältung oder ein einfacher Durchfall genügten, um die neuen Christen ohne Federlesen ins Jenseits zu führen.
Am Mittwoch gegen Mittag griffen die Indianer an. Sie näherten sich lautlos, aber als sie in die Ländereien der Mission eindrangen, war man vorbereitet. Kaum hatten die Krieger die ersten Hütten erreicht, ließen sie alle Vorsicht fahren und stürmten als wütende Horde in den Hof, aber der war wie ausgestorben, und nur ein zerstreutes Huhn und ein paar dürre Hunde liefen zwischen den Hütten herum. Keine Menschenseele weit und breit, Grabesstille, kein Rauch über den Feuerstellen. Ein paar der Angreifer trugen Kleidung aus gegerbten Häuten und saßen auf Pferden, die meisten jedoch waren nackt und liefen zu Fuß, bewaffnet mit Pfeil und Bogen, Knüppeln und Speeren. Vorneweg galoppierte der mysteriöse Häuptling, dessen Arme und Beine bemalt waren mit roten und schwarzen Blitzen, der Rumpf bedeckt von einem kurzen Wolfspelz, das Haupt geziert mit dem Kopf des gleichen Tieres, unter dem eine schwarze Haarmähne hervorquoll. Sein Gesicht war kaum zu erkennen, nur die Augen funkelten zwischen den aufgerissenen Lefzen des Wolfs.
In Windeseile durchsuchten die Indianer die Gebäude der Mission, legten Feuer an die Strohhütten, zertrümmerten Tonkrüge und Holzfässer, das Werkzeug, die Webstühle und alles, was sie finden konnten, ohne auf den geringsten Widerstand zu stoßen. In ihrer Hast und dem grausigen Kriegsgeheul gingen die Rufe derjenigen unter, die in der Schlafhütte der Frauen angekettet und eingesperrt waren. Von ihrem raschen Erfolg angestachelt, wandten sich die Angreifer nun der Kirche zu, und ein Hagel Pfeile prasselte nutzlos gegen die dicken Wände aus Lehm. Häuptling Grauer Wolf rief einen Befehl, und in einem wilden Durcheinander warfen sich seine Krieger gegen die dicke, zweiflüglige Tür, die unter dem Ansturm erzitterte, aber nicht nachgab. Das Geheul und die Schreie schwollen an, wieder und wieder rammten die Krieger gegen das Holzportal, während einige der behenderen und kühneren versuchten, die Mauer zu den schmalen Fensterlöchern und zum Glockenturm zu erklimmen.
Im Innern der Kirche wurde die Spannung mit jedem neuen Ansturm gegen die Tür unerträglicher. Die Verteidiger ‒ drei Missionare, fünf Soldaten und acht Neophyten ‒ hatten sich an den Seiten des Kirchenschiffs hinter den Sandsäcken postiert, zusammen mit einigen Indianermädchen, deren Aufgabe es sein würde, die Gewehre nachzuladen. De la Vega hatte sich alle Mühe gegeben, es ihnen beizubringen, aber zu viel durfte man nicht erwarten, sie waren ja fast noch Kinder, hatten nie zuvor eine Muskete aus der Nähe gesehen und waren jetzt zudem zu Tode erschrocken. Jeder Soldat hätte diese Reihe von Handgriffen im Schlaf ausgeführt, hätte Pulver, Kugel und Dichtpfropfen in den Lauf gestopft und die Pfanne mit Zündkraut gefüllt, aber den Hauptmann hatte es Stunden gekostet, das den Mädchen zu erklären. War ein Gewehr bereit, sollte es zum Schießen an einen der Männer übergeben werden, während unverzüglich das nächste nachgeladen wurde. Er hatte seine Schützlinge darauf vorbereitet, daß feuchtes Pulver, abgenutzte Feuersteine und blockierte Abzugshähne immer wieder zu Ausfällen führen konnten und man in der Hast auch manchmal den Ladestock im Lauf vergaß.
»Laßt euch nicht entmutigen«, hatte er ihnen eingeschärft. »So ist das in jeder Schlacht, bloß Lärm und Durcheinander. Wenn ein Gewehr sich verklemmt, muß das nächste auf der Stelle zur Hand sein, um weiter zu töten.«
In einem Raum hinter dem Altar hatten sie den Rest der Frauen und Kinder der Mission eingeschlossen, die Pater Mendoza sich geschworen hatte, mit seinem Leben zu verteidigen. Stumm, den Finger am Abzug, Mund und Nase von in Essigwasser getränkten Tüchern geschützt, warteten die Verteidiger auf das Zeichen des Hauptmanns, der als einziger nicht mit der Wimper zuckte, während die Angreifer sich draußen brüllend gegen die Tür warfen. Kühl sah De la Vega auf den bebenden Querbalken und überlegte, wie lange er noch standhalten würde. Der Erfolg seines Plans hing davon ab, daß sie im richtigen Moment und perfekt aufeinander abgestimmt handelten. Seit den Feldzügen in Italien vor etlichen Jahren hatte er keine Gelegenheit zum Kampf mehr gehabt, aber er war hellwach und ruhig; das Kribbeln in seinen Fingern, das er immer verspürte, ehe er schoß, war das einzige Zeichen seiner Anspannung.
Plötzlich war Ruhe: eine gespenstische Ruhe. Die Indianer mußten vom Ansturm auf die Tür erschöpft sein und hatten sich wohl zurückgezogen, um sich mit ihrem Anführer zu besprechen. Diesen Moment wählte De la Vega, um das Zeichen zu geben. Er packte das Tau der Kirchenglocke, die mit Furor zu läuten begann, und im selben Moment entzündeten vier der Verteidiger pechgetränkte Lappen, die einen dicken und stinkenden Qualm absonderten, während zwei andere zur Tür stürzten und den schweren Holzbalken aus der Führung hoben. Durch die Glocke neu angestachelt, rannten die Angreifer wieder gegen die Tür an. Diesmal gab sie auf der Stelle nach, und die Eindringlinge fielen, einer über den anderen, hinein in die Kirche und gegen eine Barrikade aus Sandsäcken und Steinen, die sie, vom Gleißen draußen noch geblendet, im Dämmer und Qualm nicht erkennen konnten. Zehn Musketen feuerten gleichzeitig von beiden Seiten, und mehrere der Angreifer brachen schreiend zusammen. Der Hauptmann legte Feuer an die Lunte, und im Nu fraß sich die Flamme vor bis zu den Beuteln mit einem Gemisch aus Pulver, Fett, Steinen und Metallsplittern, mit denen die Barrikade an der Tür bestückt war. Die Detonation erschütterte die Fundamente der Kirche, schleuderte einen Hagel von Steinen und Splittern in die Menge der Angreifer und riß das große Holzkreuz über dem Altar krachend aus der Verankerung. Vom Lärm schon wie betäubt, wurden die Verteidiger von einem heißen Luftschwall ins Gesicht getroffen und warfen sich hinter die Sandsäcke, erkannten aber noch eben, daß etliche der Angreifer wie Marionetten in einer lodernden Wolke übereinander stürzten. Hinter der Deckung blieb ihnen gerade genug Zeit, Atem zu schöpfen, ihre Gewehre nachzuladen und ein zweites Mal zu feuern, dann sirrten die ersten Pfeile durch das Kircheninnere. Einige der Angreifer lagen am Boden, aber andere spannten hustend und mit vom Qualm tränenden Augen ihren Bogen, feuerten blindlings und boten dabei den Kugeln ein leichtes Ziel.
Dreimal konnten die Gewehre nachgeladen werden, bis es Häuptling Grauer Wolf und einigen seiner kühnsten Krieger gelang, die Barrikade zu überklettern und ins Kirchenschiff vorzustoßen, wo sie die Spanier schon erwarteten. In dem nun folgenden Tohuwabohu verlor Hauptmann De la Vega den Anführer der Aufständischen keinen Moment aus den Augen, und kaum hatte er die Gegner abgeschüttelt, die ihn von allen Seiten bedrängten, stürzte er sich mit Raubtiergebrüll auf ihn, den Degen in der Hand. Mit aller Kraft ließ er die Klinge auf den Wolfskopf niedersausen, aber der Hieb ging ins Leere, denn als habe er die Gefahr gewittert, drehte sich Häuptling Grauer Wolf im selben Moment zur Seite und wich dem Schlag aus. Vom eigenen Schwung aus dem Gleichgewicht gebracht, taumelte der Hauptmann vornüber und fiel auf die Knie, sein Degen hieb auf den Steinboden und zerbarst in zwei Teile. Mit einem Triumphschrei hob der Indianer seinen Speer und wollte den Spanier durchbohren, aber in diesem Augenblick traf ihn ein Kolbenhieb am Hinterkopf, er stürzte nach vorn und blieb reglos liegen.
»Vergebe mir Gott!« schrie Pater Mendoza, der eine Muskete am Lauf gepackt hatte und mit wilder Lust Hiebe nach rechts und links austeilte.
Entgeistert starrte Hauptmann De la Vega, der sich selbst bereits tot geglaubt hatte, auf die dunkle Lache, die um den am Boden liegenden Häuptling rasch größer wurde und seinen stolzen Kopfputz rot färbte. Pater Mendoza krönte seinen unangemessenen Freudentaumel mit einem heftigen Tritt gegen den leblosen Körper des Gefallenen. Er hatte nur das Pulver riechen müssen, und sogleich war er wieder der blutgierige Soldat, der er in seiner Jugend gewesen war.
Im Nu hatte sich unter den Angreifern die Kunde verbreitet, daß ihr Anführer gefallen war, und sie begannen den Rückzug, zunächst zögerlich, dann in wilder Flucht. Schweißgebadet und halberstickt warteten die Sieger im Innern der Kirche, bis sich die Staubwolke auf dem Vorplatz gelegt hatte, dann traten sie keuchend ins Freie. Das Stöhnen der Verwundeten und die angstvollen Schreie der Frauen und Kinder, die noch immer im Raum hinter dem Altar eingeschlossen und dem Qualm der Pechfackeln ausgesetzt waren, gingen unter im frenetischen Lärm der Kirchenglocke, in einer Salve von Schüssen in die Luft und in dem nicht enden wollenden Siegesgeschrei derer, die mit dem Leben davongekommen waren.
Pater Mendoza raffte mit zwei Händen seine blutige Soutane und ging unverzüglich daran, seine Missionsstation wieder auf Vordermann zu bringen, ohne zu merken, daß er ein Ohr verloren hatte und das Blut an seiner Schulter nicht das seiner Gegner, sondern sein eigenes war. Er schickte ein Dankgebet zum Himmel angesichts ihrer geringen Verluste und gleich darauf ein zweites, in dem er um Vergebung dafür bat, daß er das christliche Mitgefühl im Eifer des Gefechts derart aus dem Blick verloren hatte. Von den Soldaten waren zwei leicht verwundet worden, und im Arm eines Missionars steckte ein Pfeil. Aber sie hatten nur eine Tote zu beklagen, eines der Mädchen, das die Gewehre nachgeladen hatte, gerade fünfzehn Jahre alt, und nun lag sie da, mit eingeschlagenem Schädel, und starrte mit einem erstaunten Ausdruck in ihren großen, dunklen Augen zur Kirchendecke. Während Pater Mendoza die Eingeschlossenen aus dem Schlafhaus und dem hinteren Teil der Kirche befreite und Anweisungen gab, damit die Brände gelöscht, die Verwundeten versorgt und die Toten begraben wurden, nahm Hauptmann Alejandro de la Vega einem seiner Soldaten den Degen ab und lief damit, noch immer rasend vor Zorn und atemlos, auf der Suche nach dem toten Indianerhäuptling durch die Kirche, denn er wollte dessen Kopf auf eine Pike spießen und am Eingang der Mission auf pflanzen als Warnung für jeden, der mit dem Gedanken spielen sollte, seinem Beispiel zu folgen. Er fand den Häuptling dort, wo er zusammengebrochen war: kaum mehr als ein jämmerliches Bündel Mensch, gebadet im eigenen Blut. Er riß ihm den Wolfskopf herunter und drehte mit der Fußspitze den leblosen Körper um, der viel kleiner war, als er mit erhobenem Speer gewirkt hatte. Mit einer Hand packte der Hauptmann in den langen Haarschopf und hob mit der anderen den Degen, um den Kopf mit einem Hieb vom Leib zu trennen, und erstarrte mitten in der Bewegung, denn der Gefallene schlug die Augen auf und sah ihn mit einem unerwartet neugierigen Blick an.
»Heilige Mutter Gottes, er lebt!« keuchte De la Vega und wich einen Schritt zurück.
Daß sein Widersacher noch atmete, war das eine, aber mehr noch verblüffte ihn die Schönheit dieser karamelfarbenen, schmalgeschwungenen Augen mit den dichten Wimpern, die schimmernden Augen eines Rehs in diesem von Blut und Kriegsbemalung verkrusteten Gesicht. De la Vega ließ den Degen los, kniete sich hin, schob dem Krieger die Hand unter den Nacken und half ihm vorsichtig, sich aufzusetzen. Die Rehaugen schlossen sich, und ein langer Schmerzenslaut kam aus dem Mund. Der Hauptmann sah sich um, aber hier in diesem Winkel der Kirche, sehr nah am Altar, war sonst niemand. Ohne darüber nachzudenken, hob er den Verwundeten hoch und wollte ihn eigentlich über der Schulter nach draußen schleppen, aber er war viel leichter als gedacht, und so trug er ihn im Arm wie ein Kind, vorbei an den Sandsäcken, den Steinbrocken, den Waffen und den noch nicht geborgenen Toten hinaus aus der Kirche und in den Sonnenschein dieses Herbsttags, an den er sich für den Rest seines Lebens erinnern sollte.
»Er lebt, Pater«, sagte er und legte den Verwundeten neben die anderen auf die Erde.
»Schlecht für ihn, Capitán, denn hinrichten müssen wir ihn doch«, gab der Pater zurück, der sich inzwischen ein Hemd wie einen Turban um den Kopf geschlungen hatte, um das Blut zu stillen dort, wo einmal sein rechtes Ohr gewesen war.
Alejandro de la Vega würde nie erklären können, weshalb er diese Bemerkung des Paters nicht nutzte, um den Indianer zu enthaupten, sondern statt dessen am Brunnen Wasser holte und ein paar Lappen, mit denen er ihm das Blut abwischen konnte. Eine der Frauen der Mission half ihm, das dichte Haar zu entwirren und die lange Platzwunde auszuwaschen, die bei der Berührung mit dem Wasser erneut stark zu bluten begann. Der Hauptmann tastete den Kopf des Verwundeten ab und fand noch eine frühere, entzündete Verletzung, aber der Knochen schien heil zu sein. Im Krieg hatte er Schlimmeres gesehen. Er nahm eine der gebogenen Nadeln zum Nähen der Matratzen, zog durch die Öse eins der Pferdehaare, die Pater Mendoza in einer Schale mit Tequila bereitgestellt hatte, um die Verwundeten wieder zusammenzuflicken, und nähte die Kopfhaut mit mehreren Stichen. Dann wusch er dem Häuptling das Blut und die Bemalung vom Gesicht und sah, daß seine Haut hell und seine Züge weich waren. Mit einem Messer schlitzte er den blutigen Wolfsumhang auf, um nach weiteren Verletzungen zu suchen, und schrie entgeistert auf:
»Eine Frau!«
Sofort waren Pater Mendoza und die anderen, die sich um die Verwundeten gekümmert hatten, bei ihm und starrten mit großen Augen auf die Jungmädchenbrüste des Kriegers.
»Jetzt wird es noch viel schwerer, das Todesurteil zu vollstrecken …«, stöhnte Pater Mendoza.
Sie hieß Toypurnia und war kaum zwanzig Jahre alt. Die Krieger vieler Stämme waren ihrem Aufruf zum Kampf gefolgt, weil ihr ein mythischer Ruf vorauseilte. Ihre Mutter war Weiße Eule, die Schamanin und Heilerin eines Stammes vom Volk der Chumash, und ihr Vater ein von einem spanischen Schiff desertierter Matrose. Viele Jahre hatte sich der Mann bei den Indianern verborgen, bis er schließlich einer Lungenentzündung zum Opfer fiel, als seine Tochter schon halbwüchsig war. Von ihrem Vater hatte Toypurnia etwas Spanisch gelernt, von ihrer Mutter den Gebrauch von Heilpflanzen und die Traditionen ihres Volkes. Daß ihr ein außergewöhnliches Schicksal beschieden war, zeigte sich schon wenige Monate nach ihrer Geburt, an dem Abend, als ihre Mutter sie unter einem Baum schlafen ließ, während sie selbst im Fluß badete, und ein Wolf sich dem in Felle gehüllten Bündel näherte, es mit den Zähnen packte und in den Wald schleifte. Verzweifelt folgte Weiße Eule tagelang der Fährte des Tiers, ohne ihre Tochter zu finden. Über den Sommer ergraute ihr Haar, und der Stamm suchte rastlos nach dem Kind, bis auch der letzte Funke Hoffnung schwand, es je wiederzusehen, und man die Zeremonien abhielt, um es in die weiten Jagdgründe des Großen Geistes zu führen. Weiße Eule aber suchte weiter mit dem Blick den Horizont ab und weigerte sich, an den Zeremonien teilzunehmen, denn sie spürte in den Knochen, daß ihre Tochter am Leben war. Eines Morgens, als der Winter nicht mehr fern war, löste sich eine schmutzige und nackte Gestalt aus dem Nebel und kroch auf allen vieren, die Nase am Boden, auf das Indianerdorf zu. Es war die verlorene Tochter, die wie ein Hund knurrend und nach Raubtier riechend heimkehrte. Sie nannten sie Toypurnia, Tochter des Wolfs, und erzogen sie wie die Jungen des Stamms mit Pfeil, Bogen und Speer, denn sie hatte den Wald mit unzähmbarem Herzen verlassen.
All das erfuhr Alejandro de la Vega in den nächsten Tagen von den gefangengenommenen Indianern, die über ihre Wunden klagten und über die Demütigung, in den Hütten der Missionare eingesperrt zu sein. Pater Mendoza hatte entschieden, jeden laufen zu lassen, der genesen wäre, denn er konnte sie ja doch nicht auf unbegrenzte Zeit festhalten, und ohne ihren Anführer wirkten sie wieder gleichgültig und fügsam wie eh und je. Er wollte sie nicht auspeitschen, obwohl sie es nach seinem Dafürhalten verdient hätten, denn die Bestrafung hätte nur den Groll geschürt, noch versuchte er, sie zu bekehren, denn ihm schien, daß keiner von ihnen das Zeug zum Christen hatte; sie wären wie faulige Äpfel, die ihm die Reinheit seiner Ernte verderben würden. Dem Missionar war nicht entgangen, daß die junge Toypurnia eine starke Anziehungskraft auf Hauptmann De la Vega ausübte, der allenthalben Vorwände fand, um in das unterirdische Gewölbe hinabzusteigen, in dem der Wein lagerte und sie die Gefangene eingeschlossen hatten. Den Keller hatte der Missionar aus zwei Gründen als Kerker gewählt: Man konnte ihn abschließen, und die Dunkelheit würde Toypurnia Gelegenheit geben, sich über ihre Taten klar zu werden. Da die Indianer versicherten, ihr Anführer könne sich in einen Wolf verwandeln und aus jedem Gefängnis entkommen, fesselte er die Gefangene zusätzlich mit Lederriemen an die rauhen Bretter, die ihr als Pritsche dienten. Mehrere Tage lag die junge Frau im Fieber, quälte sich zwischen Bewußtlosigkeit und Albträumen und wenigen wachen Momenten, wenn Hauptmann De la Vega ihr mit einem Löffel Milch, Honig und Wein einflößte. Zuweilen schlug sie in völliger Dunkelheit die Augen auf und fürchtete, blind zu sein, aber andere Male blickte sie in die flackernde Flamme einer Kerze und in das Gesicht eines Fremden, der sie beim Namen rief.
Eine Woche später tat Toypurnia heimlich ihre ersten Schritte am Arm des stattlichen Hauptmanns, der beschlossen hatte, sich über die Anweisungen des Paters hinwegzusetzen, daß die Gefangene gefesselt und in Dunkelheit zu halten sei. Jetzt konnten die beiden sich verständigen, da sie sich ihres fast verschütteten Spanisch erinnerte und er sich große Mühe gab, einige Wörter ihrer Sprache zu lernen. Als Pater Mendoza die beiden Hand in Hand ertappte, wußte er, daß es höchste Zeit war, die Gefangene für gesund zu erklären und abzuurteilen. Zwar sträubte sich alles in ihm gegen eine Hinrichtung, und eigentlich wußte er gar nicht, wie er sie bewerkstelligen sollte, aber er war für die Sicherheit seiner Mission und ihrer Bewohner verantwortlich, und diese Frau hatte immerhin den Tod mehrerer Menschen verschuldet. Niedergedrückt erinnerte er den Hauptmann daran, daß in Spanien auf rebellische Umtriebe, wie die von Toypurnia angeführten, der Tod durch die Garrotte stand, der Verurteilte also mit einer eisernen Würgschraube langsam erdrosselt wurde.
»Wir sind hier nicht in Spanien«, entfuhr es dem entsetzten Hauptmann.
»Gleichwohl werdet Ihr mir zustimmen, Capitán, daß wir alle in Gefahr sind, solange sie lebt. Sie wird die Stämme erneut aufwiegeln. Keine Garrotte, das ist zu grausam, aber wenn es auch in der Seele schmerzt, so muß sie doch hängen, uns bleibt keine Wahl.«
»Diese Frau ist Mestizin, Pater, in ihren Adern fließt spanisches Blut. Euch steht es zu, über die Indianer in Eurem Gebiet zu richten, nicht jedoch über sie. Das kann nur der Gouverneur von Kalifornien tun«, entgegnete der Hauptmann fest.
Pater Mendoza, der schon seit Tagen unter der Last ächzte, sich einen weiteren Toten auf das Gewissen laden zu müssen, klammerte sich unverzüglich an diesen rettenden Strohhalm. De la Vega erbot sich, selbst nach Monterey zu reiten, damit Pedro Fages über Toypurnias Schicksal entschied, und mit einem Seufzer der Erleichterung willigte der Missionar ein.
Alejandro de la Vega legte die Strecke nach Monterey in weniger Zeit zurück, als ein Reiter unter normalen Umständen benötigt hätte, denn es drängte ihn, seinen Auftrag zu erledigen. Er ritt allein und im Galopp, hielt nur an den Missionen auf seinem Weg, um das Pferd zu wechseln und ein paar Stunden zu schlafen. Er war diesen Teil des Camino Real schon öfter geritten und kannte ihn gut, und doch war er auch diesmal beeindruckt von der Schönheit der Landschaft, die so viel verschwenderischer war als seine kastilische Heimat, mit diesen ausgedehnten Wäldern, in denen es von Vögeln und Wild wimmelte, überall Bäche und sprudelnde Quellen, und dann der weiße Sand an den Stränden des Pazifiks. Er traf nicht auf aufständische Indianer, und so hatte Pater Mendoza wohl recht mit seiner Vermutung, daß sie sich nun, ohne ihren Anführer, in kleinen Grüppchen in die Berge geflüchtet hatten. Wenn seine Vorhersage stimmte, war ihnen die Lust am Kämpfen gründlich vergangen, und es würde Jahre dauern, bis sie sich erneut zusammenschlössen.
Die Festungsanlage von Monterey, gebaut auf einer einsamen, ins Meer ragenden Felsnase, siebenhundert spanische Meilen von der Hauptstadt Mexiko entfernt und eine halbe Welt von Madrid, war ein kerkerdüsteres Gebäude, eine Monstrosität aus Steinen und Lehmmörtel, die ein kleines Kontingent von Soldaten beherbergte, die einzige Gesellschaft für den Gouverneur und seine Familie. Gedämpft drang das Kreischen der Möwen und Tosen der Wellen gegen die Klippen an diesem Morgen durch den feuchten Nebel.
Pedro Fages empfing den Hauptmann in einem großen, nahezu leeren Saal, durch dessen Fensterlöcher kaum Licht, dafür aber die eisige Brise vom Meer her drang. An den Wänden hingen ausgestopfte Bärenköpfe, Säbel, Pistolen und das Familienwappen von Eulalia de Callís, einst in Gold gestickt, nun jedoch stumpf und der Stoff ausgebleicht. Einzige Möbel waren ein wuchtiger Waffenschrank, ein Dutzend schwere, ungepolsterte Holzstühle und ein runder Tisch für militärische Besprechungen. Die rußgeschwärzte Decke und der gestampfte Lehmboden wären der derbsten Kaserne würdig gewesen. Der Gouverneur, ein beleibter Koloß von einem Mann mit einer polternden Stimme, besaß die rare Tugend, für Schmeicheleien und Bestechung unempfänglich zu sein. Er versah sein Amt in der stillen Gewißheit, daß es seine verdammte Pflicht und Schuldigkeit sei, Kalifornien aus der Barbarei zu holen, koste es, was es wolle. Er verglich sich dabei gern mit den ersten Eroberern des Kontinents, mit Männern wie Hernán Cortés, die dem Weltreich solche Größe verliehen hatten. So war es also sein Sinn für Geschichte, der ihn zur Erfüllung seiner Pflicht trieb, denn im Grunde hätte er es vorgezogen, sich mit dem Vermögen seiner Frau daheim in Barcelona ein angenehmes Leben zu machen, worum sie ihn ohne Unterlaß bat. Eine Ordonnanz servierte Rotwein in Gläsern aus böhmischem Kristall, die eine weite Reise in den Truhen von Eulalia de Callís hinter sich hatten und auf dem ungeschlachten Holztisch völlig deplaziert wirkten. Die Männer stießen auf das ferne Vaterland und auf ihre Freundschaft an und tauschten sich über die Ereignisse in Frankreich aus, wo sich das Volk gewaltsam gegen die Obrigkeit erhoben hatte. Das war nun schon über ein Jahr her, aber Monterey hatte erst kürzlich davon Nachricht erhalten. Man war sich einig, daß kein Grund zur Beunruhigung bestehe, sicher war die Ordnung längst wieder hergestellt und König Ludwig XVI. erneut auf dem Thron, obwohl der ja doch ein Hanswurst sei, dem man keine Träne nachweinen müsse. Im stillen waren die beiden erfreut darüber, daß die Franzosen sich gegenseitig umbrachten, aber ihre guten Manieren verboten es, das zu erwähnen. Von irgendwo drangen gedämpfte Stimmen und Schreie zu ihnen, die lauter wurden, bis sie sich nicht mehr überhören ließen.
»Entschuldigt, Capitan. Diese Frauen, nichts als Arger«, grummelte Pedro Fages und klopfte mit den Fingern ungeduldig auf die Tischplatte.
»Geht es Ihrer Exzellenz Doña Eulalia nicht gut?« fragte Alejandro de la Vega, bis unter die Haarspitzen errötend.
Pedro Fages durchbohrte ihn mit einem Blick, als wollte er seine Gedanken aufspießen. Natürlich hatte er gehört, was die Leute tuschelten über diesen stattlichen Hauptmann und seine Frau, er war ja nicht taub. Niemand, und am wenigsten er selbst, hatte verstanden, warum Doña Eulalia fast ein Jahr gebraucht hatte, um in Monterey anzukommen, wenn man die Strecke in viel kürzerer Zeit zurücklegen konnte; es hieß, sie hätten die Reise mit Absicht verschleppt, um den Abschied hinauszuzögern. Auch war die Rede von einem Überfall von Strauchdieben, bei dem De la Vega sein Leben für Eulalia aufs Spiel gesetzt hatte. Das war maßlos übertrieben, was Pedro Fages allerdings nie erfahren würde. Die blutrünstigen Banditen waren ein halbes Dutzend sturzbetrunkener Indianer gewesen, die mit dem ersten Schuß das Weite gesucht hatten, und die Verletzung am Bein hatte sich De la Vega nicht, wie behauptet wurde, in Verteidigung des Lebens von Doña Eulalia de Callís zugezogen, sondern bei der Begegnung mit einer aufgebrachten Kuh. Pedro Fages hielt sich zugute, daß man ihm so leicht nichts vormachen konnte, nicht von ungefähr war er seit Jahren ein mächtiger Mann, und nachdem er Alejandro de la Vega gemustert hatte, schüttelte er kaum merklich den Kopf, denn es war unsinnig, Verdächtigungen auf ihn zu verschwenden: als der Hauptmann ihm seine Gattin übergeben hatte, war deren Treue intakt. Er kannte seine Frau. Hätten die beiden sich ineinander verliebt, hätte keine Macht der Welt oder des Himmels Eulalia dazu bewegen können, ihren Geliebten zu verlassen und zu ihrem Ehemann zurückzukehren. Es sei, daß sie eine platonische Zuneigung zueinander verspürt hatten, aber nichts, was einem den Schlaf rauben müßte, entschied der Gouverneur. Er war ein Ehrenmann und fühlte sich diesem Offizier gegenüber in der Schuld, der mehr als genug Zeit gehabt hätte, Eulalia zu verführen, ohne es zu tun. Dies Verdienst schrieb er gänzlich ihm zu, denn nach seinem Dafürhalten konnte man zwar zuweilen auf die Loyalität eines Mannes vertrauen, niemals jedoch auf die einer Frau, deren naturgegebener Wankelmut für die Treue nicht taugte.
Unterdessen gingen das Hin und Her der Dienstboten, das Türenschlagen und die unterdrückten Schreie draußen weiter. Wie alle Welt, so wußte auch Alejandro de la Vega um die Streitereien des Gouverneursehepaares, die legendär waren wie ihre Versöhnungen. Angeblich warfen sich die Fages in ihren Tobsuchtsanfällen das Geschirr um die Ohren, und Don Pedro hatte mehr als einmal den Säbel gegen seine Frau gezogen, aber danach schlossen sich die beiden tagelang ein und verließen das Bett nicht. Jetzt hieb der bärbeißige Gouverneur mit der Faust auf den Tisch, daß die Gläser tanzten, beugte sich zu seinem Gast vor und knurrte, Eulalia habe sich seit fünf Tagen in ihren Räumen eingeschlossen und sei wie rasend.
»Ihr fehlt die feine Lebensart, an die sie gewöhnt ist«, seufzte er, während draußen ein schauriges Heulen anhob.
»Vielleicht fühlt sie sich etwas einsam, Exzellenz«, murmelte De la Vega, der nicht wußte, was er sagen sollte.
»Ich habe ihr versprochen, daß wir in drei Jahren nach Mexiko oder nach Barcelona zurückkehren, aber sie will nichts hören. Meine Geduld ist am Ende, Capitan. Ich schicke sie in die nächstgelegene Mission, soll sie mit den Indianern auf den Feldern schuften, das wird sie lehren, was es heißt, mir den Respekt zu versagen!«
»Dürfte ich ein paar Worte mit ihr wechseln, Exzellenz?«
Während dieser fünf Tage ihrer Tobsucht hatte die Gouverneurin sich sogar geweigert, ihren dreijährigen Sohn zu sehen. Der Kleine kauerte weinend vor ihrem Gemach und machte vor Angst in die Hose, wenn sein Vater mit dem Spazierstock vergeblich auf die Tür eindrosch. Nur eine Indianerin, die das Essen brachte und den Nachttopf leerte, überquerte die Schwelle, aber als Eulalia nun gemeldet wurde, Alejandro de la Vega sei zu Besuch und wünsche, sie zu sehen, verrauchte ihr Zorn im Nu. Sie wusch sich das Gesicht, richtete ihren roten Zopf, zog ein malvenfarbenes Seidenkleid an und behängte sich mit all ihren Perlen. Pedro Fages sah sie den Raum betreten, prächtig und strahlend wie in ihren besten Zeiten, und sehnte bereits die Hitze einer möglichen Versöhnung herbei, wiewohl er nicht gewillt war, ihr so ohne weiteres zu verzeihen, denn irgendeine Strafe mußte sein. Während sie in einem ähnlich düsteren Raum wie der Waffenkammer bei einem schlichten Abendessen zu Tische saßen, nutzten Eulalia de Callís und Pedro Fages die Anwesenheit eines Zeugen, um einander alles an den Kopf zu werfen, was ihnen seit Monaten die Seele vergiftete. Alejandro de la Vega flüchtete sich bis zum Nachtisch in ein unbehagliches Schweigen, dann schien der Wein seine Wirkung zu tun, der Zorn der Ehegatten flaute ab, und Alejandro kam auf den Grund seines Besuchs zu sprechen. Er redete von dem spanischen Blut, das in Toypurnias Adern floß, beschrieb ihren Mut und ihre Klugheit, ließ ihre Schönheit indes unerwähnt und bat den Gouverneur, seinem Ruf eines gnädigen Herrschers gerecht zu werden und im Namen ihrer Freundschaft Milde walten zu lassen. Abgelenkt von dem rötlichen Schimmer auf Eulalias Dekolleté, ließ Pedro Fages sich nicht lange bitten und erklärte sich bereit, die Todesstrafe in zwanzig Jahre Kerkerhaft umzuwandeln.
»Im Kerker würde diese Frau für die Indianer zur Märtyrerin. Man brauchte nur ihren Namen zu nennen, und die Stämme würden erneut zu den Waffen greifen«, widersprach ihm Eulalia. »Ich weiß etwas Besseres. Zunächst muß sie getauft werden, wie es Gottes Wille ist, dann bringt Ihr sie her und überlaßt alles weitere mir. Jede Wette, daß ich diese Toypurnia binnen Jahresfrist von der wilden Tochter des Wolfs in eine gottgefällige spanische Dame verwandele. So brechen wir ihren Einfluß auf die Indianer für immer.«
»Und ganz nebenbei bekommst du etwas zu tun und jemanden, der dir Gesellschaft leistet«, griff ihr Ehemann den Vorschlag freudig auf.
So geschah es. Alejandro de la Vega wurde beauftragt, die Gefangene von San Gabriel nach Monterey zu bringen, sehr zur Erleichterung von Pater Mendoza, der sich ihrer schleunigst entledigen wollte. Die junge Frau glich einem Vulkan, der jeden Moment in der Mission ausbrechen konnte, wo sich die Bewohner noch nicht vom Aufruhr des Kampfes erholt hatten. Toypurnia wurde auf den Namen Regina María de la Inmaculada Concepción getauft, vergaß jedoch umgehend den ganzen Rattenschwanz und blieb bei Regina. Pater Mendoza hieß sie, einen der groben Kittel der Neophyten anzuziehen, streifte ihr ein Medaillon der Jungfrau Maria über den Kopf, half ihr aufs Pferd, weil ihre Hände gefesselt waren, und gab ihr den Segen. Kaum waren die geduckten Gebäude der Mission außer Sichtweite, band Hauptmann De la Vega seiner Gefangenen die Hände los und gab ihr mit einer ausladenden Armbewegung auf das weite Hügelland zu verstehen, daß er sie nicht an der Flucht hindern werde. Regina saß eine Weile nachdenklich im Sattel und muß wohl gemutmaßt haben, daß es kein Pardon gäbe, wenn sie ein zweites Mal gefaßt würde, denn schließlich schüttelte sie den Kopf. Oder vielleicht war es nicht ausschließlich Furcht, sondern dasselbe brennende Verlangen, das auch den Verstand des Spaniers trübte. Jedenfalls folgte sie ihm ohne jedes Zeichen von Aufsässigkeit während dieses ganzen Weges, den er so lange wie möglich hinauszuzögern trachtete, da er sicher war, sie danach nie mehr wiederzusehen. Jeden Zoll des Camino Real kostete Alejandro de la Vega an ihrer Seite aus, jede Nacht, die sie unter den Sternen schliefen, ohne einander zu berühren, jede Gelegenheit, sich gemeinsam mit ihr im Meer zu erfrischen, während er einen zähen Kampf gegen die Begierde und Vorstellungskraft ausfocht. Ein De la Vega, ein Mann von seinem Stand und Geblüt, durfte von einer Verbindung mit einer Mestizin noch nicht einmal träumen. Doch sollte er gehofft haben, dieser Ritt an Reginas Seite durch die menschenleere Weite Kaliforniens würde seine Liebe erkalten lassen, so täuschte er sich, denn als sie schließlich unvermeidlich die Festung von Monterey erreichten, war er verliebt wie ein kleiner Junge. Er mußte sich an seine lang geübte soldatische Disziplin erinnern, um dieser Frau Lebewohl zu sagen und sich zu schwören, daß er niemals ihre Nähe suchen würde.
Drei Jahre später löste Pedro Fages das seiner Frau gegebene Versprechen ein und legte sein Amt als Gouverneur von Ober-Kalifornien nieder, um in die Zivilisation zurückzukehren. Im stillen war er erfreut über diese Entscheidung, da ihm die Ausübung der Macht stets als undankbare Aufgabe erschienen war. Das Paar ließ seine Reisetruhen auf die Maulesel und die Ochsenkarren verladen, scharte seinen kleinen Hofstaat um sich und brach nach Mexiko auf, wo Eulalia de Callís sich einen barocken Palast hatte herrichten lassen, dessen Pomp ihrem gesellschaftlichen Status entsprach. Notgedrungen legten sie in jedem Dorf und jeder Mission auf ihrem Weg eine Rast ein, denn die Reise war beschwerlich, und die Siedler ließen es sich nicht nehmen, das Paar festlich zu bewirten. Die Fages waren trotz ihrer ruppigen Art beliebt, Don Pedro hatte gerecht regiert, und Doña Eulalia stand im Ruf einer großzügigen Spinnerin. In La Reina de los Ángeles tat man sich mit der nahe gelegenen Mission San Gabriel zusammen, dem Aushängeschild der Provinz, um den Reisenden einen würdigen Empfang zu bereiten. Das Dorf bestand zu jener Zeit nur aus vier Straßen und hundert Hütten aus Schilfrohr, die sich nach dem Vorbild spanischer Kolonialstädte um einen zentralen Platz in der Mitte gruppierten, aber seine Lage war mit Umsicht gewählt, damit es wachsen und gedeihen konnte. Auch gab es bereits eine Taverne, deren Hinterzimmer als Kramladen diente, eine Kirche, ein Gefängnis und ein halbes Dutzend stattlicher Gebäude aus Stein, Lehm und Ziegeln, in denen die Obrigkeit wohnte. Trotz der spärlichen Einwohnerzahl und der verbreiteten Armut waren die Siedler bekannt für ihre Gastfreundschaft und ihre Feste, die übers Jahr reihum von den Familien gegeben wurden. Die Nächte waren belebt von den Klängen der Gitarren, Trompeten, Geigen und Klaviere, samstags und sonntags tanzte man Fandango. Doch seit seiner Gründung hatte sich dem Dorf kein besserer Anlaß zum Feiern geboten als der Besuch des Gouverneursehepaars. Rund um den Platz wurden Bögen mit Wimpeln und Papierblumen errichtet, in der Mitte lange Tische mit weißen Decken aufgestellt, und wer immer ein Instrument spielen konnte, war für die Kapelle rekrutiert worden, selbst zwei Sträflinge, die aus dem Halsstock befreit wurden, als man erfuhr, sie könnten die Gitarre schlagen. Schon seit Monaten bereitete man sich vor und sprach von nichts anderem. Die Frauen hatten sich festliche Kleider geschneidert, die Männer polierten ihre silbernen Knöpfe und Gürtelschnallen auf Hochglanz, die Musiker probten die neuesten Tänze vom Hof des Vizekönigs, die Köchinnen schufteten für das üppigste Bankett, das der Ort je gesehen hatte. Pater Mendoza kam mit seinen Indianern und brachte mehrere Fässer seines besten Weins, zwei Kühe und mehrere Schweine, Hühner und Enten, die für das Fest dem Beil zum Opfer fielen.
Hauptmann Alejandro de la Vega oblag es, während des Aufenthalts der Ehrengäste für Ordnung im Dorf zu sorgen. Seit er von deren Kommen unterrichtet war, ließ ihm die Erinnerung an Regina keine ruhige Minute. Er fragte sich, was wohl in diesen drei Jahrhunderten der Trennung aus ihr geworden sein mochte, wie sie die Zeit in der düsteren Festung von Monterey überstanden hatte, ob sie sich womöglich an ihn erinnerte. Aller Zweifel war verflogen, als er am Festabend im Schein der Fackeln und unter den Klängen des Orchesters eine junge Frau auf den Platz treten sah, strahlend schön und nach spanischer Mode gekleidet und frisiert, die er dennoch auf der Stelle wiedererkannte an diesen Augen von der Farbe karamelisierten Zuckers. Auch sie hatte ihn in der Menschenmenge ausgemacht, trat ohne Zögern auf ihn zu und sah ihn mit todernster Miene an. Das Herz wollte dem Hauptmann zerspringen, er streckte die Hand aus, um Regina zum Tanz aufzufordern, aber statt dessen sprudelte aus seinem Mund die Frage, ob sie seine Frau werden wolle. Es war keine jähe Kopflosigkeit, vielmehr hatte er drei Jahre lang darüber nachgedacht und entschieden, daß er lieber seinen untadeligen Stammbaum befleckte, als ohne sie zu leben. Er wußte, er würde sie niemals seiner Familie oder der Gesellschaft in Spanien vorstellen können, doch es war ihm einerlei, für sie würde er in Kalifornien Wurzeln schlagen und die Neue Welt nie mehr verlassen. Regina nahm seinen Antrag ohne Umschweife an: Seit jenen Tagen, als sie im Weinkeller von Pater Mendoza im Sterben lag und Alejandro sie ins Leben zurückgeholt hatte, hatte sie diesen Mann insgeheim geliebt.
Und so fand das rauschende Fest für den hohen Besuch in La Reina de los Ángeles in der Vermählung des Hauptmanns mit der geheimnisvollen Gesellschaftsdame von Eulalia de Callís einen krönenden Abschluß. Pater Mendoza, dessen nun schulterlanges Haar die grausige Narbe seines fehlenden Ohrs überdeckte, führte die Trauung durch, obwohl er bis zum letzten Moment versucht hatte, dem Hauptmann diese Heirat auszureden. Daß die Braut Mestizin war, kümmerte ihn nicht, viele Spanier heirateten Indianerinnen, aber er argwöhnte, daß unter Reginas untadeliger Fassade eines europäischen Fräuleins Toypurnia unbeschadet weiterlebte: die Tochter des Wolfs. Pedro Fages persönlich führte die Braut zum Altar in der Überzeugung, daß sie seine Ehe gerettet hatte, da Eulalia im Bemühen um ihre Erziehung ihren Jähzorn gemäßigt und aufgehört hatte, ihm mit ihrer Tobsucht zur Last zu fallen. Auch verdankte er ja, wie die Gerüchte ihm zugetragen hatten, Alejandro de la Vega das Leben seiner Frau, und so befand er dies für eine gute Gelegenheit, sich großzügig zu zeigen. Ihm stand es zu, Land unter den Siedlern zu verteilen, also überschrieb er mit einem Handstreich dem strahlenden Paar die Eigentumstitel für eine Länderei und schenkte ihnen mehrere tausend Stück Vieh. Der Laune seines Bleistifts folgend, legte er die Umrisse der künftigen Farm auf einer Landkarte fest, und als man später ihre tatsächlichen Ausmaße nachprüfte, zeigte sich, daß sie viele Morgen Weideland, Hügel, Wälder, Flüsse und Strand umfaßte. Zu Pferd brauchte man mehrere Tage, dies Land zu umrunden: es war die größte und am besten gelegene Länderei der ganzen Gegend. Ohne darum gebeten zu haben, sah sich Alejandro de la Vega in einen reichen Mann verwandelt. Einige Wochen später, als die Leute ihn Don Alejandro zu nennen begannen, quittierte er seinen Dienst im Heer des Königs und widmete sich ganz der Aufgabe, dieses neue Land urbar zu machen. Im Jahr darauf wählte man ihn zum Bürgermeister von La Reina de los Ángeles.
Alejandro de la Vega baute ein großes, solides Haus ohne Prunk, mit dicken Mauern aus Lehm, einem Ziegeldach und Fußböden aus groben Terrakottaplatten. Er stellte schwere Möbel hinein, die ihm der galicische Schreiner am Ort fertigte, dem nicht um schönes Aussehen, sondern einzig um Haltbarkeit zu tun war. Die Lage des Anwesens war einzigartig, sehr nah am Strand und doch nur wenige Meilen von La Reina de los Ángeles und von der Mission San Gabriel entfernt. Im Stil einer mexikanischen Hacienda erhob sich das große Lehmhaus auf einer Felsnase und bot einen Rundblick auf Küste und Meer. Nicht weit entfernt gab es natürliche Pechgruben, die allseits gemieden wurden, da es hieß, dort gingen die Seelen derjenigen um, die in der stinkenden, zähen Masse ihr Leben gelassen hatten. Außerdem erstreckte sich zwischen Strand und Hacienda ein unterirdisches Höhlenlabyrinth, ein heiliger Ort der Indianer, der ähnliche Ängste wachrief wie die Pechgruben. Aus Achtung vor ihren Ahnen blieben die Indianer den Höhlen fern, die Spanier wegen der häufigen Steinschläge und weil man sich im Innern leicht verirrte.
Alejandro de la Vega siedelte mehrere Familien von Indianern und mestizischen Viehtreibern auf seiner Hacienda an, brannte seinen Rindern sein Zeichen ein und begann mit Hilfe einiger Hengste und Stuten, die er sich aus dem Hochland um Mexiko hatte bringen lassen, eine Zucht von Rassepferden. Was ihm an Zeit blieb, steckte er in den Aufbau einer Seifensiederei und in Experimente in der Küche, mit denen er das perfekte Rezept für Rauchfleisch in Chili zu finden hoffte. Das Fleisch sollte trocken sein, dennoch schmackhaft und über Monate haltbar. Dieses Vorhaben fraß seine freie Zeit und füllte den Himmel mit vulkanischen Qualmwolken, die mehrere Meilen aufs Meer hinaus trieben und die Wale verwirrten. Aber hätte er erst die rechte Ausgewogenheit zwischen gutem Geschmack und Haltbarkeit erzielt, so würde er sein Trockenfleisch an die spanischen Truppen und die Schiffsmannschaften verkaufen können. Es schien ihm eine maßlose Verschwendung, daß von den Rindern nur die Häute und das Fett genutzt wurden und man bergeweise bestes Fleisch verlor. Während ihr Ehemann die Zahl seiner Rinder, Schafe und Pferde mehrte, die Politik des Dorfes leitete und Geschäfte mit den Handelsschiffen abschloß, nahm sich Regina der Belange der Indianer auf der Farm an. Am gesellschaftlichen Leben der Siedler zeigte sie hingegen kein Interesse und hörte mit majestätischem Gleichmut über die Gerüchte hinweg, die über sie kursierten. Hinter ihrem Rücken raunte man über ihre Verstocktheit und ihren Hochmut, über ihre mehr als zweifelhafte Herkunft, ihre Ausritte allein, darüber, daß sie nackt im Meer bade. Da sie als Schützling der Fages’ nach Los Ángeles gekommen war, wie sich das Dorf mittlerweile aus Bequemlichkeit nannte, hatte die winzige Gesellschaft sie in ihrer Mitte aufnehmen wollen, ohne Fragen zu stellen, aber sie selbst schloß sich aus. Bald wurden die Kleider, die sie unter dem Einfluß von Eulalia de Callís getragen hatte, im Schrank ein Fraß der Motten. Sie ging lieber barfuß und im groben Leinen der Neophyten. Wenigstens tagsüber. Abends, wenn Alejandro bald heimkommen würde, wusch sie sich, schlang ihr Haar zu einem lockeren Knoten und streifte ein schlichtes Kleid über, in dem sie unschuldig aussah wie eine Novizin. Blind vor Liebe und von seinen Verpflichtungen zu sehr in Anspruch genommen, übersah ihr Mann die Zeichen, die ihm etwas über Reginas Gemütslage hätten verraten können; er wollte sie glücklich sehen, fragte sie indes nie, ob sie es sei, aus Angst, die Wahrheit zu hören. Alles Befremdliche an ihr schrieb er dem Umstand zu, daß sie sich an die Ehe erst gewöhnen mußte und von Natur aus verschlossen war. Er schob den Gedanken beiseite, daß die Frau mit den tadellosen Manieren, die mit ihm zu Tische saß, ebender bemalte Krieger war, der wenige Jahre zuvor die Mission San Gabriel überfallen hatte. Sicher wären auch die letzten Reste ihrer Vergangenheit für immer getilgt, wenn sie erst Mutter würde, doch trotz der häufigen und ausgedehnten Liebesspiele in dem von vier Säulen getragenen Bett, das sie teilten, sollte das so sehr ersehnte Kind noch bis zum Jahre 1795 auf sich warten lassen.
Dann, in den Monaten der Schwangerschaft, wurde Regina noch wortkarger und wilder. Unter dem Vorwand, die spanische Mode sei zu unbequem, kleidete und frisierte sie