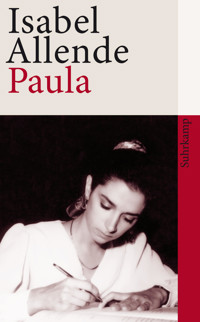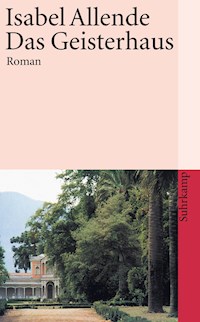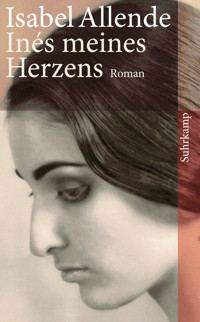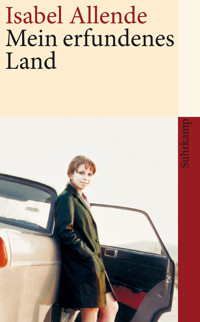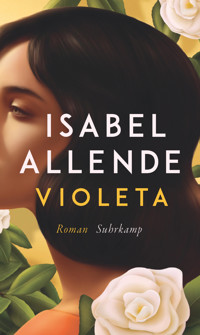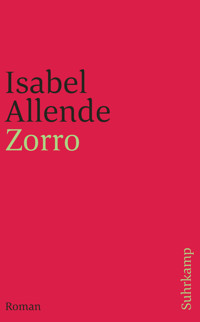12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Was bedeutet es, eine Frau zu sein? Isabel Allende ist eine Ikone, eine weltweit geliebte Schriftstellerin und das Vorbild vieler Menschen. In diesem leidenschaftlichen, provokanten und inspirierenden Memoir hält sie Rückschau auf ihr Leben und schreibt über ihr wichtigstes Thema – es ist der bewegende Appell einer großen Feministin.
Von früh auf erlebt die kleine Isabel, wie die Mutter, vom Ehemann sitzengelassen, sich tagein, tagaus um ihre Kinder kümmert, »ohne Mittel oder Stimme«. Aus Isabel wird ein wildes, aufsässiges Mädchen, fest entschlossen, für ein Leben zu kämpfen, das ihre Mutter nicht haben konnte.
In den späten Sechzigern ist Isabel in der Frauenbewegung aktiv. Umgeben von gleichgesinnten Journalistinnen, schreibt sie »mit einem Messer zwischen den Zähnen« und fühlt sich erstmals wohl in ihrer Haut. In drei Ehen erlebt sie, wie sie als Frau in Beziehungen wachsen kann, wie man scheitert und wieder auf die Beine kommt und dass man sich der eigenen sexuellen Wünsche selbst annehmen muss.
Was wollen Frauen heute? Liebe und Respekt und vor allem auch Kontrolle über Leben und Körper und Unabhängigkeit. In diesen Hinsichten aber gibt es noch sehr viel zu tun, sagt Isabel Allende. Und dieses Buch, so ihre Hoffnung, soll dazu beitragen, »unsere Töchter und Enkeltöchter zu inspirieren. Sie müssen für uns leben, so wie wir für unsere Mütter gelebt haben, und mit der Arbeit weitermachen, die wir begonnen haben.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
Isabel Allende
Was wir Frauen wollen
Aus dem Spanischen von Svenja Becker
Suhrkamp Verlag
Widmung
Für Panchita, Paula, Lori, Mana, Nicoleund all die anderen außergewöhnlichen Frauen in meinem Leben
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Textnachweis
Impressum
Hinweise zum eBook
WENNICHSAGE, dass ich schon im Kindergarten Feministin war, ehe man in meiner Familie den Begriff überhaupt kannte, dann ist das nicht übertrieben. Ich bin 1942 geboren, wir sprechen hier also von grauer Vorzeit. Meine Auflehnung gegen die Herrschaft der Männer nahm ihren Ausgang vermutlich in der Situation meiner Mutter Panchita, die von ihrem Ehemann in Peru sitzen gelassen wurde, zusammen mit zwei Kleinkindern und einem Säugling. Das nötigte Panchita dazu, sich zurück in die Obhut ihrer Eltern in Chile zu begeben, in deren Haus ich die ersten Jahre meiner Kindheit verbrachte.
Das Haus meiner Großeltern im Providencia-Viertel von Santiago, das damals eine Wohngegend war und heute ein Irrgarten aus Geschäften und Bürotürmen ist, war groß und unansehnlich, ein monströser Kasten mit zugigen, hohen Zimmern, Ruß aus den Kerosinöfen an den Wänden, schweren roten Samtvorhängen, spanischen Möbelstücken, die dafür gemacht waren, ein Jahrhundert zu überdauern, scheußlichen Porträts von verstorbenen Verwandten und Stapeln eingestaubter Bücher. Der vordere Bereich des Hauses war herrschaftlich. Man hatte sich bemüht, der Stube, der Bibliothek und dem Esszimmer ein elegantes Flair zu verleihen, doch diese Räume wurden so gut wie nie benutzt. Das übrige Haus gehörte als unaufgeräumtes Reich meiner Großmutter, den Kindern (meinen beiden Brüdern und mir), den Hausangestellten, zwei oder drei Hunden von unerfindlicher Rasse und einigen halbwilden Katzen, die sich hinter dem Kühlschrank unkontrolliert vermehrten. Die Köchin ertränkte die neugeborenen Kätzchen in einem Eimer im Hof.
Mit dem verfrühten Tod meiner Großmutter verflüchtigten sich Freude und Helligkeit aus dem Haus. Ich erinnere mich an meine Kindheit als an eine Zeit voller Furcht und Dunkelheit.
Was ich fürchtete? Meine Mutter könnte sterben und wir in einem Waisenhaus landen, der Teufel könnte in den Spiegeln erscheinen, die »Zigeuner« könnten mich rauben, kurz, alles Mögliche, womit man Kindern damals Angst einjagte. Ich bin dankbar für diese unglückliche Kindheit, weil sie mir Stoff für mein Schreiben liefert. Wie Romanautoren klarkommen, die eine angenehme Kindheit in einem normalen Zuhause hatten, ist mir rätselhaft.
Sehr früh begriff ich, dass meine Mutter gegenüber den Männern der Familie benachteiligt war. Sie hatte gegen den Willen ihrer Eltern geheiratet, war gescheitert, wie man es ihr prophezeit hatte, und die Ehe wurde annulliert, was der einzig gangbare Weg war in diesem Land, in dem Ehen erst seit dem Jahr 2004 rechtmäßig geschieden werden können. Sie verfügte weder über eine Berufsausbildung, um zu arbeiten, noch über Geld oder über Freiheit, und sie bot Anlass für Gerede, weil sie von ihrem Mann getrennt und außerdem jung, hübsch und kokett war.
MEINZORNAUFDEN Machismo begann in diesen Kinderjahren, in denen ich meine Mutter und die Hausangestellten als Opfer erlebte, als untergeordnet, ohne Handhabe und ohne Stimme, meine Mutter, weil sie mit den Konventionen gebrochen hatte, die anderen Frauen, weil sie arm waren. Natürlich verstand ich das damals noch nicht, Worte dafür fand ich erst im Alter von fünfzig in der Therapie, doch die Gefühle von Frustration waren, auch ohne dass ich sie gedanklich erfassen konnte, mächtig genug, um für immer mein Verlangen nach Gerechtigkeit und meine tiefsitzende Abneigung gegen jede Form von männlicher Vorherrschaft zu prägen. Mein Widerwille galt als abwegig in meiner Familie, wo man sich zwar als intellektuell und modern begriff, nach heutigen Maßstäben jedoch schlicht steinzeitlich war.
Panchita konsultierte mehr als einen Arzt, um herauszufinden, was mit mir los sein könnte, ob ihre Tochter womöglich unter Bauchkrämpfen litt oder einen Bandwurm hatte. Halsstarrige und herausfordernde Züge, die man bei meinen Brüdern als männliche Grundeigenschaften begrüßt hätte, galten in meinem Fall als behandlungsbedürftig. Und ist das nicht fast immer so? Mädchen spricht man das Recht ab, zornig zu sein und außer sich zu geraten. Psychologen gab es auch damals schon in Chile, womöglich sogar Kinderpsychologen, aber einen aufzusuchen war aufgrund der herrschenden Tabus den heillos Irren vorbehalten und in meiner Familie noch nicht einmal denen. Unsere Spinner wurden hinter verschlossenen Türen ertragen. Meine Mutter bekniete mich, zurückhaltender zu sein. »Ich weiß nicht, wo du das alles herhast, wenn du so weitermachst, heißt es noch, du wärst ein Mannweib«, sagte sie einmal zu mir, wobei unklar blieb, was dieses Schimpfwort bedeuten sollte.
Sie hatte allen Grund zur Beunruhigung. Als ich sechs Jahre alt war, verwiesen die deutschen Nonnen mich wegen Aufsässigkeit von der Schule, wie ein Präludium zu dem, was mein weiterer Lebensweg sein würde. Ich frage mich gerade, ob sie das nicht in Wahrheit taten, weil Panchita vor dem Gesetz eine alleinstehende Mutter von drei Kindern war. Auch wenn das die Nonnen eigentlich nicht erschüttert haben dürfte, denn in Chile werden die meisten Kinder außerhalb von Ehen geboren, war es doch unerhört in der Gesellschaftsschicht, aus der die Schülerinnen dieser Lehranstalt kamen.
Jahrzehntelang habe ich meine Mutter als Opfer betrachtet, doch mittlerweile habe ich gelernt, dass ein Opfer als jemand definiert ist, der keine Kontrolle und Macht über seine Verhältnisse besitzt, und ich glaube, das trifft auf sie nicht zu. Sicher wirkte meine Mutter zunächst gefangen, verwundbar, zuweilen verzweifelt, doch ihre Lage änderte sich, als sie sich meinem Stiefvater anschloss und die beiden zu reisen begannen. Sie hätte stärker für ihre Unabhängigkeit eintreten können, dafür, das Leben zu führen, das sie sich wünschte, und ihr enormes Potential auszuschöpfen, anstatt sich zu unterwerfen, aber ich habe leicht reden, schließlich ist meine Generation mit dem Feminismus aufgewachsen, und ich hatte Chancen, die sie nie bekommen hat.
NOCHETWASFANDICH mit fünfzig in der Therapie heraus, dass nämlich die Abwesenheit eines Vaters bestimmt zu meiner Auflehnung in Kinderjahren beitrug. Ich brauchte sehr lange, um Onkel Ramón zu akzeptieren, wie ich den Mann, mit dem Panchita zusammenkam, als ich ungefähr elf war, ein Leben lang nannte, und um zu verstehen, dass ich keinen besseren Vater als ihn hätte haben können. Das begriff ich, als meine Tochter Paula geboren wurde, er hingerissen wurde von seiner Liebe zu ihr (seine Gefühle wurden erwidert) und ich zum ersten Mal die sanfte, einfühlsame und verspielte Seite dieses Stiefvaters wahrnahm, dem ich einst den Krieg erklärt hatte. Als Heranwachsende hatte ich ihn gehasst und seine Autorität in Frage gestellt, aber weil er ein unverbesserlicher Optimist war, bekam er das überhaupt nicht mit. Wollte man ihm glauben, bin ich immer eine vorbildliche Tochter gewesen. Onkel Ramón besaß allem Negativen gegenüber ein derart schlechtes Gedächtnis, dass er mich im Alter Angélica nannte – das ist mein Zweitname – und mir riet, auf der Seite zu schlafen, um meine Engelsflügel nicht zu zerdrücken. Das wiederholte er bis zum Ende seiner Tage, als er durch Demenz und Lebensmattigkeit schon nur noch ein Schatten seiner selbst war.
Über die Zeit wurde Onkel Ramón zu meinem besten Freund und Vertrauten. Er war fröhlich, herrisch, stolz und ein Macho, auch wenn er das mit dem Argument von sich wies, niemand verhalte sich Frauen gegenüber respektvoller als er. Ich konnte ihm nie wirklich begreiflich machen, worin sein ausgeprägter Machismo im Kern bestand. Er hatte seine Frau verlassen, mit der er vier Kinder hatte, und die Annullierung dieser Ehe konnte er nicht erwirken, sich also mit meiner Mutter nicht rechtskräftig verbinden, was die beiden aber nicht daran hinderte, fast siebzig Jahre zusammenzuleben, und auch wenn das zu Beginn für Empörung und Gerede sorgte, stellte später kaum noch jemand ihre Verbindung in Frage, weil die Sitten sich lockerten und man sich wegen der fehlenden Scheidungsmöglichkeit allenthalben ohne Papierkram zusammenfand und trennte.
Panchita bewunderte die Vorzüge ihres Partners, ärgerte sich aber nicht weniger über seine Unzulänglichkeiten. Die Rolle einer Ehefrau, die nichts zu sagen hat und häufig wütend ist, übernahm sie aus Liebe und weil sie sich nicht in der Lage sah, ihren Kindern allein eine Zukunft zu bieten. Ernährt und beschützt zu werden hatte eben seinen Preis.
MEINENLEIBLICHENVATERHABE ich nie vermisst, und ich war nie neugierig, etwas über ihn zu erfahren. Als Bedingung dafür, dass er der Annullierung der Ehe zustimmte, hatte er von Panchita verlangt, sich nicht um seine Kinder kümmern zu müssen, und das trieb er so weit, dass er nie mehr den Kontakt zu uns suchte. Die seltenen Male, wenn sein Name in der Familie fiel – alle mieden das Thema tunlichst –, bekam meine Mutter heftige Kopfschmerzen. Mir gegenüber behauptete man nur, er sei sehr klug und habe mich sehr geliebt, habe mir klassische Musik vorgespielt und Kunstbücher mit mir angeschaut, so dass ich schon mit zwei Jahren erkennen konnte, von welchem Maler ein Bild stammte. Er sagte Monet oder Renoir, und ich fand die entsprechende Seite im Buch. Ich bezweifele das. Mir würde das heute im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte nicht gelingen. Da sich das aber, wenn überhaupt, vor meinem dritten Lebensjahr ereignet haben muss, kann ich mich an nichts erinnern, trotzdem hat die plötzliche Fahnenflucht meines Vaters mich geprägt. Wie sollte ich Vertrauen haben zu Männern, wenn sie einen heute lieben und sich morgen in Luft auflösen?
Der Fortgang meines Vaters ist nicht außergewöhnlich. In Chile sind die Frauen die Stützen von Familie und Gemeinschaft, vor allem in der Arbeiterklasse, wo die Väter kommen und gehen, und das nicht selten für immer, ohne je wieder einen Gedanken an ihre Kinder zu verschwenden. Die Mütter hingegen sind fest verwurzelte Bäume. Sie kümmern sich um die eigenen Kinder und wenn nötig auch um die von anderen. Sie sind so stark und praktisch veranlagt, dass zuweilen behauptet wird, Chile sei ein Matriarchat, und noch die vorgestrigsten Typen wiederholen das, ohne rot zu werden, dabei ist es weit entfernt von der Wahrheit. Die Männer herrschen in Politik und Wirtschaft, sie erlassen die Gesetze und wenden sie nach ihrem Gutdünken an, und falls das nicht genügt, mischt die Kirche sich ein mit ihrem altbackenen patriarchalen Gepräge. Die Frauen haben nur innerhalb ihrer Familie das Sagen … manchmal.
INEINEMDIESERINTERVIEWS, vor denen ich Bammel habe, weil man mit Allerweltsfragen bombardiert wird, auf die man wie bei einem tückischen Psychotest in Windeseile antworten soll, hatte ich neulich zwei Sekunden, um zu entscheiden, mit welcher meiner Romanfiguren ich am liebsten zu Abend essen wollte. Hätte man mich gefragt, mit welchen Menschen ich gerne essen gehen wollte, hätte ich auf der Stelle geantwortet: mit Paula, meiner Tochter, und mit Panchita, meiner Mutter, zwei Geistern, die stets um mich sind, aber hier sollte es ja eine literarische Figur sein. Ich konnte das nicht so unmittelbar beantworten, wie es dem Interviewer vorschwebte, denn ich habe mehr als zwanzig Bücher geschrieben, und ich würde fast mit jeder meiner Hauptfiguren, sowohl Frauen als auch Männern, gerne essen gehen, aber als ich etwas Zeit zum Nachdenken bekam, entschied ich mich für Eliza Sommers, die junge Frau aus Fortunas Tochter. Als ich 1999 zum Erscheinen des Buchs in Spanien gewesen war, hatte ein aufgeweckter Journalist meinen Roman eine Allegorie auf den Feminismus genannt. Damit lag er richtig, auch wenn ich das beim Schreiben ehrlich nicht im Sinn gehabt hatte.
Mitte des 19. Jahrhunderts, also zu viktorianischen Hochzeiten, wuchs Eliza Sommers heran, wurde in ein Korsett gezwängt, daheim eingesperrt, verfügte kaum über Bildung und noch weniger über Rechte, war dafür vorgesehen, zu heiraten und Kinder zu bekommen, verließ jedoch ihr abgesichertes Zuhause und machte sich von Chile aus auf den Weg ins vom Goldrausch erfasste Kalifornien. Um zu überleben, kleidete sie sich als Mann und lernte, in einem extrem männlich geprägten Umfeld voller Gier, Ehrgeiz und Gewalt auf eigenen Füßen zu stehen. Nachdem sie unzählige Hindernisse überwunden und Gefahren überstanden hatte, konnte sie wieder in Frauenkleider schlüpfen, trug aber nie mehr ein Korsett. Sie hatte ihre Freiheit errungen und würde sie nicht wieder hergeben.
Elizas Werdegang weist tatsächlich Ähnlichkeiten auf mit dem der Frauen, die durch ihre Emanzipation die Welt der Männer im Sturm erobert haben. Dafür mussten wir uns verhalten wie die Männer, ihre Taktiken lernen und mit ihnen in Konkurrenz treten. Ich erinnere mich noch an Zeiten, als die Frauen, um ernst genommen zu werden, mit Hosen und Jacketts ins Büro kamen und manchmal sogar Krawatte trugen. Das ist inzwischen nicht mehr notwendig, wir können unsere Macht aus der Weiblichkeit heraus entfalten. Wie Eliza haben wir einiges an Freiheit errungen, und wir kämpfen weiter, um sie zu erhalten, sie zu erweitern und sicherzustellen, dass alle Frauen in ihren Genuss kommen. Davon würde ich Eliza gerne erzählen, ginge sie mit mir essen.
FEMINISMUSWIRKTHÄUFIGEINSCHÜCHTERND, weil er mitunter radikal daherkommt oder als Hass auf die Männer verstanden wird, deshalb möchte ich hier, ehe ich fortfahre, für einige meiner Leserinnen etwas klären. Beginnen wir mit dem Begriff »Patriarchat«.
Meine Definition von »Patriarchat« unterscheidet sich vielleicht ein wenig von der, die sich bei Wikipedia oder in gedruckten Enzyklopädien nachlesen lässt. Ursprünglich stand der Begriff für die absolute Vorherrschaft des Mannes über die Frau, über andere Lebewesen und die Natur, und auch wenn die feministische Bewegung diese absolute Macht in einigen Bereichen untergraben hat, besteht sie in anderen seit tausenden von Jahren weitgehend unangetastet fort. Gewiss wurden inzwischen viele diskriminierende Gesetze geändert, das Patriarchat ist aber noch immer das vorherrschende System politischer, wirtschaftlicher, kultureller und religiöser Unterdrückung, das dem männlichen Geschlecht Macht und Privilegien einräumt. Neben Misogynie – der Geringschätzung von Frauen – umfasst dieses System noch verschiedene andere Formen von Ausgrenzung und Aggression: Rassismus, Homophobie, Klassendenken, Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz gegenüber Menschen mit anderen Vorstellungen oder einem anderen Lebensstil. Das Patriarchat setzt sich aggressiv durch, verlangt Gehorsam und bestraft diejenigen, die sich trauen, ihm entgegenzutreten.
Und worin besteht nun mein Feminismus? Dass es nicht darauf ankommt, was wir zwischen den Beinen, sondern was wir zwischen den Ohren haben. Er ist eine philosophische Haltung und eine Auflehnung gegen die Herrschaft der Männer. Er ist eine Form, die Beziehungen zwischen Menschen zu verstehen und auf die Welt zu schauen, er setzt auf Gerechtigkeit, kämpft nicht nur für die Emanzipation von Frauen, von schwulen, lesbischen und queeren Menschen (LGBTQIA+) und allen anderen, die durch das System unterdrückt werden, sondern von jeder Person, die sich anschließen möchte. Herzlich willkommen, würden die jungen Leute heutzutage wohl sagen: Je mehr wir sind, desto besser.
In meiner Jugend arbeitete ich mich an der Gleichheit ab, ich wollte mitmachen beim Spiel der Männer, aber im Alter habe ich begriffen, dass dieses Spiel ein Irrsinn ist, weil es den Planeten und den moralischen Zusammenhalt der Menschheit zerstört. Es kann nicht darum gehen, bei dem Desaster mitzumischen, es muss behoben werden. Natürlich sieht sich diese Bewegung mächtigen reaktionären Kräften gegenüber, wie Fundamentalismus, Faschismus, Traditionalismus und einigen mehr. Mich deprimiert, dass sich in diesen Gegenströmungen so viele Frauen finden, die den Wandel fürchten und sich keine andere Zukunft vorstellen können.
Das Patriarchat ist aus Stein, der Feminismus dagegen ein bewegter Ozean, mächtig, tief und so unendlich vielschichtig wie das Leben selbst. Er wogt, strömt, kennt Gezeiten und zuweilen wütende Stürme. Wie der Ozean gibt auch der Feminismus niemals Ruhe.
Nein, schweigend du bist nicht hübscher.
Du bist eine Schönheit, wenn du kämpfst,
wenn du eintrittst für dich,
wenn du nicht schweigst
und deine Wörter beißen,
wenn du den Mund aufmachst
und alles um dich her brennt.
Nein, schweigend du bist nicht hübscher,
du bist nur ein bisschen toter,
und wenn ich etwas weiß über dich,
dann, dass ich nie
niemals
jemand gesehen habe mit so viel Lust zu leben.
Lautstark.
MIGUEL GANE, »Brennt«
VONKLEINAUFNAHM ich an, dass ich so früh wie möglich auf eigenen Füßen stehen und für meine Mutter sorgen müsste. Diese Annahme ergab sich aus dem, was mein Großvater mir vermittelte, der als unangefochtener Patriarch der Familie begriff, dass es ein Nachteil war, eine Frau zu sein, und mir die Waffen in die Hand geben wollte, damit ich nie abhängig sein müsste. Ich verbrachte meine ersten acht Lebensjahre unter seiner Obhut und zog dann mit sechzehn erneut zu ihm, als Onkel Ramón mich und meine Brüder zurück nach Chile schickte. Damals lebten wir im Libanon, wo er als Konsul arbeitete, doch 1958 drohten politische und religiöse Konflikte das Land in einen Bürgerkrieg zu stürzen. Meine Brüder kamen auf ein Militärinternat in Santiago, ich kehrte zurück zu meinem Großvater.
Großvater Agustín hatte mit vierzehn Jahren zu arbeiten begonnen, weil die Familie nach dem Tod seines Vaters mittellos war. Für ihn bestand das Leben aus Disziplin, Anstrengung und Verantwortung. Er trug den Kopf hoch erhoben: Die Ehre ging über alles. In seiner stoischen Schule, die ich durchlief, galt es, jede Angeberei und Verschwendung zu meiden, sich nicht zu beklagen, alles auszuhalten, seine Pflicht zu erfüllen, um nichts zu bitten und nichts zu erwarten, alleine klarzukommen, zu helfen und für andere da zu sein, ohne sich dessen zu rühmen.
Des Öfteren hörte ich folgende Geschichte von ihm: Es war einmal ein Mann, der hatte einen einzigen Sohn, den er von ganzem Herzen liebte. Als der Junge vierzehn Jahre alt wurde, forderte sein Vater ihn auf, ohne Angst vom Balkon im ersten Stock zu springen, er werde ihn auffangen. Der Junge tat, wie ihm geheißen, doch der Vater rührte keinen Finger und sah zu, wie sein Sohn sich beim Aufprall im Hof mehrere Knochen brach. Die Moral der grausamen Geschichte war, dass man niemandem vertrauen sollte, nicht einmal dem eigenen Vater.
Trotz seiner Strenge war mein Großvater sehr beliebt, denn er war großzügig und bedingungslos für seine Nächsten da. Ich vergötterte ihn. Ich erinnere mich noch gut an sein schlohweißes Haar, sein schallendes, gelbzahniges Lachen, seine von der Arthritis krummen Finger, seinen schalkhaften Humor und die unbestreitbare Tatsache, dass ich sein liebstes Enkelkind war. Zweifellos hätte er sich gewünscht, ich wäre ein Junge geworden, aber dann blieb ihm nichts anderes übrig, als mich trotz meines Geschlechts zu lieben, weil ich ihn an seine Frau erinnerte, meine Großmutter Isabel, von der ich den Namen habe und den Ausdruck in den Augen.
INDERPUBERTÄTWURDEOFFENSICHTLICH, dass ich nirgends hineinpasste, und mein armer Großvater musste sich mit mir herumschlagen. Nicht dass ich faul oder unverschämt gewesen wäre, im Gegenteil, ich war eine sehr gute Schülerin und fügte mich ohne Murren den Regeln des Zusammenlebens, aber ich lebte in einem Zustand unterdrückten Zorns, der sich nicht in Geschrei oder Türenknallen offenbarte, sondern in fortgesetztem anklagendem Schweigen. Ich war verheddert in meinen Komplexen, fühlte mich hässlich, machtlos, unsichtbar, gefangen in einem beengten Alltag und sehr allein. Ich gehörte zu keiner Gruppe, kam mir anders und ausgeschlossen vor. Gegen meine Einsamkeit verschlang ich Bücher und schrieb jeden Tag an meine Mutter, die vom Libanon in die Türkei verpflanzt worden war. Sie schrieb mir ebenso oft, und es kümmerte uns nicht, dass die Briefe ihr Ziel erst nach Wochen erreichten. Damit begann der Briefwechsel, den wir ein Leben lang beibehalten sollten.
Schon als Kind besaß ich ein ausgeprägtes Bewusstsein für Ungerechtigkeiten. Ich weiß noch, dass die Hausangestellten, als ich klein war, von früh bis spät arbeiteten, fast nie aus dem Haus gingen, einen Hungerlohn bekamen und in fensterlosen Kabuffs schliefen, in denen es außer einer Pritsche und einer windschiefen Kommode keine Möbel gab. (Das war in den vierziger und fünfziger Jahren, natürlich ist das heute in Chile nicht mehr so.) In der Pubertät verschärfte sich mein Sinn für Gerechtigkeit derart, dass ich, während andere Mädchen mit ihrem Aussehen und mit der Jagd auf einen Verlobten beschäftigt waren, Reden über Sozialismus und Frauenrechte schwang. Ich hatte nicht von ungefähr keine Freundinnen. Die Ungleichheit, die in Chile zwischen den Gesellschaftsschichten, den Einkommen und den damit einhergehenden Chancen sehr ausgeprägt ist, machte mich wütend.
Am schlimmsten betroffen von Diskriminierung sind die Armen – das ist immer so –, mich belastete aber mehr, was die Frauen auszuhalten hatten, weil mir schien, dass man der Armut bisweilen entkommen kann, hingegen niemals den Bedingungen, denen man aufgrund der Geschlechterrolle unterliegt. Dass sich selbst das biologische Geschlecht ändern ließe, hätte sich damals niemand träumen lassen. Zwar hatte es auch bei uns von jeher kämpferische Frauen gegeben, sie hatten das Frauenwahlrecht und andere Rechte erstritten, hatten die Bildungschancen für Frauen verbessert und mischten mit in der Politik, im Gesundheitswesen, in Wissenschaft und Kunst, aber insgesamt waren wir Lichtjahre entfernt von der Frauenbewegung in Europa und den USA. In meiner Umgebung sprach kein Mensch über die Lage der Frau, nicht bei mir zu Hause, nicht in der Schule, nicht in der Presse, deshalb ist mir unerklärlich, wie ich damals zu diesem Bewusstsein kam.
ERLAUBENSIEMIREINEN