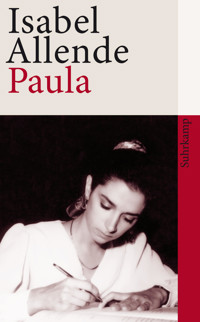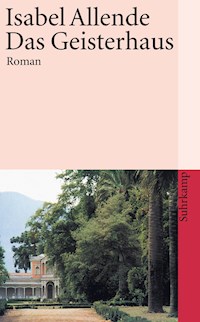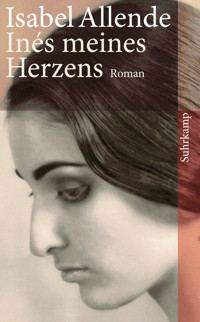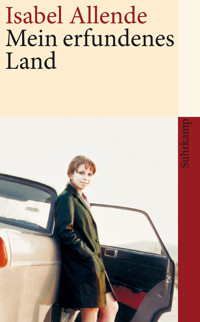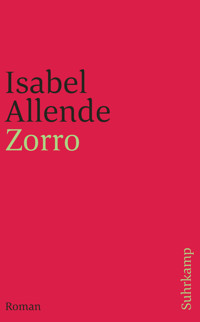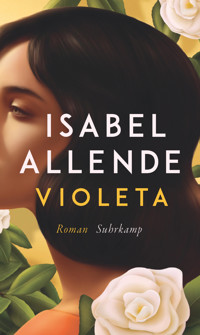
13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Violeta ist die inspirierende Geschichte einer eigensinnigen, leidenschaftlichen, humorvollen Frau, deren Leben ein ganzes Jahrhundert umspannt. Einer Frau, die Aufruhr und Umwälzungen ihrer Zeit nicht nur bezeugt, sondern am eigenen Leib erfährt und erleidet. Und die sich gegen alle Rückschläge ihre Hingabe bewahrt, ihre innige Liebe zu den Menschen und zur Welt.
An einem stürmischen Tag des Jahres 1920 kommt sie zur Welt, jüngste Schwester von fünf übermütigen Brüdern, Violeta del Valle. Die Auswirkungen des Krieges sind noch immer spürbar, da verwüstet die Spanische Grippe bereits ihre südamerikanische Heimat. Zum Glück hat der Vater vorgesorgt, die Familie kommt durch, doch schon droht das nächste Unheil, die Weltwirtschaftskrise wird das vornehme Stadtleben, in dem Violeta aufwächst, für immer beenden, die del Valles ziehen sich ins wild-schöne Hinterland zurück. Dort wird Violeta volljährig, und schon steht der erste Verehrer vor der Tür …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cover
Titel
Isabel Allende
Violeta
Roman
Aus dem Spanischen von Svenja Becker
Suhrkamp Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel Violeta bei Plaza y Janés, Barcelona.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der 5. Auflage der deutschen Erstausgabe, 2023.
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2022© ISABEL ALLENDE, 2021.
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg, nach Entwürfen von Elena Giavaldi
Umschlagillustration: Amanda Arlotta
eISBN 978-3-518-77377-2
www.suhrkamp.de
Motto
Tell me, what is it you plan to do
with your one wild and precious life?
Sag mir, was willst du selber tun
mit deinem einzigen wilden und wertvollen Leben?
Mary Oliver, »The Summer Day«
Violeta
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Motto
ERSTER TEIL
. Die Verbannung 1920-1940
1
2
3
4
5
6
ZWEITER TEIL
. Leidenschaft 1940-1960
7
8
9
10
11
12
13
DRITTER TEIL
. Die Abwesenden 1960-1983
14
15
16
17
18
19
20
VIERTER TEIL
. Wiedergeburt 1983-2020
21
22
23
24
25
26
27
28
Lebe wohl, Camilo
Dank
Informationen zum Buch
Mein geliebter Camilo,
mit diesen Seiten möchte ich Dir ein Zeugnis hinterlassen, weil ich mir vorstelle, dass Dich in ferner Zukunft, wenn Du alt bist und an mich denkst, Dein Gedächtnis womöglich im Stich lässt, denn Du bist so zerstreut, und mit den Jahren wird das nicht besser. Mein Leben ist es wert, erzählt zu werden, was weniger an meinen tugendhaften als an meinen sündigen Taten liegt, von denen Du viele nicht ahnst. Hier erzähle ich Dir von ihnen. Du wirst sehen, mein Leben ist ein Roman.
Du verwahrst meine Briefe, und bis auf einige der eben erwähnten Sünden ist darin mein gesamtes Leben aufgezeichnet, doch musst Du Dein Versprechen halten und sie nach meinem Tod verbrennen, denn sie sind rührselig und nicht selten gehässig. Diese Zusammenfassung soll meine ausufernde Korrespondenz ersetzen.
Ich liebe Dich mehr als irgendwen sonst auf der Welt
Violeta
Santa Clara, September 2020
ERSTER TEIL
Die Verbannung 1920-1940
1
Ich kam an einem stürmischen Freitag des Jahres 1920 zur Welt, im Jahr der Seuche. Am Abend meiner Geburt war wie so oft bei Gewitter der Strom ausgefallen, und man hatte die Kerzen und Petroleumlampen angezündet, die für derlei Notfälle bereitstanden. Meine Mutter, María Gracia, erkannte die einsetzenden Wehen, da sie bereits fünf Söhne geboren hatte, überließ sich dem Schmerz in der Gewissheit, dass sie einen weiteren Jungen zur Welt bringen würde, und vertraute auf die Hilfe ihrer Schwestern, die ihr schon mehrfach zur Seite gestanden hatten und die Nerven bewahrten. Der Arzt der Familie arbeitete seit Wochen unermüdlich in einem der Notlazarette, und es wäre ihnen leichtsinnig erschienen, ihn für etwas so Gewöhnliches wie eine Geburt zu bemühen. Bei früheren Gelegenheiten hatten sie auf die immer gleiche Hebamme zurückgreifen können, aber die Frau war unter den ersten Opfern der Seuche gewesen, und eine andere Geburtshelferin kannten sie nicht.
Meine Mutter überlegte, dass sie ihr gesamtes Erwachsenenleben schwanger verbracht hatte, im Wochenbett oder sich von einer Fehlgeburt erholend. Ihr ältester Sohn, José Antonio, war gerade siebzehn geworden, da war sie sich sicher, denn er war in dem Jahr geboren, als die Erde so schlimm bebte, dass das halbe Land in Trümmern lag und man Tausende Tote beklagte, aber an das genaue Alter ihrer übrigen Söhne erinnerte sie sich so wenig wie an die Zahl ihrer missglückten Schwangerschaften. Nach jeder war sie für Monate unpässlich gewesen, und nach jeder Geburt für lange Zeit erschöpft und schwermütig. Vor ihrer Hochzeit hatte sie als die schönste Debütantin in der Hauptstadt gegolten, rank und schlank, das Gesicht mit den grünen Augen und dem durchscheinenden Teint unvergesslich, doch die Zumutungen der Mutterschaft hatten ihren Körper verunstaltet und ihr Gemüt ausgelaugt.
Theoretisch liebte sie ihre Kinder, praktisch zog sie es jedoch vor, einen gewissen Abstand zu wahren, weil die energiegeladene Jungsmeute mit Schlachtenlärm in ihr kleines weibliches Hoheitsgebiet einfiel. Einmal bemerkte sie ihrem Beichtvater gegenüber, sie sei vom Teufel dazu erkoren, ausschließlich Jungen zu gebären. Als Buße musste sie zwei Jahre hindurch täglich einen Rosenkranz beten und eine beträchtliche Summe für die Renovierung der Kirche spenden. Ihr Ehemann untersagte ihr, je wieder zu beichten.
Unter der Aufsicht von Tante Pilar kletterte Torito, der Junge, der im Haus für alle erdenklichen Arbeiten angestellt war, auf eine Leiter und befestigte die für derlei Gelegenheiten im Schrank lagernden Riemen an den beiden von ihm in die Zimmerdecke getriebenen Stahlhaken. Im Nachthemd hockte meine Mutter sich hin, krallte sich mit jeder Hand in einen Riemen, presste eine ihr endlos scheinende Weile und stieß dabei Verwünschungen aus, die ihr sonst niemals über die Lippen gekommen wären. Meine Tante Pía kauerte zwischen ihren Beinen und machte sich darauf gefasst, das Neugeborene in Empfang zu nehmen, ehe es den Boden berührte. Ihre Tees aus Brennnessel, Beifuß und Raute standen schon für den Moment nach der Entbindung bereit. Der Sturm, der gegen die Jalousien schlug und einzelne Dachpfannen aus den Ziegelreihen brach, übertönte das Wehklagen und den letzten langen Schrei, unter dem ich zunächst den Kopf sehen ließ und gleich darauf den mit Schleim und Blut überzogenen Körper, der meiner Tante durch die Finger glitt und auf den Holzboden knallte.
»Pass doch auf, Pía!«, schrie Pilar, hob mich an einem Fuß in die Höhe und rief erstaunt: »Ein Mädchen!«
»Ausgeschlossen, schau noch mal nach«, murmelte meine erschöpfte Mutter.
»Wenn ich's dir sage, Schwester: kein Röhrchen.«
An diesem Abend kam mein Vater spät aus dem Club nach Hause, wo er diniert und etliche Partien Brisca gespielt hatte, und begab sich zunächst in sein Zimmer, um sich umzukleiden und vorsorglich mit Alkohol abzureiben, ehe er seine Familie begrüßte. Er bat die Bedienstete um ein Glas Cognac, und ihr kam es nicht in den Sinn, ihm die Neuigkeit mitzuteilen, da sie es nicht gewohnt war, das Wort an ihren Dienstherrn zu richten, dann ging er zu seiner Frau. Der rostige Blutgeruch kündigte ihm das Geschehene bereits an, bevor er über die Schwelle trat. In einem sauberen Nachthemd, gerötet und mit schweißnassem Haar lag meine Mutter im Bett und ruhte sich aus. Die Riemen waren schon von der Decke entfernt und die Eimer mit den blutigen Lappen verschwunden.
»Wieso habt ihr mir nicht Bescheid gegeben!«, beschwerte er sich, nachdem er seine Frau auf die Stirn geküsst hatte.
»Wie hätten wir das bitte anstellen sollen? Du hattest den Fahrer dabei, und zu Fuß wäre bei diesem Sturm keine von uns rausgegangen, selbst wenn deine bewaffneten Handlanger uns gelassen hätten«, hielt Pilar ihm entgegen.
»Es ist ein Mädchen, Arsenio«, meldete sich Pía. »Du hast endlich eine Tochter.« Sie deutete mit dem Kinn auf das Bündel in ihren Armen.
»Gott sei's gedankt!«, hauchte mein Vater, doch sein Lächeln erstarb, als er sah, was da zwischen den Tuchfalten zum Vorschein kam. »Sie hat ein Ei auf der Stirn!«
»Keine Sorge. Manche Kinder haben das bei der Geburt, nach ein paar Tagen wächst es sich aus: Ein Zeichen für Klugheit«, improvisierte Pilar, weil sie nicht zugeben wollte, dass seine Tochter eine Bruchlandung ins Leben hinter sich hatte.
»Wie soll sie heißen?«, fragte Pía.
»Violeta«, sagte meine Mutter entschlossen und ließ ihrem Mann keine Gelegenheit zum Einspruch.
Das ist der illustre Name meiner Urgroßmutter mütterlicherseits, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts das Wappen auf die erste Unabhängigkeitsflagge des Landes gestickt hat.
Die Pandemie hatte meine Familie nicht unvorbereitet getroffen. Nach den ersten Gerüchten über Sterbenskranke, die sich durch die Straßen am Hafen schleppten, und über eine alarmierende Zahl von blauschwarzen Toten im Leichenschauhaus überlegte mein Vater, Arsenio del Valle, dass es keine zwei Tage mehr dauern würde, bis die Seuche die Hauptstadt erreicht hätte, blieb jedoch gelassen, da er die Krankheit bereits erwartete. Er hatte sich mit demselben Eifer gegen sie gewappnet, den er bei allem an den Tag legte, der ihm bei seinen Geschäften half und dabei, zu Geld zu kommen. Von den Geschwistern del Valle war er als Einziger drauf und dran, das Ansehen des wohlhabenden Mannes zurückzugewinnen, das mein Urgroßvater besessen hatte und das mein Großvater erbte, über die Jahre jedoch verlor, weil er zu viele Kinder bekam und redlich war. Von den fünfzehn Kindern dieses Großvaters blieben beachtliche elf am Leben, was, wie mein Vater prahlte, die Stärke der Blutslinie del Valle bewies, doch eine derart vielköpfige Familie zu unterhalten kostet Mühe und Geld, und das Vermögen schmolz dahin.
Noch bevor die Presse die Krankheit beim Namen nannte, wusste mein Vater, dass es sich um die Spanische Grippe handelte, denn er informierte sich über die Weltlage mit Hilfe der ausländischen Zeitungen, die etwas verspätet im Club de la Unión eintrafen, aber doch aussagekräftiger waren als die lokalen Blätter, und außerdem besaß er ein eigenhändig nach Bauanleitung zusammengeschraubtes Funkgerät, das ihm den Kontakt zu anderen Hobbyfunkern ermöglichte, so dass er unter dem Rauschen und Kratzen der Kurzwellenverbindung erfahren hatte, welche Verheerungen das Virus andernorts anrichtete. Er hatte die Ausbreitung der Pandemie von Anfang an verfolgt, wusste, dass die Krankheit wie ein todbringender Wind durch Europa und die Vereinigten Staaten gefegt war, und dachte, wenn ihre Auswirkungen in zivilisierteren Ländern derart tragisch waren, so würde es bei uns, wo die Mittel begrenzt und die Menschen unwissender waren, noch schlimmer kommen.
Die Spanische Grippe erreichte uns mit einer Verspätung von fast zwei Jahren. Aus Wissenschaftskreisen verlautete, die geographische Lage habe uns vor der Ansteckung bewahrt, die natürliche Barriere aus Gebirge auf der einen, Ozean auf der anderen Seite, dazu das günstige Klima und die Weltabgewandtheit, die uns unnötige Kontakte zu infizierten Ausländern ersparte, doch das Volk schrieb es einmütig dem Wirken von Padre Juan Quiroga zu, für den man vorsorglich Wallfahrten veranstaltet hatte. Da er bei Wundern für den Hausgebrauch jeden anderen aussticht, ist er der einzige Heilige, dessen Verehrung sich lohnt, auch wenn der Vatikan ihn bisher nicht kanonisiert hat. Doch 1920 traf uns das Virus dann mit unvorstellbarer Wucht und machte jede wissenschaftliche und theologische Theorie zunichte.
Die Krankheit begann mit einem Grabesfrösteln, gegen das nichts half, dann fiebriges Schlottern, der Kopf wie im Schraubstock, Augen und Kehle in Flammen, Sinnestrübung und Angstbilder vom Tod, der eine Armeslänge entfernt lauerte. Die Haut verfärbte sich rötlich blau, wurde dunkler und dunkler, Hände und Füße liefen schwarz an, Husten raubte den Atem, blutiger Schaum überschwemmte die Lunge, das Opfer wimmerte vor Entsetzen, bis es am Ende erstickte. Wer Glück hatte, starb binnen weniger Stunden.
Nicht ohne Grund vermutete mein Vater, dass die Grippe während des Kriegs in Europa unter den Soldaten, die in den Schützengräben aufeinanderhockten und eine Ansteckung nicht vermeiden konnten, mehr Opfer gefordert hatte als Kugeln und Senfgas. Ähnlich verheerend wütete sie in den Vereinigten Staaten und in Mexiko und breitete sich von dort nach Südamerika aus. Die Zeitungen schrieben, in anderen Ländern würden die Leichen in den Straßen wie Brennholz gestapelt, man komme beim Bestatten nicht nach und es fehle Platz auf den Friedhöfen, ein Drittel der Menschheit sei infiziert und über fünfzig Millionen seien bereits gestorben, doch waren die Meldungen ähnlich undurchsichtig wie die grausigen Gerüchte, die umgingen. Vor achtzehn Monaten war der Waffenstillstand unterzeichnet worden, mit dem die vier Schreckensjahre des Krieges in Europa endeten, und erst allmählich kam das tatsächliche Ausmaß der Pandemie ans Licht, die von der Militärzensur vertuscht worden war. Kein Land hatte seine Opferzahlen offengelegt. Einzig Spanien, das im Krieg neutral geblieben war, berichtete über die Krankheit, und so bekam sie schließlich den Namen »Spanische Grippe«.
Zuvor waren die Menschen hierzulande aus den immer gleichen Gründen gestorben, an hoffnungsloser Armut, am Suff, durch Handgreiflichkeiten oder Unfälle, an verunreinigtem Wasser, an Typhus oder Altersschwäche. Das war der natürliche Gang der Dinge, der einem Zeit ließ für ein würdiges Begräbnis, doch als die Seuche uns anfiel wie ein hungriger Tiger, war es vorbei mit dem Trost für die Sterbenden und den Ritualen der Trauer.
Die ersten Fälle traten Ende Herbst in den Freudenhäusern am Hafen auf, außer meinem Vater schenkte jedoch niemand ihnen die gebührende Beachtung, da die Opfer wenig tugendhafte Frauenzimmer, Ganoven und Drogenhändler waren. Man tat es ab als eine von Matrosen aus Indonesien eingeschleppte Geschlechtskrankheit. Sehr bald ließ sich das allgemeine Unglück jedoch nicht mehr leugnen oder der Zügellosigkeit und dem Lotterleben zuschreiben, denn die Krankheit unterschied nicht zwischen Sündern und Tugendhaften. Das Virus hatte Padre Quiroga besiegt und griff jetzt unaufhaltsam um sich, befiel Kinder und Alte, Arme und Reiche. Als das gesamte Zarzuela-Ensemble und etliche Mitglieder des Kongresses erkrankten, verkündete die Boulevardpresse den Weltuntergang, und die Regierung entschied, alle Grenzen zu schließen und die Häfen zu überwachen. Da war es bereits zu spät.
Nutzlos die Messen mit drei Priestern und die Beutelchen mit Kampfer, die, um den Hals getragen, eine Ansteckung verhindern sollten. Dass der Winter bevorstand und der erste Regen fiel, verschlimmerte die Lage. Auf Sportplätzen wurden Notlazarette errichtet, Leichen lagerten in den Kühlhäusern des städtischen Schlachthofs, und in Massengräbern streute man Branntkalk über die Kadaver der Armen. Weil inzwischen bekannt war, dass die Krankheit über Nase und Mund in den Körper gelangte und nicht über Mückenstiche oder Darmwürmer, wie vom gemeinen Volk gemutmaßt, wurde das Tragen von Schutzmasken verordnet, doch selbst für das medizinische Personal, das sich an vorderster Front mühte, standen sie nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung, und so ging das Gros der Bevölkerung leer aus.
Der Präsident, ein Sohn italienischer Einwanderer, hegte fortschrittliche Ideen und war einige Monate zuvor mit den Stimmen der aufstrebenden Mittelschicht und der Arbeitergewerkschaften ins Amt gelangt. Wie alle Angehörigen der Familie del Valle, alle seine Freunde und Bekannten misstraute auch mein Vater diesem Präsidenten, weil die Reformen, die er anstrebte, für die Konservativen wenig vorteilhaft waren, er als Emporkömmling galt und keinen der altehrwürdigen kastilisch-baskischen Namen trug, aber damit, wie er der Katastrophe begegnete, war mein Vater einverstanden. Zunächst wurde angeordnet, dass alle zu Hause bleiben sollten, um Ansteckungen zu vermeiden, und als dem niemand nachkam, rief der Präsident den Notstand aus, verhängte eine nächtliche Ausgangssperre und untersagte der Zivilbevölkerung unter Androhung von Bußgeld, Arrest und nicht selten auch Hieben, sich ohne triftigen Grund von der Stelle zu bewegen.
Schulen wurden geschlossen, Geschäfte, Parkanlagen und andere Orte, an denen gewöhnlich viele Menschen zusammenkamen, doch blieben einige Behörden und die Banken geöffnet, Lastwagen und Züge durften die Städte mit Waren versorgen, und auch der Schnapsverkauf blieb gestattet, da es hieß, die Einnahme großer Mengen Alkohol und Aspirin töte den Erreger. Wie viele Opfer diese giftige Alkohol-Aspirin-Mischung forderte, würde kein Mensch wissen, gab meine Tante Pía zu bedenken, die abstinent war und nicht daran glaubte, dass Arzneimittel aus der Apotheke überhaupt etwas ausrichteten. Wie mein Vater befürchtet hatte, kam die Polizei beim Durchsetzen der Regeln und der Verbrechensbekämpfung nicht nach, und für die Straßenpatrouillen musste aufs Militär zurückgegriffen werden, obwohl das aus guten Gründen als brutal verschrien war. Die Oppositionsparteien schlugen Alarm, ebenso Intellektuelle und Künstler, die nicht vergessen hatten, welches Massaker Soldaten einige Jahre zuvor an wehrlosen Arbeitern, Frauen und Kindern verübt hatten und wie die Truppe immer wieder mit aufgepflanzten Bajonetten gegen die Zivilbevölkerung vorging, als handelte es sich um feindliche Invasoren.
Die Wallfahrtskirche von Padre Juan Quiroga füllte sich mit Pilgern, die Heilung von der Grippe suchten und sie in vielen Fällen auch fanden, selbst wenn die Ungläubigen, die stets zur Stelle sind, behaupteten, dass ein Kranker, der es die zweiunddreißig Stufen zur Kapelle auf dem Cerro San Pedro hinaufschaffte, bereits aus dem Gröbsten heraus sein musste. Das konnte die Gläubigen nicht beirren. Trotz des Versammlungsverbots bildete sich spontan eine Prozession, die angeführt von zwei Bischöfen zur Wallfahrtskirche aufbrechen wollte, jedoch von Soldaten mit Gewehrkolben und Schüssen auseinandergetrieben wurde. Nach einer knappen Viertelstunde waren zwei Tote und dreiundsechzig Verletzte zu beklagen, von denen einer noch in derselben Nacht starb. Der förmliche Protest der Bischöfe wurde vom Präsidenten abgeschmettert, er empfing die Würdenträger nicht in seinem Büro und ließ nur schriftlich über sein Sekretariat ausrichten: »Wer gegen Gesetze verstößt, bekommt die harte Hand zu spüren, selbst wenn er Papst ist.« Allen war die Lust vergangen, diese Wallfahrt zu wiederholen.
In unserer Familie kam es zu keiner einzigen Ansteckung, weil mein Vater schon vor den ersten Maßnahmen der Regierung Vorkehrungen getroffen hatte, die er sich bei der Pandemiebekämpfung in anderen Ländern abgeschaut hatte. Über Funk kontaktierte er den Verwalter seines Sägewerks, einen kroatischen Einwanderer, der sein volles Vertrauen genoss, und ließ aus dem Süden zwei seiner kräftigsten Holzfäller kommen. Die stattete er mit vorsintflutlichen Jagdflinten aus, von denen er selbst nicht wusste, wie sie zu gebrauchen waren, pflanzte sie vor die beiden Eingänge zu seinem Anwesen und wies sie an zu verhindern, dass irgendjemand außer ihm und meinem ältesten Bruder hinaus- oder hineingelangte. Der Befehl war schwerlich umzusetzen, denn natürlich hätten die beiden kein Mitglied der Familie mit Schüssen aufgehalten, aber dass sie dort standen, konnte Diebe abschrecken. Die über Nacht in bewaffnete Wächter verwandelten Holzfäller kamen nie ins Haus. Sie schliefen auf Strohsäcken in der Remise, ernährten sich von dem, was ihnen die Köchin durch ein Fenster reichte, und tranken gegen den Erreger den Eseltöter-Schnaps, den mein Vater ihnen in unbegrenzter Menge zusammen mit Aspirin zur Verfügung stellte.
Zu seinem eigenen Schutz erwarb mein Vater einen geschmuggelten englischen Webley-Revolver, ein bewährtes Kriegsmodell, und versetzte mit seinen Schießübungen die Hühner im Dienstbotenhof in Aufruhr. Tatsächlich fürchtete er sich weniger vor dem Virus als vor den verzweifelten Menschen. Schon zu normalen Zeiten gab es zu viele Bedürftige, Bettler und Diebe in der Stadt. Wenn sich hier wiederholte, was andernorts geschehen war, dann würde die Arbeitslosigkeit zunehmen, Nahrungsmittel würden knapp werden, Panik würde um sich greifen und selbst einigermaßen anständige Personen, die bislang nur vor dem Kongress protestierten und Arbeit und Gerechtigkeit forderten, würden zu Kriminellen werden, wie damals, als die entlassenen Minenarbeiter aus dem Norden hungrig und aufgebracht in die Stadt strömten und sich der Typhus verbreitete.
Mein Vater kaufte Vorräte, um über den Winter zu kommen: Säcke mit Kartoffeln, Mehl, Zucker, Öl, Reis und Hülsenfrüchte, Nüsse, Knoblauchzöpfe, Trockenfleisch und kistenweise Obst und Gemüse zum Einkochen. Vier seiner Söhne, der jüngste gerade zwölf Jahre alt, schickte er in den Süden, noch bevor das Colegio San Ignacio den Unterricht auf Anordnung der Regierung einstellte, und nur José Antonio blieb in der Hauptstadt, denn er würde auf die Universität gehen, sobald sich die Lage normalisiert hätte. Der Reiseverkehr war eingestellt, doch ergatterten meine Brüder noch eben Plätze in einem der letzten Personenzüge und gelangten so bis nach San Bartolomé, wo Marko Kusanović sie erwartete, der kroatische Verwalter, der Anweisung hatte, sie zusammen mit den rauen Holzfällern der Gegend zur Arbeit einzusetzen. Keine Kindereien. Das würde sie auf Trab und gesund halten und vermied obendrein Scherereien daheim.
Meine Mutter, ihre beiden Schwestern Pía und Pilar und die Hausangestellten wurden dazu verdonnert, im Haus zu bleiben und es um nichts in der Welt zu verlassen. Die Lunge meiner Mutter war durch eine Tuberkulose in ihrer Jugend angegriffen, sie war von zarter Konstitution und durfte sich der Gefahr einer Ansteckung auf keinen Fall aussetzen.
Die Pandemie änderte am Alltag im geschlossenen Universum unseres Hauses wenig. Durch den Vordereingang, eine verzierte Tür aus Mahagoni, gelangte man in eine große, düstere Vorhalle, von der zwei Salons abgingen, die Bibliothek, der Speisesaal für Besucher, das Billardzimmer und ein weiterer, geschlossener Raum, der »das Büro« genannt wurde, weil dort ein halbes Dutzend Metallschränke voller Unterlagen standen, in die seit unvordenklicher Zeit niemand einen Blick geworfen hatte. Der zweite Teil des Hauses war vom ersten durch einen mit portugiesischen Kacheln verzierten Hof getrennt, in dem es einen maurischen Springbrunnen gab, aus dem kein Wasser mehr kam, und eine Überfülle von Kamelien in großen Kübeln. Von ihnen hatte das Anwesen seinen Namen: Das große Haus der Kamelien. An drei Seiten zog sich eine mit geschliffenen Scheiben verglaste Galerie um den Hof und verband die Räume des täglichen Gebrauchs: Esszimmer, Spielzimmer, Nähzimmer, Schlafzimmer und Bäder. Im Sommer war es auf der Galerie angenehm kühl, im Winter durch die aufgestellten Kohlebecken einigermaßen warm. Der rückwärtige Teil des Hauses war das Reich der Bediensteten und der Tiere, dort befanden sich die Küche und die Waschtröge, die Vorratsräume, die Remise und eine Reihe winziger Kabuffs, in denen die Hausangestellten schliefen. In diesen hinteren Hof hatte meine Mutter kaum je einen Fuß gesetzt.
Das Anwesen hatte meinen Großeltern väterlicherseits gehört und war nach deren Tod das einzig nennenswerte Erbe für ihre Kinder gewesen. Geteilt durch elf blieb von seinem Wert für jeden nur wenig übrig. Arsenio, der als Einziger Weitblick für die Zukunft besaß, erbot sich, seinen Geschwistern ihre Anteile in kleinen Raten abzukaufen. Zunächst verstanden sie das als einen Gefallen, denn wie mein Vater ihnen darlegte, barg der alte Kasten unendlich viele bauliche Mängel. Niemand, der noch ganz bei Trost sei, würde darin wohnen wollen, aber er brauche den Platz für seine bereits vorhandenen und noch zu erwartenden Kinder, außerdem für seine Schwiegermutter, die schon sehr betagt war, und für die Schwestern seiner Frau, beide alleinstehend und auf seine Mildtätigkeit angewiesen. Als er dann mit Verspätung nur einen Bruchteil des Versprochenen abstotterte und die Zahlungen schließlich ganz einstellte, litt das Verhältnis zu seinen Geschwistern erheblich. Er hatte nicht vorgehabt, sie übers Ohr zu hauen. Ihm hatten sich finanzielle Chancen eröffnet, die er nutzen wollte, und er nahm sich fest vor, die ausstehenden Beträge später mit Zinsen auszuzahlen, aber die Jahre vergingen von einem Aufschub zum nächsten, bis er die Schulden schließlich vergaß.
Das Wohnhaus war in der Tat ein schlecht gepflegter Kasten, aber das Grundstück nahm ein halbes Straßenkarree ein und war von zwei Straßen aus zugänglich. Ich wünschte, ich hätte ein Foto und könnte es Dir zeigen, Camilo, denn dort beginnen mein Leben und meine Erinnerungen. Das Haus hatte den Glanz verloren, den es einst, vor dem wirtschaftlichen Niedergang, besessen haben musste, als der Großvater über seinen Clan mit den vielen Kindern und ein Heer von Hausangestellten und Gärtnern herrschte, die das Haus tadellos in Schuss hielten und im Garten ein Paradies aus Blumen und Obstbäumen schufen, mit einer verglasten Orangerie, in der Orchideen aus fernen Ländern wuchsen, und vier Marmorstatuen griechischer Götter, die damals bei den namhaften Familien in Mode waren und von denselben lokalen Steinmetzen stammten, die auch die Grabplatten für den Friedhof herstellten. Solche Gärtner wie früher gebe es nicht mehr, die heutigen waren laut meinem Vater ein Haufen Faulpelze. »Wenn das so weitergeht, verschlingt das Unkraut noch unser Haus«, sagte er ständig, machte aber keine Anstalten, dem vorzubeugen. Natur fand er aus der Ferne recht hübsch, wollte indes seine Aufmerksamkeit nicht an sie verschwenden, denn dafür gab es Rentableres. Der fortschreitende Verfall des Anwesens beunruhigte ihn wenig, er hatte sowieso nicht vor, es länger als nötig zu behalten. Das Haus war nichts wert, das Grundstück hingegen ein Traum. Er würde es verkaufen, sobald es ausreichend im Wert gestiegen wäre, auch wenn er dafür ein paar Jahre warten musste. Seine Devise war eine Binsenweisheit: Günstig kaufen, teuer verkaufen.
Die Oberschicht zog bereits in die Wohngegenden fernab der Verwaltungsbehörden, der Märkte und der staubigen, von den Tauben verunreinigten Plätze. Man fieberte danach, Häuser wie unseres abzureißen und an ihrer Stelle Bürogebäude oder Apartmenthäuser für den Mittelstand zu bauen. Schon damals gehörte die Hauptstadt zu den am stärksten segregierten Wohnorten der Welt, und da sich in den Straßen rings um unser Haus, die seit der Kolonialzeit zu den bedeutendsten gehört hatten, zusehends niedrige Schichten ansiedelten, würde mein Vater mit seiner Familie wegziehen müssen, um in den Augen seiner Freunde und Bekannten nicht an Prestige zu verlieren. Auf Bitten meiner Mutter ließ er in Teilen des Hauses Strom legen und Toiletten einbauen, alles andere jedoch verfiel weiter still vor sich hin.
2
Meine Großmutter mütterlicherseits saß den ganzen Tag in einem Ohrensessel auf der Galerie und war so tief in ihren Erinnerungen versunken, dass sie in den vergangenen sechs Jahren nicht ein Wort gesagt hatte. Meine Tanten Pía und Pilar wohnten auch mit im Haus. Pía war eine kleine, zarte Person, die sich mit den Eigenschaften von Pflanzen auskannte und die Gabe besaß, mit ihren Händen zu heilen. Im Alter von dreiundzwanzig Jahren hätte sie fast einen Vetter zweiten Grades geheiratet, in den sie schon mit fünfzehn verliebt gewesen war, doch ihr Brautkleid blieb ungetragen, weil ihr Verlobter zwei Monate vor der Hochzeit überraschend verstarb. Da die Familie eine Autopsie verweigerte, gab es für den vermuteten angeborenen Herzfehler als Todesursache keine Bestätigung. Pía betrachtete sich selbst als Witwe ihrer einzigen Liebe, kleidete sich in strenge Trauer und ließ sich nie mehr auf einen Anwärter ein.
Tante Pilar sah wie alle Frauen der Familie gut aus, bemühte sich jedoch nach Kräften, das zu verbergen, und spottete über die Tugenden und Zierden der Weiblichkeit. Zweimal hatten wackere junge Männer sie zu erobern versucht, waren von ihr aber verscheucht worden. Sie bedauerte, nicht ein halbes Jahrhundert später zur Welt gekommen zu sein, denn zu gern wäre sie die erste Frau auf dem Mount Everest gewesen. Als dem Sherpa Tenzing Norgay und dem Neuseeländer Edmund Hillary die Erstbesteigung 1953 gelang, weinte sie vor Erbitterung. Sie war groß, stark und geschickt und besaß das Temperament eines Feldwebels. Im Haus befehligte sie die Dienstboten und kümmerte sich um die allenthalben fälligen Reparaturen. Sie besaß ein Händchen für Mechanik, erfand Haushaltsgeräte und kam auf originelle Lösungen, wenn etwas seinen Dienst versagte, deshalb hieß es, Gott habe sich bei ihrem Geschlecht geirrt. Niemand wunderte sich, wenn sie nach einem Erdbeben auf dem Dach stand und den Austausch zerbrochener Dachpfannen beaufsichtigte oder im Hof wenig zimperlich bei der Schlachtung von Hühnern und Truthähnen fürs Weihnachtsfest half.
Die wegen der Seuche verhängte Quarantäne machte sich in unserer Familie kaum bemerkbar. Schon zu normalen Zeiten hatten die Dienstmädchen, die Köchin und die Waschfrau nur an zwei Nachmittagen im Monat Ausgang. Der Fahrer und die Gärtner genossen mehr Freiheiten, weil Männer nicht zum Hauspersonal gezählt wurden. Eine Ausnahme war Apolonio Toro, ein hünenhafter Junge, der ein paar Jahre zuvor an die Tür geklopft, um etwas zu essen gebeten hatte und am Ende geblieben war. Man ging davon aus, dass er ein Waisenkind war, auch wenn niemand sich die Mühe machte, das nachzuprüfen. Torito verließ nur sehr selten das Haus, weil er sich fürchtete, angegriffen zu werden, was schon mehrfach passiert war. Seine etwas tierhafte Erscheinung und seine Arglosigkeit reizten die Boshaften. Er schleppte Brennholz und Kohlen, zog das Parkett ab, bohnerte es und erledigte andere schwere Arbeiten, die kaum Nachdenken erforderten.
Meine Mutter war nicht sehr gesellig und bereits zu normalen Zeiten so wenig wie möglich ausgegangen. Nur widerstrebend begleitete sie ihren Ehemann zu den Zusammenkünften der Familie del Valle, die vielköpfig genug war, um den Kalender rund ums Jahr mit Geburtstagen, Taufen, Hochzeiten und Beisetzungen zu füllen, denn der Rummel verursachte ihr Kopfschmerzen. Ihre angegriffene Gesundheit oder eine gerade aktuelle Schwangerschaft lieferten ihr Vorwände, um das Bett zu hüten oder ein Lungensanatorium in den Bergen aufzusuchen, wo sie ihre Bronchitis kurierte und Ruhe fand. Bei schönem Wetter unternahm sie mit ihrem Mann kurze Ausflüge in dem brandneuen Automobil, das er, gleich als es in Mode kam, erworben hatte, einem Ford T, der das selbstmörderische Tempo von fünfzig Stundenkilometern erreichte.
»Bald nehme ich dich in meinem eigenen Flugzeug mit«, versprach er ihr, obwohl es das Letzte war, was sie sich als Transportmittel gewünscht hätte.
Die Luftfahrt, allgemein als Spleen von Abenteurern und Playboys belächelt, faszinierte meinen Vater. Er war davon überzeugt, dass diese Mücken aus Leinwand und Holz eines Tages wie das Automobil für jeden verfügbar sein würden, der das nötige Geld besaß, und er wollte zu den Ersten gehören, die hier investierten. Er hatte alles durchdacht. Er würde sie gebraucht in den USA kaufen, in Einzelteile zerlegt ins Land bringen, um Importsteuern zu sparen, und sie dann, fachmännisch zusammengesetzt, zu Höchstpreisen verkaufen. Durch eine Laune des Zufalls sollte ich seinen Traum viele Jahre später leicht abgewandelt erfüllen.
Der Fahrer brachte meine Mutter bisweilen zum Einkaufen an den Eingang der Markthalle oder zum Teesalon Versailles, wo sie von einer ihrer Schwägerinnen den neuesten Familienklatsch erfuhr, aber in den zurückliegenden Monaten war beides kaum möglich gewesen, zunächst wegen ihres schweren Bauchs und dann, weil man sich gegen die Pandemie abschottete. Die Wintertage waren kurz und vergingen beim Kartenspiel mit meinen Tanten Pía und Pilar, mit Nähen, Stricken und den Rosenkranzgebeten mit Torito und den Hausangestellten. Die Schlafzimmer ihrer abwesenden Söhne ließ sie zusperren, ebenso die beiden Salons und den Speisesaal. Die Bibliothek wurde nur von ihrem Ehemann und ihrem ältesten Sohn benutzt. Dort heizte Torito den Kamin an, damit die Bücher keine Feuchtigkeit zogen. In den übrigen Räumen und auf der Galerie standen Kohlebecken, in deren Glut Töpfe mit Wasser und Eukalyptusblättern siedeten, um die Atemwege zu reinigen und das Gespenst der Grippe zu vertreiben.
Für meinen Vater und meinen Bruder José Antonio galten weder Quarantäne noch Ausgangssperre, da mein Vater aufgrund seiner Geschäfte als unverzichtbar für den reibungslosen Betrieb der Wirtschaft galt und sein Sohn ihm nicht von der Seite wich. Wie andere Industrielle, Unternehmer, Politiker und alles medizinische Personal konnten sie sich mit einer Sondergenehmigung frei bewegen. Sie gingen ins Büro, trafen sich mit Geschäftsfreunden und Kunden und aßen im Club de la Unión zu Abend, der nicht geschlossen worden war, weil das vergleichbar gewesen wäre mit einer Schließung der Kathedrale, allerdings büßte das Club-Restaurant mit jedem Kellner, der starb, an Qualität ein. Auf der Straße trugen Vater und Sohn Schutzmasken, die meine Tanten genäht hatten, und vor dem Zubettgehen rieben sie sich mit Alkohol ab. Sie wussten, dass niemand gegen die Grippe gefeit war, hofften aber, dass ihre Maßnahmen zusammen mit den Eukalyptusdämpfen den Erreger von unserem Haus fernhalten würden.
Damals, als ich geboren wurde, zogen Damen wie meine Mutter sich zurück, um ihren Schwangerschaftsbauch vor den Blicken der Welt zu verbergen, und sie stillten ihre Neugeborenen nicht selbst, weil das als anstößig galt. Beauftragt wurde damit für gewöhnlich eine Amme, eine arme Frau, die dem eigenen Nachwuchs die Brust wegnahm, um sie an ein reicher gesegnetes Kind zu vermieten, aber mein Vater gestattete nicht, dass eine Fremde ins Haus kam. Sie hätte die Grippe einschleppen können. Man löste das Problem meiner Ernährung mit einer Ziege, die im hinteren Hof untergebracht wurde.
Vom ersten Tag an bis zum Alter von fünf Jahren waren ausschließlich meine Tanten Pía und Pilar für mich zuständig und verhätschelten mich, bis mein Charakter fast ruiniert war. Mein Vater trug ebenfalls dazu bei, schließlich war ich das einzige Mädchen in einem Rudel von Söhnen. In einem Alter, in dem andere Kinder anfangen, lesen zu lernen, konnte ich noch nicht allein mit dem Löffel essen, wurde gefüttert und schlief mit angezogenen Knien in einer schaukelnden Wiege neben dem Bett meiner Mutter.
Eines Tages wagte es mein Vater, mich zurechtzuweisen, weil ich den Tonkopf einer Puppe gegen eine Wand gedroschen und zertrümmert hatte.
»Verzogenes Gör! Ich versohl dir den Hintern!«
Nie zuvor hatte er mir gegenüber die Stimme erhoben. Ich warf mich wie so oft auf den Boden und plärrte wie am Spieß, doch zum ersten Mal verlor er die grenzenlose Geduld, die ich von ihm gewohnt war, packte mich an den Armen und schüttelte mich so heftig, dass er mir, wären meine Tanten nicht dazwischengegangen, den Hals gebrochen hätte. Der Schreck beendete meinen Tobsuchtsanfall auf der Stelle.
»Was die Kleine braucht, ist ein englisches Kindermädchen«, sagte mein Vater erbost.
Und so kam Miss Taylor in die Familie. Mein Vater fand sie über einen Agenten, der für ihn einige Geschäfte in London abwickelte und eine einzige Anzeige in der Times aufgab. Über Telegramme und Briefe, die mehrere Wochen brauchten, und Antworten, die noch einmal so lange unterwegs waren, verständigten sich die beiden und fanden einvernehmlich allen Widrigkeiten von Entfernung und Sprache zum Trotz – der Agent konnte kein Spanisch, und der Englischwortschatz meines Vaters beschränkte sich auf Devisenbestimmungen und Exportpapiere – die ideale Person für diese Stellung, nachweislich erfahren und mit bestem Leumund.
Sonntäglich gekleidet in einem Mäntelchen aus blauem Samt, Strohhut und Lackstiefeln nahmen mich meine Eltern und mein Bruder José Antonio vier Monate später zum Hafen mit, um die Engländerin abzuholen. Erst als sämtliche Passagiere über die Gangway das Schiff verlassen hatten und von ihrem jeweiligen Empfangskomitee begrüßt worden waren, alle einander in aufgeregten Gruppen fotografiert hatten und sich die Reisenden bei ihrem unübersichtlichen Gepäck einfanden, leerte sich die Mole und wir konnten eine einsame, verloren wirkende Gestalt ausmachen. Schlagartig wurde meinen Eltern klar, dass dieses Kindermädchen nicht so war, wie sie aufgrund der vor sprachlichen Missverständnissen strotzenden Korrespondenz mit dem Agenten angenommen hatten. Tatsächlich hatte mein Vater der Frau vor Vertragsabschluss über Telegramm nur eine einzige Frage gestellt, nämlich ob sie Hunde möge. Sie hatte geantwortet, sie ziehe sie den Menschen vor.
Aufgrund eines in meiner Familie tief verwurzelten Vorurteils hatten sie eine reife, etwas antiquierte Frau mit schmaler Nase und schlechten Zähnen erwartet, ähnlich den Damen aus der britischen Society, die sie aus der Ferne kannten und über die auf den Gesellschaftsseiten der Zeitung berichtet wurde. Miss Josephine Taylor war allerdings Anfang zwanzig, eher klein und etwas mollig, ohne dick zu sein, trug ein senfgelbes, locker fallendes Kleid mit tiefer Taille, einen nachttopfförmigen Filzhut und Schuhe mit Fesselriemchen. Der schwarze Kajalstrich um ihre tiefblauen Knopfaugen betonte ihren erschrockenen Gesichtsausdruck, ihr Haar war strohblond, und sie hatte diese reispapierhafte Haut, die bei jungen Frauen aus nordischen Ländern häufiger vorkommt und die mit den Jahren erbarmungslos fleckig und faltig wird. José Antonio konnte sich mit ihr auf Englisch verständigen, er hatte einen Intensivkurs besucht, das Gelernte bisher allerdings nie anwenden können.
Meine Mutter war auf den ersten Blick von dieser apfelfrischen Miss Taylor entzückt, aber ihr Ehemann fühlte sich betrogen, weil er diese Person doch von so weit her hatte kommen lassen, damit sie mir Disziplin und Manieren beibrachte und für die Grundlagen einer angemessenen Schulbildung sorgte. Er hatte verfügt, dass ich zu Hause unterrichtet werden sollte, um mich von schädlichen Einflüssen, ungehobeltem Benehmen und all den Krankheiten fernzuhalten, von denen die Kinder hingerafft wurden. Die Pandemie hatte ein paar Opfer in unserer entfernteren Verwandtschaft gefordert, im engeren Familienkreis war aber niemand betroffen. Man fürchtete allerdings, sie könnte erneut aufflammen und totbringend unter den Kindern wüten, die weniger Abwehrkräfte besaßen als die Erwachsenen, die die erste Ansteckungswelle überstanden hatten. Auch nach fünf Jahren hatte sich das Land noch nicht vollständig von dem Unglück erholt, die öffentliche Gesundheitsversorgung und die Wirtschaft waren hart getroffen worden, und während andernorts die Ausgelassenheit der Roaring Twenties herrschte, blieb man hierzulande vorsichtig. Mein Vater fürchtete um meine Gesundheit, ohne zu ahnen, dass meine Ohnmachtsanfälle, die Krämpfe und das explosionsartige Erbrechen Ausdruck des beachtlichen melodramatischen Talents waren, das ich damals besaß und leider verloren habe. Für ihn lag es auf der Hand, dass der modisch gekleidete Flapper, den er da vom Hafen abholte, nicht die geeignete Person war, um seine Tochter und ihr wildes Temperament zu zähmen. Jedoch hielt diese Ausländerin mehr als eine Überraschung für ihn bereit, darunter auch die, dass sie gar keine Engländerin war.
Vor ihrer Ankunft hatte niemand eine klare Vorstellung davon gehabt, welchen Platz Miss Taylor in der häuslichen Ordnung einnehmen sollte. Sie gehörte nicht in dieselbe Kategorie wie die Dienstmädchen, war aber auch kein Mitglied der Familie. Mein Vater hatte gesagt, man solle sie höflich behandeln und den Abstand wahren, ihre Mahlzeiten werde sie gemeinsam mit mir nicht im Esszimmer, sondern auf der Galerie oder am Tisch in der Speisekammer einnehmen, und zum Wohnen solle man ihr das Schlafzimmer der Großmutter zurechtmachen, die einige Monate zuvor auf dem Nachttopf sitzend gestorben war. Torito schaffte die schweren, mit fadenscheinigen Stoffen bespannten, vor Trockenheit ächzenden Holzmöbel in den Keller, und man ersetzte sie durch weniger düstere, damit das Kindermädchen nicht schwermütig würde, wie Tante Pilar sagte, denn dazu habe sie ja ohnehin ausreichend Anlass, wenn sie sich mit mir herumschlagen und sich einleben müsse in einem von Barbaren bevölkerten Land am Ende der Welt. Damit meinte sie bei uns. Pilar wählte eine schlichte gestreifte Tapete und Vorhänge mit ausgebleichten Rosen, die ihr für eine alte Jungfer passend schienen, wurde sich jedoch beim ersten Blick auf Miss Taylor ihres Irrtums bewusst.
Nach einer Woche war das Kindermädchen erheblich näher an die Familie herangerückt, als ihr Arbeitgeber das erwartet hatte, und die in unserem an Standesdünkel reichen Land so bedeutende Frage nach ihrem Platz auf der gesellschaftlichen Leiter stellte sich nicht mehr. Miss Taylor war freundlich und zurückhaltend, dabei keineswegs schüchtern, und sie sorgte dafür, dass alle sie respektierten, selbst meine Brüder, die zwar schon groß waren, sich aber weiterhin wie die Kannibalen benahmen. Selbst die beiden Mastiffs, die mein Vater während der Pandemie angeschafft hatte, um uns vor möglichen Überfällen zu schützen, und die sich mit der Zeit in schrecklich unerzogene Schoßhunde verwandelt hatten, gehorchten ihr. Miss Taylor brauchte nur auf den Boden zu zeigen und einen Befehl auf Englisch zu sagen, ohne dabei die Stimme zu erheben, und schon stiegen die zwei mit hängenden Ohren von den Polstermöbeln. Für mich schuf sie im Handumdrehen einen festen Tagesablauf und fing damit an, mir einige fundamentale Regeln des Zusammenlebens beizubringen, nachdem sie meinen Eltern einen Stundenplan vorgelegt hatte, der auch Turnen an der frischen Luft, Musikunterricht, Naturwissenschaft und Kunst umfasste.
Mein Vater fragte nach, wie sie in ihrem Alter über all das Bescheid wissen könne, und sie antwortete, dafür gebe es Nachschlagewerke. Vor allem anderen erklärte sie mir die Vorteile davon, »bitte« und »danke« zu sagen. Wenn ich mich sträubte und mich stattdessen brüllend auf den Boden warf, hielt sie meine herbeieilende Mutter und meine Tanten mit einer Handbewegung davon ab, mich zu trösten, wartete, bis ich mich ausgeheult hatte, und las unterdessen ungerührt weiter, strickte oder arrangierte die Gartenblumen in den Vasen um. Auch meine gespielte Epilepsie ließ sie kalt.
»Solange sie nicht blutet, halten wir uns raus«, entschied sie, und die anderen gehorchten voller Entsetzen, weil sie es nicht wagten, ihre Erziehungsmethoden in Frage zu stellen.
Sie kam aus London, also musste sie qualifiziert sein.
Miss Taylor sagte, ich sei zu alt, um in dieser kleinen Wiege im Zimmer meiner Mutter zu schlafen, und bat um ein zweites Bett in ihrem Zimmer. In den ersten beiden Nächten schob sie die Kommode vor die Tür, damit ich nicht entwischte, aber ich ergab mich rasch in mein Schicksal. Als Nächstes brachte sie mir bei, mich ohne Hilfe anzuziehen und zu essen, ließ mich dafür halbnackt herumlaufen, bis ich wenigstens einen Teil meiner Sachen selbständig anzog, setzte mich mit einem Löffel in der Hand vor einen Teller und wartete mit der Gleichmut eines Trappistenmönchs, bis ich aus Hunger zu essen begann. Die Ergebnisse waren spektakulär, und aus dem Monster, das den Bewohnern des Hauses die Nerven zerrüttet hatte, wurde binnen kürzester Zeit ein normales Kind, das seinem Kindermädchen überallhin nachlief, gefesselt von ihrem Duft nach Bergamotte und ihren pummeligen Händen, die durch die Luft flatterten wie Tauben. Mein Vater kam zu dem Schluss, dass ich fünf Jahre lang um eine Struktur gebettelt hatte und jetzt endlich eine hatte. Das verstanden meine Mutter und meine Tanten als Vorwurf, aber sie mussten eingestehen, dass sich etwas Wesentliches geändert hatte. Die Stimmung war sanfter geworden.
Miss Taylor bearbeitete das Klavier mit mehr Begeisterung als Begabung und sang Balladen mit einem blutleeren Stimmchen, traf dabei aber jeden Ton. Ihr gutes Ohr half ihr dabei, rasch ein weiches und verständliches Spanisch zu lernen, in das sie auch einige Kraftausdrücke meiner Brüder einstreute, ohne ihre Bedeutung zu kennen. Dank ihres deutlichen Akzents klangen sie nicht beleidigend, und da niemand sie korrigierte, verwendete Miss Taylor sie weiter. Das schwere Essen war nicht ihr Fall, aber sie begegnete der einheimischen Küche mit demselben britischen Phlegma wie den Wolkenbrüchen im Winter, der trockenen, staubigen Hitze im Sommer und den Erdbeben, bei denen die Lampen tanzten und die Stühle wanderten, ohne dass jemand Notiz davon nahm. Was sie hingegen nicht ertrug, waren die Schlachtungen der Tiere im hinteren Hof, in ihren Augen eine primitive und grausame Angelegenheit. Ihr schien es rücksichtslos, einen Eintopf mit einem Kaninchen oder einem Huhn zu verspeisen, die wir persönlich gekannt hatten. Als Torito einer Ziege, die er drei Monate für den Geburtstag des Hausherrn gemästet hatte, die Kehle durchschnitt, sank Miss Taylor mit Fieber ins Bett. Da entschied Tante Pilar, Fleisch zukünftig außer Haus zu kaufen, auch wenn sie nicht einsah, welchen Unterschied es machen sollte, ob das arme Tier auf dem Markt oder daheim geschlachtet wurde. Ich sollte hier klarstellen, dass es sich nicht um dieselbe Ziege handelte, die mir in meinen Säuglingstagen als Amme gedient hatte. Die starb einige Jahre später an Altersschwäche.
Die beiden Truhen aus grünem Blech, mit denen Miss Taylor angereist war, enthielten Schulbücher und Kunstbände, alle auf Englisch, ein Mikroskop, eine Holzkiste mit dem Nötigsten für chemische Experimente und die neunundzwanzig Bände der jüngsten Ausgabe der Encyclopædia Britannica, die 1911 erschienen war. Wenn etwas nicht in der Enzyklopädie stand, dann weil es nicht existierte, vermutete Miss Taylor. An Kleidung besaß sie neben dem senfgelben Kleid, mit dem sie vom Schiff gegangen war, noch eine zweite Garderobe für außer Haus, je einen passenden Hut dazu und einen Mantel mit einem Pelzkragen von einem schwer zu bestimmenden Säugetier. Alles andere waren schlichte Röcke und Blusen, über denen sie tagsüber einen Kittel trug. Sie kleidete sich unter Schlangenmenschverrenkungen an und aus, so dass ich sie nie in Unterwäsche oder gar nackt sah, obwohl wir das Zimmer teilten.
Meine Mutter wachte darüber, dass ich vor dem Zubettgehen auf Spanisch betete, denn die Gebete auf Englisch konnten ketzerisch sein, und wer wusste schon, ob sie im Himmel verstanden wurden. Miss Taylor war Mitglied der anglikanischen Kirche, was sie davor bewahrte, mit der Familie die Messe besuchen oder den gemeinschaftlichen Rosenkranz beten zu müssen. Ich sah sie nie in der Bibel lesen, die in ihrem Nachtschränkchen lag, und sie zeigte auch keinerlei Bekehrungseifer. Zweimal im Jahr nahm sie am anglikanischen Gottesdienst teil, der bei jemand aus der britischen Society zu Hause gefeiert wurde, sang dort Loblieder und plauderte mit anderen Ausländern, mit denen sie sich zuweilen zum Tee traf und Zeitschriften und Romane austauschte.
Mit ihr verbesserte sich mein Dasein spürbar. Die ersten Jahre meiner Kindheit waren ein einziges Gezerre gewesen, um meinen Willen durchzusetzen, und da ich ihn am Ende immer bekam, fühlte ich mich weder sicher noch behütet. Genau wie mein Vater vermutete, war ich stärker als die Erwachsenen und hatte niemand, der mir Halt gab. Das Kindermädchen zähmte meine Widerspenstigkeit nicht vollständig, brachte mir aber die Regeln guten Betragens in Gesellschaft bei und trieb mir diesen Tick aus, über Körperfunktionen und Krankheiten zu sprechen, was hierzulande ja Lieblingsthemen sind. Männer unterhalten sich über Politik und Geschäfte, Frauen über ihre Wehwehchen und die Hausangestellten. Jeden Morgen nach dem Aufwachen ging meine Mutter ihre Beschwerden durch und notierte sie im selben Heft, in dem sie auch Listen über früher und aktuell eingenommene Medikamente führte, und häufig blätterte sie durch diese Seiten und las darin mit mehr Rührung, als sie beim Betrachten des Fotoalbums der Familie empfand. Ich war auf dem besten Weg gewesen, so zu werden wie sie. Weil ich mich dauernd krank stellte, war ich Expertin für eine Vielzahl von Beschwerden, aber dank Miss Taylor, die sich darauf nicht einließ, gingen sie von selbst weg.
Zu Beginn erledigte ich meine Schulaufgaben und meine Klavierübungen, damit mein Kindermädchen zufrieden mit mir war, fand aber rasch selbst Gefallen am Lernen. Sobald ich flüssig schreiben konnte, ließ Miss Taylor mich in einem wunderschönen Heft mit Ledereinband und einem winzigen Vorhängeschloss Tagebuch führen, eine Gewohnheit, die ich fast mein Leben lang beibehalten habe. Als ich flüssig lesen konnte, machte ich mich über die Encyclopædia Britannica her. Miss Taylor dachte sich ein Spiel aus, bei dem wir einander mit wenig gebräuchlichen Wörtern herausforderten, deren Bedeutung wir auswendig lernten. Schon bald nahm auch José Antonio an unseren Spielrunden teil, der inzwischen dreiundzwanzig war und nicht die geringste Absicht hegte, die Annehmlichkeiten unter dem väterlichen Dach zu verlassen.
Mein Bruder José Antonio hatte Jura studiert, jedoch nicht aus Berufung, sondern weil für Männer unserer Gesellschaftsschicht damals nur sehr wenige Laufbahnen in Frage kamen. Jura schien ihm besser als die beiden anderen Optionen: Medizin oder Ingenieurwesen. José Antonio arbeitete für unseren Vater und leitete mit ihm gemeinsam die Geschäfte. Arsenio del Valle stellte ihn überall als seinen Lieblingssohn vor, seine rechte Hand, und José Antonio dankte ihm diese Bevorzugung, indem er sich ganz in seinen Dienst stellte, obwohl er mit den in seinen Augen gewagten Entscheidungen unseres Vaters nicht immer einverstanden war. Mehr als einmal wies er unseren Vater darauf hin, er habe zu viele Eisen im Feuer und jongliere zu sehr mit seinen Schulden, und bekam dann zu hören, große Geschäfte würden auf Kredit gemacht und kein Unternehmer mit wirtschaftlichem Weitblick arbeite mit seinem eigenen Geld, wenn er es auch mit dem von anderen tun könne. José Antonio, der Einblick in die kreative Buchführung dieser Unternehmungen besaß, hielt dem entgegen, es müsse eine Grenze geben, man dürfe den Bogen nicht überspannen, aber unser Vater versicherte ihm, alles unter Kontrolle zu haben.
»Eines Tages wirst du das Wirtschaftsimperium führen, das ich hier aufbaue, aber wenn du dich nicht auf Zack bringst und lernst, wie man Risiken eingeht, schaffst du das nicht. Übrigens scheinst du gerade nicht recht bei der Sache zu sein. Du vertust zu viel Zeit mit den Frauen im Haus, das macht dich noch dumm und saftlos«, sagte er.
Die Enzyklopädie war eine der Vorlieben, die José Antonio mit mir und Miss Taylor teilte. Mein Bruder war der Einzige in der Familie, der mein Kindermädchen wie eine Freundin behandelte und mit Vornamen ansprach, für alle anderen sollte sie für immer Miss Taylor sein. In den Mußestunden am Abend erzählte mein Bruder ihr von der Geschichte unseres Landes, von den Wäldern im Süden, in die er sie eines Tages mitnehmen würde, um ihr das Sägewerk der Familie zu zeigen, von den Neuigkeiten aus der Politik, über die er beunruhigt war, seit ein Oberst sich als einziger Kandidat für die Präsidentschaftswahl hatte aufstellen lassen, folgerichtig hundert Prozent der Stimmen erhalten hatte und seither die Regierung wie einen Kasernenhof führte. Er räumte gegenüber Miss Taylor ein, der Mann sei zu Recht beliebt für die Infrastrukturprojekte und die Reform der Institutionen, die er vorantrieb, doch in seinen Augen stellten autoritäre Caudillos wie er, die seit den Unabhängigkeitskriegen in so vielen Ländern Lateinamerikas gediehen, eine Gefahr für die Demokratie dar. »Demokratie ist vulgär, eine absolute Monarchie würde euch besser bekommen«, spottete sie, war aber in Wahrheit stolz auf ihren Großvater, der 1846 in Irland hingerichtet worden war, weil er sich für Arbeiterrechte eingesetzt und ein allgemeines Wahlrecht für alle Männer gefordert hatte und nicht nur für Grundeigentümer, wie im Gesetz vorgesehen.
Einmal hatte sie, als sie glaubte, ich würde es nicht hören, meinem Bruder erzählt, dass ihr Großvater als Anhänger der Chartistenbewegung und wegen Verrats an der Krone verurteilt worden war, man ihn gehängt und danach gevierteilt hatte.
»Ein paar Jahre zuvor hätte man ihn bei lebendigem Leib aufgeschlitzt, ihm die Eingeweide rausgeholt, ihn kastriert und ihn dann erst aufgehängt und in Stücke gerissen, und das vor Tausenden begeisterten Zuschauern«, erklärte sie ungerührt.
»Und du findest uns primitiv, weil wir ein Huhn töten!«, rief José Antonio entgeistert.
Ihre grausigen Geschichten verfolgten mich nachts in meinen Träumen. Miss Taylor erzählte meinem Bruder nämlich auch von den englischen Suffragetten, die für das Frauenwahlrecht kämpften und dafür Demütigungen und Gefängnis in Kauf nahmen und in den Hungerstreik traten, woraufhin man sie zwangsernährte und ihnen Schläuche in Kehle, Anus oder Vagina schob.
»Standhaft ertragen sie die schlimmsten Folterungen. Ein Teilwahlrecht haben sie schon erstritten, aber sie kämpfen weiter für dasselbe Recht wie die Männer.«
José Antonio war überzeugt, in unserem Land werde es so weit niemals kommen. Er hatte seinen eigenen, begrenzten, konservativen Zirkel nie verlassen und, wie sich bald zeigen sollte, keine Ahnung von dem, was sich gerade in der Mittelschicht zusammenbraute.
Gegenüber allen anderen in der Familie vermied Miss Taylor derlei Themen. Sie wollte nicht nach England zurückgeschickt werden.
3
»Sie hat einen empfindlichen Magen«, hatte Tante Pía konstatiert, als Miss Taylor am Tag nach ihrer Ankunft Durchfall bekam.
Bei Ausländern war das üblich, sie erkrankten hierzulande mit dem ersten Schluck Wasser, da aber fast alle überlebten, maß niemand dem große Bedeutung bei. Mein Kindermädchen wurde gegen unsere Bakterien jedoch nie vollständig immun, und zwei Jahre lang kämpfte sie mit den Attacken ihres Verdauungsapparats, die von Tante Pía mit Fenchel- und Kamillentee und vom Arzt der Familie mit mysteriösen Medikamentenbriefchen behandelt wurden. Offenbar bekamen ihr die Nachtische mit Karamellcreme, die Schweinekoteletts mit Chilisoße, die Maiskuchen und die dicke heiße Schokolade mit Sahne um fünf am Nachmittag nicht, genau wie vieles andere, was abzulehnen unhöflich gewesen wäre. Stoisch ertrug sie Krämpfe, Erbrechen und Durchfall und verlor nie ein Wort darüber.
Miss Taylor wurde ohne Aufhebens schwächer, bis die Familie, erschrocken über ihren Gewichtsverlust und das Aschgrau ihrer Haut, den Arzt kommen ließ. Nachdem er sie untersucht hatte, verordnete er Schonkost aus Reis und Hühnerbrühe und ein halbes Gläschen Port mit einigen Tropfen Opiumtinktur zweimal täglich. Im Vertrauen eröffnete er meinen Eltern danach, dass die Patientin einen Tumor von der Größe einer Orange im Bauch hatte. Zwar gebe es auch hierzulande Chirurgen, die sich mit den besten in Europa messen könnten, doch sei es seiner Ansicht nach für eine Operation zu spät und das Menschlichste würde sein, sie heim zu ihrer Familie zu schicken. Sie habe nur noch wenige Monate zu leben.
José Antonio fiel die schwere Aufgabe zu, der Patientin die Wahrheit schonend anzudeuten, die sie sofort ungeschönt erriet.
»Ach, wie unerfreulich«, sagte Miss Taylor, ohne die Fassung zu verlieren.
José Antonio versprach ihr, sein Vater werde alles Erforderliche tun, damit sie erster Klasse nach London reisen könne.
»Willst du mich auch loswerden?«, fragte sie lächelnd.
»Um Himmels willen, nein! Niemand möchte dich loswerden, Josephine! Wir möchten nur, dass jemand bei dir ist, du geliebt wirst, umsorgt … Ich werde deiner Familie alles erklären.«
»Ich fürchte, ihr seid das Familienähnlichste, was ich habe«, sagte sie, und dann erzählte sie ihm das, wonach bisher niemand gefragt hatte.
Es stimmte, dass Josephine Taylor die Enkelin eines Großvaters war, den man hingerichtet hatte, weil er die englische Krone gegen sich aufgebracht hatte, allerdings war meinem Bruder gegenüber unerwähnt geblieben, dass ihr Vater ein gewalttätiger Säufer gewesen war, dessen einziges Verdienst darin bestand, von diesem Kämpfer für Gerechtigkeit abzustammen. Ihre Mutter, die von ihm mit etlichen Kindern ihrem Elend überlassen wurde, starb jung. Die kleineren Geschwister wurden in der Verwandtschaft verteilt, der älteste Bruder mit seinen elf Jahren in ein Kohlebergwerk geschickt und sie, mit neun, in ein Waisenhaus zu Nonnen, wo sie sich ihren Lebensunterhalt in der Wäscherei verdienen musste, der wichtigsten Einnahmequelle der Einrichtung, und darauf hoffte, dass eine gütige Seele auftauchte und sie adoptierte. Sie erzählte meinem Bruder, was das für eine Knochenarbeit war, die fremde Wäsche einzuseifen, sie zu klopfen und zu schrubben, sie in riesigen Wannen zu kochen, sie auszuspülen, zu stärken und zu plätten.
Mit zwölf, als sie für eine Adoption nicht mehr in Frage kam, gab man sie als unbezahltes Hausmädchen in den Dienst eines englischen Armeeangehörigen, wo sie arbeitete, bis der Mann glaubte, er habe das Recht, sie systematisch zu vergewaltigen. Das erste Mal, sie war noch ein Kind, kam er nachts in ihre Kammer neben der Küche, hielt ihr den Mund zu und fiel dann sofort über sie her. Danach führte er einen festen Ablauf ein, den er stets beibehielt, den Josephine kannte und fürchtete. Er wartete, bis seine Frau, die mit wohltätigen Werken und gesellschaftlichen Verpflichtungen viel beschäftigt war, das Haus verließ, und winkte ihr dann, ihm zu folgen. Josephine gehorchte in Todesangst, ohne eine Vorstellung davon, sie könnte sich weigern oder weglaufen. Im Kutschschuppen schlug der Mann sie mit der Reitpeitsche, achtete darauf, dass er keine sichtbaren Striemen hinterließ, und vollzog dann die immer gleichen perversen Handlungen an ihr, die sie durchstand, indem sie ihren Körper der Marter überließ und jeden Gedanken an Erbarmen aus ihrem Kopf aussperrte. »Es geht vorbei, irgendwann ist es zu Ende«, sagte sie sich stumm.
Endlich, nach Monaten, begann die Ehefrau sich darüber zu wundern, dass ihr Dienstmädchen sich wie ein geprügelter Hund in den Ecken herumdrückte und zu zittern begann, sobald ihr Mann nach Hause kam. Sie war lange genug mit ihm verheiratet, um manches Verstörende an ihm wahrzunehmen, hatte ihn aber lieber nicht zur Rede gestellt, im Glauben, dass das, was man nicht beim Namen nannte, gar nicht vorhanden war. Solange der Schein gewahrt bleibe, müsse man nicht an der Oberfläche kratzen, dachte sie, es hätten schließlich alle ihre Geheimnisse. Doch dann fiel ihr auf, dass die anderen Hausangestellten hinter ihrem Rücken tuschelten, und eine Nachbarin fragte, ob ihr Mann im Schuppen die Pferde züchtige, sie habe Schläge gehört und Wimmern. Da wurde ihr klar, dass sie herausfinden musste, was unter ihrem Dach geschah, ehe andere es taten. Sie richtete es so ein, dass sie ihren Mann mit erhobener Peitsche ertappte, das Dienstmädchen halbnackt, gefesselt und geknebelt.
Die Frau setzte Josephine nicht auf die Straße, wie es in solchen Fällen häufig geschah, sondern schickte sie als Gesellschafterin zu ihrer Mutter nach London, nachdem sie ihr das Versprechen abgenommen hatte, nie ein Sterbenswort über das Verhalten ihres Mannes zu sagen. Den Skandal galt es um jeden Preis zu vermeiden.
Josephines neue Arbeitgeberin entpuppte sich als eine noch rüstige Witwe, die viel gereist war und das weiterhin tun wollte, dafür jedoch Hilfe benötigte. Sie war überheblich und herrisch, besaß aber eine pädagogische Ader und setzte alles daran, aus Josephine eine wohlerzogene junge Dame zu machen, schließlich wollte sie kein irisches Waisenmädchen mit dem Benehmen eines Waschweibs als Gesellschafterin. Zunächst trieb sie ihr diesen Akzent aus, der ihr in den Ohren schmerzte, und zwang sie zu sprechen wie jemand aus der Londoner Upperclass, danach sorgte sie dafür, dass Josephine zur anglikanischen Kirche konvertierte.
»Die Papisten sind abergläubische Ignoranten, deshalb sind sie so arm und vermehren sich wie die Karnickel«, lautete ihr Urteil.
Sie erreichte ihr Vorhaben mühelos, denn Josephine sah kaum einen Unterschied zwischen den beiden Glaubensrichtungen und hielt sich lieber möglichst fern von Gott, der sie von ihrer Geburt an so schlecht behandelt hatte. Sie lernte, sich in der Öffentlichkeit tadellos zu benehmen und ihre Gefühlsregungen und ihre Haltung streng zu beherrschen. Die alte Dame gewährte ihr Zugang zu ihrer Bibliothek und lenkte ihre Lektüre, weckte ihre Leidenschaft für die Encyclopædia Britannica und nahm sie an Orte mit, die kennenzulernen Josephine sich nie hätte träumen lassen, sei es New York oder Kairo. Dann hatte sie einen Schlaganfall, starb innerhalb weniger Wochen und hinterließ Josephine etwas Geld, von dem sie die nächsten Monate leben konnte. Als Josephine in der Zeitung auf die Anzeige für eine Stelle als Kindermädchen in Südamerika stieß, bewarb sie sich.
»Ich hatte Glück mit deiner Familie, José Antonio, ihr seid sehr gut zu mir gewesen. Um es kurz zu machen: Ich kann nirgendwohin. Wenn ihr nichts dagegen habt, sterbe ich hier.«
»Du stirbst nicht, Josephine«, sagte José Antonio mit Tränen in den Augen, weil ihm eben klar wurde, wie wichtig sie in seinem Leben geworden war.
Als mein Vater erfuhr, dass mein Kindermädchen in seinem Haus zu sterben gedachte, war sein erster Impuls, sie notfalls gegen ihren Willen auf den nächsten Überseedampfer zu verfrachten, um mir das Sterben und den Tod dieser Frau zu ersparen, an der ich so sehr hing, aber zum ersten Mal in seinem Leben trat José Antonio ihm entgegen.
»Wenn Ihr sie wegschickt, verzeihe ich Euch das niemals, Papa«, verkündete er und redete dann auf ihn ein, es sei seine Christenpflicht, sich über die düstere Prognose des Hausarztes hinwegzusetzen und alles in seiner Macht Stehende zu tun, um sie zu retten. »Violeta wird leiden, wenn Miss Taylor stirbt, aber sie wird es verstehen. Dafür ist sie alt genug. Nicht verstehen wird sie, wenn Miss Taylor einfach verschwindet. Ich kümmere mich um alles, Papa, Ihr müsst Euch damit nicht belasten.«
Er hielt Wort.
Dank der persönlichen Fürsprache des englischen Konsuls, zu dem mein Vater durch seine Exportgeschäfte Beziehungen unterhielt, wurde Miss Taylor im Militärhospital, das damals das beste Krankenhaus des Landes war, von einem Team unter Leitung des renommiertesten Chirurgen seiner Zeit operiert. Anders als die staatlichen Kliniken, die so mittellos waren wie die dort behandelten Patienten, und die wenigen Privatkliniken, in denen die Patienten bezahlen mussten, die medizinische Versorgung aber mittelmäßig war, konnte sich das Militärhospital mit den besten Kliniken in den USA und in Europa messen. Eigentlich war es Mitgliedern der Streitkräfte und des Diplomatischen Corps vorbehalten, aber wenn man gute Beziehungen hatte, wurde schon mal eine Ausnahme gemacht. Das moderne Gebäude war bestens ausgestattet, es verfügte über weitläufige Gärten, in denen die Genesenden spazieren gehen konnten, und die Krankenhausleitung, die einem Oberst unterstand, sorgte dafür, dass alles reinlich und die Betreuung tadellos war.
Meine Mutter und mein Bruder begleiteten die Patientin zu ihrer ersten Untersuchung. Eine Krankenschwester in fest gestärkter, bei jedem Schritt knirschender Tracht führte sie ins Sprechzimmer des Chirurgen, der Anfang siebzig war, kahl, mit asketischen Gesichtszügen und dem arroganten Gebaren von jemand, der es gewöhnt ist, Befehle zu erteilen. Nachdem er Josephine hinter einem Raumteiler eingehend untersucht hatte, erklärte er José Antonio, ohne die beiden Frauen auch nur zur Kenntnis zu nehmen, dass es sich bei dem Tumor vermutlich um Krebs handelte. Man könne versuchen, ihn durch Bestrahlung zu verkleinern, ihn operativ zu entfernen sei hingegen überaus riskant.
»Herr Doktor, angenommen, ich wäre Ihre Tochter, würden Sie es versuchen?«, schaltete Miss Taylor sich so gelassen wie immer ein.
Nach einer Pause, die kein Ende nehmen wollte, nickte der Arzt.
»Dann sagen Sie mir, wann Sie mich operieren«, entschied sie an seiner Stelle.
Zwei Tage später wurde sie ins Krankenhaus aufgenommen. Getreu ihrem Grundsatz, dass es am einfachsten ist, wenn man die Wahrheit sagt, erklärte sie mir, bevor sie ging, sie habe eine Orange im Bauch und die müsse rausgeholt werden, das werde aber nicht so einfach sein. Ich bettelte, weil ich mitkommen und während der Operation bei ihr sein wollte. Ich war sieben, hing aber noch immer wie eine Klette an ihr. Zum ersten Mal, seit wir sie kannten, weinte Miss Taylor. Dann verabschiedete sie sich einzeln von allen Bediensteten im Haus, umarmte Torito und meine Tanten, die sie anwies, ihre Habseligkeiten gegebenenfalls unter denen zu verteilen, die ein Erinnerungsstück haben wollten, und übergab meiner Mutter ein verschnürtes Bündel britischer Pfundnoten.
»Für Ihre Armen, Señora.«
Sie hatte ihren gesamten Verdienst gespart, weil sie eines Tages nach Irland zurückkehren und ihre in alle Winde zerstreuten Geschwister suchen wollte.
Mir schenkte sie ihren größten Schatz, die Encyclopædia Britannica, und sie versicherte mir, sie werde alles daransetzen zurückzukommen, nur könne sie mir das nicht versprechen. Ich wusste, dass in diesem Krankenhaus etwas Schreckliches passieren konnte, ich hatte schon begriffen, wie mächtig und unanfechtbar der Tod war. Ich hatte meine Großmutter im Sarg liegen sehen, ihr Gesicht eine Wachsmaske zwischen Falten aus weißem Satin, hatte die Katzen und Hunde gesehen, die an Altersschwäche starben oder bei Unfällen, und das Federvieh, die Ziegen, Schafe und Schweine, die Torito für den Kochtopf schlachtete.
Der letzte Mensch, den Josephine Taylor wahrnahm, ehe man sie auf der Liege in den OP